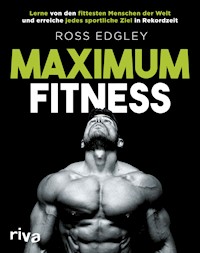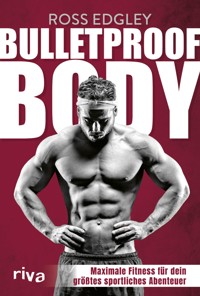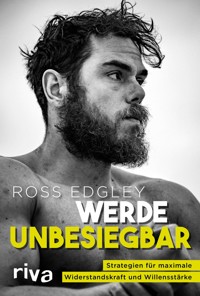
15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Mehr erfahren.
2865 Kilometer, 157 Tage, arktische Stürme, gigantische Quallen, verschmutzte Gewässer und ein völlig geschundener Körper – wenn jemand bewiesen hat, dass mit Willensstärke und Widerstandskraft alles möglich ist, dann ist es Ross Edgley, der als erster Mensch einmal um Großbritannien geschwommen ist. In 22 Lektionen erzählt der Bestsellerautor und Extremsportler vom spannenden Weg zu seinem neuesten Weltrekord und verrät, welche Strategien und Trainingsmethoden er eingesetzt hat, um die Strapazen durchzustehen und sein Ziel zu erreichen. Über Jahre hat er Sportwissenschaftler, Psychologen und Athleten befragt und ihre Techniken, Tricks und Performance analysiert, um die einzigartige Mischung aus mentaler Stärke, stoischer Gelassenheit und körperlicher Fitness zu entwickeln, die ihn unbesiegbar machte. Seine Geschichte zeigt, wozu der Mensch körperlich und geistig fähig ist – und wie auch du jede Herausforderung erfolgreich meistern kannst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 493
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
ROSS EDGLEY
WERDE UNBESIEGBAR
ROSS EDGLEY
WERDE UNBESIEGBAR
Strategien für maximale Widerstandskraft und Willensstärke
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen
Wichtige Hinweise
Dieses Buch ist für Lernzwecke gedacht. Es stellt keinen Ersatz für eine individuelle medizinische Beratung dar und sollte auch nicht als solcher benutzt werden. Wenn Sie medizinischen Rat einholen wollen, konsultieren Sie bitte einen qualifizierten Arzt. Der Verlag und der Autor haften für keine nachteiligen Auswirkungen, die in einem direkten oder indirekten Zusammenhang mit den Informationen stehen, die in diesem Buch enthalten sind.
Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wurde auf eine genderspezifische Schreibweise sowie eine Mehrfachbezeichnung verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.
3. Auflage 2024
© 2021 by riva Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Die englische Originalausgabe erschien 2020 bei HarperCollins Publishers Ltd. unter dem Titel The Art of Resilience. © 2020 by Ross Edgley. All rights reserved.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Übersetzung: Mark Bergmann
Redaktion: Julia Kaumeier
Umschlaggestaltung: Marc-Torben Fischer
Umschlagabbildung: © Olaf Pignataro / Red Bull Content Pool
Illustrationen: Liane Payne © HarperCollins Publishers 2020
Satz: Daniel Förster, Belgern
Druck: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN Print 978-3-7423-1603-5
ISBN E-Book (PDF) 978-3-7453-1286-7
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-7453-1307-9
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.rivaverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Vielen Dank an meinen Vater, den größten stoischen Sportler, den ich kenne.
INHALT
Vorwort
Prolog
Teil 1 Leben an Land (vor der Schwimmtour)
Kapitel 1 | Warum habe ich mir das angetan?
Kapitel 2 | Warum der Körper nicht zerbricht
Kapitel 3 | Warum der Geist nicht kapituliert
Teil 2 Leben auf See (während der Schwimmtour)
Lektion 1 | Stoische Sportwissenschaft ist eine Theorie, die aus der Praxis entstand
Lektion 2 | Entdecke die Kraft der spirituellen Sportwissenschaft
Lektion 3 | Der Körper blutet und leidet, doch gibt sich nicht geschlagen
Lektion 4 | Um deinen eigenen Weg zu gehen, brauchst du einen eigenen Plan
Lektion 5 | Mach deinen Körper zum Werkzeug, nicht zum Schmuckstück
Lektion 6 | Werde unverwüstlich durch Abhärtung für den Winter
Lektion 7 | Schnell kann fragil und langsam kann stabil bedeuten
Lektion 8 | Kraft verbessert Ausdauer und Ausdauer verbessert Kraft
Lektion 9 | Kreuzen und jagen
Lektion 10 | Lerne, Grenzen zu durchbrechen
Lektion 11 | Zwei Methoden zur Schmerzbewältigung
Lektion 12 | Bekämpfe Angst mit dem »Konzept der tierischen Furcht«
Lektion 13 | Erkenne die Macht eines höheren Zwecks
Lektion 14 | Akzeptiere das Unkontrollierbare
Lektion 15 | Kontrolliere das Kontrollierbare
Lektion 16 | Unverwüstlichkeit braucht Zeit, Aufgeben geht schnell
Lektion 17 | Du bist stärker, wenn du lächelst
Lektion 18 | Schlaf dich stark!
Lektion 19 | Heldentaten gegen den Hunger
Lektion 20 | Iss dich unverwüstlich!
Lektion 21 | Magen aus Stahl
Lektion 22 | Unverwüstlichkeit bedeutet, Schmerzen strategisch zu ertragen
Epilog
Quellen
Dank
VORWORT
VON ANT MIDDLETON
Allein diese Zahlen sind atemberaubend: 2865 Kilometer, 157 Tage auf See, eine halbe Million verbrannte Kalorien und über zwei Millionen vollendete Schwimmzüge. Doch am meisten umgehauen hat mich diese Zahl: null Tage krank.
Ich hatte geglaubt, dass es schon schwer genug sei, Großbritannien mit dem Boot zu umsegeln. Wer sollte so verrückt sein, den ganzen Weg zu schwimmen? Deshalb wollte ich einer der Ersten sein, die Ross gratulierten, als er nach fünf Monaten draußen im Meer sein Mammutprojekt, den »Great British Swim«, erfolgreich beendet hatte und am Margate Beach wieder an Land ging. Eines der Dinge, die mir von diesem Tag am stärksten im Gedächtnis geblieben sind, ist, dass er zwar erschöpft war, hungrig, und aussah wie ein Außerirdischer von einem anderen Stern, aber dennoch bis über beide Ohren lächelte. Eines der wichtigsten mentalen Grundprinzipien, die mich durchs Leben gebracht haben, ist eine positive Einstellung. Und wer Ross kennt, muss mir nicht erklären, dass er davor nur so strotzt. Wenn man positiv ist, hat man mehr mentale Energie. Man ist smarter. Eine positive Einstellung kann uns durch die dunkelsten Stunden führen (und beim Lesen dieses Buchs wirst du feststellen, dass Ross einige solcher Stunden erlebt hat).
Was treibt uns über die Schmerzgrenze hinaus an und verleiht uns die Widerstandsfähigkeit, jedes Hindernis zu überwinden, das uns die Natur in den Weg stellt? Was macht den Geist so mächtig, dass er uns ganz unglaubliche Dinge vollbringen lässt? Woher nahm Ross die außergewöhnliche Kraft, derart über die menschliche Natur hinauszuwachsen und etwas zu leisten, das vor ihm niemand sonst geschafft hat?
Auf der Suche nach Antworten auf diese Fragen denke ich zurück an meine Zeit in der Spezialeinheit der Armee und wie ich dort im Training lernte, allen Widrigkeiten zum Trotz mein Schicksal in die Hand zu nehmen. In einer Gefechtssituation musste ich stets abwägen, was passieren könnte, wenn ich etwa durch eine Tür gehe, hinter der ein bewaffneter Feind lauert. Erwischt er mich, bevor ich ihn erwische? Wie groß ist das Risiko, eine Kugel in den Kopf zu bekommen, die mich sofort tötet? Meist waren die Chancen, die ich mir so ausrechnete, äußerst gering, sodass mir nichts anderes übrig blieb, als zu sagen: »Scheiß drauf, das wird schon. Ich gehe jetzt da rein!«
Auch Ross hat sein Schicksal in die Hand genommen, trotz der Quallen in der Straße von Corryvreckan, der Tanker, die seinen Weg kreuzten, der tückischen Strömungen und Strudel, der Winde und Wellen und nicht zuletzt der Stürme. Es ist eigentlich ein Wunder, dass keiner der seltenen Nordseehaie mal kurz vorbeigeschaut hat, um Hallo zu sagen. Ross erfüllte die physischen und mentalen Voraussetzungen und besaß mit seiner Qualifikation als Sportwissenschaftler und Erfahrung im Bereich Ernährung die nötigen Kenntnisse für ein solches Wahnsinnsprojekt. Wenn jemand den Great British Swim erfolgreich meistern konnte, dann Ross. Selbst der beste Schwimmer der Welt hätte es nicht über die erste Woche hinausgeschafft, ohne die nötige mentale Stärke, Widerstandskraft und die Fähigkeit, per Knopfdruck in den Überlebensmodus zu wechseln.
Endlos viele Lektionen hat uns dieses kühne Unterfangen gelehrt: Lass andere Menschen nicht bestimmen, wer du bist! Besiege die Furcht vor dem Unbekannten! Befreie deinen Geist von allem – es gibt nur noch dich und deinen Kampf gegen das Wasser! Beiß die Zähne zusammen, reiß dich am Riemen und zieh das jetzt durch!
Ross ist einer der bodenständigsten und inspirierendsten Menschen, die man sich vorstellen kann. Die Botschaft, die beim Lesen dieses Buchs hängen bleibt, lautet: Du kannst alles schaffen!
Wer wagt, der schwimmt. Viel Glück, Kumpel! Ich könnte nicht stolzer sein, dich als meinen Freund zu bezeichnen. Du bist ein Unikat, ein wahrer britischer Held, und ich kann gar nicht abwarten, welches große (und hoffentlich trockene) Abenteuer dein nächstes ist.
PROLOG
Es ist 10 Uhr morgens, am 31. Januar 2018 im Royal Marines Commando Training Centre in Lympstone, Devon, Großbritannien. Ich hatte gerade eine 48-stündige Schwimmeinheit beendet (und dabei 185 Kilometer im Trainingsbecken der Anlage zurückgelegt), in Vorbereitung auf meinen Weltrekordversuch: die längste strömungsneutrale Strecke aller Zeiten in einem Ozean, einem Meer oder einer Bucht zu schwimmen. Mein ursprünglicher Plan war es, dafür die Bermudainseln zu umrunden, wo das Wasser warm und das Essen lecker ist und ich viele Leute kenne, die ein Boot besitzen, sodass genug Unterstützer bereitgestanden hätten.
Im Offizierskasino (dem Bereich, in dem sich das hochrangige Militärpersonal trifft und isst) setzte ich mich mit meinem guten Freund Ollie Mason zusammen – ein Kapitän der Royal Marines, Rugby-Coach und übergangsweise mein Schwimmtrainer –, um die vergangenen Tage auszuwerten. Wir machten es uns auf ein paar üppigen Ledersofas bequem, tranken Tee und verbrachten die ersten Augenblicke in Stille. Als ich mich so umsah, erschien es mir wie ein großes Privileg, überhaupt hier sein zu dürfen. Hunderte Offiziere waren über die Jahre in diesen Räumen ein- und ausgegangen. Dieser Ort besaß eine zeitlose und doch altmodische Opulenz, mit den Buchregalen aus massiver Eiche, den Türrahmen aus poliertem Messing, dem Flügel in der Ecke und dem großen Gemälde, das eine Gruppe Kommandotruppen zeigte, die ihre Green Berets erhalten und so zu vollwertigen Royal Marines werden.
Die Stille wurde unterbrochen, als sich einer der älteren Offiziere zu uns setzte.
»Junge«, sagte er und deutete auf meine schrumpeligen Hände und Füße. »Ich habe von deinem 48-Stunden-Schwimmtraining gehört. Für was genau trainierst du denn da?«
Er war groß und hatte gewaltige Hände, in denen die Tasse, aus der er trank, geradezu absurd winzig wirkte. Sein Oberlippenbart war nicht minder beeindruckend. Einen besseren Offizier der Royal Marines hätte sich kein Drehbuchautor ausdenken können.
»Ich trainiere wohl für die längste strömungsneutrale Strecke aller Zeiten«, entgegnete ich.
Er hielt kurz inne, nippte an seinem Tee und blickte nachdenklich in die Tasse, als wolle er dort nach Indizien suchen, bevor er sein Urteil fällt.
»Kann ich ehrlich zu dir sein, junger Mann?«, fragte er schließlich.
»Ja, aber bitte«, antwortete ich, neugierig, was er wohl sagen würde.
»Das klingt ganz schön beschissen.«
Mit einer solchen Meinung hatte ich selbstverständlich nicht gerechnet. Im Grunde hatte ich nicht einmal um seine Meinung gebeten. Im Gegenteil, weder hatte ich mich überhaupt vorgestellt noch kannte ich seinen Namen. Aber den üblichen Austausch von Höflichkeiten hatten wir offenbar übersprungen, um direkt mit einer spontanen Runde Brainstorming zu beginnen.
Nun schaltete sich auch Ollie ein: »Ich will ehrlich sein, Kumpel. Meiner Meinung nach solltest du einfach den Hintern zusammenkneifen und einmal um ganz Großbritannien schwimmen.«
»Warum sollte ich das tun?«, fragte ich, geschockt von der Größenordnung dieses Vorschlags.
»Also mir fallen da mindestens drei Gründe ein«, sagte er. »Das sind etwa 2900 Kilometer, es wäre also die längste in Etappen geschwommene Strecke der Menschheitsgeschichte. Du würdest diesen Rekord damit heim in britische Gewässer holen. Und es klingt nicht so beschissen wie ›ein strömungsneutraler Rekord in Bermuda‹.«
Ich ließ mir seine Logik kurz durch den Kopf gehen. Zunächst verwarf ich die Idee. Völlig erschöpft und mit noch immer jeder Menge Chlor im Hirn schlürfte ich meinen Tee und schüttelte lachend den Kopf, schaudernd beim Gedanken daran, den gesamten Sommer über durch einige der tückischsten Strömungen der Welt die britische Küste auf und ab zu schwimmen.
Doch als im Verlauf des Abends die Teevorräte langsam zur Neige gingen, musste ich gestehen, dass der Vorschlag gar nicht mehr so übel klang. Vielleicht konnte ich aufgrund des Schlafmangels nicht mehr klar denken, doch als ich dort, halb benommen, in meinem riesigen Ledersessel saß, lief der Gedanke, um diesen gigantischen Felsen namens Großbritannien zu schwimmen, in meinem Kopf auf Dauerschleife. Ich dachte plötzlich an all die großen britischen Abenteurer von früher, an Captain James Cook und Ernest Shackleton. Abenteuer und Entdeckungen scheinen uns Briten im Blut zu liegen. Die Vorstellung, in deren Fußstapfen zu treten (auf meine bescheidene Art und Weise), hatte ein Feuer in mir entfacht, das selbst ein energiezehrendes 48-stündiges und 185 Kilometer langes Schwimmtraining nicht mehr zu löschen vermochte.
~
Es ist 19 Uhr am 3. August 2018. 63 Tage und knapp 1300 Kilometer des Great British Swim liegen hinter mir. Ich habe die Straße von Corryvreckan erreicht, eine kleine Meerenge zwischen den Inseln Jura und Scarba vor der schottischen Westküste. Diese Region ist zweifelsohne der ganz wilde Westen Großbritanniens. Im Sommer laufen die gewaltigen Bergketten auf dem Festland in malerische, von Pinien gesäumte grüne Täler aus. Doch im Winter sind dieselben Berge von dichtem Weiß umhüllt, weil arktische Blizzards eine kristallartig schimmernde Schneeschicht auf ihren Gipfeln hinterlassen haben.
Im Moment befinden wir uns irgendwo zwischen Sommer und Herbst. Kilometer um Kilometer des rauen, feuchten Heidelands mit seinen Fjorden und Fjellen nimmt unter den immer schwächer werdenden Sonnenstrahlen langsam eine goldbraune Farbe an. Eine atemberaubende Aussicht, die man genießen könnte, wenn man einen dicken Mantel, eine Wollmütze und warme Thermohandschuhe tragen würde.
Doch nicht, wenn man von acht Grad kaltem Wasser umgeben ist, auf halber Strecke des Versuchs, als erster Mensch Großbritannien zu umschwimmen, die neuntgrößte Insel der Welt.
Und genau dort befinde ich mich gerade, bei etwa Kilometer 1380 des sogenannten Great British Swims. Alles andere als glücklich – und alles andere als gesund.
Nachdem ich durch mörderische Stürme, peitschende Wellen, tückische Strömungen und verschmutzte Wasserstraßen geschwommen bin, funktionieren meine Lunge und meine Gliedmaßen nicht mehr so gut wie gewohnt. Die letzten zwei Monate hatte ich durchweg zwölf Stunden täglich mit Erschöpfung zu kämpfen. Doch so erschöpft wie jetzt war ich noch nie.
Die Erschöpfung steckte mir buchstäblich tief in Sehnen und Bändern. Wegen des vielen Salzwassers begann meine Zunge, sich Schicht für Schicht aufzulösen. (Dieser Zustand nennt sich »Salzzunge«. Dabei geht alle Flüssigkeit im Mund verloren und die obersten Schichten der Zunge beginnen zu erodieren.) Und um all dem die Krone aufzusetzen, zeigten die schottischen Gewässer keine Gnade mit mir. Die Wellen schienen wütend zu sein und türmten sich bösartig vor mir auf.
Meinen anderen Körperteilen war es nicht besser ergangen: Die Schultern wurden immer wieder von den Wellen verdreht, meine Haut war wund gescheuert und gepeinigt von Wassergeschwüren und der bitteren Kälte. Sie war inzwischen ganz rau geworden, hatte ihre natürliche Farbe verloren und dafür einen seltsamen Ton aus Blau, Lila und Grau angenommen, sodass ich aussah, als sei ich nicht von dieser Welt. Meine Nase und Wangen waren durch die ständigen Wellenschläge so stark angeschwollen, dass ich Schwierigkeiten hatte, die Schwimmbrille auf meine immer stärker schmerzenden Augenhöhlen zu setzen.
Doch trotz dieser langen Liste von Beschwerden war ich glücklich, noch immer auf dem Wasser zu sein (statt auf dem Meeresgrund). Der Mann von der örtlichen Küstenwache hatte uns berichtet, dass die Gewässer hier derart tückisch und schon so viele Menschen darin ertrunkenen seien, dass dieser Ort ein fester Bestandteil schottischer Folklore geworden ist. Einheimische Fischer erzählen von einer mythischen Hexengöttin, die über die schottischen Seen und Teiche wacht. Dazu muss ich sagen, dass ich mich – bevor ich in Corryvreckan ankam – nicht gerade als abergläubischen Menschen bezeichnet hätte. Das änderte sich allerdings schnell. Als der heulende Wind so über die Inseln pfiff, machte mich dieser eindringliche Sound, der die Küsten entlangzuschallen schien, glauben, die schottische Mythologie sei tief beleidigt, dass ich etwas wie das hier überhaupt versuchte.
Das galt im Übrigen auch für die wilde schottische Tierwelt. Vögel versammelten sich, um dem Spektakel beizuwohnen, und kreisten über meinem Kopf, in weiter Ferne beobachtete mich eine einsame Möwe. Sie alle mussten sich gewundert haben, was sie da sahen. Weil meine Schultern schon so lange von den Wellen malträtiert wurden, waren meine Schwimmzüge zäh und schwerfällig geworden und ich sah wohl nicht mehr so aus wie die meisten Menschen, die sie bisher gesehen hatten.
In sicherer Entfernung zu diesem seltsamen Wesen, das halb Mensch, halb Tier zu sein schien, beschloss das Team auf dem Support-Boot – der Hecate –, dass es an der Zeit sei, mich auf noch mehr Qualen vorzubereiten. Matt (der Kapitän des Great British Swims) und Taz (Matts Sohn und Teamchef) riefen mir von Deck aus laute und präzise Instruktionen zu.
»Du musst die nächsten drei Stunden mit vollem Tempo sprinten«, sagte Matt mit einem Anflug von Empathie, wissend, dass er meinem geschundenen, ausgelaugten Körper damit einiges abverlangte. »Wenn du das schaffst, sind wir raus aus dem Strudel.«
In Anbetracht meines Zustands war ein dreistündiger Sprint ambitioniert. Doch Matt hatte leider recht. Es war die einzige Möglichkeit, durch diesen schäumenden Meeresabschnitt zu gelangen, der als »Strudel von Corryvreckan« berüchtigt ist. In diesem Moment existierten Pacingstrategien, Pausen und Regeneration schlicht nicht mehr – entweder ich schwamm am Limit oder ich schwamm bald gar nicht mehr.
Ich signalisierte Matt und Taz, dass ich bereit war. Vorsichtig rückte ich die Schwimmbrille auf meinen geschwollenen Augen zurecht, stellte den Timer meiner Uhr auf drei Stunden ein und versprach mir selbst, nicht mit dem Schwimmen aufzuhören, bevor ich den Alarm hörte. Kein Strudel und keine mythischen Fabelwesen würden mich von der Aufgabe abhalten können, die nun vor mir lag.
Zug um Zug führte ich einen Kampf der Extreme, zwischen Mut und gesundem Menschenverstand. Meine Arme schmerzten und meine Lunge protestierte, doch mir war klar, dass all dies besser war als die Alternative: ein Schicksal auf dem Grund des Meeres. In den ersten 40 Minuten flehte ich meinen Körper deshalb an, das unmögliche Tempo zu halten, während wir unseren Angriff auf die Straße von Corryvreckan fortführten. Doch nach etwa einer Stunde konterten die schottischen Gewässer – die auch als der mystische Waschzuber der Hexengöttin bekannt sind – und warfen mir einen weiteren Knüppel zwischen die Beine … beziehungsweise eine gigantische Qualle direkt ins Gesicht.
Und die war nicht allein; vor mir schwamm eine ganze Armee der Biester. Die Gelbe Haarqualle kann bis zu 25 Kilogramm schwer werden und ihre Tentakel bis zu 1,80 Meter lang. Zwar wurde ich schon oft von Quallententakeln im Gesicht getroffen, doch dieses Mal war etwas anders. Obwohl ich versuchte, die ersten Quallenstiche einfach wegzuschwimmen, spürte ich ein Brennen an Nase und Wangen. Nach zwei Stunden waren die Schmerzen kaum noch auszuhalten. Es fühlte sich an, als würde jemand einen glühenden Schürhaken in mein Gesicht pressen, der mir das Fleisch versengte. Mit jedem weiteren Kilometer konnte ich die Brandblasen spüren, die sich auf meiner Haut bildeten. Nach zweieinhalb Stunden lähmten mich die Schmerzen. Ich spürte, dass ich keine Kontrolle mehr über meine linke Gesichtshälfte hatte, weil das Gift der Qualle in meine Haut einzog und die schmerzhafteste Lähmung verursachte, die ich jemals erlebt hatte. Ohne noch Herr über meinen eigenen Mund zu sein, begann ich zu sabbern, aber Gott sei Dank nicht zu ertrinken. Nach zwei Stunden und 45 Minuten machten die Schmerzen mich blind … Die Lähmung hatte meine Augen ergriffen und verursachte Tränen, die meine Brille füllten und meine Sicht beeinträchtigten. Als ich mitten in einem Schwimmzug versuchte, die Brille zu richten, bemerkte ich, dass der letzte Hieb einer Qualle mein Gesicht so hart getroffen hatte, dass meine Augenhöhle sich entzündete, wodurch die Ränder der Brille nicht mehr dicht waren.
»Schwimm weiter!«, rief Matt vom Boot aus.
Mit 40 Jahren Erfahrung als Segler wusste er am besten, dass wir uns noch immer unangenehm (und gefährlich) nah an einem der größten und tödlichsten Strudel der Welt befanden.
Weil meine Sicht durch die Tränen und das Salzwasser zunehmend schlechter wurde, war ich inzwischen halb blind … im offenen Meer … ohne Orientierungssinn … Also drosch ich die Brille aus purer Verzweiflung in mein Gesicht. So bekam ich die Ränder irgendwie (schmerzhaft) wieder dicht, konnte ein wenig besser sehen und war so in der Lage, in die Richtung zu sprinten, die Matt mir vorgab.
Nach drei Stunden hatten all die Schmerzen sich endlich gelohnt. Der Alarm meiner Uhr hatte noch nie schöner geklungen als in diesem Moment, in dem er mir signalisierte, dass der Strudel hinter mir lag. Zeit, mich zu freuen, hatte ich allerdings nicht, denn die Schmerzen der Quallenstiche plagten mein Gesicht, meinen Hals und meine Arme.
»Eine Qualle hat mich erwischt«, rief ich der Crew zu.
Taz hastete an den Rand des Boots, um die Situation besser einzuschätzen.
»Meine Haut brennt immer noch«, sagte ich, vor Schmerzen zuckend.
Während Matt sich darauf konzentrierte, präzise den Kurs durch die lebensgefährlichen Gewässer zu halten, nahm Taz mein Gesicht in Augenschein und erkannte sofort, wo das Problem lag. »Das kann ich mir denken«, sagte er und zuckte ebenfalls zusammen. »Der Tentakel ist noch immer um dein Gesicht gewickelt.« Unglaublich – ich hatte durch die gesamte Straße von Corryvreckan einen Quallententakel um mein Gesicht getragen.
Ich schälte den dicken, fetten und giftigen Tentakel ab, der sich irgendwie um das Gummiband der Brille und mein Gesicht gewickelt hatte, und spürte einen kurzen Moment lang Linderung, als die kalte schottische Meeresbrise meine Haut kühlte. Somit war ich in der Lage weiterzuschwimmen und legte noch fünf zusätzliche Kilometer zurück, um die Fänge des Corryvreckan hinter mir zu lassen.
Nachdem ich zurück ins Boot geklettert war, kollabierte ich an Deck, so sehr hatte ich mich mental und körperlich verausgabt. Mir war nun bewusst geworden, dass die konventionellen Regeln des Sports hier draußen nicht galten. In diesem wilden, ungezähmten Winkel Britanniens war meine Schwimmtechnik nicht der limitierende Faktor. Stattdessen werden Abenteuer wie dieses durch die Fähigkeit entschieden, jedes noch so kleine bisschen mentale Stärke im Körper abzurufen, um die chronische und lähmende Erschöpfung zu besiegen.
In dieser Nacht wurde mir klar, dass dies mehr als eine Schwimmtour war … Es war die absolut extremste Methode, unbesiegbar zu werden.
~
Es ist 7:45 Uhr am 13. August 2018 und wir befinden uns (immer noch) inmitten der Inneren Hebriden Schottlands.
»Sobald Sie unter dieser Brücke durch sind, ist alles anders«, knurrte der Fischer in einem breiten schottischen Akzent, der alles, was er sagte, noch bedrohlicher klingen ließ. Er war alt, sicher schon über 70, und segelte seit mehr als einem halben Jahrhundert in diesen Gewässern. All seine Erfahrung und alles Seefahrerwissen schienen in jede Falte des zerfurchten und wettergegerbten Gesichts eingekerbt zu sein. Man glaubte, die vielen Jahre, in denen er seinen täglichen Fang einholte, an den schwieligen Händen ablesen zu können.
»Bis jetzt war Schottland noch sanft zu dir«, fuhr er fort.
»Tatsächlich?«, rief ich ungläubig und zog den Kragen meines Pullis herunter, um meine Andenken aus den letzten Schlachten zu zeigen: Wassergeschwüre und eine Haut, die vom Neoprenanzug wund gescheuert war. Quallenstiche und Narben von meiner Nacht mit der Hexengöttin in der Straße von Corryvreckan.
»Wenn das sanft war, würden Sie mir dann verraten, was Ihrer Meinung nach grob ist?«, fragte ich ihn.
»Oh, Junge«, entgegnete er mit einem besorgten Lächeln. »Du bist durch die Inneren Hebriden geschwommen, zwischen den Inseln vor dem schottischen Festland. Die sind ganz nah beisammen, manchmal nur eine Meile voneinander entfernt, und bieten dir Schutz vor Wind und Wellen. Wenn ein Sturm aufzieht, kannst du schnell den nächsten Hafen ansteuern, wo du Essen und Vorräte findest und vielleicht sogar eine Kostprobe der berühmten hebridischen Gastfreundschaft bekommst – inklusive eines regionalen Single-Malt-Whiskys.«
Während er das sagte, deutete er in Richtung Kyle of Lochalsh, einen Ort, in dem noch die uralte gälische Sprache gesprochen und im kleinen Pub mit einem Folkloremusiker gesungen wurde.
»Sobald du unter der Skye Bridge durchgeschwommen bist, gibt es so was nicht mehr«, mahnte er. »Einmal da durch, kommst zu den Äußeren Hebriden und noch weiter raus. Dort gibt es 50 Kilometer weit und breit keinen Schutz vor einem Sturm. Dort oben heißt dich keiner mit einem Whisky willkommen, da gibt’s nur 50 Knoten starke arktische Stürme und sechs Meter hohe Wellen. Quallen dürften dann deine kleinste Sorge sein.«
Wir standen erst mal einen Moment lang baff da und starrten stumm in Richtung Skye Bridge. Gut 1,5 Kilometer lang, verbindet sie das schottische Festland und das Dörfchen Kyle of Lochalsh mit der Insel Skye, die bis 1995 nur mit dem Boot erreichbar war. Nun würde das Wasser dort ein wichtiger Meilenstein des Great British Swim werden.
Am Vormittag saß ich auf dem Boot und beantwortete Medienvertretern und einigen Fischern, die von unserer Tour um Großbritannien fasziniert waren, ihre Fragen. Der Gezeitenwechsel hatte begonnen – mein Signal, dass die Zeit für Interviews vorüber war und ein weiterer Schwimmabschnitt vor mir lag. Als die Journalisten und Fischer das Boot verließen, saß ich still mit Matt dort und versuchte vorsichtig, den kalten, klammen Neoprenanzug über meine frischen, schmerzenden Wunden zu ziehen. Während ich das tat, war noch ein einzelner Schreiber auf Deck geblieben und fasste den Mut, mir drei letzte Fragen zu stellen, die sowohl für den weiteren Verlauf meiner Tour als auch dieses Buch von wesentlicher Bedeutung werden würden:
»Warum tun Sie sich das an?«
»Warum zerbricht Ihr Körper nicht daran?«
»Warum kapituliert Ihr Geist nicht einfach?«
Um ehrlich zu sein, versuchte ich zu diesem Zeitpunkt noch immer selbst, mir diese Fragen zu beantworten. Erschöpfung und Schmerz steckten tief in jeder Zelle meines Körpers und drohten, während ich nun dort saß, meinem Weltrekordversuch ein Ende zu setzen. Vor dem Journalisten versuchte ich nun mein Bestes, eine Schlussfolgerung zu geben, die ich nach 74 Tagen auf See gezogen hatte, auch wenn ich mir der Antwort nicht hundertprozentig sicher war:
»Ich glaube, mein Körper ist nicht daran zerbrochen und mein Geist hat (noch) nicht kapituliert, weil ich die Lehren antiker griechischer Denker mit moderner Sportwissenschaft verschmolzen und so meine ganz eigene Philosophie geschaffen habe, die ich ›stoische Sportwissenschaft‹ nenne.«
Der Journalist wirkte zunächst ein wenig verwirrt, nickte dann aber mit gezücktem Stift und Notizblock, so als erwarte er meine nächste Antwort schon gespannt, voller Hoffnung, ich würde ein wenig tiefgründiges, tief spirituelles Seefahrerwissen mit ihm teilen. Doch leider hatte ich nichts weiter für ihn parat. Ich musste noch mehr als 1500 Kilometer schwimmen, meine neu gefundene Philosophie war also alles andere als bewährt. Ich erklärte ihm aber, dass ich – sobald ich das Ziel erreicht hätte – meine Studien und das Buch dazu fertigstellen würde.
»Dann werde ich wohl warten müssen, um ein Exemplar zu kaufen«, sagte er lachend.
Ich lächelte und einen Moment lang saßen wir nur da und sogen die gewaltige Weite der Natur auf, die uns umgab, sinnierend darüber, was uns hier an diesem ungewöhnlichen Ort zusammengebracht hatte.
»Okay, also warum tun Sie sich das alles nun an?«, fragte er.
Ich sah zu Matt hinüber, der mit wissenden Augen zu mir zurückblickte. Es musste nichts gesagt werden.
Die Erinnerung an den Beginn dieser Reise (und das Leben daheim an Land) schienen eine Ewigkeit zurückzuliegen. Viele Kilometer, Gezeiten und Sonnenuntergänge war dieser Tag bereits her. Um zu verstehen, warum wir uns das antaten, muss man verstehen, dass wir Menschen die Kunst der Unverwüstlichkeit bereits seit Jahrhunderten praktizieren. Sie ist das eine Schlüsselmerkmal, das wir allen anderen Arten voraushaben. Was am 1. Juni am Strand von Margate Beach in Südostengland begann, war daher in vielerlei Hinsicht nur ein gesteigerter Ausdruck unserer einzigartigen menschlichen Fähigkeit, aus Leiden Kraft zu schöpfen.
TEIL 1 |LEBEN AN LAND (VOR DER SCHWIMMTOUR)
KAPITEL 1 | WARUM HABE ICH MIR DAS ANGETAN?
ORT: Margate
ZURÜCKGELEGTE DISTANZ: 0 Kilometer
TAGE AUF SEE: 0
Es ist 7 Uhr morgens am 1. Juni 2018, im kleinen Küstenstädtchen Margate. Versteckt an Englands Südostküste, nur 130 Kilometer von London entfernt, ist der Badeort mit seinen feinen Sandstränden seit vielen Jahren ein Magnet für die Hauptstädter. Alles in Margate, von den Eisdielen über Cafés und Restaurants bis hin zum Freizeitpark und den Spielhallen, besitzt den zeitlosen Charme vergangener Tage. Die Geschichte der Stadt war stets eng mit der See verknüpft und das Fehlen des einstmals prächtigen viktorianischen Piers, der bei einem Sturm 1978 zerstört wurde, ist für Anwohner und Touristen eine mahnende Erinnerung, welch unbändige Kraft das Meer besitzt.
Deshalb war die britische Küstenlinie das ideale »Testgebiet«, um die Kunst der Unverwüstlichkeit zu erforschen. Ihre weltbekannten, gefährlichen Wetterumschwünge, Wellen und Strömungen, die bedrohlichen Strudel, rauen Landzungen und wilden Nordseestürme waren ideale Werkzeuge, um meinen Geist zu schärfen und meinen Körper abzuhärten.
Warum wir Margate als Startpunkt wählten? Als wir die Tour geplant hatten, beschlossen wir, Großbritannien im Uhrzeigersinn zu umschwimmen, weil die vorherrschenden Winde üblicherweise von Westen oder Südwesten auf die Insel treffen. So erwartete uns der »schwerere« Teil der Reise – die Südküste entlang, um Cornwall herum und die Irische See hinauf nach Westschottland – während der Sommermonate. Die »leichtere« Hälfte der Strecke verlief dann theoretisch über die Spitze Schottlands und die Ostküste Britanniens hinab, die uns aufgrund der topografischen Beschaffenheit der Küstenlinie einigermaßen guten Schutz vor den starken Südwestwinden bot. Um unsere Mission vor Wintereinbruch zu beenden, mussten wir allerdings schnell sein.
An jenem Morgen stand ich jedoch am Strand, blickte hinaus aufs Meer und hatte absolut keine Ahnung, was mich erwarten würde. Viele Leute bezeichneten mein Vorhaben als »schwimmenden Selbstmord« und glaubten, es sei unmöglich, allein der Versuch töricht. Um jedoch die preisgekrönte Romanautorin Pearl S. Buck zu zitieren: »Die jungen Leute wissen noch zu wenig, um vernünftig zu handeln. Darum versuchen sie das Unmögliche – und bringen es, Generation auf Generation, immer wieder zuwege.«
Deshalb war mein Plan so simpel. Als schwimmendes Versuchskaninchen würde ich als erster Mensch probieren, 2865 Kilometer um ganz Großbritannien herum zu schwimmen und dabei die Wissenschaft, die hinter Kraft, Mut und Stoizismus steckt, zu erforschen. Indem ich auf meiner Mission die unterschiedlichsten Facetten der Widerstandskraft kennenlernte, wollte ich verstehen, was den menschlichen Willen so unzerstörbar macht.
Auch die Regeln des Versuchs waren recht einfach: Betitelt wurde das Ganze als »weltlängste in Etappen geschwommene Strecke« (wobei die Länge der einzelnen Etappen von Tag zu Tag variieren konnte und eine neue Etappe immer dort begann, wo die letzte aufgehört hatte). Zudem galten die Regularien der World Open Water Swimming Association (WOWSA) und des Guinnessbuchs der Weltrekorde. Ich wurde mit einem elektronischen GPS-Tracker ausgestattet und mein Standort am Ende jeder Etappe von der WOWSA dokumentiert. Während der Etappen schleppte ich aus Sicherheitsgründen eine aufblasbare Boje mit mir herum (vor allem nachts, denn an der Boje war ein Blitzlicht angebracht, sodass man mich immer sehen konnte). Ich selbst bestand darauf, während der gesamten Schwimmtour kein einziges Mal Land zu betreten, verbrachte meine Erholungsphasen aber außerhalb des Wassers auf einem Support-Boot.
Natürlich war ein solches Projekt nicht allein zu stemmen. Für eine Tour dieser Größenordnung brauchte ich einen Bootskapitän mit stählernem Mut und jahrelanger Segelerfahrung unter den widrigsten Bedingungen, die Mutter Natur heraufbeschwören kann. Dazu eine Crew mit unerschütterlichem Glauben, die Tag und Nacht, durch Himmel und Hölle, an meiner Seite segeln würde – nur so konnte diese Mission ein Erfolg werden.
Doch statt ein solches Team zu finden, fand ich etwas viel Besseres: Ich fand eine Familie.
Familie Knight war eine Truppe leidenschaftlicher Segler und Wellenreiter, die schon seit vielen Jahren den (gemeinsamen) Traum hatten, einmal Großbritannien zu umsegeln. Wegen seiner Liebe zum Abenteuer und einem Faible für das Unmögliche wurde mir Vater, Ehemann und Kapitän Matt Knight von einem gemeinsamen Freund als perfekter Kopf meiner Crew empfohlen. Als wir uns im südenglischen Städtchen Torquay zum ersten Mal trafen, um die Mission zu besprechen, hatte ich ihn mit meinem Enthusiasmus förmlich umgehauen und musste gar keine großartige Überzeugungsarbeit mehr leisten, damit er mich völlig naiven und wahnsinnig optimistischen Schwimmer aufnahm und mit mir die erste Umschwimmung des gigantischen Felsens plante, den wir Großbritannien nennen.
Matt und seinen Charakter zu beschreiben, ist nicht einfach, aber ich will es versuchen. Er ist über 1,80 Meter groß und war zum damaligen Zeitpunkt bereits 60, aber trotzdem noch gebaut wie ein Triathlet: kein Gramm Fett am Körper, dafür riesige Unterarme, die an Popeye erinnerten, und eine Haut, die nach Jahren im Kampf mit Wind, Wellen und Salzwasser aussah wie Leder. Doch all diese Eigenschaften waren nur die physische Komponente seiner tiefen Verbindung zum Meer, die seit den 1980er-Jahren bestand, als er, als junger Bursche auf der Suche nach Abenteuer, seine Heimatstadt verließ, als Deckhelfer auf einem Schiff anheuerte und über den Atlantik segelte. Mit harter Arbeit und einer unsterblichen Liebe für das Meer arbeitete er sich die Ränge hinauf und machte Jahre später seinen »Jachtmaster« – den britischen Sportbootführerschein – und führte Boote als Skipper durch den Atlantik, Pazifik und den Indischen Ozean.
Dabei lernte er auch Mutter, Ehefrau und Küchenchefin Suzanne kennen, eine zierliche blonde Lady aus Devonshire, deren Mutterinstinkt nur dann ganz befriedigt zu sein schien, wenn sie bei sechs Meter hohen Wellen im offenen Meer Essen für die ganze Familie und Crew kochte. Als Paar segelten sie und Matt die Küstenlinien von Frankreich, Cornwall, Devon, Wales, Irland, Portugal und Madeira entlang und erkundeten einige der abgelegensten Inseln im Südpazifik und in Indonesien.
Unterwegs fanden sie sogar die Zeit, vier tolle Kinder zu zeugen, die später meine Crew und neuen Adoptivbrüder und -schwestern wurden: Taz, Harriet, Peony und Jemima. Ohne festgelegte Hierarchie tat jedes meiner »Meeresgeschwister« alles Menschenmögliche, um sicherzustellen, dass wir auf unserem Weg die Küste entlang weiter vorankamen, lotsten mich vorbei an Hummerfallen, zerklüfteten Felsen und durch gefährliche Schifffahrtsrouten und beschützten mich vor Haien, Killerwalen und Seehunden in der Paarungszeit.
Zu guter Letzt muss ich das Boot erwähnen, das 157 Tage lang mein Zuhause gewesen ist: Die Hecate war ein 16 Meter langer und sieben Meter breiter, speziell angefertigter Katamaran (nach seinem Designer »Wharram« genannt), der aus zwei parallelen Schiffsrümpfen bestand, die im Grunde nur von Tau und Takelage zusammengehalten wurden. Dadurch bewegte, bog und krümmte sich das Boot mit den Wellen. Vorlage für diese besondere Bauweise war die traditionelle polynesische Bootsbaukunst, die sich seit Tausenden von Jahren nicht verändert hat.
Der Plan sah vor, dass die Hecate sooft es ging unter Segel fuhr. Es würde jedoch auch Zeiten geben, in denen die See besonders rau oder die Strömungen besonders tückisch waren, sodass wir den Motor anwerfen mussten.
Das Beste an der Hecate war die Kombüse, die als Bordküche und Bibliothek diente und in der ein Großteil dieses Buchs geschrieben wurde. Nachdem ich zwölf Stunden täglich geschwommen war, verbrachte ich die verbleibende Zeit mit Essen, Schlafen (Träumen) und dem Aufschreiben von Theorien und Prinzipien zur Unverwüstlichkeit, die mir durch den Kopf gingen, während ich auf den Meeresgrund starrte. Wir haben ausgerechnet, dass ich während meiner 157-tägigen Tour mehr als 1500 Stunden (also über 60 Tage) mit dem Gesicht nach unten schwamm, in den dunkelblauen Abgrund blickte und die Kapitel dieses Buchs in meinem Kopf vollendete, noch bevor ich sie auf Papier niederschrieb.
Deshalb besteht der Inhalt dieses Buchs aus einer Mischung aus
wahren Begebenheiten der Schwimmtour,
Erlebnissen aus meiner Vergangenheit, von denen die Schwimmtour beeinflusst war,
Geschichten aus der sonderbaren Welt der Reizabschirmung, die in meinem Kopf stattfanden.
Der eine rote Faden, der sich durch das gesamte Buch zieht, ist die sogenannte Resilienz – mit anderen Worten: Belastbarkeit, Unnachgiebigkeit und Unverwüstlichkeit. Inspiriert wurde ich dazu auch durch Forschungsergebnisse in einem Artikel im Fachblatt Journal of Personality and Social Psychology, in dem stand: »Die Bedeutung intellektuellen Talents für Erfolge in allen professionellen Bereichen ist hinreichend belegt, weniger bekannt war bisher jedoch über die Bedeutung der Resilienz. Resilienz, definiert als Beharrlichkeit und Leidenschaft für langfristige Ziele … beeinflusste den IQ zwar nicht positiv, es zeigte sich aber, dass sich eine schrittweise Verbesserung der Vorhersagevalidität von Erfolg an mehr als nur dem IQ misst. Die Ergebnisse lassen vermuten, dass das Erreichen komplizierter Zielstellungen nicht einzig vom Talent, sondern auch von der beständigen und zielgerichteten Anwendung dieses Talents über einen gewissen Zeitraum abhängt.«1
Unterm Strich heißt das: Intelligenz ist super und mit Talent gesegnet zu sein definitiv ein Vorteil. Doch eine der am meisten unterschätzten und doch stärksten Tugenden, die ein Mensch besitzen kann, ist Resilienz – was auch der Grund dafür war, dass ich mir diese Schwimmtour unbedingt antun wollte.
Ich träumte davon, in die Fußstapfen meines Helden Captain Matthew Webb zu treten, dem am 25. August 1875 gelang, was viele für unmöglich gehalten hatten: das Durchqueren des Ärmelkanals, 33,79 Kilometer von Dover in England nach Calais in Frankreich. Erfahrene Seemänner behaupteten damals, das sei schwimmender Selbstmord, weil die Strömungen zu stark und das Wasser zu kalt seien. Aber Captain Webb schwamm – in einem Taucheranzug aus Wolle und gestärkt mit Brandy und Rinderbrühe – im Bruststil drauflos (weil Kraulen zur damaligen Zeit unter Gentlemen verpönt war) und kämpfte sich 20 Stunden lang durch die Wellen, um Geschichte zu schreiben.
Ich liebe diese Geschichte. Sie steht für Charakterstärke, Hartnäckigkeit und das Trotzen gegen alle Widrigkeiten. Seine verbissene Sturheit und der Glaube an sich selbst entsprachen dem damaligen Zeitgeist und zementierten Webb als Helden des viktorianischen Zeitalters.
Großbritannien zu umschwimmen war deshalb eine Möglichkeit für mich, zu diesen kraftvollen und ursprünglichen menschlichen Eigenschaften zurückzufinden. Wenn man die Anthropologie von uns Menschen (und die 4,5 Millionen Jahre alte Geschichte der Erde) betrachtet, sind diese Eigenschaften der Grund, warum wir heute alle unbestritten an der Spitze der Nahrungskette stehen und Sieger in einem Spiel sind, das Charles Darwin und Herbert Spencer als »Survival of the Fittest« bezeichneten.
Wie wir das geschafft haben? Nun, unsere Strategie war simpel: Vor etwa 100 000 Jahren entwickelten unsere Vorfahren große Gehirne und die erstaunliche Fähigkeit, ausdauernde körperliche Arbeit zu verrichten, und waren seitdem in der Lage, schneller zu denken, besser zu jagen und länger zu bestehen als größere, stärkere und schnellere Vertreter des Tierreichs.
Für sie waren Tapferkeit und Widerstandsfähigkeit keine seltenen und geachteten Tugenden, sondern alltägliche Eigenschaften, die Menschen einfach besitzen mussten, um außerhalb ihrer sicheren Höhle zu überleben, wo alles und jeder sie fressen wollte.
Machen wir einen Sprung ins Zeitalter der modernen (zivilisierten) Menschheit. Dieselben Attribute – Charakterstärke, Entschlossenheit und Mut –, die einst unser Überleben sicherten, sichern nun unseren Erfolg. Ob Captain Matthew Webbs erste Durchquerung des Ärmelkanals oder die ersten Everest-Besteigung durch Sir Edmund Hillary und Tenzing Norgay 1953, die Konzepte von Beharrlichkeit, Heldenmut und innerer Stärke waren im Verlauf der Geschichte immer Triebfedern für die größten Meisterleistungen der Menschheit.
Doch heutzutage sind wir in Gefahr. Wir ignorieren diese Schlüsselattribute, die unsere Art so überlegen gemacht haben, und verlieren zusehends die uralte Fähigkeit zur mentalen und körperlichen Robustheit. Wir führen ein Leben zwischen Schreibtisch und Sofa. Unsere tollkühnen Vorfahren, die vor 70 000 Jahren auszogen, um ihre Träume wahrzumachen, und von Ostafrika aus die Welt entdeckten, würden uns nicht wiedererkennen. Genau deshalb habe ich mich entschieden, um Großbritannien zu schwimmen und dieses Buch zu schreiben.
Um zu zeigen, dass wir modernen Menschen dieselbe übermenschliche Unverwüstlichkeit in uns tragen wie unsere furchtlosen Urahnen.
KAPITEL 2 | WARUM DER KÖRPER NICHT ZERBRICHT
ORT: Margate
ZURÜCKGELEGTE DISTANZ: 0 Kilometer
TAGE AUF SEE: 0
Die Uhr am Strand von Margate schlägt 14 Uhr und läutet somit meine letzten drei Stunden auf der Insel ein.
Diese letzten wertvollen Momente verbrachte ich damit, zwischen Patisserien und Pizzerien an der Seepromenade zu pendeln, um mit einer großzügigen Portion Teegebäck, Donuts und einer riesigen Familienpizza mit Käserand meine Nerven zu beruhigen. Weil ich nicht wusste, wann ich das nächste Mal eine frisch gebackene Pizza genießen könnte, aß ich soviel ich konnte und steckte mir den Rest in die Tasche, bevor ich mich auf den Weg zum Strand machte, um die Bürgermeisterin von Margate zu treffen, die freundlicherweise ein paar Worte an mich und die Medienvertreter richten wollte, bevor wir die Segel setzten und in See stachen.
Ihr Name war Julie und sie war einfach bezaubernd. Tadellos gekleidet, trug sie ein riesiges, »Chain of Office« genanntes goldenes Medaillon. Sie und ihr Mann Ray hatten bereits meine Eltern kennengelernt, die schon früher am selben Tag angekommen waren. Wir übersprangen deshalb die Formalitäten und redeten über Teegebäck und Schwimmen. Ich aß die Pizzareste aus meiner Tasche, während sie mir von der Geschichte und dem Erbe ihrer geliebten Stadt erzählte.
»Was glauben Sie, wie lange Sie brauchen werden?«, fragte Julie.
Ich hielt einen Moment inne, denn ich hatte wirklich absolut keine Ahnung. Ich wusste nur, dass die Wellen, Wind und Wetter entscheiden würden, ob und wann ich ins Ziel komme. Als sehr grobe Schätzung entgegnete ich: »100 Tage vielleicht, vermutlich aber mehr.«
»Oje!«, sagte sie enttäuscht und schaute Ray besorgt an. »Dann wird er unser Food Festival im August verpassen, wenn er sich nicht sputet.«
In diesem einen Moment habe ich Margate für immer ins Herz geschlossen.
Das herrliche Margate! Traditionsbewusst und gastfreundlich, dabei gänzlich unprätentiös und bodenständig. Während alle sich über den Start Gedanken machten, plante Julie bereits (ambitioniert) mein Finish zeitlich passend zum Food Festival, wo sie zweifellos mit Teegebäck und Konfitüre warten würde. Deshalb werde ich der Stadt, in der meine Reise ihren Anfang genommen hat, für immer verbunden sein.
Ich will nicht unerwähnt lassen, dass nicht jeder Julies Optimismus teilte und dass an diesem Tag, bis auf ein paar Einheimische, nicht viele Zuschauer da waren. Sponsoren hatten sich bemüht, landesweite Medien zur Berichterstattung über den Start zu bewegen, aber die wenigsten nahmen die Aktion ernst. Einige Monate zuvor hatte ein anderer Schwimmer denselben Versuch gestartet, aufgrund schlechter Bedingungen aber schon nach einer Woche abgebrochen. Daher hielten die meisten Journalisten dies für den weiteren unseligen Versuch eines unmöglichen Abenteuers. Die sozialen Medien quollen geradezu über vor Posts von Leuten, die an mein Scheitern glaubten.
Viele dachten, mein Geist würde kapitulieren …
Andere, mein Körper würde daran zerbrechen …
Doch unter all den Unkenrufen am lautesten waren die der Sportwissenschaftler aus der Schwimm-Community, die schnell darauf verweisen, dass ich es mit meinen gerade mal 1,73 Metern und stämmigen 88 Kilogramm niemals um die Insel schaffen und die Gesetze der Hydrodynamik (die Lehre von Objekten, die sich durchs Wasser bewegen) aufgrund meiner kurzen, stummeligen Gliedmaßen gegen mich arbeiten würden.
All dessen war auch ich mir bewusst. Monate bevor ich in Margate zu meiner Mission aufbrach, hatte ich mich in einem Sportlabor einer vollständigen medizinischen Untersuchung unterzogen, um zu sehen, ob mein Körper eine Schwimmtour dieser Größenordnung überhaupt überleben könnte. Nachdem ich stundenlang untersucht und gepikst worden war, hatte man mir unmissverständlich klargemacht, dass ich »nicht über die physischen Attribute eines Eliteschwimmers« verfügte. Nicht ohne hinzuzufügen, dass ich vermutlich »wie ein Stein sinken« würde, sollte ich dieses unselige Abenteuer wagen.
Doch es kam noch schlimmer … Als ich an einem Tag das Untersuchungszimmer betrat, hielt der wissenschaftliche Leiter des Instituts ein Klemmbrett mit meinen Testergebnissen in der Hand, musterte mich von oben bis unten und sagte: »Sie sind ziemlich schwer … aber auch ziemlich klein.«
Ein wenig schroff, aber wahr, dachte ich mir.
»Das ist nicht gut«, fuhr er fort und begann nun die Stirn zu runzeln, so als hätte mein untersetzter Körperbau ihn und sein Labor irgendwie beleidigt. »Aber wenn ich ehrlich sein soll, sorgt mich Ihre Körperzusammensetzung am meisten. Fett schwimmt und hält warm, doch Sie haben kaum welches. Dafür besitzen Sie massig Muskeln, die allerdings sinken. Ihnen dürfte es schon schwerfallen, nur im Wasser zu treiben und warm zu bleiben, vom Schwimmen einmal ganz zu schweigen.«
Ich nickte und dachte mir, dass dies wohl die brutalste Einschätzung eines Körpers in der Geschichte des Schwimmsports gewesen sein musste. Aber das war noch nicht alles. Er fuhr mit seiner jegliches Selbstwertgefühl vernichtenden Kritik fort und störte sich nun an bestimmten Körperteilen.
»Ihr Kopf ist auch ein Problem«, sagte er.
»Was ist denn mit meinem Kopf?«, wollte ich wissen. Inzwischen fühlte ich mich regelrecht verlegen.
»Er ist groß und dicht«, erklärte er barsch.
»Ich weiß, dass ich einen großen Kopf habe, aber …«, begann ich, wurde jedoch jäh unterbrochen, bevor ich meinen überdimensionierten Schädel verteidigen konnte.
»Ja, aber er ist nicht nur groß, sondern auch äußerst dicht«, sagte er und gestikulierte dabei mit seinen Händen. »Tatsächlich sind alle Ihre Knochen sehr dicht. Worum ich mich aber sorge, ist, dass Sie sich aufgrund der Größe und Position Ihres Kopfes im Grunde in ein menschliches U-Boot verwandeln, weil das massive Gewicht Ihres Schädels Sie nach unten auf den Meeresgrund zieht.«
Anschließend blätterte er weiter durch seine Datenblätter, wertete die Statistiken aus und erklärte mir wieder und wieder, dass ich einen der dichtesten Schädel hätte, die er je gesehen habe. Einige Augenblicke (und fünf Seiten) später fand er aber einen statistischen Lichtblick.
»Oh, warten Sie«, sagte er. »Das hier ist vielleicht eine gute Nachricht.«
Erleichtert atmete ich auf.
»Sie haben eine ganz ausgezeichnete, dicke, fette, gebärfreudige Hüfte!«
»Was?« Mir war nicht ganz klar, warum das eine gute Nachricht sein sollte, aber es war wohl immer noch besser als ein massiver U-Boot-Schädel, also beschloss ich hinzuhören.
»Ihr ganzes Fett befindet sich an den Schenkeln, wie bei einer Frau«, sagte er und gestikulierte erneut mit den Händen. »Das bedeutet, auch wenn Ihr schwerer Kopf sinkt, werden Ihre Schenkel oben schwimmen … wie der Hintern einer Ente.«
Er hielt kurz inne, um seine endgültige Diagnose zu formulieren. »Wenn Sie meinen Rat hören wollen: Ich würde mit dem Krafttraining aufhören, Muskelmasse abbauen und einen Körper formen, der dem eines Schwimmers ähnlicher ist. In ein paar Jahren können Sie dann versuchen, einmal um Großbritannien zu schwimmen. Jetzt im Moment glaube ich nicht, dass Sie um die Insel laufen könnten – und schwimmen erst recht nicht.«
Ich stimmte ihm in jeder Hinsicht zu, außer seiner »Hüftdiagnose«.
Ich besitze einen schweren Kopf und eine gebärfreudige Hüfte, die mich zu einem übergroßen Sumo-Schwimmer machte, war mir aber sicher, dass diese Hüfte mir – entgegen den Erkenntnissen konventioneller Sportwissenschaft – auf meiner Schwimmtour um Großbritannien helfen würde.
Warum ich mir da so sicher war? Weil seine Einschätzungen auf Erfahrungen mit Eliteschwimmern basierten, die in ihren Wettkämpfen Distanzen von 100 Metern oder 10 Kilometern zurücklegen, und nicht auf jemandem, der vorhat, 2865 Kilometer um mehrere Länder herumzuschwimmen. Das war der wesentliche Unterschied: Mir war bewusst, dass ich als schlankerer, leichterer Schwimmer schneller sein würde. Doch als schwererer, stärkerer Schwimmer war ich robuster.
Studien belegen das. Untersuchungen der National Strength and Conditioning Association (NSCA) zeigen, dass die »Rolle eines Kraft- und Konditionstrainers über das Verordnen von Übungen und Überwachen der korrekten Ausführung hinausgehen kann, etwa im Rahmen von Strategien zur Vermeidung von Sportverletzungen, durch das Formen robuster und widerstandsfähiger Athleten.«1
Das gilt für Schwimmen genauso wie für andere Sportarten. Schon 1986 wurden im Journal of Sports Medicine Forschungsergebnisse veröffentlicht, die belegen, dass das »Auftreten von Verletzungen, die aus Überbeanspruchung resultieren, wie die Schwimmerschulter oder der Tennisarm, durch die Ausführung von Widerstandstraining reduziert werden kann«.2 Wie das? Die Wissenschaftler ergänzten: »Widerstandstraining fördert das Wachstum und stärkt die Kraft von Sehnen und Bändern, deren Verbindungen mit den Knochen, des Knorpelgewebes sowie des Bindegewebes zwischen der Muskulatur. Studien zeigen darüber hinaus, dass Widerstandstraining den Mineralgehalt der Knochen erhöhen und daher bei der Prävention von Knochenverletzungen helfen kann.«3
Nun ist natürlich jeder Sportler anders und es gibt Tausende hervorragende (und spezifische) Behandlungsmethoden von weltweit führenden Physiotherapeuten, Osteopathen und Spezialisten für Verletzungsprävention, mit denen Tausende komplizierte Verletzungen behandelt werden und deren Bedeutung ich an dieser Stelle keinesfalls kleinreden möchte. Doch Untersuchungen belegen – wie du später in diesem Kapitel noch sehen wirst –, dass Widerstandstraining in der Breite, also in allen Sportarten, Ländern, Altersgruppen und Geschlechtern, der Schlüssel zur Schaffung robuster und widerstandsfähiger Menschen sein kann.
Und dies würde – so glaubte ich – ein entscheidender Faktor bei dieser Schwimmtour sein. Denn selbst wenn mir nur einige wenige Tage perfekter Schwimmbedingungen aufgrund einer Verletzung flöten gegangen wären, hätte mich das locker 160 Kilometer Streckenfortschritt gekostet. Natürlich wäre Schnelligkeit ein Vorteil gewesen, doch Widerstandsfähigkeit war eine Notwendigkeit.
Selbstverständlich waren diesbezüglich viele Experten anderer Meinung. Einer aber stimmte mir zu: Barry. Barry hat immer an mich geglaubt. Er war 65 Jahre alt, ein Fischer aus Margate und hatte sein gesamtes Leben dort verbracht. Als die Nachricht seinen Pub erreichte, dass jemand versuchte, um Großbritannien zu schwimmen, kamen er und sein Kumpel George zum Hafen runter, um sich den Start dieses Spektakels anzusehen.
Nachdem sie mich von oben bis unten gemustert hatten wie ein zu kleines Rennpferd, entschieden sie offenbar, dass sich mit meinem kleinen Abenteuer Geld machen ließe. Während sie an Ihren Pints regional gebrauten Ales nippten, diskutierten sie die Bedingungen ihrer Wette und gaben schließlich beide eine Prognose darüber ab, wie diese Schwimmtour enden würde.
George trat als Erster an mich heran. Sehr freundlich, aber auch äußerst skeptisch. Er sah die Sache wie die Wissenschaftler aus der Schwimmgemeinde und prophezeite mir, dass ich es 160 Kilometer die Küste entlang schaffen würde, bevor mein Körper zerbrechen oder mein Geist kapitulieren würde.
»Bitte nehmen Sie mir das nicht übel, junger Mann«, sagte er und begutachtete erneut meine (fehlende) Größe. »Aber wenn man bedenkt, wie rau die See hier an der Südküste manchmal werden kann, dann glaube ich, dass ich mit Ihnen gerade 100 Mäuse gewonnen habe.«
Barry aber schüttelte entschieden den Kopf, legte seinen Arm um mich und sagte: »Du machst das schon, Junge. Ich kümmere mich um das Bier, wenn du zurück bist.«
Da musste ich lachen und nahm Barry fest in die Arme.
Wie gesagt: Dies ist der Grund, aus dem ich Margate liebe. Ich dankte ihnen für ihr Kommen, denn beide waren – unabhängig von ihrer Wette – zum Hafen gegangen, um mir zum Abschied zu winken. Ich verabschiedete mich mit den Worten: »Cider ist mir lieber als Bier, aber wir sehen uns auf jeden Fall in paar Monaten.«
Es war bereits spät am Nachmittag und der Gezeitenwechsel stand bevor. Sobald die Tide gestiegen war, würde ich mich auf den Weg machen, den Hafen ostwärts in Richtung der berühmten Kreidefelsen von Dover und der Südküste Englands verlassen und erst nach Margate zurückkehren, nachdem ich einmal komplett um Großbritannien herumgeschwommen war.
Um das zu schaffen, musste ich dafür sorgen, dass mein Körper nicht daran zerbrach und mein Geist nicht kapitulierte. Mir war allerdings auch klar, dass ich nicht über den Gesetzen der Sportwissenschaft stand. Viele der Regeln, nach denen unsere Psychologie und Physiologie funktionieren, sind unfehlbar und als studierter Sportwissenschaftler wusste ich, dass ich sie nicht einfach brechen konnte.
Stattdessen musste ich in den kommenden 157 Tagen lernen, wie man sie verbiegt.
KAPITEL 3 | WARUM DER GEIST NICHT KAPITULIERT
ORT: Margate
ZURÜCKGELEGTE DISTANZ: 0 Kilometer
TAGE AUF SEE: 0
Es ist 17 Uhr. Ich stehe barfuß am Strand und blicke aufs Meer hinaus.
Ich wusste, dass meine Füße und Zehen mit der Zeit das Gefühl von Sand und festem Boden vergessen würden. Als ich an diesem Tag den Hafen von Margate in südlicher Richtung verließ, schwor ich mir, kein Land mehr zu betreten, bevor ich die 2865 Kilometer um Großbritannien geschafft und denselben Hafen aus nördlicher Richtung kommend wieder erreicht hatte. Ich versuchte, das Gefühl von festem Boden so gut es ging zu genießen, krallte meine Zehen in den Sand und wackelte mit ihnen hin und her.
Kurz darauf stießen meine Mutter, mein Vater und meine Freundin zu mir.
Normalerweise bin ich vor meinen sportlichen Abenteuern gern allein, weil ich sehr nervös werde, aber diese drei bilden eine Ausnahme. Mein Vater hat stets ein paar weise Worte parat, die mich beruhigten. Meine Mutter bringt üblicherweise ihren hausgemachten Zitronen-Heidelbeer-Käsekuchen mit, der mich für kurze Zeit von allen Sorgen ablenken kann, die ich vielleicht habe. Und meine Freundin Hester sorgt in diesen Situationen immer für ein wenig Normalität, indem sie etwas sagt wie: »Tja, schon eine komische Art, seinen Sommer zu verbringen, oder?«
Ich nahm mir ein großes Stück Käsekuchen und lachte drauflos.
»Hätten wir nicht einfach in den Urlaub fliegen können wie ein normales Pärchen?«, fragte Hester.
Wir waren seit fünf Jahren zusammen, sie wusste also bereits, dass »normale« Ferien nicht mein Ding waren. Einmal versprach ich ihr einen romantischen Urlaub in der Karibik, nur um dort dann einen Triathlon mit einem Baumstamm auf dem Rücken zu bestreiten (für einen guten Zweck) – den ersten »Tree-athlon« der Welt. Aber Spaß beiseite, Hester war äußerst verständnisvoll und kannte meine sportlichen Abenteuer inzwischen, in denen ich nur allzu oft blind und enthusiastisch Herausforderungen annahm, die meine Fähigkeiten bei Weitem überstiegen. Seinen Ursprung hat dieser Drang wohl in meiner Familie, die aus absoluten Sportfanatikern besteht und mich stets bei allem unterstützt.
Als Kind habe ich jede Sportart ausprobiert. Mein zwei Jahre älterer Bruder Scott nahm mich überallhin mit, ob zum Fußball, Mountainbiking, Leichtathletik oder Tennis. Weil ich kleiner und jünger als alle anderen war, musste ich meinen Mangel an Größe und sportlichen Fähigkeiten durch Sturheit und Schnelligkeit wettmachen.
Mein Vater unterstützte mich stets dabei. Nach dem Fußballtraining am Sonntag bat ich ihn einmal, am Ende unserer Straße anzuhalten, damit ich aus dem Auto aussteigen und mir ein Wettrennen mit ihm liefern konnte. Natürlich fuhr er dabei nur acht Kilometer pro Stunde – gerade langsam genug, dass ich als Erster daheim ankam – und ließ mich gewinnen, was beim anschließenden Sonntagsbraten gefeiert wurde, wo ich meiner Mutter stolz (und naiv) berichtete, dass ich schneller war als ein Auto. Sie belohnte mich dafür mit einer Extraportion Yorkshire-Pudding und mehreren Portionen ihres hausgemachten Reispuddings (das Lieblingsessen von meinem Bruder und mir).
Ein Jahr darauf wollte ich stärker werden und entdeckte so die Liebe für den Ringsport. Welche Art von Ringen, war mir egal. Mit meinem Großvater schaute ich mir sonntags alte Sumo-Kämpfe im Fernsehen an und wenn mein Vater heimkam, räumten wir die Möbel im Wohnzimmer um und veranstalteten unser eigenes Turnier. Meine Mutter strickte währenddessen meist, feuerte uns aber an und zog ihre Beine aus dem Weg, damit die Arena größer wurde.
Dann versuchten Scott, mein jüngerer Bruder Craig und ich abwechselnd, unseren Vater zu besiegen, der amtierender Sumo-Champion im Haus war. Gelungen ist uns das nie. Bis heute ist er wohl der hochrangigste Sumo-Ringer der Edgley-Familie.
Von Beginn an hatten unsere Eltern die Begeisterung für Sport in uns geweckt, sodass ich bereits im Alter von zehn geradezu besessen vom Training war. Ich versuchte stets, größer, stärker und fitter zu sein, damit ich mit Scott und seinen Freunden mithalten konnte. Auf dem Schulweg packte ich Gewichte in meinen Ranzen und löcherte meinen Vater nach Übungen, von denen ich »kräftigere Arme« oder »schnellere Beine« bekommen würde.
Ich war völlig ahnungslos, aber total motiviert. Ich kann mich noch erinnern, wie ich mal ein ganz simples militärisches Zirkeltrainingsprogramm in einem alten Buch fand, das aus Liegestützen, Ausfallschritten, Sit-ups und Shuttle Runs bestand. Übungen, die »den Charakter stärken«, so stand es darin geschrieben. Ich ging mit dem Buch zu meinem Vater und fragte ihn, welcher Muskel damit gemeint war, weil ich ihn nämlich auf keiner Anatomie-Übersicht finden konnte.
Drei Jahre später spielte ich als 13-jähriger Schuljunge bereits Wasserball gegen erwachsene Männer – ein knallharter Sport, bei dem unter Wasser gehauen und getreten wird, was das Zeug hält. Weil ich siebenmal pro Woche eine Abreibung bekam und unter Wasser gedrückt wurde, war das irgendwann ganz normal für mich, bis ich die Pubertät eines Tages hinter mir hatte und auch mal den einen oder anderen Zweikampf gewann.
So ging das die nächsten 20 Jahre weiter. Die Arbeitsmoral, die ich von meinen Eltern übernommen hatte, formte die Grundlage meines Glaubenssystems. Jede Trainingseinheit, die ich in den vergangenen zwei Dekaden absolviert habe, stand unter folgendem Motto:
»Harte Arbeit ist oft die Antwort. Die Frage spielt oft keine Rolle.«
ROSS EDGLEY
Dieses Motto und die Einstellung dahinter hatten auch für die vor mir liegende Schwimmtour eine ganz wichtige Bedeutung. Denn die Bauweise meines Körpers und die Verdrahtung meines Gehirns waren in vielerlei Hinsicht das Ergebnis der grenzenlosen Unterstützung durch meine Familie einerseits und des konstanten Strebens nach – wie viele glaubten – unmöglich oder kaum zu meisternden Abenteuern.
Um 17:15 Uhr brach ich auf zu meinem bisher größten Abenteuer. Ich zog meinen Neoprenanzug an, setzte meine Schwimmbrille auf und umarmte Mutter, Vater und Hester. Es war kein emotionaler Abschied, denn sie hatten bereits geplant, wo sie wann hinkommen mussten, um mich von der Küste aus zu sehen. Außerdem hatten sie Matt auf Kurzwahl, sodass ich schon bald von ihnen hören würde.
Meine größte Sorge war zunächst, sicher ins Wasser und erfolgreich aus dem Hafenbecken rauszukommen, während eine kleine Gruppe Menschen (und Lokalmedien) sich am alten Pier versammelt hatte, um mir zum Abschied zu winken. Insgesamt waren es vielleicht nur 50 Personen (darunter die Besitzer des Pizzaladens), aber ihre Anfeuerungsrufe schallten übers Wasser und klangen wie eine ganze Armee von Unterstützern.
Ich watete bis zur Brust ins Wasser, drehte mich ein letztes Mal um und dankte Barry, George, Julie und Ray, bevor ich in Richtung der Hecate losschwamm, die einige Hundert Meter voraus ihren Kurs setzte. Als mein Gesicht ins Wasser eintauchte, spürte ich ein Gefühl großer Erleichterung am ganzen Körper. Die Zeit des Planens und der Vorbereitung war nun vorüber. Jetzt gab es nur noch mich und das Meer, in einer Schlacht von Wind und Wellen gegen Schwimmen und Sportwissenschaft.
Ich gab mir Mühe, meine Emotionen zu kontrollieren, und hielt kurz am Pier, um den Einwohnern von Margate zu danken, dass sie meinem Start beiwohnten. Ich sagte ihnen, dass ich hoffte, noch vor Weihnachten zurück zu sein. Sie alle lachten (denn Weihnachten war erst in sechs Monaten), doch leider meinte ich das völlig ernst.
Während der ersten Kilometer wurde ich noch von Pizza, Käsekuchen und purem Adrenalin angetrieben. Captain Matt hielt beständig seinen Kurs und ich nutzte die Hecate als Wegweiser, während wir uns auf in Richtung Hafen von Dover machten. Ich schwamm bis spät in die Abendstunden hinein und startete früh am Morgen sofort wieder, sodass ich in weniger als neun Stunden 33,79 Kilometer zurücklegte – das Äquivalent des Ärmelkanals. Gemessen an üblichen Schwimmerstandards könnte man also sagen, dass ich gute Fortschritte machte.
Doch das vor mir liegende Unterfangen hatte eine völlig andere Größenordnung als alles bisher Dagewesene und die nackten Zahlen, die dahinterstanden, waren ziemlich deprimierend: Um Großbritannien einmal schwimmend zu umrunden, musste ich die bereits geschaffte Strecke erneut zurücklegen … bis zu 100 Mal.
Schon jetzt taten meine Augen weh, meine Arme waren müde davon, ständig gegen die Wellen anzukämpfen, und meine Zunge war wund von all dem Salzwasser und den Massen an Kalorien, die nötig waren, um meine Energiespeicher für die Strecke am nächsten Tag aufzufüllen.
Selbst zu diesem extrem frühen Zeitpunkt war mir bereits klar, dass dies keine reine Schwimmexpedition mehr war. Die Position meines Kopfs und meiner Hände oder das Intervall meiner Schwimmzüge würden nicht darüber entscheiden, ob ich diesen riesigen Felsen namens Großbritannien umrundete oder nicht. Dies würde ein 157-tägiger Kampf gegen einen ganz anderen Gegner werden: Erschöpfung in all ihren Formen.
Deshalb stand in der Bordküche/Bibliothek der Hecate auch ein Buch, das ich eifrig studierte, seit ich die Idee zu dieser Schwimmtour hatte: The Facts of Fatigue (deutsch: Die Fakten der Erschöpfung).
ERSCHÖPFUNG: DIE FAKTEN
In der Sportwissenschaft war das Thema Erschöpfung lange Zeit nicht vollständig erforscht. Wir wussten nur, dass sie hervorgerufen wird, weil etwas in uns versagt.1 Seit jeher stritten sich Psychologen und Physiologen jedoch, ob Erschöpfung sich nun im Kopf oder im Körper manifestiert. So steht im Fachblatt Journal of Neuromuscular Fatigue in Contact Sports: »Der Begriff ›Erschöpfung‹ wurde in Abstimmung mit den unterschiedlichen Subdisziplinen definiert, die mit der Sportwissenschaft im Zusammenhang stehen, nämlich den Fachbereichen der Physiologie (Körper) und Psychologie (Geist).
Auf der einen Seite stehen die Physiologen, die Erschöpfung als Versagen oder Fehlfunktion eines bestimmten physiologischen Systems betrachten (Entstehung im Körper). Auf der anderen Seite stehen die Psychologen, die Erschöpfung als unangenehme Wahrnehmung oder unangenehmes Gefühl betrachten (Entstehung im Geist).«2
Bei mir hatte das Meer allerdings Körper und Geist gleichermaßen ramponiert. Die Erschöpfung plagte mich sowohl körperlich als auch geistig, sodass ich auf meiner Reise um Großbritannien den helfenden Rat sowohl von Physiologen als auch Psychologen benötigen würde. Nach Hunderten Seiten Recherche war mir schließlich bewusst geworden, dass die moderne Sportwissenschaft der Auffassung ist, Erschöpfung definiere sich als eine Kombination aus beiden Denkrichtungen (Physiologie und Psychologie).
Oder, wie Forscher vom Institut für Bewegungs- und Neurowissenschaft der Deutschen Sporthochschule Köln sagen: »Es können mehrere Symptome von Erschöpfung gleichzeitig auftreten. Die zugrunde liegenden Mechanismen (sowohl biologische als auch psychische) überschneiden sich und interagieren miteinander.«3
Deshalb entwickelten moderne Wissenschaftler das psychobiologische Erschöpfungsmodell und betrachten Erschöpfung inzwischen als eine Kombination vieler komplexer Faktoren sowohl physischer als auch mentaler Natur.