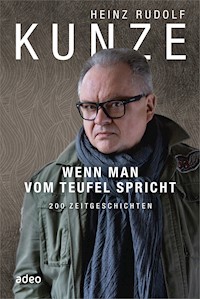23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Heinz Rudolf Kunze erinnert sich an sein Leben und seine Musik, an seine Familie und seine Weggefährten. Mit einnehmender Stimme blickt er zurück: auf eine Kindheit und Jugend im Wirtschaftswunderland, das mit der Aufarbeitung seiner Vergangenheit noch nichts zu tun haben wollte, auf die Umbrüche und Aufbrüche der grell-turbulenten 1980er Jahre und den deutschen Zeitgeist der letzten Jahrzehnte. »Werdegang« erzählt von Erfolgen, Zweifeln und Höhenflügen. Und nicht zuletzt davon, welche Kraft Musik und Literatur entfalten können. »Compañero Heinz Rudolf – über die Jahrzehnte stehen wir, wenn's drauf ankommt, immer schon Seite an Seite. Ob bei der Anti-Atom-Bewegung, auf der Loreley mit Willy Brandt, gegen Ausländerfeindlichkeit, gegen Nazis, bei Rock gegen rechte Gewalt oder auch als Teil der Friedensbewegung. Heinz Rudolf hat als Sänger immer schon politische Verantwortung übernommen. Und zusammen powern wir weiter!« UDO LINDENBERG »Unbändige Schaffenskraft, eine nie enden wollende Kreativität und der Mut, immer neue Herausforderungen anzunehmen – all das zeichnet Heinz und seinen künstlerischen Kompass aus. Respekt, Herr Nachbar!« KLAUS MEINE »Ich liebe Heinz für die Klarheit seiner Worte, für seine einprägsamen Bilder, für seine stets überraschenden Wendungen und klugen Gedanken. Ich liebe Heinz für seine Musik, für das Geschenk seiner Lieder – und weil er ein Freund ist.« REINHARD MEY
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 462
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Heinz Rudolf Kunze
Werdegang
Die Autobiographie
Reclam
Das Motto-Zitat von Donovan stammt aus dem Song »There is a Mountain« (1967). Das Motto-Zitat von Peter Handke stammt aus dem Theaterstück Die Unvernünftigen sterben aus. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1973. – © Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1973. Alle Rechte vorbehalten durch Suhrkamp Verlag Berlin.
Kontakt Heinz Rudolf Kunze:
MAWI ARTISTMANAGEMENT
Matthias Winkler
Arndtstraße 10, 04275 Leipzig
www.heinzrudolfkunze.de
2021 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Umschlaggestaltung: Anja Grimm Gestaltung
Umschlagabbildung: Flaca, www.flacas-art.de
Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen. Made in Germany 2021
Made in Germany 2021
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-961941-5
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-011379-0
www.reclam.de
Inhalt
Widmung
Hein Rudolf Kunze
Zitate
Intro. Woran man mit mir war
01. Bestandsaufnahme
02. Vertriebener
03. In der Alten Piccardie
04. Ich glaub es geht los
Erste Bildstrecke
05. Stirnenfuß
06. Glaubt keinem Sänger
07. Mehr als dies
08. Größer als wir beide
Zweite Bildstrecke
09. Raus auf die Straße
10. Möglicherweise ein Walzer
11. Die offene See
12. Herzschlagfinale
Diskographie
Nebenprojekte
Bücher
Abbildungsnachweis
Dieses Buch ist allen gewidmet, die mir Gutes getan haben und die ich hier zu wenig,
ihrer Meinung nach unzutreffend oder schlimmstenfalls gar nicht erwähnt habe.
First there is a mountain.
Then there is no mountain.
Then there is.
Donovan
Auf einmal fällt mir ein,
daß ich etwas spiele,
das es gar nicht gibt,
und das ist der Unterschied.
Das ist die Verzweiflung!
Peter Handke
And now, son, go out and do it!
Pete Townshend
Intro. Woran man mit mir war
Bei Martin Heidegger fand ich einmal den Satz: »Das Leben ist diesig, es nebelt sich immer wieder ein.« Wie sehr der Satz stimmt, habe ich bei der Arbeit an diesem Buch gemerkt. Jede Autobiographie ist ein Versuch, den Nebel, der sich über die Vergangenheit gelegt hat, zu durchdringen. Aber Erinnerung stellt sich nicht auf Knopfdruck ein. Sie ist launisch und entzieht sich der Kontrolle. Oft verweigert sie sich, wenn man sie braucht, und liefert nur ein paar nichtssagende Stichworte, aus denen alles Leben verschwunden ist. Dann wiederum überfällt sie einen regelrecht und bringt längst Vergangenes in einer solchen Klarheit und Fülle zurück, dass man glaubt, es noch einmal zu erleben. Das kann beglückend sein, manchmal aber auch sehr schmerzhaft, wenn Verdrängtes, Versäumtes, Misslungenes plötzlich wieder gegenwärtig wird.
Ich habe nie Tagebuch geschrieben oder auf sonst eine Art Buch über mein Leben geführt. Auch in meinen Texten und Liedern habe ich selten von mir gesprochen. Anstatt meine Gefühle auszustellen, bin ich lieber in fremde Rollen geschlüpft. Ich bin abgebogen in Ausgedachtes, in Geschichten, die mir dann immer sehr viel wahrer und paradoxerweise auch persönlicher erschienen sind als alles, was mir selbst passiert ist. Ich wollte mein Privates in etwas Größeres verwandeln, in dem sich auch andere Menschen wiederfinden können.
Deshalb konnte ich mich auch lange Zeit nicht mit dem Gedanken anfreunden, eine Autobiographie zu verfassen. »Am schönsten wär, wenn niemand weiß, / woran man mit mir war«, heißt es in einem meiner Songs, und das gilt noch immer. Darin liegt nicht unbedingt ein Widerspruch. Dass es diese Autobiographie nun doch gibt, verdankt sich vor allem einer ganz bestimmten Hoffnung: dass sie sich lesen lässt wie eine Sammlung von Geschichten, vielleicht sogar wie ein Entwicklungsroman.
Jedes Erzählen setzt Auswahl voraus. Mir ging es beim Schreiben nicht um Vollständigkeit. Nicht um das ermüdende Abhaken möglichst vieler Namen, Orte und Daten aus fünfundsechzig Lebens- und vierzig Bühnenjahren. Sondern um die möglichst intensive Vergegenwärtigung bestimmter Abschnitte. Ich glaube, es liegt in der Natur der Sache, dass sich viele Geschichten in diesem Buch auf das erste Jahrzehnt meiner Karriere beziehen. Es war eben die für meinen Werdegang prägende Zeit. Alles war neu, alles geschah zum ersten Mal. Ich unterschrieb einen Plattenvertrag, wurde nicht Lehrer oder Dozent an der Uni und fand eine Band. Ich spielte vor Publikum, traf Kollegen, und man hieß mich mal freundlich, mal misstrauisch willkommen. Eine Reise hatte begonnen, von der ich nicht wusste, wie lange sie dauern und was ich auf ihr erleben würde. Erst als sich nach und nach der Erfolg einstellte, gerade noch rechtzeitig sogar der große, glaubte ich langsam an die Möglichkeit, mein weiteres Leben der Musik widmen zu können. Mein Werdegang war damit sicher nicht abgeschlossen, doch ich hatte den Platz in der Welt gefunden, an den ich bis heute gehöre. Ich war angekommen.
Vieles in diesem Buch liegt noch gar nicht so lange zurück, wirkt aber doch schon wie aus einer fernen Zeit, nicht nur, was das Musikgeschäft betrifft. Anderes, das Wichtigste, ist jedoch immer gleich geblieben: die Freude am Schreiben, Veröffentlichen und Auftreten. »Her life was saved by rock ’n’ roll«, hat Lou Reed gesungen. Das gilt auch für mein Leben. Nicht zuletzt davon erzählt dieses Buch. Geschrieben wurde es mit einem großen Gefühl der Dankbarkeit. Der Dank gebührt all den Menschen, die mir in den letzten vierzig Jahren ihre Zeit und ihre Liebe geschenkt haben – auf der Bühne, hinter der Bühne und nicht zuletzt vor der Bühne.
01. Bestandsaufnahme
Mick Franke war der große Bruder, den ich nie hatte, nach dem ich aber immer auf der Suche gewesen war. Die Sorte von Bruder, die einem Lieder auf der Gitarre beibringt. »Father And Son« von Cat Stevens zum Beispiel, und es war, als ob Mick mir mit diesem Song, der von der fast immer scheiternden Kommunikation zwischen den Generationen handelt, etwas sagen wollte: Irgendwann wird sich eine Möglichkeit für dein Leben eröffnen, und auch du wirst weggehen müssen. Und dann wäre es die immer gleiche, die alte Geschichte. Zukunftsmusik, kaum vorstellbar. Was wusste ich schon vom Ausbrechen. Bis zum Abitur war mein Leben wie auf Schienen verlaufen, der nächste Bahnhof immer schon in Sichtweite.
Mick dagegen rebellierte mit allem, was er hatte, gegen seine Herkunft. Sein Vater war Heinrich Franke, er saß seit Mitte der sechziger Jahre für die CDU im Bundestag. Später, in der Regierung Kohl, sollte er das Rennen um das Amt des Arbeitsministers nur knapp gegen Norbert Blüm verlieren und stattdessen Präsident der Bundesanstalt für Arbeit werden. Micks vier Brüder schickten sich an, es ihrem Vater nachzutun, und verdingten sich in der Jungen Union. Mick stürzte lieber ein Klassenzimmer in unserer Schule mit Löschschaum ins Chaos und tat auch ansonsten viel dafür, den Moment zu feiern, was ihm schnell den Ruf eines Anarchisten einbrachte. Er flog vom Gymnasium, und nicht einmal sein Vater, dem halb Osnabrück gehörte, konnte das verhindern. Der Zufall wollte es, dass Mick nach seinem Rauswurf ausgerechnet in der Realschulklasse landete, in der mein Vater unterrichtete. Wenn er von Mick erzählte, kratzte sich mein Vater am Kopf: »Wäre dieser Lausebengel nicht so nett, müsste ich ihn zerbrechen. Er benimmt sich unmöglich. Er tut nur das, was er will, und kümmert sich nicht um den Rest. Eigentlich geht das ganz und gar nicht. Aber ich bringe es einfach nicht übers Herz, ihn zu bestrafen.«
Mick war ein Taugenichts, dem die Herzen zuflogen. Er hatte all das, was ich nicht hatte: Charme, Witz, Schlagfertigkeit, Mut und eine beeindruckende Lockenmähne. Er lebte die immer etwas schlampigen Ideale eines Hippies. Er las Hermann Hesse. Er liebte die indische Küche und den britischen Humor von Monty Python, beides lernte ich erst durch ihn kennen. Ich war brav, daran bestand kein Zweifel. Niemand hätte mich für die Rolle des schwarzen Schafs besetzt. Wenn ich mich auslebte, geschah das nur in meinem Kopf oder auf einem Blatt Papier.
Und trotzdem freundeten Mick und ich uns an. Für einige Jahre wurden wir sogar unzertrennlich. Aus nächster Nähe konnte ich dabei miterleben, was der Begriff ›Womanizer‹ wirklich bedeutet. Mick spielte den Casanova nicht, er war einer. Doch der Ehrenkodex galt. Meine Freundin blieb für ihn immer tabu. Gila wurde vielmehr Teil des Teams, und wir unternahmen viel zu dritt.
Ich hatte Mick über meinen Klassenkameraden Klaus Thorwesten kennengelernt. Die beiden machten zusammen Musik und traten auch gelegentlich als Duo auf. Mick spielte akustische Gitarre, Bouzouki, Balalaika und Mandoline. Zudem sang er eine gute und genaue zweite Stimme. Mit ihm im Bunde konnte nicht viel schiefgehen, wenn man sich vor ein Publikum wagen wollte. Mick wusste, dass ich eigene Sachen schrieb. Mehrere hundert Gedichte und Lieder waren über die Jahre zusammengekommen, doch nur wenige davon hatten den Weg an die Öffentlichkeit gefunden. Und nachdem ich mein Germanistik-Studium begonnen hatte, sah es auch nicht danach aus, als würde sich das noch einmal grundlegend ändern. Zu den Gruppenlesungen, an denen ich mitwirkte, oder zu den wenigen Kneipen-Auftritten, die ich mit einem Freund bestritt und die wir mit selbstgemalten Plakaten ankündigten, kam kaum jemand.
Immerhin schaffte ich es im Februar 1976 mit einer vom Kulturamt Osnabrück organisierten Lesung ins Kulturgeschichtliche Museum der Stadt. Auf die Einladung ließ ich »Heinz Rudolf Kunze: ›mücken und elefanten‹ (lyrik und lieder)« drucken – natürlich in modischer Kleinschreibung, ich hatte bei Hans Magnus Enzensberger gut aufgepasst. Für den Eintritt von 2 DM (Schüler und Studenten: 1 DM) wurde aber noch mehr geboten, die Ankündigung versprach auch »alte deutsche Lieder (Deutsche Folklore) mit Michael Franke«. Mick und ich zusammen auf einer Bühne. Es gelang uns, den Abend zu einem Erfolg zu machen, denn wir ergänzten uns gut. In unserem Auftritt eine Möglichkeit zu sehen, die Musik von nun an etwas zielstrebiger zu betreiben, erlaubte ich mir dennoch nicht. Dazu fehlte mir der Mut.
Während ich brav weiterstudierte, machte Mick so etwas wie eine Karriere. Er schaffte es, von seiner Musik zu leben. Man musste in Osnabrück lange suchen, um jemanden zu finden, der das konnte. Eigentlich fiel mir da nur das infernalische Medium-Terzett ein, das mit Liedern wie »Ein Loch ist im Eimer« oder »Drei Chinesen mit dem Kontrabass« Dauergast in Heinz Schenks Fernsehsendung Zum Blauen Bock war und mich so manches Mal aus dem Rausch des Beat-Clubs auf den Boden eines weiteren öden Samstags voller Spießigkeit und Langeweile zurückgeholt hatte.
Mick spielte in gleich zwei Bands, und beide hatten Plattenverträge bei der Metronome. Fiedel Michel bildeten eine Art norddeutsche Alternative zu dem weiter südlich immens erfolgreichen Duo Zupfgeigenhansel. Auf dem Programm stand Folk aus gleich mehreren Jahrhunderten. Musikalische Geschichtsschreibung von unten, Tänze, Arbeiterlieder, Revolutionsromantik. Vertonte Gedichte von Brecht, Kästner oder Georg Herwegh ergänzten die reine Lehre. Eine ihrer Platten hatten Fiedel Michel in den Windmill Lane Studios in Dublin aufgenommen. Beinahe wären sie dabei U2 über den Weg gelaufen, die dort gerade erst mit der Arbeit an ihrer Debüt-LP fertig geworden waren.
Micks andere Band hieß Falckenstein, sie rockte ein wenig mehr, doch auch hier gaben Hackbrett, Akustikgitarre und Geige den Ton an. Ich konnte mit beiden Bands nichts anfangen. Zu viel Tradition, zu wenig Gegenwart. Für diese Art Purismus interessierte ich mich einfach nicht. Daran konnte nicht einmal das in ganz Europa berühmte Folk-Festival etwas ändern, das jedes Jahr in Osnabrück stattfand.
Ich blieb auf dem mir vorgezeichneten Weg und ging an jeder Kreuzung weiter geradeaus. Nie trieb es mich ins Freie. Ich studierte in Osnabrück und – als es darum ging, eine andere Universität kennenzulernen – im nahe gelegenen Münster. Ich zog bei meinen Eltern aus, doch nur, um bald die nächste Bindung einzugehen. Gila und ich heirateten Ende 1979. Mein bürgerlicher Lebensplan sah vor, nach dem Studium an der Uni zu bleiben, erst zu promovieren und mich dann irgendwann auch zu habilitieren. Die Aussichten auf eine akademische Karriere standen gar nicht so schlecht. Mein Professor hatte mir eine Assistentenstelle in Aussicht gestellt, es brauchte nur noch etwas Geduld. Ich überbrückte die Zeit, indem ich dorthin zurückkehrte, wo ich gerade erst losgelaufen war: an die Schule. Fürs Erste würde ich mich als Lehrer versuchen.
In Niedersachsen gab es zu dieser Zeit die sogenannte »einphasige Lehrerausbildung«. Studium und Referendariat fanden nicht nacheinander statt, sondern waren miteinander verzahnt. Nach einem Jahr an der Schule und einer praktischen Prüfung würde es wieder an die Uni gehen für das theoretische Examen. Auf mich warteten die Abiturientinnen eines Mädchengymnasiums in Hannover. Die meisten von ihnen waren aufmerksam und interessiert, der Rest schwieg höflich. Großmütig waren sie allesamt, denn sie halfen mir, mit einer Verantwortung umzugehen, die ich eigentlich noch gar nicht übernehmen durfte, die mir Doktor Meyer, mein Ausbilder im Fach Deutsch, mangels Personal gleichwohl übertragen hatte: Ich musste drei Kurse zum Abitur führen.
Meine Nervosität legte sich rasch, und ich fand in meinen neuen Alltag hinein. Um unter der Woche nicht immer pendeln zu müssen, lebte ich zusammen mit einer anderen Referendarin in einer WG in Hannover. Elke Bunning und ich teilten uns die Miete und waren froh, die Abende nicht allein verbringen zu müssen. Fast immer saßen wir bis tief in die Nacht an unseren Schreibtischen. Von der Stadt sah ich die ganzen Monate kaum etwas. Jede einzelne Unterrichtsstunde, die wir abhielten, musste im Voraus schriftlich vorbereitet werden, das gehörte mit zur Ausbildung. Morgens stolperte ich müde der Schule entgegen. Es war nicht weit, ich ging den knappen Kilometer von unserer Wohnung zu Fuß. Im Winter hatte der Tag um halb acht noch gar nicht richtig begonnen, und doch war das Schulgebäude schon hell erleuchtet und erfüllt von Lachen, Übermut, Traurigkeit und Angst. Vermutlich habe ich in meinem ganzen Leben nie mehr so hart gearbeitet wie in diesem Jahr an der Käthe-Kollwitz-Schule.
Welche Texte ich im Unterricht behandelte, blieb weitgehend mir selbst überlassen. Lehrpläne existierten zwar, doch niemand bestand darauf, dass man sie sklavisch abarbeitete. Das kam mir entgegen. Ich wollte den Schülerinnen vermitteln, wie gegenwärtig Literatur sein konnte, und zog Rolf Dieter Brinkmanns einzigen, passenderweise zum Teil in Hannover spielenden Roman Keiner weiß mehr aus der Tasche. Das Buch war 1968 erschienen, Brinkmann selbst hatte damals von einem »Pop-Roman« gesprochen, und das war Keiner weiß mehr mit seinen vielen Anspielungen auf die Rockmusik und die zeitgenössische Mode auch. Aber noch viel mehr war es ein Ehe-Roman, der die alltäglichen Missverständnisse und die schmerzhaften Niederlagen beim Versuch zweier Menschen, miteinander auszukommen, nicht aussparte und vor Sex und Gewalt nicht verschämt die Augen niederschlug. Die Schülerinnen hatten damit kein Problem, manche Eltern dafür umso mehr. Ihnen war das Buch zu obszön. Sie liefen zur Schulleitung und schlugen Alarm. Direktor Ahlborn, ein CDU-Mann, bat mich zum Gespräch. Mein Ausbilder Doktor Meyer, seines Zeichens SPD-Mann, wurde gleich mit einbestellt:
»Kunze, mir sind da gewisse Dinge zu Ohren gekommen. Einige Eltern haben sich über Ihren Unterricht beschwert. Was machen Sie denn da?«
»Herr Direktor, ich behandle einen Roman der Gegenwartsliteratur, und mein Eindruck ist, dass die Klasse gut mit dem Buch zurechtkommt.«
»Sagen die Eltern die Wahrheit? Enthält der Roman unsittliche Stellen?«
»Ja, die gibt es tatsächlich.«
»Das geht aber nicht! Das können wir uns nicht leisten! Die Eltern machen mir ja die Hölle heiß!«
Doktor Meyer hatte die ganze Zeit still zugehört. Jetzt sah er den Moment für seinen Auftritt gekommen.
»Aber Herr Direktor Ahlborn, bei allem Respekt, wir lassen uns doch nicht von irgendwelchen dahergelaufenen Leuten vorschreiben, was wir hier veranstalten! Über unsere Unterrichtsinhalte entscheiden immer noch wir! Herr Kunze hat diesen Roman ausgewählt, ich habe das begleitet, und an seinem Unterricht gibt es nicht das Geringste auszusetzen. Wer sind wir denn, dass wir vor solchen Querschüssen in Deckung gehen!«
Der Direktor dachte einen Augenblick nach, dann straffte er sich.
»Stimmt, Herr Doktor Meyer, da haben Sie eigentlich recht. Machen Sie weiter, Kunze!«
Und so kam es, dass eine große Koalition aus CDU und SPD für Rolf Dieter Brinkmanns Keiner weiß mehr Partei ergriff. Noch Jahre später sprachen mich nach Konzerten ab und zu einige meiner ehemaligen Schülerinnen an. Keine hatte auch nur im Geringsten durch die Lektüre des Romans Schaden genommen.
Im Frühsommer 1980 saß ich vor dem Radio und hörte NDR. Ich war den Sendungen von Klaus Wellershaus verfallen, seit ich begonnen hatte, mich ernsthaft für Musik zu interessieren. Doch an diesem Tag kam es mir zum ersten Mal so vor, als würde sich Wellershaus wie in einer öffentlichen Durchsage an mich persönlich wenden. Er sprach von einem anstehenden Pop-Nachwuchsfestival der Deutschen Phonoakademie, von einer hochkarätig besetzten Jury und von Stipendien, Preisen und sogar Plattenverträgen, die winkten. Die Endausscheidung werde an drei aufeinanderfolgenden November-Tagen im Würzburger Stadttheater stattfinden. Also schickt eure Kassetten, sagte Wellershaus, aber denkt daran: Kein Beitrag darf länger als fünfzehn Minuten sein. Und weiter ging es mit Musik.
Ich starrte das Radio an. Ein Nachwuchsfestival! Auf so eine Idee war ich in all der Zeit gar nicht gekommen. Aber war es nicht sowieso schon viel zu spät, sich noch einmal Hoffnungen zu machen? Eigentlich hatte ich doch den Traum, mein Leben der Musik zu widmen, nie richtig zu träumen gewagt. Alles stand schon fest, so wie immer alles in meinem Leben schon festgestanden hatte. Die Zukunft würde nichts als die Fortsetzung der Gegenwart sein. Meine Wege würden nicht erst beim Gehen entstehen, sondern schon ausgeschilderte sein, wohin ich auch kam.
Aber Wellershaus hatte so überzeugend und auch so ermutigend geklungen. Mit seinem Hinweis auf das Festival hatte er unversehens eine Tür geöffnet, die ich nicht einfach wieder zufallen lassen konnte, ohne zumindest probiert zu haben, hindurchzugehen. Alleine würde mir das jedoch nicht gelingen. Ich rief Mick an, er war sofort bei der Sache. Seine Unbekümmertheit sprang auf mich über. Was konnten wir schon verlieren? Bei Mick nahmen wir zwei meiner Songs auf, beide hatten so viel zu erzählen, dass ein dritter den vorgegebenen Zeitrahmen gesprengt hätte. Als ich die Kassette zur Post brachte, war ich mit mir selbst im Reinen. Wir hatten unser Bestes gegeben, mehr konnten wir nicht tun. Außer zu warten.
Die Einladung nach Würzburg kam per Telegramm. Mick und ich waren für die Endausscheidung im Bereich ›Folk-Lied-Song‹ ausgewählt worden. Daneben gab es auch noch die Bereiche ›Rock‹ und ›Jazz‹, insgesamt hatten sich, so hörte man, mehrere hundert Solisten und Bands beworben.
Als wir am 9. November 1980 im Stadttheater ankamen, platzten wir mitten in den Aufbau einer anderen Band. Beinahe konnte man meinen, Pink Floyd hätten sich nach Würzburg verirrt. Angesichts der Keyboard-Türme, Gongs und Marshall-Stacks kamen wir uns mit unseren beiden Wandergitarren wie eine Abordnung der lokalen Pfadfindergruppe vor. Wie ich später von meinem ersten Bassisten Joshi Kappl erfuhr, stammten die Musiker von Transsylvania Phoenix ursprünglich aus Rumänien, waren aber in einer spektakulären Aktion in den Westen geflohen, weil sie die Restriktionen durch das Ceaușescu-Regime nicht mehr ausgehalten hatten. Doch sie mussten schnell erkennen, dass ihr auf Englisch vorgetragener, mit Folk-Elementen versetzter Prog-Rock, mit dem sie in Rumänien Stadien gefüllt hatten, in den Zeiten von New Wave und Punk antiquiert wirkte. Sie waren zu spät gekommen. Nun versuchten sie ihr Glück beim Nachwuchswettbewerb, jedoch ohne Joshi Kappl, der fürs Erste bei der Band ausgestiegen war. Wir sollten uns erst ein paar Wochen später über den Weg laufen, dann aber für viele Jahre gemeinsam tätig sein.
Für alles auf Deutsch Gesungene abseits des wie eh und je populären Schlagers standen Ende 1980 die Sterne dagegen günstig. So günstig wie vielleicht noch nie. Angesichts der sich aufbauenden Neuen Deutschen Welle lag bei den Plattenfirmen Goldgräberstimmung in der Luft. Eine mehr oder weniger freundliche Übernahme des musikalischen Untergrunds durch die Industrie stand unmittelbar bevor. Doch noch passten unter den Oberbegriff ›NDW‹ jede Menge Widersprüche: Coolness und Weltschmerz aus grauer Städte Mauern; Neo-Schlager und Zackig-Dadaistisches. Auf einmal gab es nicht mehr nur die Liedermacher oder Rock-Einzeltäter wie Udo Lindenberg und Ton Steine Scherben. Sondern auch Bands wie Fehlfarben, Ideal und DAF, deren erste Platten mich elektrisiert hatten. Dass ich zumindest indirekt einmal von ihren Pioniertaten profitieren würde, wäre mir jedoch nie in den Sinn gekommen. Aber genau so war es. Die Zeit war reif für sperrige deutsche Texte. Der Zufall hatte mich zur richtigen Zeit an den richtigen Ort geführt.
Unsere ›Folk-Lied-Song‹-Mitbewerber in Würzburg hielten der Tradition noch unverbrüchlich die Treue. Ihre Stücke hießen »Flieg, Vogel, flieg« oder »Mit dir zu fliegen«. Die inzwischen längst international bekannte, sogar Grammy-nominierte Cellistin Anja Lechner stimmte zusammen mit dem Pianisten Peter Ludwig ein seltsames Duett namens »Kieselsteine« an: »Ich möchte gern ein Kieselstein in deinem Bachbett sein …«. Eine Band hieß Fundevogel, eine andere Bundschuh. Mit derlei Empfindsamkeit konnte ich nicht dienen. Zwar hätte Mick mit seinen Ketten, seiner Weste über dem weiten weißen Hemd und seinem Vollbart problemlos in jeden Folk-Club gepasst. Aber mein Outfit wäre dort definitiv fehl am Platz gewesen. Ich wollte so aussehen wie Robert Fripp von King Crimson, nachdem er sich die Haare abgeschnitten hatte. Akkurater Scheitel, weißes Hemd, weiße Jeans, rote Chucks, und meine Kassengestell-verdächtige Brille trug ich ja ohnehin. Dazu wählte ich eine schwarze Krawatte. Leider hatte ich übersehen, dass das Fripp’sche Modell schmal geschnitten und aus Leder war. Ich hingegen betrat die Bühne mit einer ganz breiten, mir heute noch peinlichen Konfirmationskrawatte.
Durch den Abend führte Bill Ramsey. Ein freundlicher, jedem Auftretenden Mut zusprechender Mann, den man wohl für immer mit seinen Schlagern aus den sechziger Jahren verbinden würde, obwohl seine ganze Liebe dem Jazz gehörte. Ramsey sagte uns an, Mick und ich nahmen Platz auf zwei Barhockern, und unsere Viertelstunde begann. Wie auf der eingeschickten Kassette legten wir los mit »Balkonfrühstück«. Das Lied kann einen auf dem falschen Fuß erwischen, und genau das war mein Plan. Wer aufgrund des Titels und der beschwingten Melodie die Beschreibung eines Idylls erwartet, wird nicht glücklich werden. »Balkonfrühstück« ist ein Reiseführer in die seltsame Welt der Stadtränder, Reihenhäuser und Industriebrachen. Deutlich mehr »Highway 61« als ein Bild von Manet. Geschrieben hatte ich das Stück in einem Vorort von Nürnberg, genauer gesagt in Nürnberg-Langwasser, ein Freund wohnte da, den ich von der Studienstiftung kannte. Gila und ich hatten ihn über Ostern besucht, und ich war so fasziniert gewesen von seinen Trabantenstadt-Erzählungen, dass ich mir Notizen gemacht hatte. Wieder daheim, musste ich ihnen nur noch eine zusätzliche Drehung ins Absurde geben, und fertig war das Sittenbild eines Pfingstmontags im »Gewerbegebiet Nürnberg-Süd«, beschädigtes Leben und Geschichtsvergessenheit in unmenschlicher Architektur inklusive. Wie erhofft gefiel dem Würzburger Publikum der lokale Bezug. Ich hörte es lachen bei der Zeile »Wenn du dich anstrengst, kannst du durch den Frankensmog ein bisschen Sonne sehn« – da wusste ich, dass wir auf das richtige Pferd gesetzt hatten.
Viele Jahre später erfuhr ich, dass »Balkonfrühstück« sogar bis in die bayerische Staatskanzlei vorgedrungen war. Bei einer Ausstellungseröffnung in München sprach mich der aus Franken stammende Ministerpräsident Günther Beckstein an:
»Herr Kunze, wenn ich mich nicht täusche, waren Sie es doch, der vor langer Zeit mal ein Lied über Nürnberg geschrieben hat, oder?«
»Ja, das stimmt, Herr Ministerpräsident.«
Dass mich Beckstein überhaupt registrierte, war schon bemerkenswert. Dass er aber auch noch eines meiner frühesten Stücke kannte, überraschte mich vollends.
»Aber ich muss Ihnen ehrlicherweise sagen, dass das Lied von einem unglaublich öden Stadtteil handelt. Von einem Gewerbegebiet, in dem sich nicht einmal mehr Fuchs und Hase Gute Nacht sagen, weil sie längst das Weite gesucht haben.«
Günther Beckstein lächelte gequält. Er sah aus, als sei ihm jemand auf die Füße getreten.
»Ich weiß«, sagte er. »Ich wohne da.«
»Balkonfrühstück« erhielt starken Beifall. Aber ich wusste, das würde noch nicht reichen. Wollte ich gewinnen, musste ich das Beste zeigen, was ich zu bieten hatte. Ich setzte mich ans Klavier. Ein langes instrumentales Vorspiel ließ eine getragene Folknummer erwarten. Erst nach eineinhalb Minuten nahm das Lied Fahrt auf, und ich begann zu singen: »Es gab mal Zeiten, wo die Brüste unsrer Mädchen / noch kein Geheimnis waren, kein Privatbesitz …«.
Ich wusste, dass »Bestandsaufnahme« kein Stück ist, das die Arme ausbreitet und in das man sich Hals über Kopf verlieben kann. Dafür ist es zu schneidend, zu bitter auch. Ein Lied der Midlife-Crisis, der müden Weltabsage und des Sich-Einrichtens in der Gewöhnlichkeit. Das ›Wir‹, das in ihm laut wird, hat mit allem abgeschlossen, mit der Jugend, dem Rock ’n’ Roll, dem Sex und mit der Politik erst recht. Die Strafe für die umfassende Resignation wird vollzogen durch stumpfes Ableben, manchmal helfen Schmerztabletten dabei, schneller einzuschlafen. Kafkas Schloss im Schnee würde niemals mehr gefunden werden.
»Bestandsaufnahme« ist Rollenlyrik. Ich leihe einer Gruppe von Menschen eine Stimme und lasse sie reden – auch auf die Gefahr hin, dass der Hörer das Spiel nicht durchschaut und das Lied als Bericht aus meinem Leben missversteht. Wozu ich ihn zumindest in diesem Fall auch ein wenig einlade, denn »Bestandsaufnahme« endet mit den Zeilen: »Wir lauschen auf das Ticken unserer Herzen / in denen DREIUNDZWANZIG vor dem Komma steht.« Mit dreiundzwanzig hatte ich das Lied in meinem Kellerzimmer im Osnabrücker Wohnhaus meiner Eltern geschrieben, nicht einmal eine Stunde hatte das gedauert. Dagegen stehen die vierzig Jahre, die ich es nun schon im Programm habe. Irgendwann bin ich dazu übergegangen, die Altersangabe am Ende auf den jeweils gerade aktuellen Stand zu bringen. Das hat sich offensichtlich herumgesprochen, denn inzwischen merke ich, wie die Leute im Saal die Ohren spitzen und auf die entscheidende Stelle richtiggehend lauern: Wie alt ist der eigentlich mittlerweile? Pass auf, gleich singt er’s, gleich singt er’s!
Nach »Bestandsaufnahme« gab es kein Halten mehr. Das Würzburger Publikum schien geradezu zu explodieren. Sogar Bravorufe waren zu hören. Ich murmelte mein »Danke schön!« ins Mikrofon und sah aus den Augenwinkeln, wie in den ersten Reihen Hektik ausbrach. Ich wusste, dass dort die Leute saßen, auf die es ankam und auf die jeder der Auftretenden letztlich hoffte: die Einkäufer der Plattenfirmen. Männer in Anzügen eilten zum Bühnenrand und schauten mir erwartungsvoll entgegen. Der Erste, der mich erwischte, war Ralph Siegel: »Kommen Sie morgen in mein Hotel, wir müssen zusammen frühstücken!«
Ich wusste zwar, dass Siegel eine Plattenfirma betrieb, bei der auch Rockmusik erschienen war, dennoch verblüffte mich sein Angebot. In erster Linie galt er als Komponist und Produzent von Schlagern. Erst vor wenigen Monaten hatte Katja Ebstein mit einem seiner Titel den zweiten Platz beim Grand Prix errungen. Ich stellte mir besser nicht vor, wie Mick und ich eine Showtreppe herunterkamen, flankiert von Balletttänzerinnen. Aber er war freundlich, und ich sagte zu. Frühstück mit Ralph Siegel. Warum nicht.
Killy Kumberger schüttelte meine Hand als Zweiter. Er kam von der WEA, dem deutschen Ableger von Warner Music. Eigentlich wollte er nur sichergehen, dass ich später noch in der Würzburger Kneipe anzutreffen sein würde, die als zentraler Treffpunkt für alle Künstler auserkoren worden war. »Denn mein Chef möchte mit Ihnen reden«, meinte Kumberger. »Dringend.« Und weg war er.
Die Nächsten warteten schon. Vertreter der RCA, der Polydor, der CBS. Hier ist meine Karte, bitte melden Sie sich unbedingt bei uns, lassen sie uns in Kontakt bleiben, wir haben großes Interesse an Ihnen. Nach meinem allerersten wirklich ernstzunehmenden Auftritt hatten mir fünf der größten Plattenfirmen Deutschlands mehr als deutlich zu verstehen gegeben, dass sie an der Veröffentlichung meiner Lieder interessiert waren. Es war wie erfunden.
Hilfesuchend schaute ich mich nach Mick um. Er hatte sich im Hintergrund gehalten und sich seinen eigenen Reim auf den Rummel gemacht. Seine Erfahrungen mit der Plattenindustrie zahlten sich nun aus. Er wusste, was zu tun war. Vor allem: ruhig bleiben. »Sag bloß nicht gleich irgendwo zu! Wir genießen den Abend, hören uns an, was man uns anbietet, und wenn wir wieder daheim sind, rufe ich Alfred Schacht an, meinen Verleger aus Hamburg. Mit dem machen wir einen Verlagsvertrag, und der handelt das dann alles für uns aus.« – Eine gute Entscheidung.
Beinahe war der eigentliche Anlass des Abends in den Hintergrund geraten. Dabei war die Jury des Nachwuchswettbewerbs prominent besetzt. Neben Leuten vom Rundfunk gehörten ihr auch die Jazzmusiker Peter Herbolzheimer und Albert Mangelsdorff an, der Texter Michael Kunze, die Folksängerin Joana, der Komponist Christian Bruhn und – Peter Maffay. Die Beratung fand hinter verschlossenen Türen statt. Als sie sich wieder öffneten, stand fest, dass man mich zu einem der drei Gewinner ausgerufen hatte. Ich war benommen und ging mit Anja Lechner, Peter Ludwig und dem französischen Gitarristen Biréli Lagrène noch einmal auf die Bühne, um mich zu bedanken. Dass mit dem Preis auch ein Stipendium der Deutschen Phono-Akademie in Höhe von 2500 DM verbunden war, bekam ich, wenn überhaupt, nur am Rande mit. Der ganze Abend überstieg mein Fassungsvermögen um ein Vielfaches.
Nur langsam setzte der Rausch des Sieges ein, doch gerade rechtzeitig, um die ausgelassene Stimmung der Party danach genießen zu können. Bei der ›Kneipe‹ handelte es sich um einen angenehm verrauchten Ritterkeller. Der Andrang war enorm. Wenn man nicht aufpasste, stieß man sich den Kopf an den Rüstungen, Hellebarden und sonstigen Lanzen, die überall an den grob gemauerten Steinwänden hingen. Ein blonder, braungebrannter Mann stellte sich mir in den Weg. Er sah aus wie eine Mischung aus Robert Redford und Hardy Krüger. Vielleicht fiel mir deshalb zu seinem Grinsen unmittelbar das Wort ›kalifornisch‹ ein. Begrüßt wurde ich mit einer Stimme, der man anhörte, dass sie schon viele und vor allem erfolgreiche Verhandlungen geführt hatte:
»Ich grüße Sie, mein Name ist Siegfried Loch.«
»Ich grüße Sie auch. Mein Name ist Heinz Rudolf Kunze.«
Dann ließ ich ihn stehen und sah mich nach der Theke um. Ich hatte Durst. Mick war bleich geworden. Hastig zog er mich auf die Seite.
»Bist du wahnsinnig geworden? Weißt du überhaupt, wer das ist?«
»Nein, keine Ahnung.«
»Das ist Siegfried Loch, der Chef der WEA, einer der wichtigsten Leute in der gesamten Branche! Normalerweise fallen alle vor dem auf die Knie!«
Ich hatte den Mann, der nur kurze Zeit später mein Leben für immer verändern sollte, tatsächlich nicht erkannt. Bis heute dürfte Loch nur äußerst selten eine derartige Abfuhr erfahren haben, wenn sie auch in meinem Fall aus purer Unwissenheit geschehen war. Denn Mick hatte ja recht. Siegfried Loch war eine Legende. Ein Selfmademan, für den Musik immer ein anderes Wort für Freiheit geblieben war. Er fand diese Freiheit im Jazz, aber auch im Rock ’n’ Roll der frühen Tage, wie man ihn im Star-Club auf der Reeperbahn hören konnte. Loch war erst Handelsreisender in Sachen Schallplatten gewesen, dann sorgte er als Produzent und schließlich als Chef der WEA dafür, dass andere welche aufnehmen konnten. Sein Adressbuch war so dick wie ein Lexikon, seine Trefferquote legendär. Nicht nur Klaus Doldinger, Al Jarreau, Marius Müller-Westernhagen oder Ideal wussten, was sie ihm zu verdanken hatten. Auch der ahnungslose Parzival aus dem Ritterkeller würde es sehr bald schon ganz genau wissen.
Noch etwas verkatert, betraten wir am nächsten Morgen den Frühstücksraum von Ralph Siegels Hotel. Leise wies mich Mick darauf hin, dass Bernd Meinunger, Siegels Mann fürs gesungene Wort, mit am Tisch saß. Das kam mir verdächtig vor. Wer auch immer versuchen würde, mir in meine Songtexte hineinzureden, er würde auf Granit beißen. Mein Misstrauen war geweckt und verschwand auch nicht mehr. Ich wusste, dass Siegel und ich nicht miteinander ins Geschäft kommen würden. Trotzdem gingen wir freundlich auseinander. Bis heute haben wir ein gutes Verhältnis, ein sehr viel besseres, als viele vielleicht meinen, weil sie nur auf das starren, was uns unterscheidet.
Die Ereignisse in Würzburg stürzten mich in ein Gefühlschaos. Einerseits spürte ich eine tiefe Genugtuung, denn meine Träume hatten den Realitätstest bestanden. Ich hatte mir all die Jahre nicht nur etwas vorgemacht, als ich von der Qualität meiner Lieder überzeugt gewesen war. Andererseits merkte ich aber auch, wie schwer es mir fiel, wieder in den Alltag zurückzukehren und mich den Menschen, die mir am nächsten standen, mitzuteilen. Gila hörte sich meinen Bericht an, dann schwieg sie erst einmal. Vermutlich ahnte sie die Tragweite schon mehr, als ich selbst es vermochte. Im Gesicht meiner Mutter las ich Besorgnis und die bange Frage: Was soll nun werden? Nur mein Vater war hellauf begeistert. Verkappter Entertainer, der er nun einmal war, drückte er mir voller Überzeugung die Daumen. Vielleicht würde ja doch noch jemand aus der Familie vor ein Mikrofon oder eine Kamera treten, um die Leute zu unterhalten.
Aber eigentlich hatte ich dafür überhaupt keine Zeit. Die praktischen Prüfungen für das Lehramt standen schon vor der Tür. Ich hatte nicht vor, sie in den Sand zu setzen, und wusste, dass die Vorbereitung meine ganze Konzentration beanspruchen würde. Micks Anruf eine Woche nach unserem Sieg in Würzburg warf mich daher völlig aus der Bahn.
»Du musst am Wochenende nach Hamburg kommen! Ich habe uns ein Studio besorgt und eine Band. Wir müssen den Plattenfirmen schließlich irgendwas anbieten können. Die wollen wissen, wie wir uns das erste Album vorstellen. Wir brauchen Demos!«
Das war zu viel. Ich verlor die Nerven und hätte am liebsten alles abgeblasen, mir die Decke über den Kopf gezogen und geschlafen, bis sich niemand mehr für mich interessierte. Lange konnte das ja nicht dauern. Es brauchte schon Gilas und Micks ganze Überredungskunst, um die Dinge wieder in freundlicherem Licht sehen zu können. Sie blieben hartnäckig, weil sie wussten, dass ich es recht bald schon bitter bereuen würde, eine solche Chance ausgeschlagen zu haben.
Mick hatte eine gute Band zusammengestellt. Er war kein Risiko eingegangen, sondern hatte auf Leute gesetzt, denen er vertraute. Das galt für den Falckenstein-Schlagzeuger Joachim Luhrmann ebenso wie für den Keyboarder Hendrik Schaper, mit dem wiederum Luhrmann in der Prog-Rock-Band Tetragon zusammengespielt hatte. Den Bass würde der Exil-Rumäne Joshi Kappl bedienen, dessen ehemalige Band Transsylvania Phoenix mir gerade erst in Würzburg aufgefallen war.
Das Studio gehörte Alfred Schacht, Micks Verleger. Bald wurde er auch meiner. Wir nahmen fünf Songs auf, das fertige Demo-Band würde unsere Visitenkarte bei den Plattenfirmen sein. Mit ihnen zu verhandeln überließen wir Alfred Schacht. Am Ende waren drei Bewerber übriggeblieben: die Polydor, die RCA und die WEA. Schacht wog ab.
»Wenn ich mir das alles recht überlege – die WEA ist jung und bissig, die wollen noch hoch hinaus. Und ehrlich gesagt, hätten Sie dort auch den besten Chef. Gehen Sie dahin.«
Der Chef, das war Siegfried Loch. Mein Chef, mein Sepp Herberger, mein Entdecker. Jemanden wie ihn hatte ich noch nicht getroffen. Es gab solche Menschen nicht an Schulen oder Universitäten, wo letztlich alles Gerede und Theorie und Papier war, Berge von Papier, die jahrelang den Staub fingen, bis sich ein Hausbote endlich erbarmte und kopfschüttelnd alles in den Müll warf. Siegfried Loch hielt sich nicht mit Theorien auf. Er verschanzte sich auch nicht hinter seinem Schreibtisch. Er ging lieber mit Lust und ohne Hemmungen ins Risiko. Was er sagte, wurde wahr, wurde Tat, wurde ein Produkt, das jeder nur wenig später im Laden kaufen konnte. Und so jemand wollte ausgerechnet mich an seinem Hof haben.
Ganz leicht machte ich es ihm jedoch nicht. In einer Mischung aus Naivität, Frechheit und einem tiefen Bedürfnis nach Absicherung legte ich erst am Ende der Verhandlungen meine Karten wirklich auf den Tisch:
»Ja, ich gebe mein Leben gern in Ihre Hände. Aber dann will ich auch, dass Sie für mich sorgen. Ich komme nur zu Ihnen, wenn ich jeden Monat ein Studienratsgehalt bekomme, das ich nicht zurückzahlen muss, egal, wie viele Platten ich verkaufe. Denn dieses Geld könnte ich in Osnabrück an meiner Schule verdienen.«
Ich sah, dass Loch Mühe hatte, die Fassung zu bewahren. Ihm blieb kurz die Luft weg. Für gewöhnlich warfen sich die Musiker vor ihm in den Staub. Aber dann sagte er:
»Okay. Das können wir ja mal probieren.«
Es war der Beginn einer wunderbaren Zusammenarbeit und einer Freundschaft, die nie endete. Siegfried Loch hat mich im letzten Moment aus einem bereits vollständig durchgeplanten Leben herausgeholt. Er hat mir gezeigt, dass auch für mich ein Ort existierte, an den ich ganz und gar gehörte. Dass ich es schaffen konnte, mit mehr Wagnis zu leben, als ich es mir in meinen kühnsten Träumen ausgemalt hatte.
Hermann Kant hat einmal gesagt, Literatur sei ein anderes Wort für Ausweg. Meiner war die Musik – und über diesen Umweg dann auch die Literatur. Siegfried Loch gab mir alle Freiheiten und ließ mich meinen Krieg selbst aussuchen. Aber gleichzeitig machte er mir klar, dass ich diesen Krieg dann auch gewinnen musste, wenn ich nicht nur von den Gewinnen anderer leben wollte, von den Rod Stewarts und AC/DCs dieser Welt.
Als absoluter Nobody erhielt ich einen Fünfjahresvertrag, und der Ritt über den Bodensee begann. Kurz bevor der Vertrag zum ersten Mal auslief, 1985, erschien »Dein ist mein ganzes Herz«, und ich konnte das Vertrauen, das Siegfried Loch in mich investiert hatte, zurückzahlen. Das Eis hatte gehalten.
Es hält bis heute.
Meine Abiturientinnen an der Käthe-Kollwitz-Schule machten es mir leicht. Ein Referendar mit Plattenvertrag, das war ja fast schon so etwas wie ein Popstar. Sie zeigten sich von ihrer besten Seite und trugen mich auf Händen durch das praktische Examen. Danach war es höchste Zeit, mir den verbleibenden Rest Kreide von den Klamotten zu klopfen und den letzten Tafelaufschrieb wegzuwischen. In Zukunft würden die jungen Leute nicht mehr gezwungen sein, mir morgens um acht in der Schule zuzuhören. Sondern würden hoffentlich abends um acht freiwillig zu mir ins Konzert kommen. Doktor Meyer, mein Ausbilder, bedauerte, dass es mich ins Ungewisse zog. »Schade«, meinte er, »wir hätten Sie gerne behalten, Sie hätten sofort hier anfangen können.« Er seufzte. »Na gut, dann gehen Sie mit Gott. Aber tun Sie mir bitte einen Gefallen: Enden Sie nicht wie Elvis.«
Ich wäre nicht gerne Lehrer geworden. Wahrscheinlich hätte ich wie einige meiner Mitschüler, die sich fürs Lehrer-Sein entschieden haben, recht schnell jeglichen Enthusiasmus verloren. Wenn ich später einem von ihnen zufällig begegnete und ihm zuhörte, wie er von Schülern erzählte, denen er täglich Zuversicht verkaufen musste, obwohl sie längst begriffen hatten, dass nicht das große, tolle Leben auf sie warten würde, dann war ich dankbar, meinem erlernten Beruf entkommen zu sein. Aus diesem Gefühl der Dankbarkeit heraus schrieb ich zu Beginn der achtziger Jahre das Lied »Ruf mal wieder an«. Ein abendliches Telefonat mit einem melancholischen Junglehrer, der sich nichts sehnlicher wünscht, als am nächsten Morgen pensioniert aufzuwachen. Ich schaffte es, im Text das Wort »Verbeamtungsprüfung« unterzubringen, ohne dass es wie ein Fremdkörper wirkt. An den Spitzenreiter in dieser Disziplin reichte das dennoch nicht heran. Dafür hatte mein späterer guter Freund Reinhard Mey mit der »Luftaufsichtsbaracke« aus »Über den Wolken« die Latte einfach zu hoch gelegt.
Ich bestand die letzten Prüfungen an der Uni, dann fuhr ich nach Hamburg, um meine erste LP aufzunehmen. Keine Atempause. Die WEA hatte das Rüssl-Studio im Stadtteil Eidelstedt ausgesucht, es gehörte Otto Waalkes. Otto hatte sein Geld gut investiert und sich mit der Zeit ein wahres Rüssl-Imperium aufgebaut, zu dem auch noch ein Musikverlag, ein Plattenlabel und sogar ein mobiles Aufnahmestudio für Konzertmitschnitte gehörten. Während unserer Aufnahmen grüßte der Ottifant von allen Wänden, auch der Hausherr selbst ließ sich gelegentlich blicken, setzte sich zu uns, aber nur, um sofort wieder aufzuspringen, weiterzuhasten, zu telefonieren oder sonst irgendwelche Dinge zu regeln. Meist sahen wir nur seine wehenden blonden Haare. Quecksilber in Bewegung.
Ottos ehemaliger Mitbewohner aus der Villa Kunterbunt in Winterhude hatte mehr Sitzfleisch. Udo Lindenberg kam gleich mehrmals im Studio vorbei, nicht nur, um Billard zu spielen. Manchmal legte er sich auf die Couch und hörte uns blutigen Anfängern ein wenig zu. Höflich fragte er davor jedes Mal um Erlaubnis. Wir begegneten einem freundlichen, eher zurückhaltenden Mann, der es erst gar nicht zuließ, dass man sich in seiner Gegenwart gehemmt oder eingeschüchtert fühlte. Sein Interesse an dem, was wir taten, war echt, und was er zu unserer Musik sagte, vor allem zum Schlagzeug, hatte Hand und Fuß. Das war der andere Udo Lindenberg, der ohne Hut und Brille, ohne Udo-Slang, Udo-Gesten, Udo-Lebenswerk. Der, den die Öffentlichkeit kaum kannte, aber den zu erleben ich über die Jahre dann mehrere Male das durchaus aufwühlende Vergnügen haben würde, bei ausgeschalteten Kameras und Mikrofonen, in leisen Vieraugengesprächen. Dann zeigte sich Udo jedes Mal wie ohne Haut, fast lebensgefährlich verunsicherbar, und ich merkte, dass er den Gürtel, auf dem in großen Buchstaben ›Panik‹ stand, nicht grundlos trug.
Udo hatte mir und zahllosen anderen Kollegen vorgemacht, dass es tatsächlich möglich war, die kantige, knirschende, konsonantenreiche deutsche Sprache mit der biegsamen, vieldeutigen, groovenden Musik der Leute aus Liverpool und Memphis zu versöhnen. Dass so was ging. Vielleicht konnte ich mit einigen meiner Lieder sogar zeigen, dass es lief.
Für die Nachsicht, mit der er meine ersten, noch tapsigen Gehversuche begleitet hatte, konnte ich mich 1994 ganz offiziell bedanken. Zu einem Tribut-Album mit Udo-Songs steuerte ich die Liner Notes bei und eine Hochdruck-Version von »Odyssee«. Dass es die letzte Aufnahme vor der Trennung von meiner langjährigen Band sein würde, war zumindest schon zu ahnen. Ich sang Udos Worte vom klemmenden Kompass, vom Verlieren der Richtung und vom dichten Nebel, in dem die Zukunft lag, und kommentierte damit eigentlich auch unsere Situation als Band. Aber wir schafften es, noch einmal dem heraufziehenden Unwetter zu trotzen, ehe alles auseinanderflog. Udo gefiel unsere Fassung so gut, dass er sie an den Anfang des Albums stellte.
Ursprünglich hatte ich vorgehabt, im Rüssl-Studio mit den Musikern zu arbeiten, die auch schon bei der Aufnahme der Demos mit von der Partie gewesen waren. Hendrik Schaper, Joachim Luhrmann, Joshi Kappl. Und Mick natürlich, der zudem als Produzent vorgesehen war. Siegfried Loch sah das ein bisschen anders. Er mache mir gegenüber keinen Hehl daraus, dass er Mick die Produktion der Platte nicht zutraute. Er wollte jemanden mit wirklicher Erfahrung und einem höheren Bekanntheitsgrad. Er wollte einen Namen, der aufhorchen ließ und dem ganzen Unternehmen ein wenig mehr Glanz verlieh. Wie nicht anders zu erwarten, wurde er fündig. Klaus Voormann hatte nach Jahren in Los Angeles genug von der ewigen Sonne und war dabei, seine Zelte wieder in Hamburg aufzuschlagen. Loch wollte ihn mit der Produktion meiner Platte betrauen. »Voormann kann bei der Gelegenheit ja auch gleich seinen Bass mitbringen«, sagte er.
Gerade mal ein Vierteljahr war es her, dass ein durchgeknallter Fan John Lennon in New York erschossen hatte. Damals hatte ich die Nachricht im Radio gehört, und mir war im wahrsten Sinne des Wortes der Stift aus der Hand gefallen. Fürs Erste konnten mir alle Prüfungen gestohlen bleiben. Wie nahe mir Lennons Tod ging, zeigte wohl am besten Elke Bunnings Reaktion, als sie an jenem traurigen Dezembertag in mein Gesicht sah. Sie erschrak regelrecht.
Und nun sollte Lennons Freund Klaus Voormann, den alle nur den ›fünften Beatle‹ nannten, mein Produzent werden. Ich fühlte mich, als hätte man mich nachträglich in die von Voormann gestaltete Collage auf dem Revolver-Cover eingefügt. Ein langer Zug ikonischer Bilder setzte sich in mir in Bewegung, die ersten davon noch in Schwarz-Weiß, darauf ein paar junge Männer aus Liverpool im Nachkriegsdeutschland, auf dem Hamburger Dom, auf einem Güterwagen mit der Aufschrift »Hugo Haase Hannover«, sie sind zu fünft, Pete Best ist noch dabei und Stuart Sutcliffe noch am Leben, sie tragen Lederjacken und spitze Schuhe, und fotografiert werden sie von Astrid Kirchherr, Voormanns bester Freundin. Später dann, längst in Farbe, Voormann als Bassist auf der Bühne, in Toronto bei Lennons »Live Peace«-Gig, im Madison Square Garden bei Harrisons »Concert for Bangladesh«. Aber vor allem war Voormann der Bassist gewesen auf Plastic Ono Band, dem ersten Lennon-Soloalbum, das uns nackter als nackt mit Seelenschürfwunden-Songs das Ende des Traums verkündet und uns ins Weitermachen auf eigene Faust und Rechnung entlassen hatte. Die Vorwegnahme von Punk um mehr als fünf Jahre – und gleichzeitig schon sein einzig gültiger Schlussstein.
Klaus Voormann kam und entpuppte sich als gelassener, überaus zuvorkommender Hippie mit schon grauem Haar. Er roch den Braten schnell und hatte schon zu viel erlebt, um sich noch in Positionskämpfe verwickeln zu lassen. Zwar hatte Loch ihn als Produzenten geholt, aber wenn Mick das Feld nicht räumen wollte, und das wollte Mick auf keinen Fall, dann ließ Voormann ihn eben gewähren und spielte nur Bass. Kein Thema. Ungünstig nur, dass er ganz offensichtlich die Saiten seines Basses seit den Aufnahmen zu »Imagine« nicht mehr allzu oft gewechselt hatte. Wir sahen staunend, wie verrostet sie waren, und Thomas Kuckuck, der Toningenieur im Rüssl-Studio, musste die Regler schon ganz aufreißen, um überhaupt ein Bass-Signal empfangen zu können. So leise spielte Voormann, so wenig Druck übte er aus. Einige Spuren waren beim besten Willen nicht zu gebrauchen, und es war eine Fügung des Schicksals, dass eines Tages Joshi Kappl aus einem anderen Grund im Rüssl-Studio zu tun hatte. Wir behielten ihn gleich da. Für das Reparieren der Spuren brauchte er nur wenige Stunden.
Mein Glücksgefühl hielt sich trotzdem hartnäckig. Ich nahm mein Debütalbum auf, Klaus Voormann spielte auf einigen Stücken Bass, Otto Waalkes und Udo Lindenberg saßen im Aufnahmeraum und hörten zu! Eigentlich, so war ich mir sicher, war ich damit bereits ganz oben angelangt. Was sollte denn jetzt noch kommen?
Manche der Stücke, die wir aufnahmen, hatte ich bereits vor einigen Jahren geschrieben, mit siebzehn oder achtzehn, damals hatte ich noch bei meinen Eltern gewohnt. Den alten Satz, wonach man für seine erste Platte ein halbes Leben Zeit hat, für die nächste aber nur ein Jahr, würde ich sicher nicht unterschreiben. Der in der Vergangenheit angelegte Vorrat an mir relevant erscheinenden Liedern war dafür einfach zu groß. Musikalisch bewegte sich die Platte zum allergrößten Teil innerhalb der Grenzen, die man für gewöhnlich einem Liedermacher zugestand. Sie klang nach Akustikgitarre und Klavier. Zu mehr als schüchternen Ausflügen ins Laute reichte es noch nicht, und auch die Flirts mit der Neuen Deutschen Welle blieben so dezent, dass man sie kaum bemerkte.
Anders verhielt es sich mit den Texten. Auf der Burg Waldeck würde man mit ihnen von der Bühne gejagt werden. Vorsichtshalber ließ ich einen Satz des rumänischen Philosophen Emil Cioran als Gebrauchsanweisung auf die Plattenhülle drucken: »Man kann jede Wahrheit ertragen, sei sie noch so zerstörerisch, sofern sie für alles steht und so viel Vitalität in sich trägt wie die Hoffnung, die sie ersetzt hat.« Ich wusste, dass einige von mir hochgeschätzte Kollegen aus Österreich ähnliche Exkursionen ins Düstere, Böse, Sarkastische, Morbide unternahmen. Bei Georg Danzer oder Ludwig Hirsch verhinderte jedoch ihr Schmäh, dass der Hörer völlig in den Abgrund stürzte. Der Schrecken kam stets mit ein wenig Schlagobers verziert daher. Bei den Preußen gab es das nicht. Die Wahrheit wurde pur serviert.
Schon immer war es meine Überzeugung, dass man kein wildes Leben führen muss, um wilde Texte schreiben zu können. Wer alles auskostet bis zur Neige und sich verschwendet ohne Halt, hat es nicht mehr nötig, auf dem Papier verrückt zu spielen. Oder kommt erst gar nicht dazu, sich an den Schreibtisch zu setzen. In meinen Texten wimmelt es geradezu vor Menschen, die seltsame Dinge denken, sagen und tun. In meinem Kopf ist die Hölle los, aber privat pflege ich meine Unauffälligkeit und will eigentlich nur meine Ruhe haben. Einmal fragte ich Randy Newman, warum er in seinen Interviews so oft betone, ein ganz und gar normaler Mensch zu sein. Er lachte.
»Weil meine Songs so verrückt sind! Sie hören sich nicht an, als könnte ich sie geschrieben haben. Wenn meine Nachbarn ein Album von mir hören, sind sie ziemlich geschockt.«
Von Newman habe ich gelernt, dass es absolut okay ist, hinter seinen eigenen Texten zu verschwinden und sich aus ihnen, so gut es eben geht, herauszuhalten. Ich hege eine tiefe Abneigung gegen Songs, an deren Ende der Autor meint, unbedingt noch eine persönliche Stellungnahme, eine Mahnung oder gar eine Aufforderung, auf die Barrikaden zu gehen, unterbringen zu müssen. Warum sich nicht mit genauen Momentaufnahmen begnügen, anstatt höchstpersönlich Gefühle vorzuturnen? Warum nicht Beobachtungen und Situationen einfach hinstellen und den Hörer sein eigenes Fazit ziehen lassen?
Die Figuren, die ich auf »Reine Nervensache« auftreten ließ, waren vielleicht Helden, aber ganz sicher keine Sieger. Sie hatten Phimose, hingen am Kreuz oder hörten in der Nacht Atomsprengköpfen beim Flüstern zu. Sie saßen mit ausgeklinktem Herzen vor ihrem leeren Glas, spürten nichts mehr, wollten nichts mehr, schon gar nicht mitmachen. Sie waren Abstinenzler, und der Stoff, auf den sie verzichteten, war die Hoffnung. Ist schon gut, Mutter, ich blute ja nur. Und nicht einmal Kafkas Lachen, das das Vorlesen seiner Texte stets begleitet haben soll, klang noch wie früher, sondern glich dem hämischen der Panzerknacker: har, har, har. Diese Songs erzählten keine zusammenhängende Geschichte, aber das tat das Leben ja schließlich auch nicht. Lediglich »Romanze« schaffte es noch, für einen Abend und eine Nacht die Illusion von Liebe zu erzeugen. Doch gab es kein Gegenüber mehr, das sie erwiderte. Den alten Balz- und Paarritualen war der Partner abhandengekommen, mit dem sie einst so etwas wie Sinn ergaben. Sie dennoch zu zelebrieren, als Versehrter, Verlassener, war alles, was blieb. Und am nächsten Morgen wird die zerkratzte Theodorakis-Platte wieder in die Hülle gesteckt und der Gedichtband von F. C. Delius ins selbstgezimmerte Regal zurückgestellt. Es ist ein trüber Tag.
Ich sang »Romanze« bei meinem allerersten Fernsehauftritt. Die Aufzeichnung der ZDF-Sendung fand im Frankfurter Römer statt. Mit mir waren Ideal eingeladen, auch sie spielten live, ich glaube, ihr Song war »Eiszeit«, genau weiß ich es nicht mehr. Die beiden Nummern hätten sich jedenfalls einiges zu erzählen gehabt, nicht nur über Einsamkeit und Narzissmus. »In meinem Film bin ich der Star, ich komm auch nur alleine klar.« Das Walkman-Zeitalter hatte gerade erst begonnen.
Die Leute von der WEA wollten es ganz besonders gut machen und verpflichteten extra einen Journalisten für eine Eloge auf mich und mein erstes Album, die sie dann auf dem Backcover unterbringen konnten. Der Mann hieß Klaus Schneider und kam von der Frauenzeitschrift Petra. Man kann nicht behaupten, dass er sich keine Mühe mit seinem Text gegeben hätte. Er konnte mit Sprache umgehen, und manche Formulierung gefiel mir sogar ziemlich gut, gerade weil sie ein wenig over the top war: »Biedermann als Brandstifter, der Schwiegersohn als Heiratsschwindler, ein Spielverderber, wie er im Buche steht: Heinz Rudolf Kunze aus Osnabrück – deutscher kann keine Tarnung sein!« So fing es an, und dann packte Schneider das ganz große Besteck aus, zitierte Brecht und stellte mich auf eine Stufe mit dem jungen Dylan. Kleiner hatte er es einfach nicht. Er stellte sogar einen Bezug zu meiner Doktorarbeit über Spinoza her, die zu schreiben mir mein Philosophie-Dozent Armin Regenbogen tatsächlich angeboten hatte. Ich bin jedoch nie über das Anfangsstadium hinausgelangt, irgendwann ging mir die Kraft aus, und die Zeit dafür war auch nicht mehr da.
All das wäre kaum der Rede wert, hätte Klaus Schneider in seinen Text nicht einen Kalauer eingebaut, der mich verfolgen sollte wie ein Fluch. Schneider schrieb: »Viele spürten plötzlich, dass alle Liedermacher-Ideologien verschlissen sind. Doch der da vorn, das könnte der Niedermacher der 80er Jahre sein.« Die WEA machte daraus zur Sicherheit auch noch die Überschrift. Damit hatte ich mein erstes Etikett weg.
Mir haben Menschen später erzählt, dass sie mein Image als »Niedermacher« lange Zeit davon abhielt, sich mit meiner Musik näher zu beschäftigen. Wer kauft schon freiwillig Platten von einem »Niedermacher«? Zumal man zwar schon das Jahr 1981 schrieb, Punk und New Wave aber in Deutschland noch nicht richtig angekommen waren. Die Musik, die in Berlin im SO 36 oder in Düsseldorf im Ratinger Hof lief, war nur wenigen ein Begriff, die breite Masse hörte nach wie vor Supertramp, Pink Floyd, Angelo Branduardi und Konstantin Wecker. Das sollte sich erst ab Ende des Jahres ändern, als die Neue Deutsche Welle auch die Mainstream-Charts erreichte. Aber davor war die Zeit einfach noch nicht reif für einen »Niedermacher«.
Ein anderes Etikett machte mir aber noch mehr zu schaffen, und diesmal traf Klaus Schneider keine Schuld. Manche Journalisten stürzten sich auf meine bürgerliche Vergangenheit und gingen dazu über, mich fortan nur noch »Oberlehrer« zu titulieren. Natürlich war das als Schimpfwort gemeint. Ich konnte darin nie etwas anderes sehen als Infamie und Gehässigkeit. Denn gestimmt hat die Bezeichnung ja nie. Weder versuche ich, Menschen mit meiner Musik zu erziehen, noch möchte ich ihnen etwas beibringen. Aus dem Stand fielen mir schon Anfang der achtziger Jahre gleich mehrere Kollegen ein, die zwar rein äußerlich eher dem handelsüblichen Bild eines Rockstars entsprachen, das Predigen, Dozieren und Welterklären aber weitaus besser beherrschten als ich. Vielleicht sah ich wie ein Lehrer aus, aber spätestens mit dem Auftauchen von Leuten wie Elvis Costello waren doch eigentlich auch in dieser Beziehung die Kategorien längst durcheinandergeraten. Nur leider nicht in Deutschland.
Während eines USA-Urlaubs las ich einmal in einer großen Tageszeitung einen Artikel über Sting, in dem der Journalist fast hochachtungsvoll Stings frühere Tätigkeit als Englischlehrer erwähnte. Hierzulande hätte man ihm gerade deswegen die Befähigung zur Rockmusik abgesprochen. Besonders in meinen Anfangsjahren hielt man in der einschlägigen Presse am Dogma einer strengen Zweiteilung fest: Hier der Musiker, er muss nach Straße riechen, räudig sein und fern von jeder Bildung, denn nur dann rockt er. Und dort der für den intellektuellen Überbau zuständige Kritiker, der durch sein Wissen der Musik erst ihren wahren Wert verleiht. Wer sich auf dieses Spiel nicht bereitwillig einließ, weil er nun mal mehr als nur ein Buch gelesen hatte und damit auch nicht hinter dem Berg hielt – warum sollte er auch –, galt schnell als Klugscheißer oder eben als »Oberlehrer«. Und erst recht, wenn er eine Brille trug. Erst in jüngerer Zeit scheint man sich auf meine Entfernung aus dem höheren Schuldienst geeinigt zu haben, und ich lese immer öfter von meiner Beförderung zum »Pop-Dichter«, »Pop-Denker« oder gar »Pop-Philosophen«. Ganz ohne Preisschild scheint es einfach nicht zu gehen.
Wir nahmen acht Nummern auf, die neunte und letzte lag bereits vor. Ich hatte beschlossen, »Bestandsaufnahme« in der Liveversion aus dem Würzburger Stadttheater ans Ende des Albums zu stellen. Die Intensität dieses Mitschnitts meiner Stunde null würden wir im Studio nicht übertreffen können. Zudem hatte es den hübschen Nebeneffekt, dass die Platte mit Beifall ausklingen würde, so, als wäre gerade das Konzert eines arrivierten Künstlers zu Ende gegangen und nicht seine erste offizielle Dreiviertelstunde.
Als Dank, dass er mich in dieses Gewerbe eingeführt hatte, teilte ich mit Mick die Credits für die Musik aller Stücke. Das behielt ich auch noch bei den nächsten beiden Alben bei, erst dann ließ ich die Lennon-McCartney-Romantik fallen. Der Wahrheit hatte sie ohnehin nie entsprochen. Mick war wunderbar darin, auf meine Songs zu reagieren, mit ihnen zu arbeiten und sie aufzunehmen. Komponiert hat er aber keinen einzigen.
Ich wollte die Platte Reine Nervensache nennen, was vor allem an Wolf Wondratschek lag. Wondratschek war einer meiner Helden. Seine Gedichtbände der siebziger Jahre, die man, gut alternativ, ausschließlich im Versand und in den Läden von Zweitausendeins bekam (»Nur bei uns!«), brachten mir mehr über Lyrik bei als jede dickleibige Versgeschichte. Vor allem gaben sie mir die Gewissheit, dass auch Gedichte Gegenwart enthalten konnten, nicht zuletzt meine eigene. Ein Text im Band Chuck’s Zimmer hatte es mir besonders angetan. Er hieß »Adam jr.« und handelte von der Selbstabschaffung Gottes durch Gleichgültigkeit. Viel anderes, als jeden Sonntag im Irrenhaus Würfelzucker zu verteilen, hat er nicht mehr zu tun. Und der Refrain kommentiert jedes Mal so höhnisch wie ratlos: »Das Paradies war offensichtlich reine Nervensache / Ich weiß jetzt auch nicht so genau wie’s weitergehen soll.« Ich griff das Thema im ersten Stück des Albums wieder auf und machte daraus ein Duell zwischen Gott und dem Teufel. Russisches Roulette aus Langeweile, und einer verliert. Der Teufel ist es nicht.
Der in Musikerkreisen hochgeschätzte Michael von Gimbut hatte mich fotografiert, sein Schwarz-Weiß-Porträt sollte das Cover sein. Klaus Voormann nahm das Foto, sagte »Lasst mich mal machen« und kam erst wieder, nachdem er es buchstäblich durch die Mangel gedreht hatte. Das Ergebnis konnte den Betrachter schwindlig machen. Mein Kopf schien nun wie auf einem Plattenteller zu rotieren, meine Brille war verrutscht, und mein Blick hatte jeglichen Halt verloren. Endlich sah ich so irre aus, wie mir all das vorkam, was seit Würzburg um mich herum geschehen war.
Voormann trug mir seine Entmachtung als Produzent nicht nach. Wir blieben in Kontakt. Im Sommer 1981 rief er mich an.
»Hast du heute Abend schon was vor?«
»Nein, wieso?«
»Dann fahr nach Georgsmarienhütte. Direkt an der Straße nach Münster, noch vor dem Ortseingang ist rechts eine Kneipe, du kannst sie gar nicht verfehlen.«
»Und was soll ich da?«