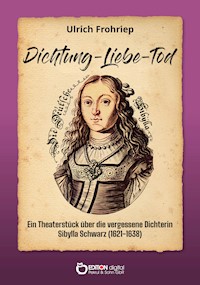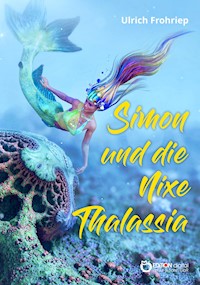7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Sprache: Deutsch
Westindien - Traum vom Reichtum und von der Liebe schöner Frauen. Westindien - Traum vom Leben in Sorglosigkeit. Dorthin zieht es die Männer, die im Jahre 1640 mit einer holländischen Fleute in die Inselwelt der Karibik eintauchen. Sie haben den großen Krieg in Europa hinter sich gelassen, sie haben ein Ziel: Santo Domingo, Haiti. Dort sollen sich ihre Hoffnungen erfüllen! Es kommt anders. Die Fleute gerät in das Feuer spanischer Galeonen, das Wrack erreicht mit Not den rettenden Strand. Die wenigen Überlebenden sind glücklich gelandet: auf Tortuga. Hier treffen sie auf Geld und Macht, und hier treffen sie auf Amelie und Jaqueline, die schönsten Frauen, denen je ein Bordell gehörte. Und sie begegnen der Liebe, wie es sie nur auf Tortuga gibt. Aber die Sache hat - begreiflicherweise - einen Haken: Tortuga ist Pirateninsel. Und wollen die Männer ihren Unterhalt verdienen, müssen sie es tun wie alle - auf See: Mit Intrige und Raub und Mord. Mit Kaperfahrt gegen die spanische Silberflotte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Impressum
Ulrich Frohriep
Westindienfahrer
Eine Seeräuberballade
ISBN 978-3-96521-874-1 (E-Book)
Umschlaggestaltung: Ernst Franta
Das Buch erschien erstmals 1986 im Hinstorff Verlag Rostock, 2000 im BS-Verlag Rostock.
2023 EDITION digital
Pekrul & Sohn GbR
Godern
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Tel.: 03860 505788
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.edition-digital.de
ERSTER TEIL: Insel
Das Gefecht
In Europa ist Krieg. Ein langer Krieg. Er dauert zwanzig, fünfundzwanzig Jahre. Und wie so oft, geht es darum, Recht zu bekommen, zu behalten, wie man will. Auf der einen Seite kämpfen die, die zum Vater, zum Sohn, zum Heiligen Geist aufsehen, auf der anderen Seite betet man denselben Gott an. Verfeindet allerdings sind die Staaten miteinander, die Herrscherhäuser, wieso sollte sonst zum Beispiel zugunsten der evangelischen Kräfte das katholische Frankreich eingreifen? Aus reiner Nächstenliebe? Aber wer ist dir der Nächste in solch einem Krieg, in dem am Ende nur die Not herrscht und das Elend. Nur Mord und Brand und Flucht und Tod. Oh, gibt es nicht auch andere Gegenden in der Welt? Friedlichere? Länder, in denen man in Ruhe, in Geborgenheit seiner Arbeit nachgehen kann? Doch, man spricht davon. Laut schreien die Werber es heraus in den Hafenstädten. Im Land geht es von Mund zu Mund. Aber kann man so einfach alles aufgeben? So einfach alles hinter sich lassen? Ja, aber was denn? Was hat man zu verlieren in diesem Krieg. Das Leben allemal. Und was ist das schon: Europa! Westindien heißt das Schlagwort, das in den Häfen umgeht, bis ins Landesinnere dringt. Eine neue Welt ist gefunden worden. Diese Welt braucht Menschen, Männer, ganze Kerle. Diese Welt ist gerade im richtigen Augenblick gefunden worden. Sie gehört den Spaniern. Gut. Macht das was? Nein. Es gibt Möglichkeiten genug. Und es gibt Wege, dorthin zu gelangen. Für jeden. Für manchen.
Wer sagt aber, dass man entkommen ist? Woanders ist auch Krieg. Hier, dort, überall.
Das Schiff ist stark und schnittig gebaut, und es liegt gut vor dem raumen Wind. Und unermüdlich pflügt es den Ozean. Seit Wochen schon. Der Nordostpassat dauert an und wird das Schiff herantragen an die gelobten Inseln Westindiens, das ist sicher. Und es wird noch vor Abend geschehen, da singt der Ausguck Land aus. So ist vor drei Menschenaltern der Genuese Columbus gesegelt mit seinen Spaniern, so sind ihm Engländer gefolgt, Deutsche, Schweden, Holländer. Wer zählt sie auf, wer kennt die Namen. Und alle suchen eins: Reichtum. Denn Reichtum ist die Quelle des Glücks.
Ein Schiff aber ist nur so gut wie sein Kapitän. Was aber, wenn der krank in der Koje liegt und sich nicht zu rühren vermag. Was, wenn eine feindliche Fregatte den Kurs kreuzt, das kann doch geschehen! Die Spanier wachen eifersüchtig über ihre Gewässer, oder was sie dafür halten. Gewiss, das Gebiet ist groß und kaum kontrollierbar. Aber wer befiehlt die Flucht im rechten Augenblick, führt im Kampf Schiff gegen Schiff, Mann gegen Mann. Ja, wer hält überhaupt Ausschau, wenn der Ausguck selig träumt und nicht sieht, wie zwei Segel über den Horizont steigen und schnell näher kommen. Noch wäre es Zeit, will man nicht den Kanonen vertrauen, den Kurs zu ändern und die bessere Luvstellung zum Entweichen auszunutzen. Aber kein Kapitän steht der Mannschaft vor, die Disziplin lässt zu wünschen übrig. Der Ausguck schläft.
Zwei spanische Schiffe! Endlich hatte man an Deck etwas bemerkt. Der Ausguck konnte sich auf einiges gefasst machen. Da waren Seeleute gar nicht zimperlich. Hätten sie eben noch auf Gedeih und Verderb zusammengehalten, wenn ihnen jemand zugemutet hätte, vielleicht die Pumpen etwas öfter zu bedienen, jetzt ging es um das Leben. Kapitän hin, Kapitän her, jetzt wurde gehandelt. Das Schiff luvte an, ging hart an den Wind, tauchte gehorsam den Bug in die sanft anrollenden Wogen. Es war zu spät. Die Schiffe liefen schräg aufeinander zu. Wenden! Das Kommando kam vom Steuermann. Doch nun zeigte sich, dass an Bord wochenlang gefaulenzt worden war. Zu langsam schwenkten die Rahen herum, wurden die Schoten und Brassen gefiert und dichtgeholt. Das Schiff stand, dann trieb es hilflos achteraus.
Es war, als erwartete es demütig seinen neuen Herrn.
Noch aber wollte keiner aufgeben. Wer hatte denn schon Lust, diesen Abend noch an die Großrah geknüpft zu werden! Das war sicher, die Spanier machten keinen Unterschied zwischen friedlichen Handelsschiffen und Piraten. Zu oft hatte man davon gehört. Und schließlich war man selbst auch deshalb nicht schlecht bewaffnet.
Der Ausguck, als wollte er etwas wieder gutmachen, sang jetzt das Land aus, auf das sie voller Hoffnung die Wochen zugefahren waren. Ein Wutgebrüll antwortete ihm. Wäre er jetzt an Deck geklettert, seine Kameraden hätten ihn wohl kurzerhand über Bord geworfen. Er rührte sich nicht aus seinem Korb.
Der Mann am Ruder war abgelöst worden. Auch wenn das Schiff rückwärts fährt, ist es lenkbar, nur muss man die Richtung wissen, in die man den Kolderstock drückt. Mit Schwung kam das Schiff herum. Der Bug zeigte in die alte Richtung. Was ist ein Schiff wert, wenn man nicht mit ihm umzugehen versteht.
Am Schiff liegt es nicht! Es ist von den besten Schiffbauern Hollands gebaut worden, es hat hervorragende Segeleigenschaften. Man muss es nur bedienen.
Die Spanier waren nun nahe genug heran, um ihre Kanonen einsetzen zu können. Das Schicksal des Westindienfahrers war besiegelt, auch wenn die Kanonade erst begann. Die Kugeln flogen herüber und hinüber. Sie schlugen durch Holz und Tauwerk und Knochen. Und zwischen dem Aufbrüllen der Geschütze war das Stöhnen der Verwundeten.
Was hatte das für einen Zweck. Die einen wollten ungeschoren das Land erreichen, um Handel zu treiben. Die anderen wollten dies nicht zulassen, es beeinträchtigte ihre Interessen. Der Stärkere siegt. Auch hier. Die holländische Fleute sah trostlos aus. Tote lagen auf dem Deck, das Schanzkleid war zersplittert, Stengen und Rahen schleiften außenbords. Das Schiff hatte seine Masten eingebüßt.
Man hatte zurückgefeuert. Warum auch nicht, wozu sind die Kanonen schließlich an Bord! Weitab trieb der eine Spanier, er sah ähnlich gerupft aus, wenn auch die Untermasten noch standen. Beide Schiffe trieben auf die Küste zu. Nun war sie nah, die langersehnte Küste. Aber sie sah nicht gastlich aus. Schroffe Felsenklippen waren dem Strand vorgelagert, und wehe dem Schiff, das da hineingeriet. Da war der Spanier noch gut dran, er sollte abgeschleppt werden, und wenn dies nicht gelänge, würde die Mannschaft vom zweiten Schiff, das selbst kaum Treffer erhalten hatte, übernommen werden.
Aber die Holländer. Was mochte ihnen lieber sein, die Klippen oder der Galgen? Nun, sagt, tapfere Freunde? Rasch tritt der Tod den Menschen an. Im großen Krieg in Europa. Im kleinen hier in Westindien. Was, wenn ihr ein Boot nehmt und flink an Land rudert, was wird dann aus den Verwundeten? Sie sterben sowieso, sagt ihr? Ihr Pech, kann jeden treffen? Richtig: Was aber, wenn ihr?
Das Boot wurde klargemacht. Die Zeit, in der die Spanier mit sich selbst beschäftigt waren, musste genutzt werden. Da der Schiffsarzt an Bord bleiben wollte bei den Verwundeten, bitte, bitte, wer würde etwas dagegen sagen wollen, ließ man den Anker fallen, damit das Schiff nicht ungehindert in die Klippen geworfen wurde. Dann waren sie davon. Zurück blieben Heulen und Zähneknirschen. Als wenn die knapp dreißig Mann, die an Land gegangen waren, eine Chance gehabt hätten. Wie weit war es denn bis zur nächsten Ansiedlung, wann würde man sie erreichen, und in welchem Zustand? Und waren dort nicht vielleicht auch Spanier, die jeden Fremden totschlugen wie einen räudigen Hund?
Zugegeben, was hatten die Verwundeten zu erwarten? Schmerzen und Brand und Tod! Davor ein wenig Rum, es war noch genug an Bord. Davon goss sich der Arzt einen Becher voll und kippte ihn. Das Schiff trieb weiter auf die Felsen zu, auch wenn der Wind jetzt seltsamerweise einschlief. Warum er, der Arzt, ausgerechnet in dieser Lage an Bord geblieben war, hätte er jetzt nicht zu sagen gewusst. Denn wohin mit den Verwundeten, wenn der Anker wirklich am Grund festkam und die Spanier, ohne noch einmal nachzufragen, abrückten, was beides nicht sicher war? Und wohin dann mit sich selbst, wenn niemand außer ihm noch lebte? Was konnte er überhaupt tun, außer Arme abbinden, Beine, hier einen Fuß amputieren und dort eine Hand. Und das ohne einen Gehilfen. Und wozu? Der Brand kam, dagegen war er machtlos. Sie hatten sich in Gefahr begeben, sie kamen darin um. Alle. Davon war er überzeugt. Da ruckte es im Schiff, der Anker hatte gefasst. Der Arzt machte sich an die Arbeit.
Der eine Spanier hatte den anderen im Schlepp. Es wehte jetzt ein leichter Landwind. Sie entfernten sich langsam. Die Fleute schwoite an der Ankertrosse. Der Arzt, nachdem er sieben Verwundete notdürftig versorgt hatte, schleppte die Toten zur Reling. Er murmelte ein kurzes Gebet. Sie hatten es hinter sich, mochte der große Ozean sie aufnehmen. Er warf sie über Bord, einen nach dem anderen, junge Burschen, ältere. Was hatten sie erträumt. Es war dahin.
Er goss sich den Becher wieder voll. Die Brandung rauschte. Aus dem Schiffsinneren ertönte leises Klopfen. Er achtete nicht darauf, er war erschöpft. Mit Behagen trank er.
Das Wrack
Martin erwachte von einem Klopfen. Er öffnete mühsam die Augen. Nichts. Dunkel. Es klopfte heftiger, sein Kopf dröhnte. Eine Stimme rief: „Hört uns denn niemand?“ Eine weibliche Stimme. „Doch“, flüsterte Martin, „doch, ich höre. Ich komme.“ Wo war er? Was war geschehen? Wie kam er in dieses Dunkel? Er sah sich um. Langsam konnte er Dinge unterscheiden. Den Mastfuß, eine Treppe, die nach oben führte, einen viereckigen Lichtfleck. Zwei spanische Segler hatten auf die Fleute Kurs genommen, man hatte angeluvt, war über Stag gegangen. War man das? Er hatte etwas Schweres, Hartes gegen seinen Kopf bekommen und war dann wohl in diesen Niedergang gestürzt. „Ich komme“, rief er lauter und tastete sich zur Tür der Segelkammer. Von dort kam dieses schmerzhafte, dröhnende Klopfen. „Hören Sie bitte auf“, sagte er, „ich komme.“
Er konnte den Riegel nicht finden, er suchte auf der anderen Seite der Tür. Natürlich, er klemmte. Er fand eine Handspake, benutzte sie als Brechstange. Es splitterte, er drückte die Tür auf. An der Decke der Segelkammer hing eine Sturmlaterne. Ihr Licht fiel auf zwei Frauen. Sie waren in Le Havre an Bord gekommen und reisten nach Santo Domingo, zum Mann, zum Vater. Das Mädchen schaute ganz verängstigt drein. Die Mutter, noch nicht alt genug, um auch Martins Mutter sein zu können, schrie leise auf. Dann fasste sie sich. „Was ist geschehen, um Himmels willen, was ist bloß geschehen!“
„Ich weiß es nicht, Frau d'Albert“, sagte Martin. „Ich weiß es wirklich nicht.“
„Sie bluten.“
„Ja“, sagte Martin töricht.
„Was ist mit dem Schiff?“
Was sollte mit dem Schiff sein, es schwamm, es war offenbar glücklich entkommen.
Madame d'Albert schob ihn beiseite und stieg den Niedergang hinauf. Ängstlich folgte ihr die Tochter. Langsam und mit dröhnendem Schädel kletterte Martin ihnen nach. Warum hatte man Madame und ihre Tochter nur da unten eingesperrt? Vom Deck hörte er wieder einen unterdrückten Schrei. Martin lief hinauf und stand starr. Er hatte sich am Mast festhalten wollen. Da war kein Mast. Da war kein Segel. Da war gähnende Leere. Da waren Splitter und Tauwerk, umgestürzte Kanonen. Und da war Blut.
Die Frauen standen an der Reling und sahen zum Land hinüber. Land! Endlich. Ganz in der Nähe Land, und doch so unheimlich weit entfernt. Nadelscharf die Klippen davor. Das Schiff schwoite an der Ankertrosse.
„Mein Gott“, sagte Madame d'Albert. „Mein Gott!“
Da standen sie: Frau d'Albert, ihre Tochter, Martin. Nicht weit von ihnen der Schiffsarzt. Was sollte man hier tun. Martin schaute sich um. Das Schiff war verwüstet. Es würde nie mehr segeln können. Ein Wrack, das ihnen zum Grab werden sollte!
„Man muss doch etwas tun“, sagte Frau d'Albert schließlich. „Irgendetwas muss man doch tun. Hier können wir doch nicht bleiben.“
„Ich fürchte, wir müssen, Madame“, sagte der Arzt. Er hatte immer noch das Glas in der Hand. Er trank den Rest. „Das Boot hat die tapfere Besatzung genommen. Möge sie heil durchkommen.“
„Und Sie, Doktor?“
„Das ist ganz einfach, Madame. Ich laufe nicht gern. Und schon gar nicht weit. Noch schwimmt das Schiff, noch ist Hoffnung.“
„Sehen Sie sich meine Tochter an, Doktor. Sie ist noch so jung.“
„Was bringen Sie sie denn hierher mit, Madame? Haben Sie denn nicht gewusst, dass man in Westindien gefährlich lebt, dass Blut billiger als Wasser ist, ein Menschenleben für nichts gilt. Hierher macht man keine Vergnügungsreise. Die Mannschaft dieses stolzen Schiffes hat wohl auch so was geglaubt, sonst wäre sie nicht so leichtfertig auf die spanischen Galeonen losgesegelt und hätte sich so schnöde zusammenschießen lassen, nicht wahr?“
„Ich bin Ihnen wohl keine Rechenschaft schuldig, mein Herr!“
„Bitte, bitte.“
„Mama“ sagte da das Mädchen, „Mama, es blitzt. Es wird ein Gewitter geben.“
„Unfug, Kind. Keine Wolke ist am Himmel. Sieh nur den schönen Sonnenuntergang.“
Die Sonne war in der Tat schon halb hinter den bewaldeten Hügeln im Westen versunken und leuchtete glutrot. Der Himmel spielte in allen Farben, zur See hin wurde er dunkler und dunkler. Die Dämmerung kam und verging rasch. Hinter dem Horizont schien ein Gewitter heraufzuziehen.
Martin stand an der Reling und sah sich um. Er begriff langsam. Sie waren Gefangene auf diesem hilflosen Schiff, und der nächste Sturm spätestens würde sie auf die Klippen werfen. Vielleicht schon der Gewittersturm, der vom Meer her auf sie zukam.
„Van Dahlen“, sagte er zu dem Arzt, „sehen Sie doch hin!“
„Ich sehe, ich sehe. Es gibt wie immer zwei Möglichkeiten. Entweder es geht gut, oder nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es uns morgen um diese Zeit schon viel besser geht. Das ist kein Gewitter, dort draußen, Martin, das ist ein Gefecht.“
Jetzt, in der Dunkelheit, sah man das Blitzen deutlicher, hörte leise das dumpfe Grollen der Geschütze. Und Martin stellte sich vor, wie Eisen durch Holz und Bein fuhr, wie Spieß und Enterbeil aufeinander losgingen, wie Messer durch warmes Fleisch schnitten. Er stellte sich vor, er sei inmitten dieses Gemetzels und wisse nicht wohin, und er hieb und stach und schnitt ums nackte Leben, und ringsum fielen die Gegner und die Freunde, nur er blieb übrig, er ganz allein.
Er erbrach sich, spuckte alles über die Reling. Er würgte. Es würgte ihn. Van Dahlen brachte ihm einen Becher Rum. Martin schüttelte sich, aber er trank. Es wurde ihm besser. Nur im Kopf dröhnte es furchtbar. Van Dahlen schickte die Tochter der Frau d'Albert nach Wasser und einem Tuch. Martin hatte am Kopf eine riesige Beule.
„Ja, ja, mein Junge“, sagte van Dahlen, „das Kriegspielen ist nicht jedermanns Sache.“
Martin stöhnte leise. Das Aufblitzen der Geschütze schien näher gekommen zu sein. Wer mochte dort miteinander kämpfen? Hatten die Spanier wieder eine Fleute aus Europa abgefangen? War die besser auf der Hut als diese hier? Aber warum hatte sie sich überhaupt in einen Kampf eingelassen und war nicht davongeeilt dank ihrer guten Segeleigenschaften?
Ein gewaltiger Blitz fuhr aus dem Horizont, sank in sich zusammen. Das Flackern der Geschütze war verschwunden. Dumpf dröhnte die Explosion. Dann war es still.
„Das war's“, sagte van Dahlen.
„Ja, aber was hat das zu bedeuten“, fragte aufgeregt Frau d'Albert.
„Morgen früh werden wir's wissen.“
„Wir müssen auf diesem Schiff übernachten?“
„Es gibt wohl keine andere Wahl, Madame. Martin, komm mit, ich will nach dem Kapitän sehen. Er liegt immer noch bewusstlos.“
Sie gingen nach hinten und ließen die Frauen an der Bordwand zurück. Van Dahlen nahm beim Eintritt in die Kajüte eine Laterne und zündete sie an. Ihr Schein traf ein eingefallenes regloses Gesicht. Der Kapitän schlief seit Wochen und hatte nichts mitbekommen von den Ereignissen an Bord. Van Dahlen schaute ihn lange an. Dann gingen sie wieder.
„Kommt er durch?“, fragte Martin.
„Es wäre ein Wunder.“
„Und kann man nichts tun?“
„Nein.“
Cowler, als Held
Martin schlief schlecht, die Nacht wurde ihm lang. Er lag an Deck und sah zu den Sternen hinauf. Was würde werden? Nach Port au Prince sollte die Reise gehen, dort hatte er sich zu melden, laut Kontrakt. Von dort würde man ihn dann weiterschicken auf die Farm eines Herrn Ballieux. Für drei Jahre hatte er sich verpflichtet, und diese drei Jahre wollte er schon abdienen. Dann machte er sich selbstständig, rodete Wald, kaufte für das erarbeitete Geld Vieh. Hier draußen auf den Inseln kam man schnell zu etwas. Man musste nur wollen. Bald hätte er genug, um sich vielleicht nach einem Mädchen umsehen zu können, es zu heiraten. Doch nun?
Langsam erblassten die Sterne. Unmerklich war der Morgen gekommen. Neben Martin schnarchte van Dahlen. Schnell wurde es hell. Und aus der Sonne trieben Schiffe heran.
„Schiffe von See! Aufstehen, van Dahlen. Nun wachen Sie doch auf, um Gottes willen. Hat man denn so was schon gesehen? Sie fahren direkt auf uns zu!“
Van Dahlen rekelte sich, rieb sich die Augen. „Ist ja gut, mein Sohn, ist ja gut.“
Der Wind hatte wieder gedreht. Er kam von See, und mit ihm kam die Entscheidung. So oder so. Aber seltsam, alles blieb ruhig. Direkt vor der aufgehenden Sonne standen zwei Schiffe, hoch ragten die Masten in den Glutball hinein. Das dritte Schiff aber trieb schnell näher. Keine Segel drückten es vorwärts, kein Mast war mehr an Bord, an den man eins hätte aufziehen können. Das dritte Schiff war ein Wrack. Es trieb genau auf sie zu. Es lag tief im Wasser, sehr tief.
„Weißt du was, Martin“, sagte van Dahlen, „wir sind gerettet.“
„Ich sehe ein Wrack auf uns zukommen und uns rammen“, sagte Martin. „Das wird die Ankertrosse nicht halten. Und von den Klippen holt uns keiner runter.“
„Dann greif nur munter zum Bootshaken. Nein, ruf lieber die Frauen, sie sollen mit zufassen.“
Martin stürzte zum Niedergang. Und als er wieder an Deck kam, sah er van Dahlen auf der Reling sitzen. Er hatte einen Bootshaken mit einem langen Schaft auf den Knien und pfiff ein Lied.
„Das ist zwar verboten, das Pfeifen an Bord“, sagte er, „aber wir wollen ja gar nicht segeln, nicht wahr. Nimm dir so ein Ding, und die Damen bewaffnen sich bitte auch.“
Madame d'Albert verzog das Gesicht, gehorchte aber. Suzanne, ihre eher knabenhaft aussehende Tochter, blickte mit großen Augen auf das nähertreibende Wrack. „Das ist“, sagte sie, „das ist doch …“
„Ja“, sagte van Dahlen, „das ist der Spanier, der im Kampf mit uns stand und ebenfalls seine Masten verloren hatte.“
„Und das andere Schiff?“, fragte Suzanne schüchtern.
„Die Explosion“, sagte Martin. „Das andere gibt es nicht mehr. Und dieses Schiff tritt nun zum letzten Kampf gegen uns an. Zum allerletzten, bevor es auf den Klippen endgültig zugrunde geht.“
„Also los“, sagte van Dahlen. „Martin, du machst noch den zweiten Anker klar zum Fallenlassen. Und beleg mir das Ende der Trosse ordentlich. Wir werden ihn wohl brauchen.“
Martin flitzte los, steckte die Trosse an den Reserveanker, machte das Ende sorgfältig fest. Dann nahm er seinen Haken und wartete. Die Galeone trieb direkt auf sie zu. Sie kam näher, drehte sich. Der Zusammenstoß war unvermeidlich.
„Könnte sie nicht zehn Meter weiter recht oder links vorbeitreiben? Muss sie ausgerechnet diesen Kurs nehmen? Herr van Dahlen, sagen Sie doch etwas.“
„Was soll ich sagen, gnädige Frau, das Schicksal liegt in unseren Händen. Wir können nur unser Bestes tun. Sollte das nicht ausreichen, so haben wir, verflucht noch mal, Pech gehabt.“
„Was sind Sie für ein entsetzlich roher Mensch! Haben, Sie doch ein bisschen Mitgefühl. Bitte!“
„Nehmen Sie Ihre Bootshaken auf, es ist soweit.“
Die Galeone der Spanier trieb breitseits auf sie zu. Sie kam direkt von vorn. Die Ankertrosse senkte sich unter dem Druck des auflaufenden Schiffes. Vier Bootshaken streckten sich dem Feind entgegen. Strohhalme auf dem Weg des Verderbens. Wie sollten sie das Unglück aufhalten. Ein halb versunkenes Schiff kam auf sie zu, und welche Kraft war noch in ihm! Hilflos schauten sie ihm entgegen. Sie versuchten noch, das Wrack herumzudrücken, doch welch ein Gewicht, welche Wucht in diesem toten Körper. Der Anker hielt kurze Zeit, dann brach die Trosse. Martin stürzte zum Reserveanker, wurde aber aufgehalten von van Dahlen.
„Bist du verrückt? Willst du uns ins Unglück stürzen?“
Martin war verwirrt. Die Schiffe hatten sich ineinander verkeilt. Die Fleute trieb voraus, die Galeone schien sie zu schieben. Dann drehten sich die Schiffe langsam umeinander.
„Jetzt“, rief van Dahlen, „lass fallen.“
Martin hatte eine Axt genommen und schlug den Keil, mit dem der Anker am Bord festgemacht war, los. Die Trosse rauschte aus, der Anker fiel ins Unergründliche.
Sie rannten zu dem fremden Schiff. Sie hieben mit ihren Äxten drauflos. Teile der außenbords treibenden Takelage hatten sich miteinander verhakt. Das Tauwerk war neu, die Äxte stumpf. Sie arbeiteten wie die Berserker. Die Frauen guckten ängstlich zu. Und sahen auf die Klippen, die bedrohlich nahe gerückt waren. Ja, was denn nun. War dies das Ende?
Ein Ruck ging durch das Schiff, ein letzter Schlag von Martin löste die Umklammerung. Sie lagen still. Langsam entfernte sich die Galeone. Martin und van Dahlen atmeten tief durch. Es war geschafft.
„Ist dir nichts aufgefallen, Martin“, sagte van Dahlen schließlich.
„Nein.“
Die Galeone hatte keinen weiten Weg zurückzulegen, bis sie in die Klippen stieß. Sie hörten es krachen. Es knirschte, es splitterte. Hilflos hing das ehemals so stolze Schiff auf den Felsen. Es würde nicht lange dauern, und es brach völlig auseinander.
„Es war niemand an Bord.“
„Ja.“
„Eben.“
„Sie sind alle …?“
„Ja, Martin.“
„Verflucht.“
„Daran wirst du dich gewöhnen müssen, mein Junge. Hier heißt es immer, er oder ich. Von Pardon habe ich jedenfalls noch nicht gehört.“
„Ich bin aus Europa fortgegangen, weil ich nicht in den Krieg wollte, weil ich nicht totschlagen wollte. Ja, gewiss, auch nicht totgeschlagen werden wollte. Und wohin bin ich gekommen?“
„Du musst hart sein, Martin. Dies hier ist eine windige Gegend. Und wenn du nicht auf dich selber aufpasst, ein anderer tut es nicht für dich. Guck dir das an, da scheren sie heran, wie Aasgeier.“
Die Sonne stieg inzwischen immer höher, beschien von oben die beiden Schiffe, die gelassen auf die ankernde Fleute zuhielten. Sie hatten es nicht eilig. Musste doch durchschossenes Tauwerk gespleißt werden, mussten zerfetzte Segel ausgebessert, Löcher im Rumpf verstopft werden. Es gab zu tun. Und die Beute, die dort vor Anker wartete, konnte schließlich nicht entkommen.
Van Dahlen aber forderte die beiden Frauen seelenruhig auf, sich gefälligst um das Frühstück zu kümmern.
„Jawohl, Herr Kapitän“, murmelte Madame d'Albert ungehalten, machte sich aber dann an die Arbeit.
Kochen konnte sie, aber was nützte das, wenn nichts zum Kochen da war. Erbsen fand sie, hart, alt. Sie weichte sie ein, die würden Stunden brauchen. Und Brot fand sie, Schiffszwieback nannte man das Zeug, sie warf es wütend in die Ecke. Käfer, Maden, allerhand undefinierbares Getier hatte es sich zur Wohnstatt ausgesucht, auch das Klopfen auf eine harte Kante hätte nichts genützt. Die Mannschaft hatte es gegessen, abends, im Dunkeln unter Deck, es hatte nicht geschmeckt, aber es hatte gesättigt. Sie schüttelte sich. Es gab nichts anderes, man war auf einer Seereise.
Es gab doch anderes, wenn auch nicht viel. Sie fand in einem Versteck des Kochs einen Schinken, einen wohlerhaltenen, ganzen Schinken. Auf spanische Art gesalzen und getrocknet. Und sie fand einen leichten französischen Landwein. Das musste genügen.
Und es genügte. So schnitt sich jeder einige Scheiben vom Schinken herunter, strich das Salz von den Kanten ab und kaute. Und trank Wein dazu, viel Wein, denn der Schinken war schon ziemlich trocken geworden. Und salzig war er natürlich auch. Aber immerhin, sie hatten gefrühstückt.
„Sehr schön“, sagte van Dahlen und wischte sich den Bart. „Dann wollen wir die Herren mal empfangen.“
Die beiden Schiffe hatten in einiger Entfernung Anker geworfen. Ein Boot hielt auf die Fleute zu. Die Männer darin waren bewaffnet. Sie legten sich ordentlich in die Riemen.
„Was für ein Schiff“, brüllte es herüber.
„Ein holländisches mit Waren für Port au Prince und Tortuga.“
„Das passt ja gut.“
Das Boot kam längsseits, und an Bord kletterten drei Mann.
„Ich mache dir einen Vorschlag“, sagte ihr Anführer, ein großer, kräftiger Mann um die Vierzig, braun gebrannt, mit schwarzem Haar und Bart. „Ich schleppe dich ab.“
„Einverstanden“, sagte van Dahlen.
„Gut“, sagte der Mann. „Das Schiff bleibt deins, die Ladung gehört mir. Und ich bringe es nach Tortuga, so wahr ich John Cowler bin.“ Und er lächelte Frau d'Albert zu, ihr wurde himmelangst.
„Die ganze Ladung?“, sagte van Dahlen.
„Als Ausgleich für den abgesoffenen Spanier. Aber gut, ich will nicht so sein. Die halbe Ladung“, er machte eine kleine Pause, „und diese Frau.“
Frau d'Albert schrie auf und tat, als wollte sie in Ohnmacht fallen, überlegte es sich, trat näher und haute dem Frechling eine mächtige Ohrfeige herunter. Das heißt, sie wollte, ihre Hand aber wurde aufgehalten. Cowler schaute ihr tief in die Augen. Frau d'Albert riss sich endlich los. „Sie Schuft“, keuchte sie, „Sie unverschämter Schurke.“
Cowler lachte.
Martin hatte eingreifen wollen, sah aber im letzten Augenblick, wie die Hände von Cowlers Begleitern sich um die Griffe ihrer Messer legten. Es gibt immer zwei Möglichkeiten. Die zweite war, sie hier einfach über Bord zu schmeißen und überhaupt nicht zu teilen.
„Ich bin Madame d'Albert“, sagte Frau d'Albert. „Ich bin die Frau des Gouverneurs von Tortuga.“
„Teufel auch“, sagte Cowler, „und ich bin der Schwarze John. Nun?“
„Angenehm“, sagte van Dahlen, „van Dahlen. Also die ganze Ladung.“
Cowler grinste. „Die Frau des Gouverneurs, so, so. Und das reizende Töchterlein. Da wird sich der Herr Gemahl wohl freuen dürfen.“ Er jumpte über Bord, seine Begleiter ihm nach. Das Boot legte ab. „Mit dem Abendwind segeln wir.“
Sie sahen dem Boot nach. Mit kräftigen Schlägen entfernte es sich schnell.
„Ein Seeräuber“, sagte Frau d'Albert verächtlich. „Und von so einem muss man sich nun helfen lassen, pfui! Mein Mann, der Gouverneur, wird ihn schon zur Rechenschaft ziehen, diesen, diesen Halunken.“
„Na, hoffentlich“, sagte van Dahlen. „Martin, komm, wir müssen nach den Verwundeten schauen. Madame, sorgen Sie bitte für Wasser und ein wenig zu essen.“
Die beiden Frauen verschwanden in der Kombüse und van Dahlen fluchte vor sich hin. „Mein Mann, der Gouverneur! Na, so was. Die wird sich wundern. Da, drei sind tot. Fass mit an, Martin. Damit die zarten Seelen nicht bei ihrem Anblick erschrecken.“
Dreimal klatschte es. Die Frauen kamen mit Wasser und Fleisch und fütterten die übrig gebliebenen vier Blessierten, Van Dahlen und Martin schauten nach dem Kapitän. Der lag wie immer und atmete flach. „Es ist mir ein Rätsel“, sagte van Dahlen. „Eigentlich müsste er längst tot sein.“
Ankunft im Paradies
Am Abend kam Landwind auf. Die Fleute trieb über ihren Anker. Martin stand mit der Axt am Bug und hieb auf die Trosse ein, was das Zeug hielt. Jetzt kam sie wieder steif, und die zerhauenen Kardeele wirbelten um die Leine. Wieder hieb er zu. Ein Knall, das Schiff war los, und langsam trieb es hinaus auf die See. Dort warteten die beiden Brigantinen, bereit, sich vor das Wrack zu spannen.
Die Nacht hindurch wurden sie geschleppt. Die Schiffe vor ihnen waren gut zu sehen. Der Himmel war klar, und das Meer glitzerte im Schein der Sterne. Martin löste van Dahlen am Ruder ab, obwohl es nicht viel zu steuern gab, die Fleute blieb willig auf Kurs, es war, als wollte sie ihren Teil zur Rettung beitragen. Am Morgen stand voraus Land. Wie der Buckel einer Schildkröte tauchte aus dem Meer die Insel. So nahe waren sie ihrem Ziel schon gewesen, als die Spanier sie angegriffen hatten. Verständlich, dass Cowler ihnen angeboten hatte, sie einzuschleppen. Es machte wenig Mühe. Und sollte der Wind ungünstig stehen, sollte gar ein Unwetter heraufziehen, so konnte man die Fleute immer noch treiben lassen. Doch wie es schien, sollten alle Beteiligten Glück haben. Eine fette Beute für den Schwarzen John, fürwahr. Aber man war mit dem Leben davongekommen. War das etwa nichts?
„Das wäre etwas gewesen, zu Fuß durch den Urwald, was, Martin? Was meinst du wohl, wo die tapferen Seeleute jetzt stecken? Von Hunden gehetzt, von Lanzenreitern gejagt, von Dornen zerkratzt, von Schlangen gebissen. Da lob ich mir eine ruhige Seereise auf einem stabilen Schiff.“
Martin sah ihn verwundert an, sagte aber nichts.
„Da guckst du, siehst einen alten Mann vor dir, der ins Schwärmen gerät beim Anblick einer Insel. Gut, gut, ich bin erst vierzig. Aber du kannst mir glauben, ich hatte mit meinem Leben abgeschlossen, dort vor der Küste, allein mit den Verwundeten. Ich sehe mal nach ihnen.“
Er ging davon, und Martin hatte einen Augenblick wirklich das Gefühl, da gehe ein alter Mann. Und er bemerkte zum ersten Mal, dass van Dahlen fast weiße Haare hatte. Was mochte er erlebt haben. Er sah auch, wie van Dahlen zwei Männer zur Reling schleifte. Es klatschte zweimal. Fort waren sie. Gleichmütig rauschte das Meer. Er sah noch, wie mehrere dreieckige Rückenflossen herangeschossen kamen. Die See brodelte kurz auf. Dann war Stille. Er sah, wie Suzanne sich ihrer Mutter in den Arm warf und heftig schluchzte, wie Frau d'Albert einen langen Blick auf van Dahlen warf, der gewiss nicht freundlich gemeint war. Martin sah vor sich die beiden Brigantinen, die im stetigen Wind leicht überholten, er sah die Klippen vor dem Strand, nadelspitz wie die, die sie gestern verlassen hatten, und er sah die schmale Einfahrt voraus, auf die sie zuhielten. Wie sollten sie dort hindurchkommen? Das ging doch gar nicht bei dieser Windrichtung. Und er sah, wie die beiden Brigantinen Boote zu Wasser brachten. Die übernahmen die Schleppleinen. Männer legten sich in die Riemen. Hart am Wind zogen nun die Segler davon, voraus in den sicheren Hafen.
Die Fahrrinne war nicht breit, und die Boote hatten tüchtig zu tun. Hart rechts fuhren sie, direkt neben dem Felsenriff. Weit nach Lee gedrückt folgte ihnen die Fleute, fast schrammte sie auf der anderen Seite der schmalen Einfahrt die Klippen. Martin tat am Kolderstock, was ihm möglich war. Die Männer in den Booten ruderten mit aller Kraft. Der Wind ließ nach unter Land, da wurde es leichter. Mit Schwung fuhr die Fleute in die kleine Bucht ein und, da sie keinen Anker mehr an Bord hatte, den sie noch hätte fallenlassen können, auf den Strand zu, bis sie auflief. Bei Ebbe würde man sie trocknen Fußes verlassen können.
Martin ging zum Bug, sprang ins Wasser. Er nahm eine der Schleppleinen und watete zum Ufer, machte sie an einem Baum fest und kam zurück. Er brachte ein kleines Boot mit, das auf den Strand gezogen war.
Gemeinsam fuhren sie an Land, gingen durch das Dorf, auf das Fort zu, das oberhalb der Ansiedlung seine Kanonen drohend auf die Hafeneinfahrt gerichtet hatte. Dort hatte sicher der Gouverneur seine Wohnung. Dort würden sie erwartet werden. Warum aber schickte er ihnen niemand entgegen, wenn er schon nicht selbst kam? Frau d'Albert war doch ein wenig empört. Sie schritt zornig aus, so dass der Staub nur so aufstob. Ihre Tochter folgte ihr verängstigt. Etwas zurückgefallen Martin und van Dahlen. Sie fragten sich inzwischen sowieso schon, was sie in dem Fort des Herrn d'Albert eigentlich wollten. Nun gut, waren sie einmal auf dem Weg, gingen sie auch hin. Und so stapften sie verdrossen in der Staubwolke Madame d'Alberts, die wütend gegen das Tor der kanonenstarrenden Festung hieb.
Es dauerte, bis endlich geöffnet wurde. Ein altes Männlein erschien im Eingang und erschrak. „Nun kommen die Damen schon am helllichten Tage“, murmelte es. „Sie wollen hier doch nicht etwa herein?“
„Und ob ich will“, sagte Frau d'Albert und schob den Mann beiseite. „Wo ist der Gouverneur? Komm, Suzanne, wir werden ihn schon finden.“
„Er ist aber doch nicht da“, murmelte der Alte, „wenn ich es aber nun sage. He, Sie, Sie dürfen hier doch nicht einfach.“
„Sie darf“, sagte van Dahlen, „sie ist nämlich die Frau vom Herrn Gouverneur.“
„Wenn das so ist. Meinetwegen.“ Er drehte sich um und ging weg. Das Tor blieb offen, es kümmerte ihn nicht mehr.
„Seltsame Zustände“, sagte Martin.
Das Haus war leer.
Madame d'Albert schnaubte.
Suzanne war erschrocken.
Van Dahlen sagte: „Dann wollen wir mal wieder, Martin.“
Auf dem Rückweg kam ihnen eine große Staubwolke entgegen. Reiter, ein Wagen und darauf ein Toter. Martin und van Dahlen blieben stehen, zogen ihre Hüte, ließen die Kavalkade stumm vorbei. Der Staub brannte in den Augen. Martin musste niesen.
„Du sagst es“, sagte van Dahlen, „das war er also, der Herr d'Albert.“ Er musste lachen. „Da kommt sie nun über das Meer gefahren, entrinnt dem Verderben nur mit Not, und was ist? D'Albert ist tot. Mausetot.“
„Was gibt es denn da zu lachen“, sagte Martin. „Das ist doch schrecklich. Und die arme Suzanne.“
„Gehen wir ins Dorf und hören uns um.“
Ein Zwischenfall
Das Dorf war klein, und wenn es dieser nicht gewesen wäre, hätte es ein anderer erzählt. Zumal er es nicht umsonst tun musste. Ein Bier? Nein, ein ganzes Abendessen. Der Alte mit dem Holzbein erzählte gern. Offenbar.
„Das war so. Ich war ja dabei. Ich bin ja immer dabei, wenn hier auf der Insel was passiert. Und hier passiert viel, sage ich Ihnen. Wenn die Bukaniere von Santo Domingo herüberkommen, lastenweise Fleisch mitbringen, Felle, alles verkaufen und dann im Geld nur so schwimmen. Ist aber auch eine harte Arbeit, dort im Busch, monatelang hinter den wilden Rindern her sein, den Schweinen und alles. Und wenn die Flibustier von See kommen, dann ist hier immer einiges los. Zumal wenn sie Erfolg hatten, so wie der Schwarze John, der heute gekommen ist. Aber den kennen Sie ja wohl. Der hatte sein Schiff schon voll, als er auf die beiden Spanier und Ihre Fleute traf, und sein Kompagnon auch, das können Sie glauben. Nun ja, aus reiner Menschenliebe hat er Ihr Schiff schließlich auch nicht abgeschleppt. Was soll ich sagen, vor drei Jahren ist der Schwarze John das letzte Mal hier gewesen. Große Liebe mit der Chefin dieses Hauses. Ich will mal lieber etwas leiser sprechen. Dann war er weg, räuberte nach Afrika rüber. Ließ sich jedenfalls nicht mehr blicken. Hatte die Nase voll von der Dame oder einer anderen, was weiß ich. Kam hier zur Tür rein heute Mittag, als wenn nichts gewesen wäre, ließ die Tassen springen. Alles ließ sich vollaufen auf seine Kosten. Na, was machte ihm das schon. Die Mädchen immer dazwischen. So manch eine wird heute schon ganz gut verdient haben. Sollen sie, nicht wahr. Verdienen alle ganz gut hier, wenn man von mir mal absieht. Mit meinem einen Bein ist das ja so eine Sache. Da nimmt einen keiner mehr mit. Hab eben Pech gehabt. Leb aber noch, nicht wahr? Das ist schließlich auch was. Der Schwarze John zog sich mit unserer Domina in eine Ecke zurück. Nicht weit genug, als dass ich nicht noch einiges mithören konnte. Sie können ruhig noch etwas nachschenken, mein Herr. Ja, danke. Aber doch so weit, dass man keinesfalls alles verstehen konnte. Außerdem, wer wird denn in solchen Dingen indiskret sein wollen. Die Domina war zornig, das kann man sagen. Wenn sie auch nicht gerade mit Stuhlbeinen um sich schlug. Doch doch, Sie kennen sie ja nicht. Aber ich sage Ihnen, mit ihr ist nicht gut Kirschen essen. Doch wenn sie liebt, oh, ja dann. Ich schweife ab, entschuldigen Sie. Aber gewissermaßen gehört das ja zum Thema. Sie einigten sich offensichtlich darauf, einander nach wie vor unwiderstehlich zu finden, denn sie flüsterten nur noch, verliebt wie am ersten Tag. Und auf einmal waren sie verschwunden. Waren hinaufgegangen. Oben sind die Zimmer der Mädchen, müssen Sie wissen, in die sie sich mit ihren Kunden zurückziehen. Das ist hier nämlich ein anständiges Haus. Hier werden die Frauen nicht einfach über die Tische geworfen, hier zieht man sich dezent zurück, man schließt die Tür. Ja, und in diesem Augenblick stürmt der Gouverneur ins Haus, liebestoll ebenfalls. Die Stille hätten Sie hören sollen, meine Herren, sie knisterte, sage ich Ihnen. Denn jedermann, na, sagen wir, fast jedermann, wusste, nun würde es ein Unglück geben. Schon wurde der Dolch gezogen, schon wurde das Gesicht weiß vor Wut. Ach, ich vergaß zu sagen, unsere Domina war so etwas wie die Frau Gouverneur, zumindest in diesem speziellen Sinn. Vielleicht hatte es ihm auch einer geflüstert. Jedenfalls sah er sich nur kurz um, wusste Bescheid oder ahnte es wenigstens. Er stürmte die Treppe hoch. Kein Laut außer den Schritten, es war gespenstisch. Eine Tür wurde aufgerissen, nein, was sage ich, aufgebrochen mit wütenden Hieben. Den Dolch konnte der Schwarze John wohl gerade noch ergreifen, für die Hosen war es zu spät. Sie fochten auf dem Gang. Messer gegen Messer. Mann gegen Mann. Bekleidet, unbekleidet. Was hatte der Gouverneur aber außer seiner Wut. Was hatte er einzusetzen gegen diesen Briganten der See, der in tausend Kämpfen unbesiegt geblieben ist, der sich aus lauter Eigenliebe sein eigenes Porträt auf die Brust hat tätowieren lassen. Sagen Sie es mir. Nichts natürlich. Er kämpfte tapfer, gewiss. Doch wie kam er zu Tode? Durch einen ehrbaren Messerstich in die Gurgel? Bewahre. Er brach sich den Hals. Doch. Der eine Schritt rückwärts war zu viel. Das Geländer gab nach. Sehen Sie, es fehlt jetzt. Man muss aufpassen, dass nicht noch ein Unglück geschieht. Bei Gott, ein Mann in seiner Trunkenheit, er denkt es ist die Treppe. Ich bin ganz heiser in der Kehle, meine Herren. Danke. Ja, unsere Domina hielt sich prächtig. Verzog keine Miene. Kam die Treppe herunter, hielt die Knechte zur Ordnung an, dass sie den Gouverneur gewissenhaft aufbahrten. Hinten, im Anbau. Hier lief das Geschäft. Mit Verlaub gesagt, das war ja auch nicht der erste Tote im Lokal. Sie schickte jedenfalls auch gleich zum Fort hoch, die sollten ihren Herrn gefälligst abholen. Ja, ja, meine Herren, so geht das. Heute noch auf stolzen Rossen, gewissermaßen, und morgen? Sehen Sie. Das Leben ist kurz. Auch die Tage des Schwarzen John sind gezählt, ich spüre das. Er wird auf sich achten müssen. Wo er ist? Mein Gott, dies ist nicht die einzige Kneipe auf der Insel, und wer wird schon gern im Liebesspiel gestört.“
Was hätte uns die Domina, die Herrin des überaus frommen Hauses erzählen können. Der treue Liebhaber wird vom ungetreuen vom Leben zum Tode befördert. Pfui Teufel, wäre es wenigstens umgekehrt gewesen. Aber was hätte das genützt, jetzt, da die rechtmäßig angetraute Ehefrau aufgetaucht war. Das sprach sich rasch herum im Dorf. Beneiden wir den nächsten. Denn wir sind sicher, es wird einen nächsten geben, es wird immer einen nächsten geben. Denn diese Frau ist schön. Und diese Frau ist gefährlich. Aber wird man sich deshalb fürchten? Hat man nicht eben den Angriff eines überlegenen Feindes abgewehrt, hat man nicht eben unter Lebensgefahr ein spanisches Schiff geentert, sind nicht gerade rechts und links die Kameraden gefallen, wurden über Bord gespült, den Haien zum Fraß. Noch lebte man. Und nicht schlecht. Und Tortuga lebte von ihnen. Die Händler, die Gastwirte, die Huren. Ja, selbst der französische König erhielt von hier seine Tantiemen. Wofür? Dass er Kaperbriefe ausstellen ließ in seinem Namen von seinem Gouverneur hier auf der Insel. Der jetzt tot war. Aber immerhin. Kaperbriefe gegen spanische Schiffe und Städte. Auf dass ihr sie schlaget, wo immer ihr sie trefft. Der Schwarze John würde wohl nun seinen Zehnten zurückbehalten. Aber verkennen wir nicht die Wirkung so eines Wortes wie Heimat. Doch, man brauchte sie, die Heimat, man dachte oft an sie und fuhr doch nie zurück. Mochte sie sich nun Frankreich, England, Holland oder Schweden nennen, von den vielen deutschen Heimaten ganz zu schweigen, die von Kriegen zerrissen, von Seuchen geplagt, von den durchziehenden Heeren geplündert wurden. Man dachte oft an sie, das ist wahr, das Heimweh verklärte vieles. Und hier auf Tortuga war man immer nur zu Besuch. Hier schöpfte man Kraft, gewiss, hier gab man auch Geld aus, viel Geld. Aber man fühlte sich auch geborgen unter den Kanonen des Forts. Hier gab es Zuflucht für eine Weile, bis, ja, bis das Heimweh übermächtig wurde und man es in Blut und Mord zu ersticken suchte.
Wir sprechen von den Männern. Das ist üblich, denn sie begehen die Taten, so scheint es jedenfalls. Die Frauen halten sich im Hintergrund. Sie dienen. Der Mann kehrt zurück von erfolgreicher Fahrt, und sie dienen ihm. Ist es je anders gewesen?
Die Domina, Herrin über zwölf separate Zimmer und genauso viele willige Mädchen, mein Gott, es ist eben ihr Beruf, es wird ihnen schließlich nichts geschenkt, die Domina hat sich eingeschlossen in ihr Privatestes, und als doch ein Mädchen bei ihr zu klopfen wagt, tönt eine Maulschelle durchs Haus, dass alle anderen den Atem anhalten. Sie will allein sein mit ihrer Trauer, mit ihrem Schmerz. Mit ihrem Monolog um Liebe, Liebe, Liebe. Wir haben, was man nicht tut, gelauscht.
„Dieser Idiot! Muss er gerade kommen, liebestoll wie ein ausgewachsener Bulle im Frühling, wenn ich John so weit habe, dass er nackt und bloß vor mir steht und wehrlos! Eine Minute noch, und ich hätte ihn mit dem schärfsten Dolch der karibischen Inseln gewürgt. Ach, diese Gelegenheit! Er hat es gemerkt. Er hat diesen Blödian von Gouverneur, diesen eitlen Fatz, umgebracht wie einen Hund und hat es gemerkt. Ich hatte das Messer noch in der Hand, als er wieder hereinkam, leider. Er hat gelacht. Oh, er hat gelacht, dieser Schurke. Ohne Abschied ist er gegangen vor drei Jahren, und ich hätte ihm alles gegeben. Ich wollte meinen Laden hier zumachen, eine Goldgrube, das ist gewiss, die Farm auf Cuba verkaufen. Irgendwo in Südfrankreich, inmitten von lieblichen Weinbergen, wollten wir uns niederlassen. Und, was war? Von einem Tag auf den anderen war er fort. Beschlief zum Abschied schnell noch die ganze Straße. Diese Blamage. Und ließ nichts mehr von sich hören. Drei Jahre lang. Trieb sich angeblich in Europa rum, in diesem Krieg dort. Mein Gott, überall ist Krieg. Was wird er dort schon anderes gemacht haben als geraubt und geplündert, gesoffen und gehurt. Ich bin kein nachtragender Mensch, aber was zu weit geht, geht zu weit. Ich muss ihn kriegen, und ich werde ihn kriegen, das ist so gewiss, wie die Sonne jeden Tag aufgeht.“
*** Ende der Demo-Version, siehe auch http://www.edition-digital.de/Frohriep/Westindienfahrer/ ***
Ulrich Frohriep
Geb. 18.11.1943 in Rostock, Abitur, Hochschulabschluss, 1970-1986 Verlagslektor im Hinstorff Verlag Rostock. Freischaffender Schriftsteller bis 1991. Danach verschiedene Tätigkeiten in den Bereichen Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. Ab 2005 wieder freischaffender Schriftsteller.
Werke
Bücher
Westindienfahrer. Eine Seeräuberballade, Roman, Hinstorff Verlag, Rostock 1986, BS-Verlag-Rostock 2000
Die Belagerung & Ich habe getötet, Hörspiele, BS-Verlag-Rostock 2002
Simon und die Nixe Thalassia, Kinderbuch, Scheunen-Verlag, Kückenshagen 2003
Rudolf Petershagen und die kampflose Übergabe der Stadt Greifswald, (Herausgeber mit Hans-Jürgen Schumacher), Zeitzeugen erinnern sich, BS-Verlag-Rostock 2005
Was immer euch versprochen wird, Kriminalerzählung, BS-Verlag-Rostock 2005
Fernsehfilme
1986: Polizeiruf 110: Kein Tag ist wie der andere (TV-Reihe)
1989: Polizeiruf 110: Katharina (TV-Reihe)
1990: Polizeiruf 110: Das Duell (TV-Reihe)
Kinderhörspiele
Lasse, mein Knecht, 1979
Thorstein und Einar, 1980
Ein Mann namens Gratsch, 1982
Simon und die Nixe Thalassia, 1985
Kriminalhörspiele
Kramer, Oberleutnant, 1982
Ein höchst attraktives Frauenzimmer, 1983
Der Maler und das Mädchen, 1988
Zwei Frauen, 1989
Ich habe getötet, 1990
Theaterstück
Liebe Dichtung Tod, Ein Theaterstück über die vergessene Barockdichterin Sibylla Schwarz (1621–1638), BS-Verlag-Rostock 2010
E-Books von Ulrich Frohriep
Dichtung, Liebe, Tod. Ein Theaterstück über die vergessene Dichterin Sibylla Schwarz (1621-1638)
„Vor allen Dingen muß allhier nicht vorbey gegangen werden, daß wir in Teutschland Frauenpersonen gehabt, und auch noch zur Zeit haben, die die Männer selbst in der Tichtkunst beschämen können. Umb das Jahr 1638 lebte Sibylla Schwartzin ... Diese war traun ein Wunder ihrer Zeit, denn sie hat von dem dreyzehenten Jahre ihres Alters bis zum siebenzehenden, worinnen sie seeligen Todes verblichen, Verse geschrieben, die vor solche zarte Jugend, und zwar eine Jungfer, unvergleichlich sind."
Daniel Georg Morhof, 1682
Sibylla Schwarz, große Stimme in der Dichtung des Barocks. In Amerika bewundert, in Deutschland fast vergessen.
Die Belagerung & Ich habe getötet
Zwei Hörspiele, wie sie unterschiedlicher nicht sein können:
Historisches Spektakel das eine, Psychogramm eines Mörders das andere.
Das Hörspiel „Die Belagerung“ entstand nach der Erzählung Friedrich Schillers „Merkwürdige Belagerung von Antwerpen in den Jahren 1584 und 1585“ aus dem Jahre 1795.
Simon und die NixeThalassia
Simon, ein Rostocker Junge, hört immer wieder gern und begierig die Geschichten seines Bruders, der ein Seefahrer ist. Stets bringt der von seinen Reisen in abenteuerliche Welten für die ganze Familie etwas mit. Und an jedem seiner Mitbringsel hängt eine spannende Geschichte.
Ob er sich die wohl ausgedacht hat?
Das kann nicht sein, denn Simon begegnet wirklich der kleinen Nixe Thalassia und ihrem Vater, dem Meeresgott Poseidon.
Und da ist dann noch eine Sache mit einem versunkenen Schiff. Und einer Glocke.
Der Autor entführt uns in die Wunderwelt des Meeres.
Was immer euch versprochen wird oder: Vielleicht sollen wir anfangen zu beten. Kriminalerzählung
Jegliche Zeit hat ihre Geschichten. Diese erzählt von Menschen, die Verbrechen begehen und Verbrechen zum Opfer fallen. Verbrechen, die der Einzelne nicht immer als solche erkennt, wenn sie gesellschaftliche Normalität, Norm, geworden sind. Die zehn Gebote gehören der Vergangenheit an.
Die Figuren der Handlung allerdings sind erfunden. Sollte jemand glauben, er selbst sei gemeint, ihm sei versichert, er ist es nicht. Er passt nur in ein Raster. Dafür kann der Autor nicht. Er kann nicht dafür belangt werden, dass uns solche Menschen in der Realität begegnen.
Und das jeden Tag.
Westindienfahrer. Eine Seeräuberballade
Westindien - Traum vom Reichtum und von der Liebe schöner Frauen. Westindien - Traum vom Leben in Sorglosigkeit.
Dorthin zieht es die Männer, die im Jahre 1640 mit einer holländischen Fleute in die Inselwelt der Karibik eintauchen.
Sie haben den großen Krieg in Europa hinter sich gelassen, sie haben ein Ziel:
Santo Domingo, Haiti. Dort sollen sich ihre Hoffnungen erfüllen!
Es kommt anders. Die Fleute gerät in das Feuer spanischer Galeonen, das Wrack erreicht mit Not den rettenden Strand. Die wenigen Überlebenden sind glücklich gelandet: auf Tortuga.
Hier treffen sie auf Geld und Macht, und hier treffen sie auf Amelie und Jaqueline, die schönsten Frauen, denen je ein Bordell gehörte. Und sie begegnen der Liebe, wie es sie nur auf Tortuga gibt.
Aber die Sache hat - begreiflicherweise - einen Haken: Tortuga ist Pirateninsel. Und wollen die Männer ihren Unterhalt verdienen, müssen sie es tun wie alle - auf See: Mit Intrige und Raub und Mord. Mit Kaperfahrt gegen die spanische Silberflotte.
Inhaltsverzeichnis
Impressum
ERSTER TEIL: Insel
Das Gefecht
Das Wrack
Cowler, als Held
Ankunft im Paradies
Ein Zwischenfall
Ulrich Frohriep
E-Books von Ulrich Frohriep