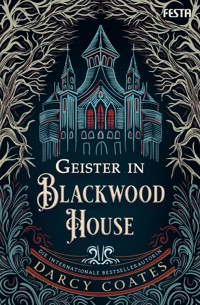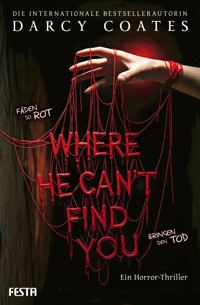
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Festa Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Abby Ward lebt in einer Stadt, in der immer wieder Menschen verschwinden. Wenn man die Leichen findet, sind die Körper zerstückelt und auf bizarre Weise wieder zusammengenäht. Mit roten Fäden … Deshalb leben Abby und ihre jüngere Schwester Hope nach strengen Regeln, die sie schützen sollen – und dennoch passiert es: Hope wird entführt. Verzweifelt versucht Abby, sie zu finden. Und sie muss sich beeilen, bevor der Stitcher ihrer Schwester die Körperteile abtrennt. Ist der Mörder wirklich ein Mensch? Oder ist der Stitcher etwas Dunkleres, Übernatürliches? Die Spur führt hinab in die alten Stollen unter der Stadt. Ein Horror-Thriller der australischen Bestsellerautorin, der tatsächlich unter die Haut geht. Die Fans von Darcy Coates lieben es, wenn beim Lesen die kalten Finger der Angst die Wirbelsäule hinaufkrabbeln.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 530
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Aus dem Amerikanischen von Claudia Rapp
Impressum
Die amerikanische Originalausgabe Where He Can’t Find You
erschien 2023 im Verlag Sourcebooks Fire.
Copyright © 2023 by Darcy Coates
Copyright © dieser Ausgabe 2025 by
Festa Verlag GmbH
Justus-von-Liebig-Straße 10
04451 Borsdorf
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung:
Published by Arrangement with
SOURCEBOOKS LLC, NAPERVILLE, IL 60563 USA
Dieses Werk wurde vermittelt durch die
Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Titelbild: Blunt Design / 99Designs
Illustrationen: Skylar Patridge
Alle Rechte vorbehalten
eISBN 978-3-98676-225-4
www.Festa-Verlag.de
TEIL 1
VORHER
Die Luft war modrig, stechend kalt und schwer vor Feuchtigkeit, die mit jedem Atemzug in ihre Kehle drang, so dicht, dass es sich anfühlte, als wollte sie January ersticken.
Sie kroch durch die Dunkelheit, während scharfe Felskanten ihre Handflächen, ihre Knie, ihre Schulterblätter aufschürften. Sie zuckte zusammen, ließ sich noch tiefer hinab und zog den Kopf ein, um durch den schmalen, engen Tunnel zu passen. Ihre Hände tasteten sich vor, um einen Weg vorwärts zu finden.
Wie lange war sie schon hier unten, in der Dunkelheit, in der Kälte, wo alles klamm und feucht war?
Tage?
Wochen?
Sie durfte nicht innehalten, musste in Bewegung bleiben. Das Ding im Dunkeln würde schon bald zurückkommen, um sie zu holen. Und sie glaubte nicht, dass sie es beim nächsten Mal überleben konnte.
Ihre Finger berührten etwas Zartes, Ekelhaftes. Fäden, die sich vor ihr im Dunkeln kreuz und quer spannten. Sie waren dünn wie Spinnweben und glitschig von der Feuchtigkeit. Als sie versuchte, sie beiseitezuwischen, wollten sie einfach nicht reißen.
Sie konnte sie nicht sehen, aber sie wusste, welche Farbe sie hatten. Rot. Es waren immer rote Fäden. Sie verliefen durch das Labyrinth, fingen Tropfen aus der Luft, wickelten sich über die Felsen und waren ineinander verwoben. Sie schnitten in Januarys Haut, wenn sie versuchte, mit Gewalt an ihnen vorbei- oder durch sie hindurchzugelangen. Schnitten in ihren Hals, in ihr Gesicht, in ihre tauben Finger.
Ein entferntes Geräusch gesellte sich zum Hintergrundlärm aus tropfendem Wasser und ihren eigenen unsteten, im engen Tunnel widerhallenden Atemzügen. Januarys Herz machte einen Satz und bebte hektisch in ihrer Brust. Sie schlug sich eine Hand über den Mund und versuchte verzweifelt, ihren Atem zu dämpfen.
Es konnte nicht gut im Dunkeln sehen. Im Labyrinth gab es kein Licht; January hatte nun schon so lange ins Nichts gestarrt, dass sie angefangen hatte zu halluzinieren, dass sich um sie herum Dinge bewegten. Unnatürlich geformte Gestalten tanzten über die Felswände, verspotteten sie und verschwanden dann, sobald sie direkt hinsah.
Das Geräusch ertönte erneut: Hände, die sich an Felsen abstützten, während es näher heranrobbte, sich vorwärtszog. Das Schaben von Haut gegen Haut. Ein trockenes, hohles Ausatmen.
Es konnte nicht gut sehen, aber es konnte hören und riechen.
Es wusste, wo sie war.
Die Angst war stärker als der Verstand. January warf sich nach vorn, kämpfte sich weiter. Sie spürte gar nicht, dass die Felskanten ihr die Handflächen aufschnitten, spürte auch nicht den Blutstropfen, der ihr über die Wange rann. Aber sie fühlte, wie die Fäden sich enger um sie zogen, während sie sich darin verfing.
Sie hatte sich direkt in sie hineingestürzt. January drängte weiter und versuchte, sich daraus zu befreien, zappelte dabei wie ein Insekt in einem Spinnennetz. Einige der Fäden rissen, verschafften ihr gerade so viel Spielraum, dass sie sich ein paar Zentimeter vorwärtsbewegen konnte, dann noch ein Stück, bis sie fast durch das Netz der roten Fäden hindurch war …
Eine kalte Hand schloss sich um ihr Bein. January blieb gerade noch genug Atem, um zu schreien. Dann zerrte das Ding in der Dunkelheit sie zurück zu sich, und ihre Stimme verklang im Nichts.
1
»Willst du was Schlimmes sehen?«
Als Abby aufwachte, klebte ihr die Kleidung an der Haut, der Schweiß war eiskalt. Ihr Atem kam als raues Keuchen, während sie ins Dunkel starrte, das ihr Zimmer flutete.
Die erste Warnung waren immer die Albträume. Sie kamen vor allen anderen Zeichen – vor den Vögeln, die vom Himmel herabstürzten, vor den Straßenlaternen, die alle gleichzeitig erloschen, vor der Krankheit.
Vor dem Verschwinden der Menschen.
Sie streckte die Hand nach ihrem Nachttisch aus und drehte die Uhr um, damit sie sie sehen konnte. Viertel nach vier. Sie beobachtete, wie der Minutenzeiger sich bewegte, um sicherzugehen, dass die Zeit noch im Takt war. Die Technik versagte jedes Mal, wenn es richtig schlimm wurde.
Sie hatte nun schon seit fast zwei Wochen Albträume. Aber dieser war der schlimmste bisher gewesen – eine Erinnerung an jene Nacht bei Jessica. Es hatte eine Übernachtungsparty mit mehreren Mädchen werden sollen, aber Abby war als Einzige gekommen. Sie und Jessica hatten eine halbe Stunde lang am leeren Esstisch gesessen, keine Eltern in Sicht, bevor Jessica die vernichtende Frage gestellt hatte.
»Willst du was Schlimmes sehen?«
Das war das erste Mal, dass Abby eine Leiche gesehen hatte.
Aber nicht das letzte Mal.
Jetzt war ihr Mund trocken wie Papier. Der Schweiß ließ ihre Haare hinten im Nacken kleben, als sie aus dem Bett glitt. Die hölzernen Dielen knackten, als sie aus ihrem Zimmer schlich und über den Flur zu dem ihrer Schwester ging.
Hope lag auf dem Bauch, einen Arm über dem Kopf, die Decken verknäuelt.
Das Fenster über ihrem Bett war einen Spaltbreit geöffnet. Hope mochte es, nachts die kalte Luft zu spüren, aber eigentlich sollten sie – durften sie – weder Türen noch Fenster oder sonst irgendwas nach Einbruch der Dunkelheit unverschlossen lassen. Abby wollte ihre Schwester nicht wecken, also machte sie sich geräuschlos daran, das Fenster hinabzuziehen und zu verriegeln.
An der gegenüberliegenden Wand, nahe der Tür, stand Hopes Schreibtisch. Darauf ihre Ausstattung inklusive Webcam, Ringlicht und Computer, welcher mit der Schnittsoftware klarkam, die sie brauchte, um ihre Videos zusammenzustellen. Auch jetzt, da die Technik ja zunehmend unzuverlässig funktionierte, war es Hope ernst mit dem Vorhaben, daraus eine Karriere zu machen. Und Abby glaubte, dass sie womöglich wirklich die Chance dazu hatte.
Als Hope angefangen hatte, Videos zu posten, hatte es sich angefühlt, als würde sie in den leeren Äther rufen. Sie bekam jedes Mal eine Handvoll Views, aber keine Likes. Keine Kommentare. Später gab sie zu, dass sie kurz davor gewesen war, aufzugeben, als ihre ersten Fans auf sie aufmerksam wurden. Zuerst waren es nur fünf Accounts – aber jene fünf Menschen schauten sich jedes einzelne Video an und kommentierten auch jedes Mal, wollten mehr. Also filmte sie weiter. Postete weiter.
Inzwischen hatte sie fast 2000 Abonnenten. Die ersten kleinen Sponsoren-Deals waren erfolgt. Und diese ersten fünf Follower waren immer noch da, freuten sich immer noch über jedes neue Video, und Hope antwortete ihnen auch immer und bedankte sich bei ihnen.
Abby hatte Hope nicht gesagt, dass diese fünf Accounts alle ihr gehörten. Wahrscheinlich würde sie das niemals tun.
Sie verließ das Zimmer auf leisen Sohlen. Am Ende des Flurs war das Zimmer ihrer Mutter, die Tür war nicht ganz geschlossen. Abby schlang die Arme um die Brust, während sie näher herantrat und sich vorbeugte.
Mondlicht drang durch die dünnen, zerschlissenen Vorhänge, ließ die Kanten der Silhouette ihrer Mutter klar hervortreten. Diese saß am Ende ihres Bettes und starrte die Wand an.
Das Licht reichte kaum aus, ihr langes, ungewaschenes Haar sehen zu können. Die harten Züge ihrer schmalen Lippen. Ihre lange, zartgliedrige Nase.
Abby hatte kein Geräusch gemacht. Hatte nicht einmal geatmet. Aber ihre Mutter schien ihre Gegenwart dennoch zu spüren. Sie drehte sich abrupt um, ein Auge blitzte in dem kalten Licht auf. Abby entfernte sich rückwärts, die Zunge zwischen die Zähne gepresst.
Sie erlaubte sich erst wieder einen Atemzug, als sie in ihrem eigenen Zimmer war. Dann rollte sie sich in ihrem Bett zusammen, die Knie bis zur Brust gezogen.
Sie würde in dieser Nacht keinen Schlaf mehr finden. Sie griff nach ihrem Telefon und war dankbar, als der Bildschirm nach einem ganz kurzen Flackern hell wurde.
Sie tippte auf die Gruppe mit dem Namen Jackrabbits, öffnete den Chat und tippte: Irgendjemand wach?
Eine Antwort von Rhys. Bin hier. Und dann, fast sofort im Anschluss: Alles okay?
Er fragte immer. Jedes einzelne Mal. Abby konnte praktisch vor sich sehen, wie er die Schultern hochzog und wie sein Blick sich verdüsterte, so wie es immer der Fall war, wenn er spürte, dass Gefahr im Anzug sein könnte. Niemand von ihnen nahm eine mögliche Bedrohung auf die leichte Schulter, aber er hatte ein besseres Gespür, eine feinere Antenne dafür als jeder andere in ihrer Gruppe. Dadurch war er stets auf der Hut, immer vorsichtig.
Abby konnte es ihm nicht verdenken.
Wenn man bedachte, was der Stitcher seinen Eltern angetan hatte.
Alles in Ordnung, schrieb sie zurück, und sie kannte ihn gut genug, um sich vorzustellen, wie seine Anspannung langsam wieder nachließ. Sie zögerte, fügte dann aber hinzu: Ich hatte einen Albtraum.
Ich auch, schrieb er. Schlimme Nacht.
Ja. Abby drehte sich auf den Bauch und zog die Decken über sich zusammen. Sie mochte allein hier in ihrem Zimmer sein, aber der Gruppenchat sorgte dafür, dass sie sich nicht gänzlich abgekoppelt und im freien Fall fühlte. Sie brauchte die anderen ebenso sehr, wie die auch sie brauchten.
Eine neue Nachricht erschien, diesmal von Riya. Hey Leute. Gefolgt von: Rhys?
Er antwortete mit einem schlichten Fragezeichen.
Eine lange Pause entstand. Riya überlegte offenbar sehr genau, was sie als Nächstes schrieb. Abby spürte, wie sich ein flaues Gefühl in ihrem Magen breitmachte, während sie wartete. Ein Flackern wie von weißem Rauschen tauchte auf der unteren Hälfte ihres Displays auf, verschwand aber gleich wieder.
Dann erschien Riyas nächste Nachricht: Kannst du gerade schlechte Neuigkeiten ertragen?
Seine Antwort kam schnell und eindeutig. Ja. Was ist passiert?
Abbys Unbehagen wurde stärker.
Ich glaube, sie haben eine Leiche gefunden. Auch Riyas Gesicht sah sie vor sich, beklommen und angespannt und verängstigt. Bei uns fuhr gerade die Polizei vorbei, Richtung Breaker Street.
Wieder entstand eine Pause. Sie mussten die Nachricht verdauen.
Rhys antwortete als Erster.
Okay. Treffen wir uns.
2
Abby schob nur noch rasch einen Zettel unter Hopes Tür hindurch, auf den sie geschrieben hatte, wo sie hingehen würde.
Das war eine ihrer Regeln: nicht weggehen, ohne jemandem Bescheid zu sagen.
Ihr silbernes Rad wartete an die Hauswand gelehnt auf sie. Sie lief damit zur Straße, stieg dann auf und fuhr auf die Hauptstraße zu.
Wenn jemand etwas Nettes über Doubtful, Illinois, sagen wollte, dann nannte er oder sie den Ort ein fahrradfreundliches Städtchen. Aber im Grunde war damit lediglich gemeint, dass Autos zu unzuverlässig waren. Die meiste Zeit über liefen sie, funktionierten wie erwartet. Aber manchmal würgte man den Motor ohne Vorwarnung einfach ab. Oder der Wagen kam abrupt zum Stehen, obwohl niemand auf die Bremse getreten war. Oder das Auto sprang schlichtweg nicht an.
Die Mechaniker im Ort schauten sich das betreffende Fahrzeug an und sagten: Es hat den Flattermann. Das war ihr Ausdruck dafür, dass sie keinen technischen Fehler finden konnten, der Wagen aber einfach nicht laufen wollte.
Und es waren ja nicht nur Autos. Telefone waren unzuverlässig. Straßenlaternen gingen plötzlich aus, Fernseher zeigten weißes Flimmern oder eine kranke Mischung aus zwei einander überlappenden Sendern, bei denen Ton und Bild zu einem doppelten Brei wurden.
In Doubtful gingen Dinge eben leicht kaputt.
Das galt allerdings nicht für Fahrräder. Reifengummis, Speichen und Backenbremsen brauchten keine Elektrizität, also ließ die zersetzende Wirkung des Ortes sie in Ruhe. Wenn man sicher sein wollte, dass man hier von A nach B kam, dann fuhr man Fahrrad.
Abbys Atem kam in heißen, hastigen Zügen, wirbelte in immer größeren Kreisen hinter ihr fort. Sie radelte schnell, spürte die Luft, die um ihren Körper strich wie in einem Trichter, während ihre Beine mit der Anstrengung immer wärmer wurden und sie sich in diesem Augenblick fühlte, als könnte sie schneller sein als die Dunkelheit, ihr davonfahren. Eine Laterne hinter ihr blinkte und erlosch dann, als wäre es eine Kerze, der man die Luft zum Brennen genommen hatte. Sie fuhr noch schneller.
Es war immer noch eine ganze Weile hin bis zur Morgendämmerung. Die Häuser rings um sie lagen im Dunkeln. Wenn kein Licht brannte, war es manchmal schwer zu sagen, in welchen davon Menschen im Schlaf lagen und welche seit Jahren verlassen waren.
Ein Schatten raste auf sie zu, war wie ein Phantom aus einer der Seitenstraßen aufgetaucht. Er flog näher heran, bis er neben ihr fuhr und sich ihrer Geschwindigkeit anpasste. Im aufscheinenden Licht der nächsten Laternen konnte sie sein dunkles Haar und die wilden, aufmerksam spähenden Augen erkennen. Rhys.
Sie wechselten einen Blick und konzentrierten sich dann wieder auf die Straße vor ihnen.
Geh nicht allein. Das war eine weitere Regel der Jackrabbits. Rhys hätte auch eine direktere Route zur Breaker Street nehmen können, aber er hatte stattdessen den längeren Weg gewählt, um mit Abby zu fahren.
Der Asphalt unter ihnen verschwand. Rhys trat mit genau derselben Kraft wie sie in die Pedale, und sie blieben gleichauf, kannten jede Kurve, bis das rostige Straßenschild aus der Düsternis auftauchte und die Breaker Street ankündigte.
Abbys Lunge brannte vor Anstrengung, aber es war ein guter Schmerz. Er sagte ihr, dass sie am Leben und in Bewegung war. Dass ihr Körper stark war. Sie ließ das Rad ausrollen und stützte dann einen Fuß auf, während sie die Straße hinaufstarrte.
Die Lichter blitzten rot und blau, erhellten den Asphalt und die verwaschen wirkenden Häuser. Sie zählte drei Streifenwagen und zwei Krankenwagen, alle schräg und hastig auf einem Rasen geparkt, der schon lange vertrocknet und von mickrigem, raschelndem Unkraut überwuchert war.
Breaker Street war eine Wohnstraße, grenzte aber direkt an eine Reihe gewerblicher Hallen: würfelförmige Gebäude mit vergitterten Fenstern und flachen Dächern. Die Bauten in dieser Gegend waren alle zur gleichen Zeit – Jahrzehnte bevor Abby geboren wurde – errichtet und dann vernachlässigt worden, um langsam herunterzukommen.
Rhys berührte sie sacht am Arm, um ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen, und nickte dann zu den Geschäften auf der anderen Straßenseite hinüber. Zwei Gestalten standen im Schatten der Gebäude. Riya, klein und starr, die Haare straff geflochten, hatte einen Arm erhoben, um sie herüberzuwinken. Direkt hinter ihr stand Connor, das lockige, flachsblonde Haar vom Schlaf zerzaust, während seine großen Zähne auf seiner Unterlippe kauten, um so seiner Nervosität Herr zu werden. Abby und Rhys überquerten schweigend die Straße, um sich zu den beiden anderen zu gesellen.
»Da ist eine Leiter«, flüsterte Riya, als sie drüben ankamen. Im hektisch wechselnden blau-roten Licht wirkte selbst ihr warmer Teint blass und fremd. Sie nickte zu der Werkstatt hinter ihnen. Dort wurden früher einmal Schilder gemalt, aber nun stand das Gebäude bereits seit mehr als einer Dekade leer. In den beschlagen aussehenden Fenstern hing immer noch Werbung und versprach 40 Prozent Rabatt auf alles. »Vielleicht können wir von weiter oben besser sehen.«
Rhys blickte die Eisenleiter hinauf, die an der rückwärtigen Wand des Gebäudes angeschraubt war. »Gut entdeckt«, sagte er.
Sie ließen die Räder an der Rückseite des Ladens stehen, wo es unwahrscheinlich war, dass man sie sehen würde. Die Firmen und Geschäfte entlang dieses Straßenabschnitts, direkt hier am Stadtrand, waren schon lange sich selbst überlassen worden. Rost fiel in Flocken von der Leiter, als Abby hinaufstieg, und die Wand war voller Risse, die im Zickzack den Steinkanten folgten, die unter dem Beton verborgen lagen wie die Landkarte einer geheimen Stadt. Sie erreichte das obere Ende und schwang die Beine über die halbhohe Dachmauer.
Das Flachdach war leer und unbewachsen, abgesehen von haufenweise verrottendem Laub in den Ecken und einem Stapel alter Kisten und zurückgelassener Möbel, die zum Wegwerfen gedacht gewesen waren, aber dann offenbar vergessen wurden. Die niedrige Mauer verlief einmal ringsherum wie eine Brustwehr, und Abby hielt den Atem an, als sie das Dach überquerte, um von der Vorderseite einen besseren Blick auf die Straße zu bekommen.
Auf der anderen Seite der Hauptstraße war an der Breaker Street eine Menge los. Abby ging in die Hocke und stützte die Arme auf die Brüstung, während ihre Freunde sich neben ihr niederließen.
Die Häuser entlang der Straße sahen aus, als wären sie alle derselben Backform entsprungen: Präriestil mit ausgetretenen Veranden und Fensterläden, ringsum jeweils ein Lattenzaun, sodass der allgegenwärtige Rasen in gleich große Portionen geteilt wurde.
Sie mochten einmal schön ausgesehen haben, aber die Breaker Street war längst dem Lauf der Zeit und der Gleichgültigkeit erlegen. Die Zäune sackten nach innen, und die Grasflächen hatten ihre Farbe verloren. In einem der Gärten ein Stück weiter war Kinderspielzeug liegen geblieben: Dreiräder und eine kleine Rutsche aus Plastik, von Unkraut überwuchert.
Die Polizeiautos parkten alle vor einem der schlimmsten Häuser. Auf dessen Veranda standen in regelmäßigen Abständen Töpfe, aber in keinem davon wuchs eine Pflanze. Die Fensterläden waren zerbrochen, einzelne Latten hatten sich daraus gelöst, und von der Hausverkleidung blätterte die Farbe ab, die schon lange ausgeblichen und nicht erneuert worden war.
Riya lehnte dicht an der Mauer, umfasste mit ihren kleinen Händen die gesplitterte Betonkante, ihr Gesicht angespannt. »Ich komme jeden Tag an diesem Haus vorbei«, sagte sie. »Ich habe da noch nie jemanden drin gesehen.«
Leer stehende Häuser waren nichts Ungewöhnliches in Doubtful. Grundstücke waren billig, aber es gab kaum Jobs, die neue Bewohner hätten anlocken können. Vergessene Zu verkaufen-Schilder standen überall im Ort, verwittert oder bereits umgekippt wie lockere Zähne, einfach aufgegeben und zurückgelassen.
Abby erinnerte sich, dass sie einige dieser leeren Gebäude hatte erkunden wollen, damals, als sie jung und scharf auf Abenteuer gewesen war. Sie hatte schnell gelernt, dass das keine gute Idee war. Es kam allzu oft vor, dass jemand in solchen Häusern Dinge fand.
Gestalten kamen aus dem Haus oder gingen hinein, Taschenlampen in der Hand. Die hinteren Türen des Krankenwagens standen offen, aber Abby konnte nicht sehen, ob da jemand drin war. Das meiste Gewusel schien Polizisten zu betreffen. Ihre Uniformen und Dienstmarken blitzten wieder und wieder im rot-blauen Licht auf, aber die Mützen waren zu tief ins Gesicht gezogen, um irgendeinen von ihnen zu erkennen.
Rhys hatte einen Unterarm auf die Mauer gestützt, während seine dunklen Augen über die Szenerie wanderten. »Denkt ihr, der Neue ist da, den sie angefordert haben?«
Einer der Deputys hatte die Stadt vor fast sechs Wochen verlassen, hatte seine Familie ins Auto gepackt und war abgezischt, ohne auch nur formell den Dienst zu quittieren. Die Stadt war gezwungen gewesen, einen von außerhalb einzustellen. Der Neue und seine Tochter waren offenbar erst vor wenigen Tagen hergezogen, aber Abby hatte bisher weder ihn noch sie gesehen.
»Ich kann mir gar nicht vorstellen, was für ein mieses Willkommen das wäre.«
Connor stöberte in dem Stapel zurückgelassenen Krempels herum, zog schließlich etwas heraus. Er hatte einen Klappstuhl aus Metall gefunden, ganz rot vor lauter Rost. Er schüttelte ihn, um ihn zu öffnen.
»Du holst dir bloß Tetanus«, kommentierte Riya bei den Geräuschen, die das protestierende Metall machte, ohne dabei den Blick von der Straße zu nehmen.
Connor stimmte ihr mit einem Brummen zu, stellte den Stuhl aber trotzdem nahe der Mauer auf und setzte sich hin. Sein helles, dicht gelocktes Haar absorbierte die sich unten drehenden Lichter und wechselte mit jedem Aufblitzen die Farbe.
»Da«, hauchte Riya und reckte sich ein paar zusätzliche Zentimeter. »Seht doch!«
Die Aktivitäten im Haus schienen sich nur noch in einem Raum abzuspielen. Die Lichtkegel der Taschenlampen kreuzten sich, waberten hektisch und ließen das Licht aus Lücken in den zerbrochenen Fensterläden oder zwischen den zerschlissenen Vorhängen hindurchdringen.
Abby reckte sich mit angehaltenem Atem nach vorn; sie wusste, was als Nächstes kam. Ein Teil von ihr wollte es nicht sehen, aber der größere, stärkere Teil musste es sehen.
So überlebte man in Doubtful.
Man beobachtete, sah zu, sah hin. Man lernte daraus.
Und man stellte die Regeln auf, die einen retten konnten. Man befolgte sie.
Gestalten erschienen im Türrahmen und trugen etwas auf einer Bahre heraus. Sie trugen dicke Handschuhe. Breite Masken bedeckten die untere Hälfte ihrer Gesichter. Sie hatten die Köpfe geneigt, blickten leicht seitlich nach unten, behielten erst die eingesunkene Veranda im Blick, dann die Stufen, die hinunterführten, und dann das ausgetrocknete Gras auf dem Weg zum Krankenwagen. Abby gewann den Eindruck, dass sie nicht nur darauf achteten, wohin sie traten, sondern gleichzeitig verzweifelt zu vermeiden versuchten, ihre Last genauer anzuschauen.
Das Ding auf der Bahre war mit einem weißen Tuch bedeckt. Es war nicht groß genug, um ein kompletter Mensch zu sein.
Aber es war zweifellos ein Teil eines Menschen.
Der ersten Bahre folgte sogleich eine zweite. Auch hier war die Last von einem Tuch bedeckt. Diesmal war das Ding größer, aber immer noch nicht groß genug für einen kompletten Leichnam.
Abby erhaschte einen Blick auf die Augen der Beamten: in Abscheu zusammengezogen.
»Was glaubt ihr, was das war?«, fragte Connor.
Abby konnte sich nicht überwinden, ihm eine Antwort zu geben. Es fühlte sich alles zu grauenvoll an, zu bitter, so als würde sie darauf wetten, wessen Familie später am Morgen einen Anruf bekäme. Wessen Leben unwiederbringlich verändert werden würde.
Eine dritte Bahre verließ das Haus, und diesmal bedeckte das Tuch etwas Kleineres als bei den beiden anderen.
Riya sog rasch die Luft ein. »Es ist mehr als eine.«
Abby bedachte sie mit einem Blick. Riyas Augen glänzten beinahe fiebrig.
»Ich habe drei Füße gezählt. Diesmal haben sie mehr als eine Leiche gefunden.«
Abby lehnte sich weiter vor, während ihr Herz immer schneller schlug. Unter ihren Händen spürte sie Splitter des bröckelnden Betons. Die erste Bahre war bereits in einem der Rettungswagen verladen worden, aber sie glaubte, dass Riya recht hatte. Die einzelnen Bündel stellten jeweils keinen kompletten Leichnam dar, aber zusammengenommen summierten sie sich zu mehr als einem.
Der Beamte, der die letzte Bahre mit heraustrug, glitt auf den Stufen der Veranda aus. Selbst aus dieser Entfernung konnte Abby hören, wie er einen erschrockenen Schrei ausstieß. Die Bahre neigte sich, das große Tuch rutschte herunter. Ein anderer Polizist sprang ihm bei, packte das Tuch und zerrte es wieder über die Last auf der Bahre, aber er war nicht schnell genug.
Sie sah kurz das, was darunter lag.
Haut. Und den roten Faden, der hindurchgewoben war, mit dem man sie wieder zusammengenäht hatte.
»War das …« Connors Stimme verlor jede Heiterkeit. Seine Worte kamen gedämpft und mit deutlich hörbarem Unwohlsein aus seinem Mund. »Eine Hand?«
Ja und nein. Ein Teil einer Hand. Und andere Teile.
Angewidert und wie gelähmt beobachtete sie, wie die letzte Bahre in den Rettungswagen gehoben wurde und darin verschwand.
Dann packte Rhys auf einmal ihren Oberarm. »Vickers«, flüsterte er. Alle vier reagierten wie eine Person, duckten sich ganz schnell unter die Mauerbrüstung.
Rhys musste nicht erklären, was er gemeint hatte.
Charles Vickers war hier. Natürlich war er das.
Er war an jedem Tatort, bei jedem neuen Fund. Oft schon bevor die Polizei eintraf.
Das Dach der Firma war dunkel. Es wäre schwierig, sie hier oben auszumachen. Langsam und mit angehaltenem Atem richtete Abby sich stückchenweise wieder auf, bis sie über die niedrige Mauer blicken konnte.
Charles Vickers befand sich auf der Veranda gegenüber. Er saß in einem Schaukelstuhl und hatte die Hände im Schoß gefaltet. Sein helles Haar, das sich am Oberkopf zur Glatze lichtete, war ordentlich gekämmt und er trug einen seiner marineblauen Pullover. Ein kompliziertes Strickmuster spannte sich über seinen Oberkörper. Er machte den Eindruck, als wäre er gerade vor die Tür gekommen, um hier zu entspannen.
Nur war das nicht sein Haus. Charles Vickers wohnte am anderen Ende des Ortes, in der Stokes Lane.
Es schien ihm absolut nicht unangenehm zu sein, in einem fremden Schaukelstuhl zu sitzen, auf einer Veranda, die ihm nicht gehörte, um von dort den Schauplatz eines Verbrechens zu beobachten, der auf der anderen Straßenseite abgeriegelt wurde.
»Wie lange sitzt er denn schon dort?«, fragte Abby, obwohl sie wusste, dass keiner der anderen das beantworten konnte.
Die Veranda lag im Schatten und seine Kleidung war dunkel. Er war kaum zu erkennen, abgesehen von der unauffälligen rhythmischen Bewegung, mit der er in trägen Schwüngen vor und zurück schaukelte.
Er mochte bereits da gewesen sein, als sie und Rhys auf ihren Rädern vorbeigerast waren. Mochte im Dunkeln gesessen und sie beobachtet haben.
»Sie haben ihn auch gesehen«, flüsterte Riya.
Zwei Polizeibeamte überquerten mit langsamen, gemessenen Schritten die Straße, von hinten abwechselnd blau und rot beleuchtet. Einer von ihnen blieb mitten auf der Straße stehen, stemmte die Hände in die Hüften und platzierte sich breitbeinig wie ein Fels. Die Beamtin ging noch ein paar Schritte weiter, bevor sie ebenfalls stehen blieb. Sie sprach jetzt mit Vickers.
»Ich wette, er hat sie hergerufen«, murmelte Riya.
»Hä?«, machte Connor.
Riyas Stimme klang angespannt. »Woher sollten sie sonst wissen, dass sie die Leichen dort finden würden? Wer untersucht denn verlassene Häuser um vier Uhr in der Frühe? Vickers hat das so arrangiert und sie dann gerufen und sich hingesetzt, um zuzuschauen, wie sie seinen Tatort untersuchen.«
Das ergab viel zu viel Sinn. Er wurde immer dreister.
Die Unterredung konnten sie hier oben nicht hören, aber sie schien sich hinzuziehen. Vickers wirkte wie immer ruhig und schaukelte langsam, während er sprach.
Dann erhob er sich schließlich aus dem Stuhl.
Charles Vickers gab eine einschüchternde Gestalt ab. Er war nicht außergewöhnlich groß und versuchte auch nicht, bedrohlich zu wirken. Meistens trug er Strickpullover oder Windjacken, auch im Sommer. Seine Schultern waren gerundet, sein Gebaren unscheinbar und gleichmütig. Er sah aus, als könnte er ein Lehrer an der High School sein, ein Berufsberater oder ein Sporttrainer.
Bis man sein Lächeln sah. Er lächelte stets nur leicht, auf eine beunruhigende Weise, denn sein Lächeln war wissend, heimlich. Als wüsste er über einen großen Scherz Bescheid, den man selbst nicht verstand. Als würde er einen hinter seinen geschlossenen Zähnen auslachen.
Er trug dieses Lächeln im Gesicht, als er die Stufen der Veranda herunterkam. Die beiden Polizeibeamten traten jeweils einen Schritt zurück. Er sagte etwas, hob die Hand zum Gruß und wandte sich dann ab.
»Sie müssen ihm gesagt haben, dass er weitergehen soll«, stellte Connor mit kratziger Stimme fest. »Seht ihr? Er trollt sich.«
Charles ging die Breaker Street bis zum Ende entlang, dann den Gehweg mit den vielen Rissen im Asphalt, und bog schließlich in die Hauptstraße ein. Er war schon fast an dem Firmengebäude vorbei, als er innehielt.
Abbys Herz zog sich schmerzhaft zusammen. Charles Vickers stand jetzt beinahe direkt unter ihrem Versteck. Er legte den Kopf zurück und spähte schräg hinauf zu ihnen. Und schenkte ihnen sein leichtes, wissendes Lächeln, das höhnisch wirkte.
Sie wichen unwillkürlich zurück. Abbys Schulter drückte gegen den Beton der niedrigen Mauer. Sie spürte Riyas Atem heiß und hastig in ihrem Nacken.
Charles Vickers’ Lächeln wurde ein winziges bisschen breiter, der entstehende Schlitz entblößte nur wenig von den kleinen, makellosen Zähnen. Dann wandte er sich wieder ab, ging weiter den Gehweg entlang und verschwand in den Straßen des Städtchens.
Abbys Blut rauschte zu schnell durch ihre Adern. Ihre Kehle schmerzte. Auch nachdem Vickers fort war, konnte sie sich nicht wieder entspannen.
Riya stöhnte, ließ sich gegen die Mauer sinken und lehnte sich zurück. Es schien sie nicht zu stören, dass sie in einem Haufen modernder Blätter und vergessenem Abfall saß. Connor hievte sich umständlich auf die Beine und machte sich erneut auf dem rostigen Stuhl breit, die Beine schief aufgestellt, eine Hand auf die Brust gepresst. Sein Herz raste.
»Er ist der Stitcher.« Riya spie die Bezeichnung geradezu aus, als wäre es ein Fluch, ein Schimpfwort. »Noch mehr Leichen, und die Polizei lässt ihn einfach gehen. Schon wieder.«
Abby sah sich nach dem Haus um, in dem die menschlichen Überreste gefunden worden waren. Die beiden Beamten, die mit Charles Vickers gesprochen hatten, waren zu ihren Kollegen zurückgekehrt. Ein anderer Polizist rollte Absperrband von der Rolle, markierte damit das gesamte Gebäude und wickelte es rings um das Grundstück. Dort würde es wahrscheinlich bleiben, bis sich die Knoten lösten und das Plastik verrottete, bis einzelne Streifen sich im Wind losrissen und im Matsch oder in den Büschen verloren gingen. Genau wie all die anderen Male.
Ein zerrissenes Spinnennetz aus vergessenem Absperrband, das sich über die gesamte Stadt zog.
Der Motor eines Rettungswagens wurde angelassen; es klang wie ein tiefes Knurren, als der Wagen sich bereit machte, die Leichen fortzubringen.
»Zumindest waren wir diesmal hier und haben es gesehen«, sagte Connor. Er zögerte und zog ungläubig die Brauen zusammen. »Das war der Plan, richtig? Erinnert mich noch mal daran, wieso das etwas war, das wir uns unbedingt anschauen wollten!«
»Nur Wissen bietet Sicherheit«, erwiderte Riya und zitierte damit eine ihrer Regeln. Sie schloss die Augen und zog eine Grimasse. Sie hatte aufmerksam und angespannt hinübergestarrt, und Abby wusste, dass ihr nun die Bilder vor Augen standen – rote Fäden, die sich durch die Haut unter dem Tuch zogen.
»Ja, hab ich verstanden.« Connor lehnte sich noch weiter zurück, und der Stuhl ächzte zur Antwort. Er verzog die breiten Lippen zu einem schuldbewussten Lächeln. »Aber da ist ja auch immer noch die Regel, nach der wir im Dunkeln nicht rausgehen sollen. Und nun sind wir trotzdem draußen.«
Riya wedelte unwirsch mit einer Hand. Die Grimasse vertiefte sich. »Du hast recht, aber jetzt ist es ja schon Morgennacht.«
»Was ist es?«
»Ist dir nie aufgefallen, dass das was anderes ist?« Sie öffnete ein Auge zumindest zu einem Schlitz, um ihn ansehen zu können. »Spätnachts und ganz frühmorgens? Du kannst morgens um vier joggen gehen, und die Leute denken maximal, dass du es mit dem Gesundbleiben ein bisschen übertreibst. Aber wenn du um Mitternacht joggen gehst … tja. Dann ist das schräg und macht misstrauisch, richtig? Das findet niemand normal.«
Einen Moment lang saßen sie alle nur da und ließen die Stille auf sich lasten.
Dann sagte Connor: »Ganz ehrlich, Leute. Ich glaube nicht, dass diese Stadt dafür gemacht ist, normal zu sein.«
Die Anspannung der vergangenen Stunde löste sich und flitschte geradezu davon wie ein bis zum Anschlag gezogener Gummi, der plötzlich losgelassen wird. Abby krümmte sich und lachte erstickt in sich hinein, auch wenn ihr die Brust nach wie vor schmerzte. Selbst Rhys neben ihr ließ zu, dass etwas wie ein Lächeln um seine Mundwinkel spielte, bevor auch das wieder schwand.
Dergleichen bekam sie nicht oft zu sehen, aber wann immer es auftauchte, wusste sie es umso mehr zu schätzen. Rhys lächelte fast nie mehr dieser Tage.
»Du weißt doch, was ich meine«, beharrte Riya mit nachdrücklich gehobenen Brauen. »Niemand sollte nach Einbruch der Dunkelheit draußen unterwegs sein. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Abenddämmerung und Morgendämmerung. Und wenn wir eben doch im Dunkeln das Haus verlassen müssen, dann ist mir lieber, es ist an diesem Ende der Nacht.«
Abby wusste, was Riya meinte. Weit entfernt am Horizont hauchte der Morgen seine ersten Atemzüge in die Nacht. Licht bedeutete Sicherheit. Jedenfalls gerade so viel Sicherheit, wie man sich in Doubtful erhoffen konnte.
Und es war immer besser, auf der Nachtseite des herannahenden Tageslichts zu sein statt auf der des abnehmenden.
Der unbeschwerte Moment war kurz gewesen, beinahe verzweifelt. Dann fragte Abby wider besseres Wissen: »Hat noch jemand von euch Albträume?«
»O ja, allerdings«, erwiderte Connor. »Drei allein in der letzten Woche.«
»Mein Fernseher lässt sich nicht einschalten«, meldete sich Riya zu Wort. »Und das Radio klingt seltsam. Es wird wieder schlimmer.«
Eine Polizeisirene schallte plötzlich sekundenlang zu ihnen herauf, bevor der Fahrer sie abschaltete. Einer der Streifenwagen fuhr weg und folgte dem Rettungswagen.
Es wird wieder schlimmer. Wenn der Kreislauf des Grauens, der hier in Doubtful herrschte, einem logischen Muster folgen würde, dann sollte die Entdeckung einer Leiche einen Höhepunkt darstellen, einen Endpunkt, einen finalen Hammer. Aber dem war nicht so. Es wird schlimmer bedeutete weitere verschwundene Menschen. Und zwar schon bald.
»Haltet euch an die Regeln. Vergesst sie nicht«, sagte Rhys. Seine Stimme war sanft, aber sie wandten sich ihm alle zu. »Und haltet euch von Vickers fern.«
Abby dachte erneut daran, wie Vickers zu ihnen hochgeschaut hatte, wie sein heimlichtuerisches, leichtes Lächeln vom Blau und Rot der Warnlichter beleuchtet worden war. Er hatte geradezu entzückt gewirkt. Kalte Schauer flossen durch Abby hindurch, und sie zog sich die Jacke enger um die Brust.
Rhys fuhr fort: »Wenn sich einer von euch aus irgendeinem Grund irgendwo allein mit Vickers wiederfindet, ruft mich an. Wenn ihr euch sonst irgendwo irgendwann nicht sicher fühlt, ruft mich an. Ganz egal wo, ganz egal wann. Ich komme dann.«
Er hatte dieses Versprechen schon mehrfach gegeben, und Abby wusste, dass er es ihnen allen gab. Aber Rhys sah Abby direkt an, als er es aussprach.
Ihr Herz machte diesen seltsamen kleinen Satz, bei dem ihr nicht wohl war und den es manchmal in seiner Nähe machte. Es fühlte sich an, als hätte sie die Anzahl der Stufen im Dunkeln falsch eingeschätzt und würde mit einem Fuß in der Luft landen. Wie bei der Gefahr, zu fallen. Ein mulmiges Absacken des Magens, ein erschrockenes Einatmen. Der Mix aus Schwindel, Aufregung und Schock, wenn der Körper sein Gleichgewicht wiederfindet.
Sie wandte den Blick ab und richtete ihn lieber auf die Sterne über ihnen, die inzwischen rapide verblassten. Sie dachte nicht gern über diese Empfindungen nach oder darüber, was sie bedeuten mochten und wohin es führen würde, wenn sie auf sie hörte.
Es hatte auch überhaupt keinen Sinn, über solche an sich normalen Dinge nachzudenken, denn es gab keine Happy Ends in Doubtful.
3
VERMISST
Nur dieses eine Wort – riesig gedruckt, in fetten schwarzen Großbuchstaben. Es stand unter dem Foto einer Frau, die das blonde Haar zu einem hohen Pferdeschwanz gebunden trug. Sie sah jung aus, gerade mal 19 oder 20, und sie lächelte ganz breit. Ihr Lächeln wirkte zu grell im starken Kontrast des schwarz-weißen Ausdrucks.
Jen starrte den Flyer an, während ihre Hände die Riemen ihres Rucksacks viel zu straff und verkrampft hielten. Es war surreal, dieses Bild auf ihrem Spind zu sehen. Noch surrealer, nachdem sie auf dem Weg zur Schule die Meldungen über Funk mitgehört hatte.
Das ist doch das Mädchen, das sie gestern tot gefunden haben. Oder nicht?
Jen drehte sich um. Dies sollte also ihr erster Tag an der Doubtful High sein. Schon der Name erfüllte sie nicht gerade mit Zuversicht. Sie war früh gekommen, um sich zurechtzufinden und zu schauen, wann sie wo in welchen Unterricht musste, aber auf den Fluren war schon jetzt richtig viel Betrieb, überall schlurfende Schritte und kurze, müde Unterhaltungen.
Niemand schien auf das Suchplakat zu achten.
Hatten sie es denn noch nicht gehört? Wussten sie nicht, dass sich keine 15 Minuten von der Schule entfernt ein Tatort befand? Jens Vater hatte nicht viel erzählt, aber sein angespanntes Gesicht, der harte Zug um den Mund heute früh auf der Fahrt hierher, hatte gereicht, um sie wissen zu lassen, dass es sich um einen schlimmen Fall handeln musste. Sein dritter Tag im neuen Revier, und er war einbestellt worden, zum Tatort zu kommen.
Das Bild des toten Mädchens lächelte Jen von einem halben Dutzend Flächen her an. Wahrscheinlich hatte sie vor nicht allzu langer Zeit hier an der Schule den Abschluss gemacht, und nun klebten die Flyer immer noch an Spinden und Wänden, waren an schwarze Bretter gepinnt.
VERMISST
JANUARY SPALLING
WENN SIE INFORMATIONEN HABEN, WENDEN SIE SICH BITTE UMGEHEND AN DAS POLIZEIREVIER IN DOUBTFUL
Es war auch nicht das einzige Vermisstenplakat. Jen hatte noch zwei andere Gesichter gesehen, als sie die Schule betreten hatte, und ein drittes weiter den Flur entlang. Jeweils ein anderes Foto, ein anderer Name, eine andere Schriftart für die fetten schwarzen Buchstaben, aber abgesehen davon sagten sie alle das Gleiche aus.
Und es schien niemanden zu interessieren.
Leute drängten sich an ihr vorbei, stießen sie an. Schüler und Schülerinnen öffneten ihre Spinde, ohne auch nur einen Blick auf die Zettel zu werfen, die dort angeklebt waren.
Als wäre das alles in Ordnung.
Als wäre es schlichtweg normal.
Jen fühlte sich, als würde ihr das Blut in den Adern gefrieren, als flösse es nur noch langsam und träge durch ihren Körper. Oberflächlich betrachtet schien die High School nicht so anders als die, die sie in New York besucht hatte. Ein bisschen älter, ein bisschen farbloser, trostloser. Zwei der Deckenlampen im Flur funktionierten nicht. Aber das alles sollte eigentlich nicht dafür sorgen, dass sie sich so extrem unwohl fühlte. Etwas an dieser Stadt fühlte sich einfach absolut und furchtbar falsch an. Alles andere als normal.
Sie riss den Zettel von der Tür ihres Spinds ab, faltete ihn zusammen und stopfte ihn dann in ihren Rucksack.
»Du kannst natürlich schon das billige Weißbrot für einen Dollar nehmen, wenn du unbedingt willst, aber ich sage dir, dass du mit der fluffigeren Eins-fünfzig-Variante eben bessere Ergebnisse erzielst«, dozierte Connor.
Sie saßen in der Nähe des Maschendrahtzauns unter der Eiche mit den ausladenden Ästen. Das abstoßende Schulgebäude dominierte auch von hier aus die Aussicht, aber zumindest befanden sie sich weitestmöglich weg davon, ohne das Gelände zu verlassen.
Abby liebte diesen Baum. Seit Jahren war das ihr Treffpunkt für die Mittagspause. Selbst im kältesten Winter zog sie diesen Platz der schäbigen Atmosphäre der Cafeteria mit ihren flackernden Lichtern und schalen Gerüchen oder dem kalten Beton der Treppenhäuser, in denen einige der anderen Schüler zu Mittag aßen, vor.
Sie saß mit dem Rücken zum Baumstamm, Rhys direkt an ihrer Seite und Riya und Connor daneben. Riyas sorgsam geflochtenes Haar lag wie drapiert auf ihrer Lacrosse-Uniform. Abby wusste aus Erfahrung, dass der seidige Zopf am Ende des Sportblocks zerstrubbelt und verschwitzt und wirr aussehen würde. Riya machte in den meisten Lebenslagen den Eindruck, sich wunderbar im Griff zu haben und stets auf ihr Aussehen zu achten, aber wenn es um Sport ging, stürzte sie sich mit einer wilden Intensität in das Training, bei der nur die wenigsten mithalten konnten.
Connor, dessen wild gelockter Schopf von links nach rechts schwankte, hatte gerade seine Box geöffnet, die aussah wie ein kompakter Werkzeugkasten, und baute nun langsam und umständlich sein Mittagessen aus den darin verpackten Zutaten zusammen. Er hatte sich eine Serviette über den Unterarm gelegt wie ein Sommelier und drapierte zwei Scheiben Weißbrot auf den Pappteller, der recht wackelig auf einer Baumwurzel platziert war.
»Das Geheimnis eines guten Schinken-Käse-Sandwichs liegt also darin, unter all den halb künstlichen Wurstwaren im Angebot deines Discounters die mit der höchsten Qualität ausfindig zu machen.« Connor hob einen belehrenden Zeigefinger. »Ich bevorzuge die mit einem Mindestanteil von 30 Prozent Schweinefleisch. Nicht Schweinespeck, wohlgemerkt.«
»Kannst du nicht einfach ein fertiges Sandwich mitbringen?«, wollte Riya wissen. Sie war mit ihrem bereits halb fertig, wovon der verschmierte Soßenfleck in ihrem Mundwinkel kündete.
Connor verzog entsetzt das Gesicht. »Das würde doch stundenlang in meiner Lunchbox vor sich hin schwitzen, und dann würde der Senf in das Brot einziehen und es aufweichen.«
»Natürlich.« Riya seufzte.
Abbys Lunchbox lag neben ihr. Sie war alt und aus steifem Blech gefertigt. Die geprägte Vorderseite wies den Aufdruck einer Waldszenerie auf, ein Aquarell mit kleinen Tieren, die hinter den Bäumen hervorspähten. Die Box hatte etwas Kindliches. Vor zwei Jahren hatte Abby daher versucht, sich eine neue zu kaufen, obwohl sie ansonsten ihr Geld eisern sparte, aber als sie dann ihr Pausenbrot einpacken wollte, konnte sie die alte Blechkiste einfach nicht durch die neue austauschen.
Sie war das letzte Geschenk, das sie von ihrem Vater bekommen hatte. Eine der letzten Erinnerungen, die sie besaß, bevor er versucht hatte, Charles Vickers herauszufordern.
Wie bei viel zu vielen Dinge in ihrem Leben war daraus ein unersetzlicher, bittersüßer Gegenstand geworden. Jeden Tag schmerzte es aufs Neue, wenn sie die Box sah. Aber es würde noch mehr schmerzen, sie aufzugeben.
Sie strich langsam mit den Fingern über das verblasste Aquarell, bevor sie die Box öffnete. Darin befanden sich zwei Sandwiches, eins lag auf dem anderen, und zwei Äpfel. Sie nahm das obere Sandwich heraus und sah zu Rhys hinüber.
Er hatte kein Mittagessen dabei. Der Morgen war immer ein schwieriger Moment für ihn. Manchmal brachte er nicht mehr zustande, als das Haus zu verlassen. Sehr oft vernachlässigte er alles andere, um das zu schaffen. Auch das Essen.
Sie schob ihm die Box zu. »Ich habe mir aus Versehen zu viel gemacht. Hilfst du mir und isst das zweite?«
Er warf einen Blick auf das Sandwich und sah ihr dann ins Gesicht. »Wir wissen beide, dass es kein Versehen war.«
Sie lehnte sich zu ihm hinüber, ihre Schulter stieß gegen seine, und eine Sekunde lang war sie wieder ein Kind, erinnerte sich an das erste Mal, als sie so beieinandergesessen hatten. In der Pause in der ersten Klasse, als sie beide fünf Jahre alt gewesen waren und erschöpft und aufgedreht von ihrem Wettlauf durch und über das Klettergerüst. Damals, als Rhys noch wusste, wie man lachte.
»Nimm das Sandwich. Es wird hier gleich richtig ungemütlich, wenn du es ablehnst.«
»Ach?« Eine seiner Brauen zuckte hoch. Neugierig fragte er: »Ist das eine Drohung?«
Sie konnte ihr Grinsen nicht unterdrücken. »Es ist eine umgedrehte Mobbing-Situation. Du nimmst jetzt mein Pausenbrot oder ich schlag dich zusammen.«
»So gewalttätig«, stellte er tadelnd fest, aber in seiner Stimme lag eine besondere Wärme.
Sie schob die Box mit zwei nachdrücklichen Stupsern zu ihm hinüber – klack, klack –, und er nahm sich endlich das Sandwich heraus.
»Den Apfel auch«, befahl sie und starrte ihn weiter drohend an, bis er das Obst ebenfalls an sich nahm.
»Danke« murmelte er, und das kleine Wörtchen glühte heiß in ihrer Brust.
Connor ignorierte sie beide, während er weiter mit seinem Zubereitungsritual beschäftigt war. Er legte Käsescheiben über den Schinken, rückte sie bedächtig zurecht, damit alles möglichst gleichmäßig bedeckt war.
»Das Ziel besteht darin, einen ausgeglichenen, vollmundigen Geschmack mit jedem Biss zu garantieren. Heute serviere ich mir dazu eine Flasche exquisiten Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat. Vielleicht fällt euch auf, dass dies eine durchaus mutige Aromenkombination darstellt …«
»Am Ende hast du keine Zeit mehr zum Essen, wenn du dich nicht beeilst«, warnte Riya. Sie hatte ihr Sandwich bereits verputzt und wischte sich gerade die Finger mit einer Papierserviette ab.
»O bitte.« Er bat mit erhobenem Finger um Schweigen. »Der Künstler arbeitet hier.«
Seine Finger waren zu weit nach hinten gebogen, wenn er sie hochhielt und ausstreckte. Die Gelenke weiter gedehnt, als Abby mitansehen konnte.
Mit zwölf war bei ihm das Ehlers-Danlos-Syndrom diagnostiziert worden, EDS. Das bedeutete, dass seine Sehnen seine Knochen nicht ausreichend zusammenhielten, nicht so wie bei anderen Menschen. Dadurch war er extrem flexibel und beweglich, aber auch enorm verletzungsgefährdet. Sein Sportlehrer war der Erste gewesen, der seinen Eltern damals geraten hatte, einen Spezialisten aufzusuchen, nachdem die Liste verstauchter Knöchel, ausgekugelter Gelenke und unerklärlicher Blutergüsse zu lang geworden war, um sie zu ignorieren. Connor konnte seine Arme vor dem Körper ausstrecken und dann immer weiter strecken, bis seine Ellbogen ungefähr 20 Grad weiter nach innen zeigten als bei allen anderen. Das war sein favorisierter Partytrick, den er vorführte, wenn er wollte, dass die Leute sich gruselten.
Er sollte solche Verrenkungen allerdings gar nicht machen. Da seine Sehnen die Gelenke nicht richtig zusammenhielten, mussten die Muskeln den Großteil der Arbeit übernehmen. Und die waren nicht dazu gedacht, so weit gedehnt zu werden. Er hatte Abby gegenüber einmal zugegeben, dass sein Arm jedes Mal den Rest des Tages schmerzte, wenn er seine Beweglichkeit demonstrierte.
»Hey«, brachte Riya hervor und setzte sich abrupt auf. »Hey, hey, das ist sie.«
»Hm?« Abby blickte von ihrem halben Sandwich hoch.
»Die Neue.«
»Ui.« Connor reckte den Hals und schirmte die zusammengekniffenen Augen gegen die Sonne ab. »Sie sieht cool aus.«
Riyas Blick war mal wieder etwas zu intensiv. »Ist sie auch. Ist sie echt. Ich hab sie kurz getroffen«, erklärte sie. »Vorhin. Also, ich hab sie gesehen. Wir haben uns nicht wirklich getroffen. Oder geredet. Oder … ja.«
Es war nicht schwer, sie auszumachen, auch wenn viele Schülergrüppchen auf der Wiese des Schulhofs unterwegs waren. Ihre Jacke, die Hose und die Stiefel waren allesamt schwarz, aber dazu trug sie ein leuchtend orangefarbenes Shirt, das deutlich aus der Umgebung hervorstach.
Farben schienen in Doubtful nicht lange durchzuhalten. Das Oberteil des Mädchens strahlte geradezu, war das farbigste weit und breit. Aber falls der Neuen bewusst war, wie sehr sie damit auffiel, schien sie das keineswegs zu stören. Es lag eine gelassene Stärke in ihrem Gebaren und der Art, wie sie sich bewegte. Mit einer Hand in der Hosentasche blieb sie jetzt stehen und ließ den Blick aufmerksam über die vereinzelten Gruppen wandern, die sich auf dem Schulhof befanden. Als wäre sie auf der Suche, auf der Jagd nach irgendwas. Und dann erblickte sie die Jackrabbits, die hier im Schatten der großen Eiche verborgen saßen.
»Sie hat mich doch nicht gehört, oder?« Riya senkte die Stimme, um das zumindest im Folgenden zu vermeiden. »O nein. Nein, nein.«
Sie kam auf sie zu. Zielsicher, den Kopf ein wenig geneigt, während das Haar bei jedem Schritt ganz leicht mitwippte, als wären sie genau das, wonach sie Ausschau gehalten hatte. Sie blieb breitbeinig stehen und hatte nun beide Hände in den Taschen, den Kopf etwas zur Seite gelegt. Sie blickte blinzelnd auf sie hinunter und sagte dann: »Hey. Ich bin Jen.«
»Abby«, stellte diese sich vor, während sie eine Hand zum Gruß hob, und zeigte dann nacheinander auf ihre Freunde. »Rhys. Connor. Und Riya.«
»Ich lieb dein … alles daran«, sprudelte es aus Riya hervor.
Eine Sekunde lang herrschte peinliches Schweigen. Dann zog Jen die Brauen zusammen und erwiderte in zweifelndem Tonfall: »Danke.«
Auf Riyas Gesicht breitete sich tiefe Schamesröte aus. Sie konnte keinem von ihnen in die Augen sehen. Abby drückte kurz beschwichtigend ihre Schulter, bevor sie sich wieder Jen zuwandte. »Du kannst mit uns essen«, bot sie an.
Das war zwar keine ihrer offiziellen Regeln, eher eine stillschweigende Übereinkunft. Es war gefährlich, hier in Doubtful isoliert zu sein. Wenn sie also jemanden sahen, der allein war, versuchten sie, diese Person einzuladen, sich ihnen anzuschließen.
»Ich kann dir ein Sandwich zubereiten«, fügte Connor hinzu und zeigte auf seines, das endlich fertig war. »Da sind saftige Alfalfa-Sprossen mit drin, die ich heute Morgen frisch aus dem Glas auf meiner Fensterbank geerntet habe.«
»Danke«, wiederholte Jen und klang immer noch zweifelnd. »Aber ich schaue nur kurz vorbei.«
Ihr Blick wanderte über sie und machte sich ein Bild. Abby konnte sich vorstellen, wie ihre Gruppe aus Jens Perspektive rüberkam. Connor staksig wie ein Insekt, aber mit einem so breiten und auffälligen Lächeln gesegnet, dass man sich von ihm unmöglich bedroht fühlen konnte. Riya mit dem puterroten Gesicht, winzig und angespannt und makellos in ihrem ordentlichen, hübschen Lacrosse-Outfit. Und sie selbst zu blass, zu bitter, und wie ihr allzu oft gesagt wurde, mit einem Blick, der die meisten Leute nervös machte.
Zuletzt blieb Jens Blick an Rhys hängen. Sie versuchte, ihn einzuschätzen.
Aber das war bei Rhys gar nicht so leicht. Man sah ihm weder an, in welcher Stimmung er war, noch, was er denken mochte. Die meisten Leute mieden ihn und fanden, dass er bedrohlich wirkte. Was zum Lachen war, wenn man ihn näher kannte. Rhys war nicht gefährlich.
Nein, das stimmte nicht ganz, Abby musste sich korrigieren: Er war nur sehr selten gefährlich.
Man brachte ihn nicht leicht in Rage. Er reagierte nicht auf Verhöhnungen oder Beleidigungen. Die Jungs aus der Schule hatten einmal versucht, ihn mit Baseball-Bällen zu bewerfen, um ihn aus der Reserve zu locken, und er hatte kaum auch nur gezuckt.
Sie hatte bisher nur ein Mal gesehen, dass er auf jemanden losging: als Sam Gunner ihr mit einem Hockeyschläger eins übergezogen, ihr quer übers Gesicht geschlagen hatte, wobei ihre Lippe aufplatzte. Blut war geflossen. Das Blut klebte nicht nur an Abbys Mund, es befleckte auch Sams Gesicht und Rhys’ Hände.
Seitdem hatte niemand in der Schule versucht, jemandem aus ihrer Gruppe Ärger zu machen.
Rhys begegnete Jens neugierigem Blick, hielt ihm stand. Während er eingeschätzt wurde, tat er umgekehrt dasselbe. Wenn mehrere Leute zusammenkamen, sagte er kaum je etwas. Aber er war immer auf der Hut, beobachtete stets alles ganz genau.
War stets bereit, seine Freunde zu verteidigen.
Dann brach Jen als Erste den Blickkontakt ab und atmete tief ein. »Darf ich euch mal eine Frage stellen? Wisst ihr, wer January Spalling ist?«
»Oh, na klar«, gab Connor eifrig zurück. Mit mehr Eifer, als Abby behagte. »Das vermisste Mädchen. Na ja, jetzt das tote Mädchen. Sie hat im Postamt gearbeitet.«
Sie hatten heute Morgen von Riya erfahren, wer sie war. Riyas Mutter führte das kleine hiesige Postamt und hatte einen Anruf bekommen, in dem ihr mitgeteilt wurde, dass ihre Angestellte nicht mehr zurückkommen würde. January Spalling war bereits seit drei Monaten vermisst worden.
Jen hob die Brauen. Sie sagte nichts, aber ihr Schweigen war erwartungsvoll, verlangte nach mehr Informationen.
»Sie haben ihre Leiche heute Nacht gefunden.« Connor war immer redselig, und nun platzierte er die letzte Brotscheibe noch einmal neu und betrachtete sein Sandwich mit kritischem Kennerauge. »Ihre und einen Teil von jemand anderem.«
»Was?« Jen machte einen halben Schritt auf sie zu. Sie schien zwar nicht gerade wild darauf zu sein, sich zu ihnen zu setzen, aber ging trotzdem in die Hocke, die Unterarme auf ihre schwarzen Jeans gestützt. »Es gab noch eine zweite Leiche?«
»O ja, ganz sicher. Aber keine ganze eben. Eher eine halbe Leiche. Sie wissen wohl noch nicht, wer das ist.« Connor drehte den Pappteller sacht, um sein Mittagessen aus unterschiedlichen Winkeln zu bewundern. »Das Ganze ist ziemlich verwurstelt.«
Jen blickte unsicher drein, die Augen waren schmal. Ihr Kiefer arbeitete.
Abby lehnte sich nach vorn und versuchte, ihre Stimme sanft zu halten. »Hast du denn noch nichts vom Stitcher gehört?«
»Nein.«
»Okay.« Abby fuhr sich mit der Zunge über die trockenen Lippen. »Doubtful ist ein gefährlicher Ort. Menschen … verschwinden hier von Zeit zu Zeit. Menschen … sterben.«
Jen blieb auf der Hut. »Du brauchst es nicht schönzureden.«
»In Doubtful bringt jemand Leute um«, sagte Abby. »Und das macht er schon ganz schön lange.«
Connor nickte. »Der Stitcher.«
»Dein Vater ist doch bei der Polizei, da kann er dir wahrscheinlich weit mehr erzählen als wir«, fuhr Abby fort. »Aber es gibt ein paar Dinge, die du tun musst, damit dir nichts zustößt. Du musst Türen und Fenster immer geschlossen, nein, verschlossen und verriegelt halten, und du darfst nach Einbruch der Dunkelheit nicht nach draußen gehen.«
»Versuch, nie allein unterwegs zu sein.« Riya, die immer noch keinem von ihnen in die Augen sehen mochte, hatte zumindest ihre Stimme wiedergefunden. Sie half Abby, die Regeln aufzusagen. »Gib jemandem Bescheid, bevor du das Haus verlässt.«
»Bleib immer da, wo viele andere Menschen sind«, führte Connor die Auflistung fort. »Verlass dich nicht auf die Technik, ganz gleich, welche. Alles geht kaputt. Und die wichtigste Regel …«
Rhys hatte das letzte Wort: »Halte dich von Charles Vickers fern.«
Jen schien wie erstarrt. Sie hatte die Brauen tief gesenkt, aber ihre Augen waren weit aufgerissen und schauten aufmerksam. »Wer ist Charles Vickers?«
»Er ist der Stitcher«, erwiderte Connor. »Er ist das Letzte, was du zu Gesicht bekommst, bevor du stirbst.«
Eine Sekunde lang schien es absolut still zu sein auf dem Schulgelände. Die Blätter über ihren Köpfen rauschten. Es hörte sich an wie tausend Fingerspitzen, die an ein Fenster tippten und darum baten, hereingelassen zu werden.
Dann lehnte Jen sich zurück, balancierte ihr Gewicht auf den Fersen, die Zähne zu einem grimmigen Lächeln entblößt. »Verstanden. Das erzählt ihr also den Neuankömmlingen, ja?«
Abby und Rhys wechselten einen Blick.
»Die gleiche Schikane wie überall, ja? Ihr wollt mir also Angst machen?« Jen erhob sich aus der Hocke und biss die Zähne zusammen. »Finde ich scheiße.«
»Wir wollen dir keine Angst machen«, rief Connor, während Jen sich bereits abwandte. »Wir versuchen, dich zu warnen!«
Sie ignorierte ihn und schritt über das magere Gras der Wiese in Richtung Schulgebäude.
Connor seufzte und sackte in sich zusammen. Selbst seine Haarpracht schien ein kleines bisschen geplättet. »Das haben wir gründlich vergeigt, oder?«
Abby blickte ihr nach. »Es wird noch mehr Leute geben, die sie warnen werden. Und irgendwem wird sie wohl glauben. Und bis dahin … behalten wir sie besser im Auge. Für alle Fälle.«
Riya stöhnte, hatte beide Hände vor das Gesicht geschlagen. »Wieso habe ich das bloß zu ihr gesagt? Es war ein Fehler, sprechen zu lernen.«
»Ehrlich gesagt bin ich beeindruckt.« Connor nahm endlich sein Sandwich in die Hände und verschlang fast die Hälfte davon mit einem riesengroßen Bissen. Er redete weiter, mit überfüllten Backen und während er kaute. »Ich liebe dein … alles daran ist womöglich der mutigste Anmachspruch, den ich je gehört habe.«
Riya stöhnte nur noch lauter, ließ sich nach vorn kippen und vergrub ihr Gesicht in den herabgefallenen Blättern.
4
January Spalling war 19 Jahre alt, als sie starb. Sie hatte ganz ordentliche Noten, sowohl in der Mittelstufe als auch in der High School, aber am besten war sie immer in Fächern, in denen auch das Soziale eine Rolle spielte, und sie war Spitzenklasse im Singen.
Nicht lange nach ihrem Abschluss hatte sie den Job im Postamt bekommen, wo sie Regale einräumte und auch kassierte. Sie sparte ihr Geld für ein Mietzimmer in Kalifornien. Sie hatte ihrer Heimatstadt entkommen wollen. Hatte geglaubt, dass sie vielleicht als Sängerin erfolgreich sein könnte.
Die meisten Leute in Doubtful träumten davon, eines Tages wegzugehen.
Kaum jemand schaffte es.
January Spalling wurde als vermisst gemeldet, als sie eines Morgens nicht auf der Arbeit erschien. Ihre Mutter sah, wie sie das gemeinsam bewohnte Haus um 8:40 Uhr verließ, die Handtasche über der Schulter.
Ihre Arbeitsstelle war einen zehnminütigen Fußmarsch von zu Hause entfernt. Ein Lieferfahrer sah sie am Ende ihrer Straße. Ihre Mutter und der Fahrer sagten später beide aus, dass sie sich ganz normal zu verhalten schien.
Danach wurde sie nicht mehr gesehen.
Fünf Tage später wurde ihre Handtasche in der Nähe des Waldrands gefunden, zu Fuß sicher 20 Minuten von ihrem Zuhause entfernt, in der entgegengesetzten Richtung von ihrer Arbeit. Es schien, als wäre sie irgendwann im Verlauf der vergangenen Tage dort weggeworfen worden; die Tasche war völlig durchnässt. Der Inhalt – Kreditkarte, Handy, Bargeld – war nicht angefasst worden. Das einzige Anzeichen von Fremdeinwirkung war ein 15 Zentimeter langes, dünnes Stück roten Garns, das zu einem Knoten gebunden in der Tasche steckte.
Drei Monate später wurde der Großteil von January Spallings Leiche in dem leer stehenden Haus in der Breaker Street geborgen, nachdem ein anonymer Tipp die Polizei dorthin geführt hatte. Sie war zerhackt und neu zusammengesetzt worden, gemeinsam mit Teilen eines zweiten Opfers, dessen Identität noch unbekannt war. Der rote Faden, mit dem ihre Haut vernäht war, passte zu dem Material, das man in ihrer Handtasche gefunden hatte.
Diese Fakten geisterten durch Abbys Kopf. Viel verrieten sie ihr nicht. Die meisten Berichte über die Verschwundenen, über die Toten lauteten ganz ähnlich – es gab eine Reihe Fakten, die sich niederschreiben ließen; Dinge, die man mit Sicherheit wusste, aber dazwischen befanden sich so viele Lücken, dass man nie das Gefühl haben konnte, dass man den Fall wirklich begriff. January Spalling hatte über Charles Vickers Bescheid gewusst. Jeder in der Stadt wusste über ihn Bescheid. Wie also war es ihm dann gelungen, sie zu entführen, ohne dass irgendjemand etwas gesehen oder gehört hatte? Absolut nichts?
»Hey«, rief Abby, als sie das Haus betrat.
»Hier oben«, brüllte Hope aus dem ersten Stock zurück.
Wenn sie nach Hause kam, sah Abby immer als Erstes nach, ob Hope da war. Sie fürchtete sich vor dem Tag, an dem ihre Begrüßung einmal keine Erwiderung finden mochte.
Dumpfe Geräusche erklangen von oben: Hope machte irgendetwas in ihrem Zimmer. »Abby«, rief sie dann. »Ich nehme ein Video auf. Kann ich dein blaues Top ausleihen?«
Abby ließ ihren Rucksack auf den Sessel im Wohnzimmer gleiten und streckte sich. »Das mit der Spitze? Klar.«
»Danke!« Hope tauchte am oberen Treppenabsatz auf und strahlte sie an. Sie trug das blaue Oberteil mit dem Spitzensaum bereits, und Abby musste lachen.
»Kommst du wenigstens gut voran?«, fragte sie.
»Die Geräte sind mal wieder ein echter Albtraum. Einen Abschnitt musste ich dreimal neu aufnehmen, bis ich es endlich hingekriegt habe, dass es gespeichert wird.« Hopes Haar, das strähnenweise rosa und fliederfarben gefärbt war, ging ihr nur bis zum Kinn, aber sie hatte es trotzdem zu einem Knoten am Hinterkopf zusammengebunden – zumindest den Teil, der in besagtem Knoten blieb und nicht gleich wieder herausrutschte. »Aber ich will das jetzt wirklich hochladen bis heute Abend.«
Hope war eine Anomalie in Doubtful. In einer Stadt, die Träume versiegen ließ und Farben auslaugte, trotzte Hope allen Widrigkeiten. Sie kämpfte mit der unzuverlässigen Technik, wo Abby es längst nicht mehr ausgehalten und aufgegeben hätte. Sie zwang hübsche Farben in ihr naturblondes Haar. Und man konnte es kaum anders ausdrücken: Sie lebte ihr Leben mit einer Vitalität, die jeden anderen Menschen an den Rand der Erschöpfung gebracht hätte.
Viele Menschen träumten davon, Doubtful zu verlassen.
Kaum jemand tat es.
Ihre Schwester würde vielleicht eine dieser seltenen Ausnahmeerscheinungen sein.
Abby sparte seit Jahren. Legte hier einen Dollar zur Seite, zwackte dort das Geld für das Schulessen ab und versteckte alles in einer Holzkiste ganz hinten in ihrer Schubladenkommode. Sie hatte es schon lange nicht mehr gezählt, aber sie glaubte, dass es reichen könnte, um zumindest einen Monat lang die Miete irgendwo anders zu zahlen. Um Hope zumindest eine Chance zu geben.
Sie musste nur lange genug auf sie beide aufpassen, dafür sorgen, dass sie zusammenblieben, bis Hope erwachsen war. Rechtlich gesehen.
Ihre jüngere Schwester drehte oben am Treppenabsatz eine Pirouette, ihr Rock wirbelte um sie herum. Sie hatte offensichtlich heute Energie und Zeit in ihr Aussehen gesteckt. Selbst die ständig ausfallende Technik hatte ihr die gute Laune nicht nehmen können.
Abby zögerte. Im Haus war es sehr still. »Hast du Momma schon gesehen?«
Hope kam stolpernd zum Stehen. »Sie war hinten im Garten, als ich nach Hause kam, sie hat gegraben. Seither hab ich sie nicht gesehen.«
»Alles klar.«
Hope verschwand wieder in ihrem Zimmer, und Abby ging in die Küche. Das Fenster über dem Spülbecken blickte auf den rückwärtigen Garten hinaus, ein Gewirr aus ungeschnittenen Sträuchern und wuchernden Rosenbüschen, deren dornige Ranken im Wind wehten.
Ihre Mutter war nicht mehr dort. Aber die frisch aufgehäuften Erdhügel schon. Hoch aufgetürmt zu beiden Seiten der Mulde, die sie ausgehoben hatte.
Abby sah sie praktisch vor sich, in der Hocke, während die Knochen sich durch ihr dünnes Nachthemd abzeichneten und ihre Hände bis über die Ellbogen mit Erde verschmiert waren. Wie sie sich mit ihren Fingern tiefer und tiefer hinabgrub und verzweifelt versuchte, dort unten an irgendetwas zu gelangen. Niemand wusste, an was. Es war nur eins von inzwischen acht Löchern, an denen sie seit Wochen grub.
Abby wandte sich ab. Im Kühlschrank waren noch Reste – ein Thunfischauflauf, den Abby nach einem Rezept aus einem alten Kochbuch mit vergilbten Ecken zubereitet hatte –, und sie löffelte etwas davon auf einen Teller, den sie dann in die Mikrowelle stellte.
Die Mulden waren ebenfalls ein schlechtes Zeichen. Ihre Mutter fing immer wieder an, tiefer zu graben, wenn es wieder schlimmer wurde. Die Aussetzer bei der Technik. Die Albträume. Und jetzt die Löcher. All das wies auf eines hin.
Schon bald würde wieder jemand entführt werden.
Die Mikrowelle piepte. Abby nahm den Teller heraus, legte einen Löffel auf den Rand und trug ihn dann nach oben.
Hopes Zimmer lag auf der linken Seite des Flurs. Sie hörte die Stimme ihrer Schwester durch das dünne Holz der Tür, aufgeregt und geradezu übersprudelnd, während sie in ihre Webcam sprach. Abbys Zimmertür befand sich auf der rechten Seite.
Am Ende des Flurs war das große Schlafzimmer. Die Tür stand immer noch einen Spalt offen, genau wie heute früh. Die Vorhänge waren zugezogen. Drinnen war es dunkel.
»Momma?«
Abby zögerte, aber sie hörte keine Zustimmung, kein Geräusch.
Die Launen ihrer Mutter kamen und gingen wie Ebbe und Flut. Meist war die Abfolge langsam und gleichmäßig und vorhersehbar. Aber manchmal, wenn man nicht gut genug aufpasste, geschah der Wechsel unverhofft und riss einem den Boden unter den Füßen weg.
Wenn es ihrer Mutter gut ging, aß sie alles, was man ihr hinstellte. Abby durfte ihr dann helfen, sich zu baden. Durfte ihr das zunehmend dünner werdende Haar bürsten und flechten und es in Ordnung halten.
Wenn es ihr dann wieder schlecht ging …
Die Löcher im Garten waren eins der Anzeichen. Aber eigentlich sollte sie noch genug Zeit haben, ihr etwas zu essen zu bringen, um der schrecklichen Magerkeit ihrer Gestalt noch eine Weile Einhalt zu gebieten.
Abby schob die Tür mit dem Ellbogen ein Stück weiter auf und beugte sich vor. Es war dunkel und staubig im Schlafzimmer; die Luft roch abgestanden. Abby hielt den Teller mit dem Essen vor sich ausgestreckt, wie ein Friedensangebot. Sie sah ihre Mutter nicht. »Momma? Möchtest du was essen?«