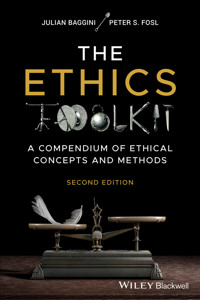26,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Überall auf dem Planeten stellen Menschen dieselben grundlegenden Fragen: Woher wissen wir, was wir wissen? Was ist die Welt? Was bedeutet es, ein Individuum zu sein? Und wie sollen wir leben? Aber diese vier Fragen werden nicht überall gleich beantwortet. Baggini erkundet die Geschichte der Philosophen Japans, Indiens, Chinas und der arabischen Welt sowie die weniger bekannten mündlichen Traditionen Afrikas und der indigenen Völker Australiens. Dafür hat er zahllose Gespräche mit lebenden Philosophen und Philosophinnen aus aller Welt geführt. Baggini zeigt uns in seinem beeindruckenden Buch, dass ein tieferes Verständnis der Denkweisen anderer der Schlüssel ist, um auch uns selbst besser zu begreifen. Eines der großen Wunder der Menschheitsgeschichte besteht darin, dass die schriftliche Philosophie in China, Indien und im antiken Griechenland mehr oder weniger zur gleichen Zeit und völlig unabhängig voneinander entstand. Diese frühen Philosophien hatten einen tiefgreifenden Einfluss auf die Entwicklung unterschiedlicher Kulturen in verschiedenen Teilen der Welt. Was wir im Westen «Philosophie» nennen, ist nur ein Teil des großen Ganzen. Julian Baggini nimmt uns mit auf eine spannende Reise durch die verschiedenen philosophischen Strömungen der Welt. Sein Buch bietet dabei nicht nur einen Überblick über die globale Philosophie und ihre faszinierenden Geschichten, sondern es öffnet in der Tat ein Fenster auf die vielfältigen Weisen, in denen die Welt denkt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Titel
Julian Baggini
WIE DIE WELT DENKT
Eine globale Geschichte der Philosophie
Aus dem Englischen von Frank Lachmann, Karin Schuler und Thomas Stauder
C.H.Beck
Übersicht
Cover
INHALT
Textbeginn
INHALT
Titel
INHALT
Widmung
ZUR SCHREIBWEISE VON NAMEN
EINLEITUNG
PROLOG – Ein historischer Überblick von der Achsenzeit bis zum Informationszeitalter
TEIL EINS: Wie die Welt weiß
DIE EINSICHT
DAS UNSAGBARE
THEOLOGIE ODER PHILOSOPHIE?
LOGIK
SÄKULARE VERNUNFT
PRAGMATISMUS
TRADITION
SCHLUSS
TEIL ZWEI: Wie die Welt ist
ZEIT
KARMA
LEERE
NATURALISMUS
EINHEIT
REDUKTIONISMUS
SCHLUSS
TEIL DREI: Wer wir in der Welt sind
DAS NICHT-SELBST
DAS RELATIONALE SELBST
DAS ATOMISIERTE SELBST
SCHLUSS
TEIL VIER: Wie die Welt lebt
HARMONIE
TUGEND
MORALISCHE VORBILDER
BEFREIUNG
VERGÄNGLICHKEIT
UNPARTEILICHKEIT
SCHLUSS
TEIL FÜNF: Abschließende Gedanken
WIE DIE WELT DENKT
EIN SINN FÜR DEN ORT
DANK
ANMERKUNGEN
Einleitung
Prolog
1 Einsicht
2 Das Unsagbare
3 Theologie oder Philosophie?
4 Logik
5 Säkulare Vernunft
6 Pragmatismus
7 Tradition
8 Schluss
9 Zeit
10 Karma
11 Leere
12 Naturalismus
13 Einheit
14 Reduktionismus
15 Schluss
16 Das Nicht-Selbst
17 Das relationale Selbst
18 Das atomisierte Selbst
19 Schluss
20 Harmonie
21 Tugend
22 Moralische Vorbilder
23 Befreiung
24 Vergänglichkeit
25 Unparteilichkeit
26 Schluss
27 Wie die Welt denkt
28 Ein Sinn für den Ort
WEITERFÜHRENDE LITERATUR
Sammlungen von Primärquellen
Sekundärliteratur
REGISTER
Zum Buch
Vita
Impressum
Widmung
Gewidmet dem East West Center an der University of Hawaii und der Gemeinschaft der Lehrenden in ihrem Kosmos
ZUR SCHREIBWEISE VON NAMEN
In China, Japan und Korea wird der Familienname dem Vornamen vorangestellt. Viele Menschen ostasiatischer Herkunft, die im Westen leben, passen sich jedoch der westlichen Konvention an, den Vornamen zuerst zu schreiben. Ich habe versucht, mich der Gepflogenheit jedes Einzelnen anzupassen, der hier in diesem Buch erwähnt wird. Das bedeutet, dass hier den meisten, aber nicht allen ostasiatischen Namen der Familienname vorangestellt wird. Normalerweise sollte sich aus dem Kontext ergeben, welcher Namensteil welcher ist. Chinesische Namen werden entweder in der Pinyin- oder nach der Wade-Giles-Romanisierung wiedergegeben.
EINLEITUNG
Eines der großen unerklärten Wunder der Menschheitsgeschichte besteht darin, dass die geschriebene Philosophie in verschiedenen Teilen der Welt mehr oder weniger gleichzeitig und völlig unabhängig voneinander entstanden ist. Die frühen Upanishaden, die von unbekannter Hand verfassten Grundlagentexte der indischen Philosophie, wurden zwischen dem achten und sechsten Jahrhundert v. Chr. verfasst. Konfuzius, der erste große chinesische Philosoph, wurde im Jahr 551 v. Chr. geboren, und Thales von Milet, der erste bedeutende griechische Vorsokratiker, um das Jahr 624 v. Chr. herum. Das traditionell angenommene Geburtsdatum des Buddha verortet auch ihn im sechsten vorchristlichen Jahrhundert, wobei Expertinnen und Experten heute eher der Auffassung sind, dass er wahrscheinlich nicht vor dem Jahr 480 geboren wurde, also etwa um dieselbe Zeit wie Sokrates.
Diese frühen Philosophien hatten nachhaltigen Einfluss auf die Entstehung unterschiedlicher Kulturen auf der ganzen Welt. Ihre Werte und Lehren haben geprägt, wie Menschen ihre religiöse Verehrung zum Ausdruck bringen, wie sie leben und wie sie über die uns alle betreffenden großen Fragen nachdenken. Zwar bringen die meisten Leute die von ihnen verinnerlichten philosophischen Überzeugungen nicht bewusst zum Ausdruck (vielmehr sind sie sich oft nicht einmal darüber im Klaren, dass sie welche haben), doch Annahmen über das Wesen des Selbst, über Ethik, die Quellen des Wissens und den Sinn des Lebens sind dennoch tief in unsere Kulturen eingelassen und prägen unser Denken, ohne dass wir uns ihrer bewusst wären. Belege für ihren Einfluss finden sich sogar in der Struktur der bedeutendsten Monumente auf der Welt, die wie lebendige Bücher gelesen werden können – als Ausdruck der Philosophien der Menschen, die sie errichtet haben. So ist die Verbotene Stadt in Peking nach konfuzianischen Prinzipien konstruiert worden und die Alhambra in Granada vom islamischen Denken durchzogen; selbst noch die Cafés auf der Rive Gauche von Paris stehen für die existentialistische Vision von der Philosophie als persönliches, alltägliches Unterfangen.
Der Prozess der kulturellen Absorption philosophischer Weltsichten wird manchmal sédimentation genannt. «In allem, was ich je meine Vernunft oder meine Idee nenne, fände man stets, könnte man alles darin Vorausgesetzte entfalten, unexpliziert gebliebene Erfahrungen, massive Beiträge der Vergangenheit wie der Gegenwart, eine ganze ‹sedimentierte Geschichte›, die nicht allein die Genesis meines Denkens betrifft, sondern auch dessen Sinn bestimmt», wie der französische Philosoph Merleau-Ponty im letzten Jahrhundert schrieb.[1] So wie ein Flussbett Ablagerungen aus dem bildet, was durch es hindurchfließt, so «sedimentieren» sich auch Werte und Überzeugungen im Geist der Menschen, die in jene Kulturen hineingeboren werden. Daher können wir diese Ablagerungen auch irrtümlich für ein unveränderliches Flussbett halten. Durch diese Kanäle im Geist strömen unsere Gedanken und Erfahrungen, ohne zu bemerken, wie sie dabei gelenkt und gesteuert werden. Der besondere Wert einer vergleichenden Philosophie besteht darin, dass wir auch unsere eigenen Hintergrundüberzeugungen in den Vordergrund treten lassen, wenn wir die unterschiedlich gearteten Grundüberzeugungen anderer – sozusagen ihre philosophischen Sedimente– explizit machen.
Trotz all der Vielfalt und des Reichtums der philosophischen Traditionen auf der Welt wird die westliche Philosophie – die ich seit über 30 Jahren studiert habe und die ausschließlich auf kanonischen westlichen Texten fußt – als universale Philosophie dargestellt: als die ultimative Untersuchung menschlichen Verstehens. «Vergleichende Philosophie», also die Forschung in zwei oder mehreren philosophischen Traditionen, wird hingegen nahezu vollständig jenen überlassen, die auf den Feldern der Anthropologie oder der Kulturwissenschaften tätig sind. Dieses mangelnde Interesse speist sich aus der Auffassung, dass uns die vergleichende Philosophie zwar die intellektuellen Kulturen Indiens, Chinas oder der islamischen Welt verstehen helfe, aber nichts zum Verständnis des menschlichen Daseins selbst beitrage könne.
Tatsächlich ist die westliche Philosophie derartig parochial, dass man sie als balkanisiert bezeichnen kann. Als ich in Manchester lebte, habe ich philosophische Oberseminare in Gebäuden besucht, die kaum eine halbe Meile voneinander entfernt auf gegenüberliegenden Straßenseiten lagen. Da eines der Institute jedoch auf kontinentale europäische und das andere auf die englischsprachige Philosophie spezialisiert war, war ich fast der Einzige, der die Straße zwischen beiden überquerte, obwohl beide ein gemeinsames Erbe von Descartes und Spinoza bis zu den alten Griechen für sich beanspruchen.
Dieser Umstand wurde mir allmählich etwas unangenehm. Bis vor wenigen Jahren wusste ich praktisch nichts über irgendeine andere Philosophie als die westliche – eine Tradition, die sich vom antiken Griechenland bis zu den bedeutenden Universitäten in Europa und Amerika erstreckt. Wenn ich mir meine Promotionsurkunde oder die Namen der philosophischen Institute ansehe, an denen ich studiert habe, dann steht da allerdings immer nur ein einziges, nicht weiter spezifiziertes Wort: Philosophie.
In letzter Zeit (und mit einiger Verspätung) habe ich die großen klassischen Philosophien aus dem Rest der Welt entdeckt und bin von Kontinent zu Kontinent gereist, um sie aus erster Hand kennenzulernen. Dies war die lohnendste intellektuelle Reise meines Lebens. Ich habe erkannt, dass ein genaueres Verständnis der philosophischen Traditionen einer Kultur auch bedeutet, jene Kultur selbst besser zu verstehen. Um eine Analogie des simbabwischen Philosophen Joram Tarusarira zu bemühen: Das philosophische Grundgerüst einer Bevölkerung zu verstehen, ist wie die Software zu verstehen, mit der ihr Denken arbeitet. «Kennt man ihre Software nicht, dann wird bei der Verständigung im Dialog immer diese Lücke sein», wie Tarusarira sagt. Solche Lücken erklären beispielsweise, warum so viele Entwicklungshilfeprojekte in Afrika gescheitert sind. «Wenn man diese Hilfe wirksam gestalten will, dann muss man sich mit den Menschen beschäftigen; wenn man Nachhaltigkeit will, dann muss man sich ebenfalls mit den Menschen beschäftigen. Viele Projekte waren allerdings unnütz, und zwar im Grunde deshalb, weil diejenigen, die sie initiiert haben, keinen Begriff von der Philosophie und Religion der Menschen vor Ort hatten.»
Die Software-Analogie ist zwar anschaulich, doch das Verhältnis von klassischen philosophischen Texten zur «Alltagsphilosophie» eines Volkes ist ohne Zweifel nicht so einfach zu bestimmen. Ideen, die von den Gelehrten entwickelt und genau analysiert werden, haben zwar durchaus ihre Entsprechungen in der allgemeinen Kultur, jedoch in simplerer, vagerer und breiterer Form. So proklamieren die meisten Amerikaner und Europäer den Wert der persönlichen und politischen individuellen Freiheit, ohne dass sie eingehendere Kenntnisse davon haben, wie diese Konzepte von ihren Philosophen begründet und erklärt worden sind. Millionen Inder führen ihr Leben gemäß den Prinzipien des Karma, ohne tiefergehende Kenntnisse der reichhaltigen und komplexen Literatur zu haben, die beschreibt, was das überhaupt heißt. Und der durchschnittliche Chinese beteuert die Bedeutung der Harmonie, obwohl er über kaum mehr als flüchtige Kenntnisse von den konfuzianischen und daoistischen Texten verfügt, die sie analysieren und darstellen. Dennoch besteht eine Beziehung zwischen anspruchsvoller Gelehrsamkeit und dem Alltagsleben – was dafür sorgt, dass Harmonie, Freiheit und Karma sehr unterschiedliche Rollen in verschiedenen Teilen der Welt spielen.
Selbst wenn wir die denkbar skeptischste Position einnehmen, dass nämlich die populären Versionen dieser philosophischen Konzepte bis zur Unkenntlichkeit verwässert und verfälscht sind, so ist es immer noch wichtig, dass wir begreifen, wie diese Begriffe den rhetorischen Raum erzeugen, in dem Kulturen denken, erklären und rechtfertigen. Wenn ein amerikanischer Politiker in seinen Ansprachen die Freiheit rühmt, dann tut er dies, weil die Kultur verlangt, dass der Wert der Freiheit hochgehalten wird – so wie es in China die Harmonie ist, die verteidigt werden muss. Was an den Philosophien der Welt markant erscheint, ist es tendenziell auch an den Kulturen, in denen sie beheimatet sind. In diesem Sinne ist zumindest das Verstehen einer Philosophie auch ein Fenster zur Kultur.
Philosophien sind aber nicht nur für das Verständnis von Völkern, sondern auch ihrer Historie wichtig. Dies ist eine Auffassung, die in der westlichen Geschichtsschreibung ein wenig aus der Mode gekommen ist, da sie ihren Schwerpunkt immer auf das Wirken wichtiger Einzelakteure oder ökonomischer und gesellschaftlicher Kräfte gelegt hat. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts nahm man allerdings noch an, dass Philosophien und religiöse Überzeugungen die primäre Ursache der bedeutendsten sozialen und politischen Umbrüche jener Epoche gewesen seien. Ideen waren nicht nur wichtig, sondern konnten auch tödlich sein. «Es war einmal ein Mann namens Rousseau, der ein Buch schrieb, das nur Ideen enthielt», sagte der schottische Philosoph und Essayist Thomas Carlyle im 19. Jahrhundert einmal gegenüber einem anderen, der diese These bezweifelte. «Die zweite Ausgabe wurde in die Haut derer eingebunden, die über die erste gelacht haben.»[2]
Der Historiker Jonathan Israel vertritt die Auffassung, dass wir wieder ein Gespür für die Bedeutung von Ideen in der Geschichte entwickeln müssen. «Ohne die radikale Aufklärung mitzudenken, ergibt nichts an der Französischen Revolution auch nur den geringsten Sinn oder könnte auch nur ansatzweise erklärt werden», wie er sagt.[3] Was Israel von der «Revolution des Geistes»[4] sagt, gilt aber auch für die Geschichte und den geschichtlichen Wandel generell. «Obwohl eine Philosophie selbst ein kulturelles Phänomen ist, kann sie eine Kultur nicht nur begreifen, sondern auch verändern», wie der Philosoph Tom Kasulis schreibt.[5]
Damit erinnert Kasulis uns nicht nur daran, dass Ideen wichtig sind, sondern auch, dass sie sich kontinuierlich weiterentwickeln. Ständig entstehen neue Formen des Denkens, die unseren sich wandelnden Bestrebungen einen Sinn verleihen und unserem Missfallen Ausdruck geben können. Wenn wir uns auf «Traditionen» konzentrieren, dann ist es leicht, diese Veränderungen zu übersehen oder herunterzuspielen. Es ist verlockend, stets nach den Kontinuitäten über die Zeit hinweg zu suchen, die die Dinge scheinbar in einen Zusammenhang bringen. Daraus resultiert allerdings, wie der dissidente chinesische Autor Xu Zhiyuan beobachtet, dass die Menschen «intrinsische Komplexitäten ignorieren und, nachdem sie ihre bequemen Vergleiche zwischen Gegenwart und Vergangenheit gezogen oder ein zufriedenstellendes deskriptives Etikett gefunden haben, sich selbstgefällig zurücklehnen und ihr Verständnis von den Dingen genießen».[6] Angesichts des Umstands, dass einer der ältesten chinesischen Klassiker das Yijing ist (das auch als Buch der Wandlungen oder I Ging bezeichnet wird), wäre es eine Farce, die Relevanz des Wandels in der Tradition zu leugnen, die es begründet hat. Wir müssen auf die Diskontinuitäten innerhalb von Kulturen ebenso Acht geben wie auf die manchmal überraschenden Gemeinsamkeiten zwischen unterschiedlichen Gesellschaften, die räumlich und zeitlich voneinander entfernt sind. So ist Kasulis beispielsweise der Auffassung, dass die dominante Denkweise während der dunklen Jahrhunderte in Europa durchaus näher an der des modernen Ostens gewesen sein könnte.[7]
Ein angemessenes Verständnis philosophischer Traditionen beseitigt also nicht einfach alle Entwicklung und Differenz, die sich über die Zeit hinweg gezeigt hat, sondern würdigt die Tatsache, dass Entwicklung und Dissens nie in einem Vakuum auftreten. Ideen und Philosophien haben Geschichten, die stets in der Mache sind. Wir haben kaum eine Chance, mit neuen Ideen für neue Zeiten durchzudringen, wenn wir nicht die Ideen und Zeiten begreifen, an die sie anschließen. So kann etwa die westliche Demokratie nicht einfach exportiert oder Ländern mit ganz anders gearteten Historien und Kulturen aufgezwungen werden. Damit die Demokratie reisen kann, muss sie sich anpassen. Die vergleichende Philosophie sollte daher nicht als ein Studium von Philosophien betrachtet werden, die in Stein gemeißelt sind wie die Ausstellungsstücke in einem Museum, sondern als eine Untersuchung dynamischer Systeme. Richtig verstanden geben sie uns Einblicke nicht nur in die Gegenwart und Vergangenheit, sondern auch in potenzielle Zukünfte.
Die Beziehung zwischen Philosophien und den Kulturen, in denen sie entstehen, ist komplex. Deshalb ist es schwer, hier Urteile über Ursache und Wirkung zu fällen. Hat Konfuzius den chinesischen Geist geprägt oder der chinesische Geist Konfuzius? Die Antwort lautet, wie bei all solchen Fragen: Ein bisschen stimmt beides, und es ist unmöglich, die tatsächlichen Anteile zu bestimmen. «Eine Kultur reflektiert oder setzt eine Philosophie – oder eine Reihe miteinander verbundener Philosophien – selbst dann noch voraus, wenn sie genau jene Rahmenbedingungen stiftet, in denen die Philosophie ihre Gestalt annimmt», sagt Kasulis.[8] Für unsere Zwecke reicht es allerdings aus, den Umstand anzuerkennen, dass hier ein enger Zusammenhang besteht. Und jeder Gelehrte, mit dem ich gesprochen habe, stimmte der Ansicht zu, dass das Verständnis der philosophischen Traditionen einer Kultur uns dabei hilft, diese Kultur insgesamt besser zu verstehen.
Meine philosophische Reise hat mich zudem davon überzeugt, dass wir uns selbst nicht verstehen können, wenn wir andere nicht verstehen. In Kunst und Literatur ist diese Feststellung fast trivial; Romane, Dramen und Filme gewähren uns imaginative Einblicke in das Leben, die Gedanken und die Gefühle anderer, was unser eigenes Herz und unser Denken weitet und bereichert. Philosophische Traditionen tun das Gleiche. In einer immer kleiner werdenden Welt ist diese Art von Selbstverständnis essenziell. Wenn Kulturen einander begegnen statt bekämpfen sollen, dann müssen wir nicht nur begreifen, wie andere sich von uns unterscheiden, sondern auch, wie wir uns von ihnen unterscheiden.
Wir können nun nicht so tun, als könnten wir die Philosophien der Welt innerhalb von wenigen Jahren verstehen, erst recht nicht durch die Lektüre eines Buchs. Mein eher bescheidenes Ziel war es vielmehr herauszufinden, was wir verstehen müssen, um mit dem Verstehen anfangen zu können. Die Suche nach diesem philosophischen Anfangspunkt ist wie die nach den Geheimtüren in einem ethnografischen Erlebnispark, die uns den Zugang zu der eigentlichen Sache erlauben. Die Japaner könnten dies als nyūmon bezeichnen. Physikalisch betrachtet ist ein nyūmon ein Eingang, wie etwa das Rote Tor an der Universität von Tokio. Das nyūmon spielt eine Doppelrolle, indem es sowohl die Grenzen eines Raums definiert als auch Besucher in ihn einlädt.[9] Dieses Wort ist von vielen japanischen Autoren für das benutzt worden, was im Englischen als «introductions» bezeichnet wird, als «Vorstellung» oder «Bekanntmachung» mit einer Person. Im engeren Sinne beschreibt es auch die Funktion des vorliegenden Buchs recht treffend: Wenn man jemandem vorgestellt wird, dann wird einem nicht sofort alles über diese Person mitgeteilt; vielmehr erhält man die Gelegenheit, eine Bekanntschaft erst zu knüpfen. Dieses eine solche Bekanntschaft stiftende Buch ist insofern der Auftakt zu einer genaueren Untersuchung, ein erster Schritt in einem längeren, unabgeschlossenen und unabschließbaren Projekt.
Andere kennenzulernen setzt voraus, dass man die miteinander verschwisterten Risiken vermeidet, entweder das zu überschätzen, was wir gemeinsam haben, oder das, was uns trennt. Unser geteiltes Menschsein und die ewigen Probleme des Lebens bedeuten, dass wir stets von den Gedanken und Praktiken anderer lernen und uns damit identifizieren können – ganz gleich, wie fremdartig sie auf den ersten Blick auch erscheinen mögen. Gleichzeitig können Unterschiede in der Denkweise sowohl tiefgreifend als auch subtil sein. Wenn wir vorschnell davon ausgehen, dass wir die Dinge auch aus der Perspektive anderer betrachten können, dann führt das nur dazu, dass wir sie bloß von einer Variation unseres eigenen Standpunkts aus beurteilen. Oft heißt es, dass wir uns in die Lage anderer hineinversetzen sollten; die eigene Lage zu verändern, ist aber nicht gleichbedeutend damit, in die Gedanken anderer einzutreten. Wir müssen über den Punkt hinausgelangen, an dem wir uns ausmalen, wie die Dinge für uns aussehen würden, wenn wir sie von einem unvertrauten Standpunkt aus betrachten, und uns ernsthaft um ein Verständnis darum bemühen, wie sie für andere aussehen, für die dieser Standpunkt ihr Zuhause ist.
Das vorliegende Buch ist eine selektive Geschichte der globalen Philosophie, die die oft verborgenen Fundamente ausgräbt, auf deren Grundlage die Welt heute denkt. Diese archäologische Metapher hat aber auch noch eine weitere Dimension. Die sichtbareren, praktischen Aspekte der Philosophien der Welt tauchen auf diesen Seiten nämlich erst zum Schluss auf. Denn um sie zu begreifen, müssen wir die Basis verstehen, auf denen sie aufbauen. Die grundlegendsten von ihnen betreffen die Frage, wie die Welt weiß – also was Überzeugungen und Erkenntnisansprüche rechtfertigt. Dies ist Gegenstand des ersten Teils dieses Buchs. Teil zwei lenkt den Blick darauf, was die Welt in Sachen Metaphysik und Kosmologie glaubt, das heißt darauf, wie die Welt funktioniert und aufgebaut ist. Teil drei ist der Frage gewidmet, wie verschiedene Philosophien die menschliche Natur auffassen – also der Frage, wie wir uns selbst betrachten. Und erst nachdem wir uns angesehen haben, wie die Philosophien die Grundlagen der Erkenntnis, den Aufbau der Welt und das Wesen des Selbst verstehen, können wir uns begreiflich machen, wie sie denken, dass wir leben sollten – was Thema des vierten Teils sein wird.
Ich nehme für mich nicht in Anspruch, ein Experte in Bezug auf alle Formen des Denkens zu sein, die ich Ihnen vorstellen werde. Gerade dass ich kein Experte für jede Tradition bin, mit der ich mich befasst habe, war für mich allerdings in vielerlei Hinsicht hilfreich. «Ein Insider ist wie ein Fisch in einem Goldfischglas», sagt Xu Zhiyuan, «unfähig, die genauen Umrisse seiner Umgebung zu erkennen, obwohl sich diese für alle anderen ganz klar abzeichnen.»[10] Hat man hingegen eine gewisse Distanz, dann macht dies die groben Strukturen deutlicher, als wenn man in zu geringer Entfernung von seinem Gegenstand operiert und etwa die einzigartigen Eigenschaften jedes Baums untersucht, aber dabei vergisst, dass sie alle derselben Spezies angehören – jener nämlich, die dem ganzen Wald seinen spezifischen Charakter verleiht.
Ich bin meine Aufgabe als eine Art philosophischer Journalist angegangen. Der Job eines Journalisten besteht darin, genug über ein Thema zu wissen, um diejenigen ausfindig machen zu können, die das meiste darüber wissen, ihnen die richtigen Fragen zu stellen und ihre Antworten zu erklären. Und das ist genau das, was ich getan habe: Ich habe kanonische Texte gelesen und mich dabei von den Worten von Fachleuten lenken lassen. Von diesen habe ich Dutzende interviewt, um herauszufinden, was man im besten Fall wissen muss, wenn man sich daran macht, die Philosophien der Welt wirklich verstehen zu wollen, statt nur eine Liste mit den Eckpunkten ihrer grundlegenden Lehren auswendig zu lernen. Viele ihrer Namen tauchen in diesem Buch auf, neben denen der Fachleute, deren Arbeiten ich gelesen habe. Jede von mir zitierte Person ist ein Experte auf dem jeweils in Rede stehenden Gebiet, der entweder gegenwärtig aktiv ist oder es bis in die jüngste Vergangenheit hinein noch war; alle nicht in den Endnoten referenzierten Kommentare wurden mir gegenüber im persönlichen Gespräch geäußert. Ich habe zudem über das ganze Buch hinweg ausgiebig aus den klassischen Texten jeder Tradition zitiert, die ihre Argumente oft mit unübertrefflicher Eleganz und in einer sehr gewählten Sprache vorbringen. Dies verschafft uns die Gelegenheit, eine direkte Begegnung mit dieser reichhaltigen Literatur zu machen.
Im 17. Jahrhundert schrieb René Descartes in seiner Abhandlung über die Methode: «Ich bemerkte ferner auf meinen Reisen, dass selbst die, welche in ihren Ansichten von den meinigen ganz abwichen, deshalb noch keine Barbaren oder Wilde waren, sondern oft ihren Verstand ebenso gut oder besser als ich gebrauchen konnten.» Ich hoffe, dass eine solche Erkenntnis heutzutage niemanden mehr derartig erstaunen wird. Eine von Descartes’ Schlussfolgerungen ist allerdings auch heute noch gültig, nämlich die, dass, wo immer wir auch leben, «uns mehr die Gewohnheit und das Beispiel als die sichere Kenntnis» bestimmt. Die Philosophien der Welt zu bereisen, ist daher eine Gelegenheit, die Überzeugungen und Denkweisen zu hinterfragen, die wir als selbstverständlich erachten. Indem wir immer mehr in Erfahrung bringen, wie andere denken, kann die Gewissheit unserer eigenen vermeintlichen Erkenntnisse ins Wanken geraten. Und das ist immer der erste Schritt hin zu einem größeren Verständnis.
PROLOG
Ein historischer Überblick von der Achsenzeit bis zum Informationszeitalter
Die Geburt der Philosophie zwischen dem 8. und 3. Jahrhundert v. Chr. wird von dem deutschen Philosophen Karl Jaspers im 20. Jahrhundert als «Achsenzeit» bezeichnet. Dies war eine Periode des allmählichen Übergangs von einer mythologischen hin zu jener eher rationalen Auffassung von der Welt, der wir heutzutage anhängen.[1] Dieses rationale Weltverständnis ist allerdings nicht einfach an die Stelle der früheren populären Glaubensüberzeugungen und Mythen getreten, sondern vielmehr aus deren Werten und Grundlagen heraus erwachsen. Weltanschauungen werden durchaus von den Ansprüchen der kalten Vernunft geprägt, aber nicht immer auch von ihr angeleitet.
Obwohl sich die klassischen Philosophien Indiens, Chinas und Griechenlands in wichtigen Hinsichten unterscheiden, bestehen zwischen ihnen auch einige höchst bedeutsame Gemeinsamkeiten. Sie alle machen den Anfang mit der fundamentalen These, dass alles eins ist. Was immer das menschliche Leben erklärt, muss auch das Universum, die Natur und alles andere jenseits davon erklären können. Wie es Wilhelm von Ockham viel später in seinem berühmten Prinzip von der «Rasierklinge» formulieren sollte, ist es niemals rational, die Existenz von mehr Dingen als nötig zu postulieren. Man beginnt mit der einfacheren Erklärung – dass alles vom selben Prinzip beherrscht wird – und verkompliziert die Angelegenheit nur dann, wenn diese Erklärung nicht funktioniert. Die frühesten Philosophen folgten daher implizit einem rationalen Prinzip, das noch niemand ausformuliert hatte.
Das Vorhaben, das Universum verstehen zu wollen, ist zudem nur dann sinnvoll, wenn das Universum auch verstehbar ist. Würden wir annehmen, dass wir es mit einer bunten Ansammlung von Mechanismen und Prinzipien zu tun haben, die unterschiedliche Aspekte der Realität beherrschen, ohne dass eine Verbindung zwischen ihnen bestünde, dann wäre das Universum ein weniger begreifbarer Ort. Voraussetzung für jeden ernsthaften Versuch eines systematischen Verstehens ist also die Annahme einer Art von Einheitlichkeit.
Die Einheitlichkeit des menschlichen Wissens war in der Achsenzeit deutlicher zu sehen als heute. Für die Griechen war alles, was wir heute als Geistes- und Naturwissenschaften bezeichnen, Teil des philosophischen Studiums. Auch in Indien oder China gab es keine grundlegenden Unterteilungen des Wissens. Mit der Intensivierung der menschlichen Forschung wuchsen zwar verschiedene Äste weiter aus dem Stamm heraus, aber sie alle blieben weiterhin prinzipiell Teil desselben Baums.
Eine weitere Gemeinsamkeit war die Annahme, dass eine zufriedenstellende Darstellung der Welt die Vernunft ansprechen muss. Attraktive Geschichten und Mythen sind nicht genug; wir müssen vielmehr ein intellektuelles Argument formulieren, das die von uns vertretenen Ansichten stützt. Vernunft – im Sinne von Rationalität – ist im Wesentlichen ein Geben von Gründen, und zwar von solchen, die geprüft, bewertet, untersucht, akzeptiert oder zurückgewiesen werden können.[2] Menschen hatten immer schon ihre Weise, die Welt zu verstehen, aber erst seit dem Aufkommen der Philosophie haben sie sich ernsthaft darum bemüht, Gründe für ihre Verständnisse anzugeben und zu verteidigen.
In der frühen Philosophie erkennen wir den Versuch, von überlieferten autoritativen Erzählungen zu systematischeren Erklärungen zu gelangen, die der Prüfung durch die Vernunft standhalten. Im Allgemeinen hat dies zu einer Weiterentwicklung jener alten Mythen statt zur Schaffung gänzlich neuer Paradigmen geführt. In Indien unterscheiden die Gelehrten die Entwicklung der Philosophie generell in vier Perioden. Die vedische Periode von etwa 2500 bis 600 v. Chr. ging der Achsenzeit voraus und wird von Sarvepalli Radhakrishnan und Charles Moore als «ein tastendes Zeitalter» bezeichnet, «in dem Religion, Philosophie, Aberglaube und das Denken untrennbar verbunden waren und trotzdem im fortwährenden Konflikt miteinander standen».[3] In dieser Zeit wurden auch die vier zentralen Veden verfasst, die orthodoxe Schulen als geoffenbarte Schriften (śruti) verstehen: Ṛg, Yajur, Sāma und Atharva.
Daran schloss sich die epische Periode (ca. 500/600 v. Chr. bis 200 n. Chr.) an, in der das Epos Mahabharata geschrieben wurde, von dem die Bhagavad Gita einen Teil bildet. Zusammen mit den Upanishaden und dem Brahma-Sutra bildet die Bhagavad Gita das «dreifache Fundament» (Prasthanatraya) der orthodoxen indischen Philosophie. Dabei handelt es sich zwar noch nicht um philosophische Werke im systematischen Sinne, aber die in diesen frühesten Perioden ersonnenen Doktrinen «haben seither den Ton, wenn nicht sogar das genaue Muster für die indische philosophische Entwicklung festgelegt».[4] Die wichtigste davon ist die Idee, dass die absolute Realität Brahman ist – eine unendliche, unwandelbare, universelle Seele. Das individuelle Selbst, Atman, hängt nur einer Illusion von Unabhängigkeit an. Unser ultimatives Ziel ist es, das Ego aufzulösen und zu Brahman zurückzukehren. Während jener Periode war es auch, dass Denker wie Gautama, Panini und der Buddhist Nagarjuna ausgereifte logische Kalküle entwickelten.
Diejenigen Schulen der indischen Philosophie, die an der Geltung der Veden festhalten, werden als orthodox oder astika bezeichnet, die anderen als heterodox oder nastika. Doch obgleich dies etwa seit der Wende zum 20. Jahrhundert die standardmäßige Klassifikation der einzelnen Schulen darstellt, ist weder klar, ob auch die Philosophien anfangs entlang dieser Trennlinien unterschieden wurden, noch, wie scharf diese Unterteilungen sind. Mit dieser Relativierung im Hinterkopf lässt sich festhalten: Die orthodoxen Schulen sind Nyāya, Vaisheshika, Samkhya, Yoga, Mimamsa und Vedanta und die heterodoxen Buddhismus, Jainismus, Charvaka, Ajivika und Ajñana.
In China gab es keine starke religiöse Kultur mit Göttern oder Jenseitsvorstellungen, sodass die neuen Philosophien dort naturalistischer waren als die Indiens. Konfuzius (551–479 v. Chr.) baute seine Lehren auf den kulturellen Normen von Ordnung, Ahnenverehrung und Tradition auf. Der Daoismus, die andere große chinesische Tradition, wertschätzte vor allem anderen die Harmonie mit der Natur. Ihr zentraler Text, das Daodejing, entstand zwischen dem vierten und dritten Jahrhundert v. Chr.
Im Gegensatz dazu musste Griechenland einen Platz für seine Götter reservieren. Da diese in der Mythologie jedoch oft als menschliche Superhelden porträtiert wurden, die mit den Sterblichen im selben physischen Raum interagieren, gab es kein grundsätzliches Problem damit, das Universum anhand von Prinzipien zu erklären, die Götter und Menschen gleichermaßen betrafen.
Diese drei philosophischen Traditionen – die indische, die chinesische und die griechische – basierten auf unterschiedlichen Erkenntnisquellen. Nur in Griechenland entwickelte sich durch die Erfindung der Logik eine systematische Vernunft in nennenswerten Ausmaßen. In Indien legte man stattdessen das Hauptaugenmerk auf das Wissen, das Seher in höheren Bewusstseinszuständen erlangten, und auf die Offenbarungen in den heiligen Texten der Veden. In China markierten Geschichte und die Alltagserfahrungen den Maßstab für die Wahrheit. Der Buddha wandelte hingegen auf einem Mittelweg, indem er behauptete, dass die einzige uns zugängliche Erkenntnisquelle die Erfahrung sei, was Spekulationen über die «wirkliche» Wirklichkeit nutzlos machte. Dennoch teilte er aber die orthodoxe indische These, dass die alltägliche Erfahrung illusorisch sei und es einiger Anstrengung bedürfe, um über sie hinauszublicken. In Griechenland nahm durch die sokratische Maxime, dass wir dem Argument folgen sollten, wo immer es uns auch hinführt, die Vernunft die Hauptrolle ein; «in welcher Richtung uns gleichsam der Wind der Rede treibt, in der müssen wir gehen», wie es in Platons Staat heißt.[5] Jede entstehende klassische Tradition hatte ihre eigenen Vorstellungen über die richtigen Methoden des Philosophierens.
In der Achsenzeit entstanden viele der grundlegenden Texte, die im Zentrum der bis heute fortwirkenden Traditionen stehen. So studieren die indischen Philosophen immer noch die Veden, die chinesischen Philosophen die Werke von Konfuzius und Mengzi und die westlichen Philosophen die von Platon und Aristoteles. Joel Kupperman bemerkt, dass «es Länder gibt, vor allem Indien und China, in denen eine kleine Anzahl philosophischer Texte von grundlegender Bedeutung sind, und zwar nicht nur für die spätere Philosophie, sondern für die ganze Kultur».[6] Während die alten Griechen für die meisten Bewohner des Westens nur noch Namen sind, sind die indischen Veden und die chinesischen Klassiker den meisten Menschen in diesen Ländern wohlvertraut.
Wenn die erste Phase der Philosophie als eine interkontinentale Absetzbewegung vom Mythos hin zu einem eher vernunftgeleiteten Verständnis des Universums betrachtet werden kann, so unterschied sich die Richtung der Reise im Folgenden von Region zu Region. Im Westen tat die Philosophie einen Schritt zurück. Die zentrale Herausforderung der mittelalterlichen Philosophie war es dort, zwischen den Aussagen des christlichen Glaubens und den Ansprüchen der Rationalität zu vermitteln. Die Philosophie war also nicht mehr eine Reaktion auf volkstümliche Mythen, sondern auf Lehren, die von geistlichen Autoritäten in einer systematischen Theologie verbreitet wurden. Der bedeutendste und einflussreichste Philosoph dieser Zeit war daher der Priester Thomas von Aquin, der im 13. Jahrhundert gelebt hat. Wie in der Antike, so stellte die Philosophie auch jetzt keine radikalen Alternativen zu der vorherrschenden religiösen Kultur dar, sondern arbeitete mit dem Kern von deren Lehren. Die natürliche Theologie hielt eine rationale Rechtfertigung des Glaubens bereit; zugleich passte die Annahme des Dualismus mit seiner scharfen Unterscheidung von Körper und Geist gut zu der christlichen Betonung der Überlegenheit des geistlichen Fortlebens nach dem Tode gegenüber dem körperlichen Leben im Hier und Jetzt.
In diesem Narrativ gibt es allerdings einige Komplikationen, ebenso wie in dem des Nahen Ostens und Afrikas, wo die Religion und nicht die säkulare Philosophie die höchste Autorität erlangte. Im sogenannten Goldenen Zeitalter der islamischen Philosophie vom 8. bis zum 13. Jahrhundert n. Chr. übersetzten und kommentierten die falāsifa die antiken griechischen Klassiker, allen voran das Werk des Aristoteles. (Dies war von entscheidender Bedeutung dafür, dass die aristotelische Philosophie ihren Weg in den Westen fand, wo ihr Urheber so wichtig wurde, dass er dort einfach «der Philosoph» genannt wurde.) In dieser Zeit kam es zu eifrigen gelehrten Debatten zwischen falāsifa wie etwa Avicenna (Ibn Sīnā) oder Averroes (Ibn Rushd) und eher theologisch orientierten Denkern des Kalām wie al-Ghazālī – eine Auseinandersetzung, die Letzterer schließlich für sich entscheiden konnte, was die Möglichkeit einer Emanzipation der islamischen Philosophie von der Theologie zunichtemachte.
In Indien stellte sich die Lage noch komplizierter dar. Die philosophische Aufmerksamkeit richtete sich dort auf die Interpretation der antiken Sutras. Das Sanskrit-Wort «Sutra» bedeutet «Faden» oder «Schnur» und bezeichnet eine Literaturgattung, in der kurze, aphoristische Lehrsätze zusammengetragen wurden, vor allem in den Veden. Im Laufe der Sutra-Periode in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten und der anschließenden scholastischen Periode wurden sehr viele Kommentare zu den antiken Sutras geschrieben, die deren Lehren einer rationalen Analyse und Rechtfertigung unterzogen. Oder wie Radhakrishnan es formuliert: «Man unternahm erhebliche Anstrengungen, um mit der Vernunft zu begründen, was der Glaube stillschweigend akzeptierte.»[7]
Eine wichtige Spaltung ereignete sich zudem in der Vedanta-Schule. Der Lehrer Shankara begründete die Philosophie des Advaita-Vedanta, die einen «Nondualismus» vertrat, demzufolge das individuelle Selbst illusorisch und seinem Wesen nach alles ein Bestandteil des absoluten Einen, Brahman, war. Denker wie Ramanuja und Madhva lehnten dies jedoch ab und vertraten einen Dualismus, in dem das Ich real und Brahman eine besondere Gottheit, nämlich Vishnu, war. Obwohl das Advaita-Vedanta seither die dominante philosophische Schule war, dürfte diese theistische Vedanta einen größeren Einfluss auf die breitere Gesellschaft gehabt haben.
Im Fernen Osten war die Entwicklung weniger verschlungen. Da es keine Stärkung religiöser Autoritäten gab, kam es dort zu einer graduellen intellektuellen Evolution – ein weiteres Beispiel für die außerordentliche Kontinuität im Denken und in der Historie Chinas. Der Konfuzianismus wurde von der Song-Dynastie (960–1127 n. Chr.) bis in die Qing-Dynastie (1644–1911) von den Neokonfuzianern wiederbelebt und umgearbeitet, wobei Einflüsse aus dem Daoismus und Buddhismus darin Eingang fanden.
Die Entwicklung der Philosophie in der mittleren Periode macht deutlich, wie sie in Teilen von Entwicklungen in der allgemeinen Kultur angeleitet wurde. Der offensichtlichste negative Aspekt an diesem Umstand ist die Tatsache, dass weibliche Stimmen in den klassischen Traditionen der Welt fast vollständig fehlen. Dies ändert sich erst in unserer Gegenwart. Noch in den Jahren 2008 und 2009 war weniger als eine von fünf akademischen Führungspositionen in den britischen philosophischen Fakultäten mit Frauen besetzt. Ähnliches besagt die Statistik auch über die Lage in den USA und in Australien.[8]
Mit Blick auf die Moderne hat die wachsende geopolitische Macht der westlichen Welt zur Folge gehabt, dass auch ihre Philosophie weit über ihre eigenen Grenzen hinaus ausstrahlte. Die Weiterentwicklung der Naturwissenschaften und die westliche Betonung der Autonomie, die im Zuge der Aufklärung des 18. Jahrhunderts aufkam, führten den im Entstehen begriffenen Naturalismus der frühen Philosophie zu seinem logischen Abschluss, indem sie die letzten Reste des religiösen und mythologischen Denkens aus dem philosophischen Mainstream verbannten. Viele Entwicklungen in der globalen Philosophie sind eine Reaktion auf das westliche Denken, was umgekehrt nicht im gleichen Maße gilt. Am einflussreichsten waren dabei jene Philosophien, die nach bestimmten konkreten Handlungen verlangten. Denn diese wurden von vielen als Möglichkeit zur Herausforderung traditioneller philosophischer Ansätze betrachtet, welche zunehmend zur Aufrechterhaltung des Status quo eingesetzt wurden. So wurden in Indien sowohl die Bewegung des praktischen Vedanta als auch Mahatma Gandhi von Karl Marx und dem Utilitaristen John Stuart Mill dazu angeregt, die traditionelle Betonung der Spiritualität mit Überlegungen zur sozialen Gerechtigkeit in Einklang zu bringen. Und in China beeinflussten der europäische Marxismus und Darwinismus – im Verbund mit dem amerikanischen Pragmatismus – sowohl den reformistischen Monarchisten Kang Youwei als auch Mao Zedong, den ersten kommunistischen Führer des Landes. Zeitgleich gab es auch Reaktionen gegen das westliche Denken, vor allem die Ablehnung des Individualismus durch die japanische Kyōto-Schule.
Die Macht des Westens zur Festlegung der globalen Agenda spiegelt sich in der Tatsache wider, dass das Wort «Philosophie» und seine vielen Übersetzungen erst seit relativ kurzer Zeit zur Beschreibung all dieser divergenten Traditionen verwendet wird. Die Japaner zum Beispiel hatten bis zum 19. Jahrhundert gar kein Wort für Philosophie. Dies kam dort erst auf, als nach der Meiji-Restauration, die das 250 Jahre währende Verbot der Einreise von Fremden und der Ausreise von Japanern aufhob, westliche philosophische Ideen im Land diskutiert wurden. Das Wort, das dafür geprägt wurde, lautete tetsugaku – ein Kofferwort aus den Bezeichnungen für «Klugheit» und «-logie».[9] Auch China bekam sein Wort für Philosophie (zhexue, wörtlich «Weisheitslernen») etwa um dieselbe Zeit.
Dies wirft die schwierige Frage auf, was überhaupt als «Philosophie» gelten kann. Fängt man mit einer zu enggefassten Definition an, dann schließt man viele oder sogar die meisten gedanklichen Ansätze aus anderen Traditionen aus, sodass sie nichts anderes als die jeweils eigene kulturelle Ausprägung von ihr meint. Aus diesem Gedanken speist sich auch Richard Rortys These, dass «die kleinen scholastischen Philosophie-Definitionen seitens der Philosophen nur polemische Mittel sind, dazu gedacht, all jene vom Ehrenfriedhof auszuschließen, deren Stammbäume fremdartig sind».[10] Fasst man die Definition aber zu weit, dann gibt es nichts, was nicht unter sie fällt.
Besser als die Philosophie einzuengen ist es meiner Meinung nach, die Auffassung zu akzeptieren, dass sie eine unscharfe Kategorie im Sinne der Wittgenstein’schen «Familienähnlichkeit» ist. Das heißt: Wir können zwar keine festen Bedingungen dafür formulieren, was als Philosophie zu gelten hat und was nicht, aber wir können erkennen, dass es bestimmte geteilte Merkmale gibt und dass intellektuelle Traditionen daher als Philosophie behandelt werden sollten, wenn sie hinreichend viele dieser Merkmale aufweisen. Menschen betreiben immer dann (gute oder schlechte) Philosophie, wenn sie ihr gedankliches Vermögen auf eine systematische Untersuchung des Wesens der Welt, des Selbstseins, der Sprache, der Logik, des Werts, des menschlichen Wohls, der Quellen und Begründungen des Wissens oder der Natur und der Grenzen der menschlichen Vernunft ansetzen. Nähert man sich diesen Dingen nur mit Mythen oder Dogmen, dann handelt es sich dabei um Religion und Folklore, aber nicht um Philosophie. Wenn man sich auf Methoden geeinigt hat, die die jeweiligen Fragen empirisch beantworten, dann wird die Untersuchung naturwissenschaftlich – und also wieder nicht philosophisch. Die Grenzen zwischen diesen beiden Polen und der Philosophie, die zwischen ihnen liegt, sind nicht trennscharf, aber klar genug dafür, dass wir den größten Teil ihres Gebiets identifizieren und erkennen können, dass die großen philosophischen Traditionen der Welt alle dort einen Platz haben. Keine davon nimmt diese Kategorie jedoch in Gänze in Beschlag, weshalb auch keine das Recht hat, anderen ihren Anteil daran zu verweigern, weil sie zu ihrem eigenen Urteil darüber gekommen ist, wie Philosophie im besten Fall aussehen sollte. Das Wesen der Philosophie ist selbst eine philosophische Frage, weshalb darüber auch eine Diskussion stattfinden muss.
Am deutlichsten zeigt sich dies, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass es neben den großen klassischen Traditionen auch Kulturen gibt, in denen etwas erkennbar Philosophisches mündlich überliefert wurde, ohne dass dessen Erfindung historischen Denkern zugeordnet werden könnte. Diese Philosophien werde ich im Folgenden zusammenfassend als «mündliche Philosophien» bezeichnen. Ob solche Gedankengebäude tatsächlich «Philosophien» darstellen – oder nicht eher als Mythologien oder bloßer «Volksglaube» betrachtet werden sollten –, ist Gegenstand vieler akademischer Debatten. Doch wie auch immer die Antwort auf diese Frage lautet (worauf ich später noch genauer eingehen werde): Fest steht, dass diese Traditionen zu viel enthalten, was eindeutig mit Philosophie zu tun hat, als dass man ihre Familienähnlichkeit übersehen könnte. Noch wichtiger ist, dass sie die Quellen bestimmter Sicht- und Verständnisweisen sind, die die großen schriftlichen Traditionen herausfordern und bereichern können.
Trotz des Siegeszugs des Westens und seines gewaltigen Einflusses – und ganz gleich, wie eng die Philosophien und Kulturen der Welt in unserer globalen Gemeinschaft verbunden sind – gibt es nach wie vor eindeutig identifizierbare globale philosophische Traditionen mit ihren eigenen spezifischen Charakteristika. Und die Ideen innerhalb dieser Traditionen existieren nicht isoliert. Sie bilden vielmehr Bestandteile größerer Zusammenhänge, von Netzwerken aus Überzeugungen, die sich gegenseitig stützen und begründen, manchmal aber auch in Spannung zueinanderstehen. Diese übergreifende Struktur ist es, die jedem System seinen allgemeinen Charakter verleiht.
Wir müssen allerdings darauf achten, von der unbestreitbaren Tatsache, dass diese besonderen Charaktere existieren, nicht den Fehler des «Essentialisierens» zu begehen, also zu glauben, dass jede Kultur ein einzigartiges und homogenes Wesen besitze, das all ihre Angehörigen gleichermaßen teilen würden. Denn dies übertreibt sowohl die Ähnlichkeiten innerhalb von Gesellschaften als auch deren Unterschiede. So schreibt der in Großbritannien geborene ghanaisch-amerikanische Philosoph Kwame Anthony Appiah, der aufgrund seiner Herkunft das eine oder andere von den Komplexitäten der kulturellen Identität weiß: «Was immer die Afrikaner gemeinsam haben, wir teilen keine traditionelle Kultur, keine Sprachen und kein religiöses oder begriffliches Vokabular. […] Viele afrikanische Gesellschaften haben genauso viel mit nichtafrikanischen traditionalen Gesellschaften gemein wie miteinander.»[11]
Andererseits sollten wir uns aber auch nicht so sehr vor verallgemeinernden Aussagen fürchten, dass wir nun überhaupt keine Generalisierungen mehr vornehmen. Mogobe B. Ramose etwa würde Appiah zwar zustimmen, sagt aber auch, dass «man überzeugend philosophisch dafür argumentieren kann, dass es eine ‹Familienatmosphäre› gibt, das heißt eine Art von philosophischer Affinität und Verwandtschaft zwischen den indigenen Völkern Afrikas», wenn auch eine mit Variationen.[12] Verallgemeinerungen sind vollkommen legitim und angebracht, solange man sie nicht für universelle Aussagen hält. «Männer sind typischerweise größer als Frauen» ist eine wahre Generalisierung; «alle Männer sind größer als alle Frauen» hingegen ist eine falsche Allaussage. Die – zutreffende – Feststellung zu tätigen, dass verschiedene philosophische Traditionen allgemeine Charakteristika aufweisen, impliziert nicht, dass jeder Denker oder jede Schule in jener Tradition diese Charakteristika auch teilt. Verallgemeinerungen mögen viele Ausnahmen haben, so wie ein gebirgiges Land seine Ebenen haben oder ein ernster Mensch auch zu lautem Gelächter in der Lage sein kann. Ich habe versucht, durch den Gebrauch von Wörtern wie «oft» oder «normalerweise» vorsichtig daran zu erinnern; es wäre aber langweilig, diesen Punkt zu sehr und zu häufig zu betonen. Es sei daher dem Leser anheimgestellt, diese wichtige Einschränkung im Hinterkopf zu behalten.[13]
Ein guter Grund dafür, nicht zu essentialisieren, liegt darin, dass es praktisch keine Denkweise gibt, die nur in einer einzigen Kultur vorkommt. Welchen kulturellen Hintergrund man auch hat: Wenn es um Konzepte wie Autonomie, Harmonie und Einsicht geht, wird jeder irgendeine Vorstellung von ihrer Bedeutung und Relevanz haben. Es mag Differenzen in Nuancen der Bedeutung geben, die einen vom Kurs abbringen könnten, sich aber leicht korrigieren lassen. Die zentrale Unterscheidung, die man bemerken wird, liegt aber vielmehr in dem variablen Gewicht, das jede Idee in unterschiedlichen Kulturen hat, das heißt, «welchen Aspekt unseres Menschseins eine kulturelle Tradition eher hervorhebt, bestärkt und als zentral behandelt», wie Kasulis es formuliert. «Was in der einen Kultur im Vordergrund steht, kann in einer anderen im Hintergrund stehen.»[14]
Eine philosophische Tradition hat viel mit einer Sprache gemein. So können wir nur in einer spezifischen Sprache kommunizieren; es gibt keine universelle menschliche Sprache. Das bedeutet aber nicht, dass wir nun selbstgefällig einfach annehmen, es gäbe nur eine einzige Sprache – nämlich unsere eigene –, die die Wahrheit zum Ausdruck bringen könne. Ohne unsere Muttersprachen jemals aufgeben zu müssen, können wir unsere Welterkenntnis erweitern, indem wir weitere Sprachen erlernen. So wie manche Menschen zwei- oder mehrsprachig sein können, können wir uns selbst auch in kultureller Hinsicht zwei- oder mehrfach orientieren und von mehr als einer philosophischen Tradition Gebrauch machen.[15] Der sozialpsychologischen Forschung zufolge bringt ein multikultureller Geist viele Vorteile mit sich. Zudem würden bikulturelle Menschen eine ausgeprägtere Kreativität aufweisen.[16]
Heute gibt es Anzeichen dafür, dass wir ein größeres Interesse an der Verbesserung unserer kulturellen Literalität hegen. Der Aufstieg Chinas zur globalen Supermacht hat einen Wust von Büchern hervorgebracht, die versuchen, die Werte und die Kultur des Landes zu erklären. Das akademische Interesse an anderen Philosophien wächst im Westen, wenn auch von einer recht schmalen Ausgangsbasis her. Man entdeckt Gemeinsamkeiten, so etwa zwischen buddhistischen und anglophonen Konzepten des Selbst. An ostasiatischen Universitäten besteht Interesse sowohl an einheimischen als auch an westlichen Philosophien. Dem Anschein nach erblicken wir heute weniger Gegensätze und hegen weniger das Gefühl, uns entscheiden zu müssen, wer oder was überlegen ist, sondern eher den Wunsch, von der Weisheit zu lernen, wo immer sie zu finden ist.
Mich hat ein Kommentar ermutigt, den Leah Kalmanson mir gegenüber geäußert hat und der vom Werk des postkolonialen Denkers Dipesh Chakrabarty inspiriert war. Sie sagte: «Wenn wir Aristoteles lesen, dann lassen wir ihn in zwei Zeiten leben. Er lebt in seiner eigenen Zeit, und wir verstehen ihn in einem kulturellen und historischen Kontext. Wir halten seinem Denken damit eine gewisse Treue. Er kann aber auch in der Gegenwart zu uns sprechen. Mit nichtwestlichen Texten gehen wir aber anscheinend nicht auf diese Weise um.» Meine Hoffnung ist, dass wir die klassischen Philosophien der Welt lesen und sie zugleich in zwei Zeiten und an zwei Orten leben lassen. Wenn wir vergessen, wann und wo ihre Autoren geschrieben haben, sind wir dazu verurteilt, sie misszuverstehen. Doch wenn wir nicht erkennen, wie das von ihnen Gesagte auch für das Hier und Heute gilt, dann sind wir dazu verdammt, sie ganz zu verwerfen oder zu missbrauchen.
TEIL EINS
Wie die Welt weiß
An einer internationalen Schule im niederländischen Maastricht gehen ein paar intelligente, aber etwas altkluge Teenager die Antworten zu einem Quiz durch, das sie für ihre Mitschüler vorbereitet haben. Sie geben zu, dass sie nicht hundertprozentig dafür garantieren können, die richtigen Antworten gefunden zu haben, versichern uns aber, dass «laut Internet» alles korrekt ist.
Die Frage, worauf unser Wissen gründet, was unser Vertrauen darauf rechtfertigt, dass unsere Überzeugungen wahr sind, ist eine der fundamentalsten Fragen der Philosophie. Dass die Antwort für eine ganze Generation «das Internet» lauten könnte, ist beängstigend. Es ist eine Sache, zu sehr auf die Wikipedia zu vertrauen, die am Ende doch nur eine einzige Website – wenn auch mit einer recht hohen Seriosität – ist. Das Internet selbst, ein buntes Sammelsurium diverser Seiten höchst unterschiedlicher Provenienz, als Autorität für die Wahrheit schlechthin zu betrachten, wirkt hingegen leichtsinnig.
Geschichtlich betrachtet hielten die Menschen für gewöhnlich nicht aus philosophischen Gründen an ihren Überzeugungen fest. Im Allgemeinen nehmen sie einfach die Überzeugungen ihrer Umgebung an, und nur eine Minderheit verweigert sich dem ganz. Dass Pawel in Krakau und Priti in Delhi aufgewachsen ist, erklärt besser, warum Pawel an den auferstandenen Christus und Priti ans Karma glaubt, als jede theologische Begründung, die die beiden liefern könnten.
Auf einer gesellschaftlichen Ebene gibt es allerdings trotzdem immer einige Rechtfertigungen für Überzeugungen, die von größerer Tragweite sind als andere – also Gründe dafür, warum manche Dinge als wahr akzeptiert und andere als falsch abgelehnt werden. Jede Kultur hat eine implizite Populär-Epistemologie, das heißt eine Erkenntnistheorie, so wie fast jede Philosophie eine explizite besitzt. Und diese formellen und informellen Epistemologien hängen miteinander zusammen.
Die internationalen Schüler, die das Internet als ihre Wissensquelle anführen, liefern einen Beleg dafür, dass populäre und formelle Erkenntnistheorien verknüpft sind. Ihrem naiven Glauben, dass das Internet ein verlässliches Archiv von Wahrheit sei, liegt eine Reihe von Annahmen über das Wesen der Erkenntnis zugrunde, die heute zwar weithin als selbstverständlich gelten, zu anderen Zeiten und an anderen Orten in der Geschichte allerdings nicht geteilt wurden. Ihr Vertrauen auf das Netz spiegelt eine Kultur wider, die Wissen jahrhundertelang als das gemeinschaftliche Produkt von Menschen mit Expertise auf unterschiedlichen Gebieten verstanden hat. Ihrer Auffassung nach besteht echtes Wissen aus dem neuesten Sachstand in Bezug auf wahre Fakten, die aufgelistet und zusammengetragen werden können. Werden diese richtig archiviert, dann kann demnach jedermann, der über die nötige Zeit und die erforderlichen Ressourcen verfügt, dieses Wissen selbst entdecken. Die Wahrheit gehört nicht den Eliten, sondern ist demokratisiert worden.
Nicht immer jedoch wurden normale Menschen als dazu fähig erachtet, Wahrheiten selbst herauszufinden und zu verstehen. Die menschliche Forschungstätigkeit galt nicht zu allen Zeiten als die einzige legitime Quelle der Erkenntnis – oft wurde die göttliche Offenbarung als sehr viel zuverlässiger betrachtet. Und auch der «neueste Sachstand» wurde nicht schon immer als erstrebenswertes Ziel angesehen. Tatsächlich behaupten viele Traditionen nach wie vor, dass die tiefsten Wahrheiten über die menschliche Natur antiken Weisen, Propheten und Sehern geoffenbart worden sind.
Dieser kurze Abriss macht in groben Zügen deutlich, dass alltägliche Denkweisen in dem fruchtbaren Boden philosophischer Traditionen wurzeln. Wenn wir verstehen wollen, warum Menschen glauben, was sie glauben, kommt es vor allem darauf an, dass wir mit der Frage beginnen, welche Quellen der Erkenntnis die philosophischen Traditionen für gültig halten, in denen sie aufgewachsen sind.
«VON SUBTILEN SEHERN ERKANNT»
DIE EINSICHT
Für jemanden wie mich, der an die Rituale und Traditionen moderner, westlicher akademischer Konferenzen gewöhnt ist, war die 90. Tagung des Indian Philosophical Congress (IPC) ein eigenartiges Erlebnis. Manche Unterschiede waren eher quantitativer als qualitativer Art. So waren das Überziehen der vorgesehenen Zeiten und die Tendenz der Vortragenden, länger zu sprechen als vorgesehen, einfach nur ausgeprägtere Versionen mir bekannter universitärer Marotten. Allerdings unterschied sich der Kongress in mehreren Hinsichten auch in grundsätzlicher Hinsicht von westlichen Konferenzen.
Den eingeladenen Granden und Gastvortragenden wurde eine extreme Ehrerbietung zuteil. Die Eröffnungszeremonie dauerte zwei Stunden, wobei der Großteil davon auf die Huldigung der (zumeist männlichen) Würdenträger verwendet wurde, von denen mehrere zu spät kamen und den Beginn der Feier damit eine halbe Stunde nach hinten verschoben. Dennoch wurde jeder von ihnen der Reihe nach geehrt, indem man ihnen eine Art goldenes Umhängetuch verpasste und ihnen ein Geschenk von einem Tablett überreichte, das von jungen weiblichen Studierenden in eleganten Saris getragen wurde. Diese rituelle Ehrerbietung hielt den gesamten Kongress über an, da fast alle Vortragenden ihre Beiträge mit einer Danksagung an «all die angesehenen Gelehrten auf dem Podium und jenseits davon» begannen. Oft fielen die Wörter «demütig» und «Bescheidenheit», eine verbale Korrektur der pompöseren Wirklichkeit.
Die offizielle Katzbuckelei stand im Gegensatz zu der völlig fehlenden Aufmerksamkeit des Auditoriums. Dort wurde viel geplaudert, der Saal verlassen und wieder betreten oder mit dem Mobiltelefon herumgespielt. Der Applaus des Publikums am Ende der Vorträge war im Allgemeinen dürftig und kam von weniger Händen als im Raum anwesend. Die Regel lautete anscheinend, dass zwar jeder sprechen sollte, aber niemand zuhören musste, solange allen die gebührende Ehrerbietung zukam und die Stühle besetzt waren.
In Europa und Amerika würde ich erwarten, dass ein Eröffnungsvortrag eine These präsentiert, die in wesentlichen Hinsichten neu und originell ist. Auf dem IPC hingegen waren die Vorträge eher Ausweise für die Belesenheit der Referenten, deren Hauptaufgabe offenbar darin bestand, eine traditionelle philosophische Schule zu repräsentieren. Oder wie es einer der Gastredner formulierte: «Hier ist nicht der Denker wichtig, sondern die Weisheit.» Folglich war da jener Buddhist, der eher eine Predigt als einen Vortrag hielt und dabei eine Botschaft verkündete, die sogar mir, der wenig über diese Religion weiß, vertraut vorkam: Wenn wir mit einem guten Herzen, mit guter Rede und guten Handlungen leben, dann wird das Leben gut sein. (Ich habe gehört, dass dieser Vortrag am Folgetag eine begeisterte Rezension in der Hindustan Times erhalten hat.) In einem ähnlichen Sinne stimmte ein Jain einen Lobgesang auf Aacharya Tulasi an, einen bedeutenden Jain-Mönch; die Gujarat Vidyapeeth Lecture on Gandhian Philosophy and Peace pries Mahatma Ghandi als Philosophen, Politiker und Heiligen, der uns den Weg zu einer moralisch besseren Welt gewiesen habe; einige Referenten warben für das Advaita-Vedanta, ein anderer für das Shaiva Siddhanta, und so weiter. Am Ende jedes Vortrags fasste die Sektionsleitung das Gesagte zusammen und lobte das Zusammenspiel von Eloquenz, Klarheit, Gelehrtheit und Tiefgründigkeit des jeweiligen Vortragenden. Nachfragen waren nicht vorgesehen, was angesichts der Tatsache, dass ohnehin keine Diskussion stattfand, ganz passend war. Diese Eigenart der indischen Gegenwartsphilosophie frustrierte nicht nur eine Minderheit der Kongressbesucher, sondern irritiert auch viele Gelehrte, deren Wirkungsstätte außerhalb des Subkontinents liegt. Ein in Indien lebender Philosoph äußerte mir gegenüber, dass seine Disziplin es dort nur noch mit Wiederholungen und nicht mehr mit Originalität zu tun habe. Und ein ausländischer Vortragender klagte in meinem Beisein darüber, dass den Großteil der sogenannten Philosophie in Indien heute die Wiedergabe von Gedanken ausmache und nicht das Denken selbst. Ironischerweise hielt aber auch er ein Referat, das im Namen seines Lehrers gehalten wurde, für den er nur lobende Worte übrighatte.
Auf besagtem Kongress war eine starke Gegnerschaft gegen die westliche Kultur und Philosophie zu spüren, die sich sowohl gegen deren manifeste Mängel als auch gegen ihr arrogantes Überlegenheitsgefühl gegenüber der indischen Kultur richtete – wobei ich fürchtete, mich aufgrund meiner skeptischen Kommentare ebenfalls schuldig gemacht zu haben, dieses Überlegenheitsgefühl zu kultvieren. Eine ganze Reihe jener ablehnenden Bemerkungen waren beschämende Erinnerungen an das rassistische und kolonialistische Erbe des Westens. Ein Vortragender etwa teilte der Zuhörerschaft mit, dass der vermeintlich große Liberale John Stuart Mill ganz Indien und Asien generell als den dunklen Kontinent abgetan habe, der der Zivilisierung bedürfe. Dass es in Wirklichkeit dessen Vater, James Mill, gewesen war, der von dem «schwachen und halbcivilisierten» indischen Volk und von der «Dunkelheit, Unbestimmtheit und Verwirrung» der «ganze[n] indische[n] Mythologie» gesprochen hatte, war kaum von Belang, da es noch zahlreiche andere Beispiele gäbe, die der Referent hätte anführen können.[1] «Die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Rasse der Weißen», schrieb Immanuel Kant im Jahr 1802. «Die gelben Inder haben schon ein geringeres Talent. Die Neger sind tiefer, und am tiefsten steht ein Teil der amerikanischen Völkerschaften.»[2] Der Rassismus seines Fast-Zeitgenossen David Hume unterschied sich von seinem eigenen nur dem Grad seiner Gewissheit nach: «Ich neige der Annahme zu, dass die Neger und allgemein alle anderen menschlichen Arten der weißen natürlicherweise unterlegen sind.»[3]
Ein großer Teil der Ablehnung der westlichen Gegenwartskultur speiste sich dort jedoch lediglich aus gezielt ausgewählten Anekdoten. Ein Vortragender merkte an, dass es in den USA nach Überschwemmungen zu Plünderungen gekommen sei, während nach einer ähnlichen Naturkatastrophe in der indischen Stadt Chennai der Tempel rund um die Uhr geöffnet geblieben sei, um den Opfern zu helfen. Ein anderer führte den Suizid eines Philosophiestudierenden aus Harvard als Beleg für den Nihilismus des westlichen Denkens und dessen «erstaunliches Versagen bei der Aufrechterhaltung eines ganzheitlichen Bilds von der Wirklichkeit» an.
Es ist nun verlockend, diese Vorkommnisse auf dem Indian Philosophical Congress in einem rein soziologischen Sinne zu erklären. Man könnte sagen, dass die indische Gesellschaft traditioneller und hierarchischer organisiert ist als die Gesellschaften des Westens, und dass dies – neben ihrer kolonialen Geschichte – alles ist, was wir benötigen, um die Ehrerbietung, die Bedeutung der Tradition und die antiwestliche Rhetorik zu verstehen. Mit dieser Antwort würden wir allerdings das philosophische Setting nicht ernst nehmen. Wenn wir zu erklären versuchen, warum indische Philosophen ihr Fach so betreiben, wie sie es eben tun, ohne dabei die Philosophie selbst zu betrachten, dann reduzieren wir sie auf anthropologische Kuriositäten. Wenn wir sie als Philosophen ernst nehmen wollen, müssen wir fragen, ob es neben soziologischen auch philosophische Gründe gibt, aus denen sie ihr intellektuelles Leben auf diese Weise führen.
Dieser Anspruch entspricht sicherlich auch dem, was westliche Menschen von ihrer eigenen Tradition verlangen würden. Gewiss gibt es Gepflogenheiten und Anstandsregeln, die einige der eigenartigen Vorgänge auf philosophischen Konferenzen im Westen erklären – zum Beispiel den Umstand, dass es unweigerlich ein Abendessen gibt, das es vermag, zugleich formal beeindruckend und gastronomisch misslungen zu sein. Wenn man aber erklären will, warum Philosophen auf Konferenzen Argumente verfechten und an ausgiebigen Frage-und-Antwort-Sektionen teilnehmen, muss man verstehen, wie diese sich in die von ihnen vertretene Konzeption von Philosophie einfügen, in der individuelle Denker Begründungen für eigenständig entwickelte Schlüsse in Form strenger Argumente präsentieren. Oder anders formuliert: Um zu erklären, wie Philosophie betrieben wird, muss man die Ideale erklären, die diese Praxis zu verkörpern sucht. Was aber sind die Ideale, die der Art und Weise zugrunde liegen, auf die die Philosophen in Indien ihre Ideen präsentieren?
Einen Hinweis gibt das traditionelle Wort für Philosophie in Indien: «Darshana». Dieser Ausdruck leitet sich von der Wurzel dṛś ab, die mit «sehen» übersetzt werden kann. «Darshana» bedeutet zugleich «Philosophie» und «sehen» oder «etwas betrachten».[4] Und diese doppelte Bedeutung hat das Wort, weil die Philosophie in Indien in weiten Teilen als eine Art des Sehens betrachtet worden ist. So waren die ursprünglichen Dichter der Veden die ersten Rishis, was «Seher» bedeutet.[5] Man glaubte, dass der Pfad des Verstehens nicht so sehr über die Tätigkeit der Vernunft denn über das Erlenen von Praktiken des Ānvīkṣikī – des Anschauens – verläuft, die uns in die Lage versetzen, eine unmittelbare Wahrnehmung (sākṣāt-kāra) der Wirklichkeit an sich zu haben.[6] Dies erklärt teilweise auch, warum einer der Giganten des indischen Denkens – Shankara oder auch Shankaracharya genannt, der vermutlich im achten nachchristlichen Jahrhundert schrieb – die Ausdrücke Maya (Illusion) und Avidya (Unwissenheit) synonym verwendet hat. Unwissenheit ist das Unvermögen, richtig zu sehen, und damit die Kehrseite der Ansicht, dass Sehen und Wissen identisch sind.
Diese Betonung einer subtilen Art der Wahrnehmung zieht sich durch die gesamte Geschichte der klassischen indischen Philosophie hindurch, welche Pratyaksha als zuverlässige Quelle der Erkenntnis identifiziert. Die ursprüngliche Bedeutung dieses Wortes war zwar die alltägliche sinnliche Wahrnehmung, entwickelte sich aber dahingehend weiter, dass sie fortan alle Arten des unmittelbaren Begreifens umfasste – ob sinnlich, spirituell oder intellektuell.[7] Daher heißt es in den Upanishaden auch, dass das Wissen vom großen/universellen Selbst (Atman) «nicht durch Anleitung noch durch Verstand oder viel Gelehrtheit» erlangt wird, sondern «von subtilen Sehern mit überlegenem, subtilem Geist geschaut» wird.[8] Das hierbei erforderliche Sehen ist nicht das der normalen Sinneswahrnehmung: «Nicht durch das Auge wird er erfasst noch durch die Rede oder andere Sinnesorgane, durch Werke oder Kasteiung»; nur «durch Meditation erkennt man den, der ungeteilt ist».[9]
Radhakrishnan pflichtet dieser Charakterisierung der klassischen indischen Tradition bei. Besonders mit Blick auf die orthodoxen Schulen sagt er: «Die Vernunft untersteht der Intuition. Das Leben kann in seiner ganzen Fülle von der logischen Vernunft nicht begriffen werden. […] Die Philosophie Indiens basiert auf dem Geist [spirit], der über der bloßen Logik steht, und behauptet, dass eine auf reiner Logik oder Wissenschaft basierende Kultur zwar effizient, aber nicht inspirierend sein kann.»[10] Zugespitzter noch heißt es bei ihm auch: «Philosophie führt uns zwar zu den Toren des gelobten Landes, kann uns aber keinen Eintritt verschaffen; dafür braucht es vielmehr der Einsicht oder Realisierung.»[11]
Wir müssen darauf achten, nicht zu unterstellen, dass die gesamte indische Philosophie eine Art mystische Einsicht darstellt, die durch Meditation erlangt wird. Die diversen Schulen der indischen Philosophie legen sehr viel Wert darauf, genau zu spezifizieren und zu beschreiben, was sie als gültige Pramanas (Quellen oder Mittel der Erkenntnis) betrachten. Obwohl jede Schule sie anders versteht, gibt es im Grunde sechs davon, die sie entweder ablehnen oder bejahen. Es ist zwar nicht möglich, sich allein anhand ihrer Namen einen Begriff von ihnen zu machen, doch selbst ein kurzer Überblick zeigt schon, dass die indische Philosophie viel mehr zu bieten hat als mystische Einsichten. Jene sechs Pramanas sind: Pratyaksha (Wahrnehmung), Anumana (Schlussfolgerung), Upamana (Vergleich und Analogie), Arthapatti (Postulat, Ableitung aus den Umständen oder dem Selbstverständlichen), Anupalabdhi (Nichtwahrnehmung, negativer/kognitiver Beweis) und Shabda (Wort, das Zeugnis vertrauenswürdiger Experten). Von diesen ist Anumana fast so allgegenwärtig wie Pratyaksha, was deutlich macht, dass für viele Schulen zumindest einige Formen des Denkens ebenso einen Teil der indischen philosophischen Tradition bilden wie irgendeine Einsicht.
Charles Moore warnt, dass das Gewicht der Intuition – im Verbund mit Autorität und einer Skepsis gegenüber der Vernunft – sowohl von westlichen als auch einheimischen Kommentatoren der Philosophie Indiens tendenziell übertrieben dargestellt wird. Dies kann durch die Anerkennung des Umstands korrigiert werden, dass die Intuition nicht für einen universellen Trumpf gehalten wird, der alles andere aussticht, sondern schlicht eine essenzielle Komponente in einem System des Verstehens bildet, das alle menschlichen Vermögen einschließt. Wie S. K. Saksena es formuliert, ist die Quelle der Erkenntnis «weder die Sinnlichkeit noch die Vernunft oder die Intuition, sondern das ganze Menschsein».[12] Der Unterschied liegt demnach lediglich darin, dass Pratyaksha in vielen Schulen eine viel wichtigere Rolle als in anderen globalen Traditionen spielt.
Pratyaksha ist eng mit einem anderen Pramana verwandt, nämlich Shabda. Das Nyāya Sutra definiert letzteres als «die anleitende Aussage einer vertrauenswürdigen Person».[13] Beide arbeiten für gewöhnlich als Team: Wir glauben den Aussagen der Rishis, weil diese über eine besonders ausgeprägte Fähigkeit zur Wahrnehmung dessen verfügen, was die Realität als solche ist. Wie Deepak Sarma es ausdrückt, werden heilige Texte deshalb als gültige Erkenntnisquellen betrachtet, weil sie «im Pratyaksa von Rishis gründen».[14]
Manchmal sind diese Vermögen sogar auf übernatürliche Weise außergewöhnlich. Mehrere Biografien über Shankara, den Begründer des Advaita-Vedanta, erzählen eine Geschichte, die damit beginnt, dass er gegenüber einem Philosophenpaar für die Ablehnung des weltlichen Lebens und damit auch ihrer Vermählung plädiert. Als die Frau darauf verweist, dass Shankara damit ein Leben zurückweist, das er selbst gar nicht erlebt hat, nutzt er seine yogischen Kräfte, um in den Körper des kürzlich verstorbenen Königs Amaruka zu fahren, diesen wieder zum Leben zu erwecken und anschließend die Künste der körperlichen Liebe zu erlernen. Als er fertig ist, kehrt er in seinen eigenen Körper zurück und ist nun in der Lage, durch seine Erfahrungen aus erster Hand zu berichten, dass er die ganze Zeit recht gehabt hatte.[15]
In der Hierarchie der Erkenntnisquellen steht das Zeugnis (Shabda) der größten Seher (Rishis) zumeist über der Wahrnehmung (Pratyaksha) selbst großer Geister, die allerdings wiederum selbst die eindrucksvollsten rationalen Argumente aussticht. Shankara verwirft «ein Denken, das die heiligen Schriften ignoriert», da es «nur auf der individuellen Meinung» fuße und «kein richtiges Fundament» besitze. Nicht einmal dem Denken «der angesehensten Geistesgrößen wie Kapila, Kanāda und anderen philosophischen Schulbegründern» können wir demnach vertrauen, da sie einander widersprechen.[16]
Wem zugebilligt wird, einen hohen Grad an Einsicht erlangt zu haben, der wird mit großer Ehrerbietung und Achtung behandelt. Die Wurzeln des Wortes «Upanishaden» zeigen dies: upa (nahe), ni (danieder) und sad (sitzen). Gruppen von Schülern saßen in der Nähe ihrer Lehrer, um Wahrheiten von ihnen zu erlangen.[17] Im Gesetzbuch des Manu gibt es eine Passage, die betont, wie schändlich es ist, sich dem eigenen Lehrer zu widersetzen: «Indem er seinen Lehrer rügt, wenn auch zu Recht, wird er in seinem nächsten Leben als Esel wiedergeboren, und verleumdet er ihn fälschlicherweise, dann als Hund; wer von den Mitteln seines Lehrers lebt, als Wurm, und wer ihm seine Verdienste neidet, als größeres Insekt.»[18] Man beachte das «wenn auch zu Recht»: Es ist falsch, den eigenen Lehrer zu rügen, selbst wenn er irrt. Dies ist eine Art von Ehrerbietung, die bis zum Äußersten getrieben wird.
Wie meine Erlebnisse auf dem Indian Philosophical Congress schon angedeutet haben, ist die Respektsbekundung gegenüber Sehern in Indien auch heute noch wichtig. Eine der ersten Gruppen, die ich kennenlernte, waren die Anhänger von Dr. Ramchandra Pralhad Parnerkar (1916–1980), der, wie sie mir begeistert berichteten, vedische und westliche Philosophie, das Objektive und das Subjektive, Geist und Materie miteinander verknüpft habe. So begierig waren sie, seine Philosophie des Poornawād