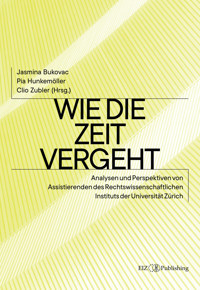
Wie die Zeit vergeht – APARIUZ XXV E-Book
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: buch & netz
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Der XXV. Jubiläumsband der Schriftenreihe APARIUZ steht unter dem Leitthema «Wie die Zeit vergeht». In elf Beiträgen reflektieren Nachwuchsforschende der Universität Zürich aktuelle Themen zur Temporalität in der Rechtswissenschaft. Die Beiträge analysieren neue Herausforderungen, zeigen historische Entwicklungen auf, fragen, ob die bekannten Lösungen noch zeitgemäss sind, und ordnen zeitliche Abläufe von Verfahren ein. Abgerundet wird der Band durch zwei Gastbeiträge.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Jasmina Bukovac Pia Hunkemöller Clio Zubler(Hrsg.)
Wie die Zeit vergeht
APARIUZ XXV
Mit Beiträgen von Charlotte Beck Tabea Berger Barbara Borkowski Julie Frei Stella Galehr Florian Geering Lena Hänni Marion A. Huggler Carlo Lienhard Lucile Pasche Una Schamberger Gabriel Schürch Cédric Schütz Kateryna Shapovalova Gabriel Steffen Vera Raguth Tscharner Subira von Euw Fiona Zilian
Mit Gastbeiträgen von Alessia Dedual Andreas Thier
Wie die Zeit vergeht – APARIUZ XXV Copyright © by Jasmina Bukovac; Pia Hunkemöller; und Clio Zubler is licensed under a Creative Commons Namensnennung-Nicht kommerziell-Keine Bearbeitung 4.0 International, except where otherwise noted.
© 2024 – CC BY-NC-ND (Werk), CC BY-SA (Text)
Verlag: EIZ Publishing (eizpublishing.ch)Herausgeberinnen: Jasmina Bukovac, Pia Hunkemöller, Clio ZublerProduktion, Satz und Vertrieb: buch & netz (buchundnetz.com)ISBN:978-3-03805-718-5 (Print – Softcover)978-3-03805-719-2 (Print – Hardcover)978-3-03805-720-8 (PDF)978-3-03805-721-5 (ePub)DOI: https://doi.org/10.36862/eiz-719Version: 1.02 – 20240910
Dieses Werk ist als gedrucktes Buch sowie als E-Book (open access) in verschiedenen Formaten verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter der URL:https://eizpublishing.ch/publikationen/wie-die-zeit-vergeht-apariuz-xxv/.
1
Vorwort
Der diesjährige Band der Schriftenreihe APARIUZ – Analysen und Perspektiven von Assistierenden des Rechtswissenschaftlichen Instituts der Universität Zürich – markiert das 25. Jubiläum der Reihe.
Jubiläen bieten die Gelegenheit, sowohl einen Blick zurück als auch in die Zukunft zu werfen. Als der erste Band 1999 erschien, erlebte die Schweiz ein besonderes politisches Jahr. In der Volksabstimmung vom 18. April 1999 nahmen Volk und Stände die neue Bundesverfassung an, in der bisher ungeschriebenes Recht ausdrücklich verankert wurde. Die totalrevidierte Verfassung trat bereits wenige Monate später, am 1. Januar 2020 in Kraft. Das Bundesamt für Justiz hielt dazu fest, die neue Bundesverfassung gebe «die moderne Verfassungswirklichkeit wieder»[1]. Ob dies 25 Jahre später noch zutrifft, überlassen wir dem Urteil unserer Leserinnen und Leser. Hinsichtlich der Gleichstellung machte die Schweiz ebenfalls Fortschritte, wenn auch – wie üblich in diesem Bereich – sehr spät: Mit Ruth Dreifuss erhielt die Schweiz 1999 ihre erste weibliche Bundespräsidentin.
Das Jahr 2024 markiert auch weitere Jubiläen: Die NATO erinnert mit dem 75. Jahrestag an die Unterzeichnung ihres Gründungsdokuments und die Feier zur Erinnerung des D-Days vor achtzig Jahren regte zum Nachdenken an. Denn die Gegenwart bietet leider Grund zu Pessimismus. Anhaltende Kriege und Krisen beschäftigen Europa, den Nahen Osten und die Welt. Umso wichtiger ist es, dass wir als Gesellschaft gemeinsam an einer friedlichen, freiheitlichen und toleranten Zukunft arbeiten. Es ist die Aufgabe der Rechtswissenschaft, zur Erfüllung dieser Werte beizutragen, indem sie vergangene und gegenwärtige Entwicklungen kritisch analysiert und innovative Vorschläge für die Zukunft macht.
Optimistisch sind wir, was die Zukunft der APARIUZ-Reihe betrifft. In der Hoffnung auf viele weitere Bände haben wir ein neues Buchcover konzipiert. Als Inspiration diente uns die für die Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Zürich identitätsstiftende, ikonische Bibliothek des Architekten Santiago Calatrava, welche vor 20 Jahren fertig gestellt wurde. Wir freuen uns, damit eine neue Tradition zu begründen.
Unser Jubiläumsband widmet sich dem Thema Zeit. Zeit beeinflusst das Recht und die Rechtswissenschaft massgeblich in all ihren Ausprägungen. Geltendes Recht wird in der Gegenwart umgesetzt, vergangene Entwicklungen beeinflussen die Rechtsetzung und die Forschung, die wiederum die Zukunft antizipieren und gestalten sollen.
Zwei Gastbeiträge bilden den Auftakt. Prof. Andreas Thier untersucht die Beziehung von Zeit und Recht, indem er die Funktionen und die Bedeutung von Vergangenheit und Geschichtlichkeit für Recht und Rechtswissen aufzeigt. Prof. Alessia Dedual befasst sich mit dem Fristenstillstand nach Art. 134 OR und den sich daraus ergebenden Herausforderungen bei der Berechnung der Verjährung.
In drei folgenden Teilen setzen sich die Autorinnen und Autoren mit dem Vermächtnis der Vergangenheit auseinander, indem sie bedeutende juristische Veränderungen rückblickend analysieren. Die Herausforderungen der Gegenwart werden durch fundierte Konfliktanalysen und praxisnahe Lösungsansätze im geltenden Recht adressiert. Darüber hinaus betrachten sie Chancen der Zukunft, indem sie Perspektiven aufzeigen und innovative Entwicklungen benennen.
Gabriel Steffen analysiert die völkerrechtlichen Abkommen zwischen der Schweiz und den Europäischen Gemeinschaften von der Gründung der EGKS bis zum Abschluss der Bilateralen I. Er zeigt ihre Verbindungen auf und beleuchtet ihre Auswirkungen auf die Integration der Schweiz in den Rechtsraum der europäischen Gemeinschaften. Gabriel Schürch ordnet den Denkmalschutz in seiner begrifflichen und gesellschaftlichen Bedeutung rechtshistorisch ein, setzt sich kritisch mit der heutigen breiten Anwendung auseinander und fragt, wie sich zukünftige Entwicklungen darauf auswirken könnten. Stella Galehr behandelt verschiedene Rechtsgrundlagen des Datenschutzes, etwa das Datenschutzgesetz der Schweiz, die Datenschutz-Grundverordnung der EU und diejenigen aus den USA. Sie zeigt, wie sich diese mit der Zeit verändert haben und welche unterschiedlichen Ansätze sie verfolgen, um auf neue technologische Entwicklungen zu reagieren. Barbara Borkowski und Fiona Zilian diskutieren das Recht des Kindes zur Anfechtung der Ehelichkeitsvermutung nach Art. 256 ZGB, indem sie die historische Entwicklung der Anfechtungsgründe reflektieren und den heutigen gesellschaftlichen Ansichten gegenüberstellen.
Mit einer für die Rechtswissenschaft jungen Forschungsmethode – der Empirie – ermitteln Florian Geering und Una Schamberger, wie lange ein Verfahren am Bundesgericht dauert und ordnen die Ergebnisse rechtlich ein. Dabei weisen sie auf eine Problematik bei Verfahren in Strafsachen hin. Julie Frei und Subira von Euw widmen sich dem System der ausserordentlichen Rechtsmittel im Asylverfahren, wobei echte und unechte Noven als Anhaltspunkt dienen. Sie setzen diese Rechtsmittel ausserdem in Zusammenhang mit den Verfahrensgrundrechten und zeigen auf, welche praktischen Probleme sich daraus ergeben. Auch das Behindertengleichstellungsgesetz feiert mit seinem Inkrafttreten 2004 ein 20-jähriges Jubiläum. Lena Hänni, Carlo Lienhard, Vera Raguth Tscharner und Cédric Schütz setzen sich mit den rechtlichen Anforderungen an eine universitäre Laufbahn von Menschen mit Behinderungen auseinander und spiegeln diese mit der Realität und den Herausforderungen, die diese nach wie vor mit sich bringt. Tabea Berger thematisiert die Diskrepanz zwischen den rechtlichen Anforderungen an die Partizipationsrechte der Kinder und deren tatsächlicher Umsetzung in der Praxis und stellt fest, dass es Zeit ist für eine neue Pflegekindverordnung. Lucile Pasche und Charlotte Beck befassen sich mit dem Recht auf Vergessenwerden, einem Recht, das als Reaktion auf jüngere technologische Entwicklungen verstanden werden kann. Sie beziehen dabei auch das totalrevidierte Datenschutzgesetz ein, das erst vor einem Jahr in Kraft getreten ist.
Kateryna Shapovalova setzt sich mit der künstlichen Intelligenz auseinander und zieht die Verbindung zum Recht auf Arbeit. Sie zeigt die damit einhergehenden Gefahren und Chancen auf und beleuchtet potenzielle rechtliche Regelungen. Der Beitrag von Marion A. Huggler behandelt die rechtlichen und ethischen Fragen, die durch innovative Ansätze in der Pflege – etwa durch Telepflege oder robotische Systeme – entstehen. Künstliche Intelligenz bietet hier innovative Ansätze, dem Fachkräftemangel und den demografischen Veränderungen zu begegnen.
Diese Beiträge umfassen eine beachtliche Bandbreite, beweisen innovative Ansätze und exakte wissenschaftliche Arbeit. Der wissenschaftliche Nachwuchs von heute zeigt damit, dass die Rechtswissenschaft auch für die Zukunft gut aufgestellt ist. An dieser Stelle möchten wir allen Autorinnen und Autoren für ihren grossen Einsatz danken, ohne den dieses Werk nicht möglich wäre. Unser Dank gebührt auch unserer Gastautorin Prof. Alessia Dedual und unserem Gastautor Prof. Andreas Thier, die durch ihre Beiträge wertwolle wissenschaftliche Orientierung und Anregung eingebracht haben.
Wir möchten EIZ Publishing unseren herzlichen Dank aussprechen. Durch ihre weitsichtige Begleitung unseres Bandes haben sie einen bedeutenden Beitrag zur Nachwuchsförderung geleistet. Insbesondere danken wir Dr. Tobias Baumgartner und Sophie Tschalèr für die unkomplizierte und effiziente Zusammenarbeit sowie Daniela Eichholzer für das umsichtige Korrektorat. Ebenfalls sehr geschätzt haben wir die inhaltliche Durchsicht durch die Peer-Reviewerinnen und Peer-Reviewer. Für die kreative Umsetzung unserer Ideen für das Buchcover gebührt Dominik Huber unser Dank. Bei der Überprüfung der Formalien war uns Lisa Fahrni eine grosse Unterstützung; auch hierfür ein besonderes Danke.
Zudem möchten wir unseren herzlichen Dank an all jene Personen und Institutionen richten, die durch ihre Unterstützung zur Entstehung dieses Buches beigetragen haben. Für die Realisierung dieses Projektes durften wir auf die finanzielle Unterstützung von verschiedenen Seiten zählen. Ein grosser Dank gebührt dem Dekan Prof. Thomas Gächter und dem Prodekanat für Forschung und Nachwuchsförderung, insbesondere Prof. Helmut Heiss und Irene Schildknecht, sowie dem Fakultätsvorstand der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich. Sie haben neben einem substanziellen Beitrag zu den Publikationskosten auch einen Beitrag an die Gestaltung des neuen Buchcovers sowie an die Buchvernissage geleistet. Zudem hat uns der UZH-Publikationsfonds Geistes- und Sozialwissenschaften bei der Finanzierung der Publikationskosten unterstützt. Auch in der Praxis stösst das Projekt APARIUZ auf Wohlwollen: Wir durften auf zusätzliche Unterstützung der Anwaltskanzleien Lenz & Staehelin, Bär & Karrer sowie Nobel & Partner zählen.
APARIUZ hat eine 25-jährige Tradition. Wir danken dem Herausgeberteam des vorangehenden Bandes – Dominik Bopp, Alexander Kistler, Natalie Lisik und Kristof Reber – für die wertvollen Tipps und wünschen dem Herausgeberteam des nächsten Bandes viel Erfolg bei der Umsetzung ihres Projektes.
Zürich, im September 2024
Jasmina Bukovac Pia Hunkemöller Clio Zubler
2
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Inhaltsverzeichnis
Autorinnen- und Autorenverzeichnis
Herausgeberinnenverzeichnis
Gastbeiträge
Andreas ThierZeit und Zeitlichkeit, Recht und Rechtswissen
Alessia DedualTime May Be Short
Vermächtnis der Vergangenheit
Gabriel SteffenDie älteren Abkommen zwischen der Schweiz und den Europäischen Gemeinschaften
Gabriel SchürchDenkmalschutz im Wandel der Zeit
Stella GalehrDatenschutzregulierung im Wandel der Zeit
Barbara Borkowski / Fiona ZilianDas Recht des Kindes zur Anfechtung der Ehelichkeitsvermutung nach Art. 256 ZGB
Herausforderungen der Gegenwart
Florian Geering / Una SchambergerDauert das noch lange?
Julie Frei / Subira von EuwChaque chose en son temps
Lena Hänni / Carlo Lienhard / Vera Raguth Tscharner / Cédric SchützBarrierefreier Bildungsweg an der UZH
Tabea BergerZeit für eine neue PAVO
Lucile Pasche / Charlotte BeckDroit à l’oubli : Analyse de ses composantes et applications
Chancen der Zukunft
Kateryna ShapovalovaTo the modern dimension of the right to work
Marion A. HugglerDigitale Leistungen in der Langzeitpflege
3
Autorinnen- und Autorenverzeichnis
Charlotte Beck hat einen Bachelor of Law der Universität Lausanne und einen zweisprachigen Master of Law der Universitäten Lausanne und Zürich absolviert. Sie ist Redakteurin bei swissprivacy.law und arbeitet als Fachjuristin für Datenschutz.
Tabea Berger, MLaw, Rechtsanwältin, studierte Rechtswissenschaft an den Universitäten Zürich und Lausanne. Nach ihrem Abschluss arbeitetet sie an einem Bezirksgericht und in einer Anwaltskanzlei. 2022 erlangte Tabea Berger das Anwaltspatent des Kantons Aargau und nahm anschliessend ihre Tätigkeit als wissenschaftliche Assistentin am Lehrstuhl für Privatrecht, Rechtsvergleichung, Tierschutzrecht und Rechtsphilosophie von Prof. Dr. Margot Michel an der Universität Zürich auf. Sie verfasst ihre Dissertation im Bereich des Kindesschutzrechts.
Mag. Barbara Borkowski studierte Rechtswissenschaft an der Universität Wien. Nach ihrem Abschluss war sie am Gericht sowie im österreichischen Bundesministerium für Justiz tätig, bevor sie im November 2022 ihre Tätigkeit als wissenschaftliche Assistentin am Lehrstuhl für Privatrecht und Rechtsvergleichung von Prof. Dr. iur. Dr. h.c. Andrea Büchler begann. Als Doktorandin an der Universität Zürich forscht sie im Rahmen ihrer Dissertation insbesondere zu Rechtsfragen an der Schnittstelle zwischen Familienrecht und dem übrigen Privatrecht unter besonderer Berücksichtigung rechtsvergleichender Aspekte.
Alessia Dedual, Gastautorin, ist seit 2022 Assistenzprofessorin für Privatrecht mit Schwerpunkt Obligationenrecht, Rechtsvergleichung und Recht und Ökonomik an der Universität Zürich.
Julie Frei studierte Rechtswissenschaft an den Universitäten Lausanne und Zürich. Sie doktoriert im Bereich des Asylrechts und der Menschenrechte und ist am Lehrstuhl für Legal Data Science und Öffentliches Recht von Prof. Dr. Tilmann Altwicker als wissenschaftliche Assistentin tätig.
Stella Galehr ist Doktorandin an der Universität Zürich. Sie verfasst eine Dissertation zur Schnittstelle von Wettbewerbsrecht und Datenschutz in der Europäischen Union. Sie hat Rechtswissenschaft an der Universität Zürich (MLaw) und der University of California, Berkeley (LL.M.) studiert. Sie arbeitet derzeit als Assistentin am Lehrstuhl für Handels-, Wirtschafts- und Europarecht von Prof. Dr. iur. Andreas Heinemann an der Universität Zürich.
Florian Geering doktoriert an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich. In seiner Dissertation «Access to the Swiss Federal Supreme Court – an empirical perspective» untersucht er, ob der Zugang zum Schweizer Bundesgericht gleich und effektiv ist und analysiert dabei empirisch, welche Fälle und Parteien an das Bundesgericht gelangen. Florian hat einen Master of Law an der Universität Zürich sowie ein Diploma of Advanced Studies (DAS) in Angewandter Statistik an der ETH Zürich abgeschlossen.
Lena Hänni studierte Rechtswissenschaft an der Universität Zürich. Sie ist als wissenschaftliche Assistentin am Lehrstuhl für Informations- und Kommunikationsrecht von Prof. Dr. Florent Thouvenin tätig und verfasst ihre Dissertation im Bereich des Immaterialgüterrechts.
Marion A. Huggler (Dr. iur. des. UZH) verfasste ihre Doktorarbeit an der Universität Zürich zum Thema Pflegeversicherung und digitale Leistungen in der Langzeitpflege unter der Betreuung von Prof. Dr. iur. utr. Brigitte Tag und Prof. Dr. iur. Thomas Gächter. Von 2021 bis 2022 war sie Co-Geschäftsführerin des Kompetenzzentrum MERH und Programmkoordinatorin des PhD Programm BmEL. Sie besitzt zudem einen MA in Human Rights der Donau Universität Krems (Österreich) und ist ausgebildete Sozialpädagogin, sowie Schulleiterin. Aktuell ist sie Rechtsvertreterin bei der Berner Rechtsberatung für Menschen in Not.
Carlo Lienhard studierte Rechtswissenschaft an den Universitäten Zürich und Lausanne. Er ist als wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Staats-, Verwaltungs- und Sozialversicherungsrecht von Prof. Dr. Thomas Gächter tätig und wird eine Dissertation im Bereich des Sozialversicherungsrechts verfassen.
Lucile Pasche hat einen Bachelor of Law der Universität Lausanne und einen zweisprachigen Master of Law der Universitäten Lausanne und Zürich absolviert. Sie arbeitet als Doktorandin am Lehrstuhl von Prof. Dr. Felix Uhlmann. Sie verfasst Ihre Dissertation im Bereich der Übertragung von Verwaltungsaufgaben und dem Datenschutzrecht.
Una Schamberger doktoriert an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich. In ihrer Dissertation «Operationalising Procedural Fairness – A Process-Legitimacy Framework for the European Court of Human Rights» verbindet sie theoretische, dogmatische und empirische Analysen, um Standards der Verfahrensgerechtigkeit für den EGMR zu formulieren. Ausserdem arbeitet sie als wissenschaftliche Assistentin am Lehrstuhl von Prof. Dr. Tilmann Altwicker an der Universität Zürich. Una hat an der Universität Leiden einen Master of Law in Völkerrecht erworben und verfügt über Arbeitserfahrung am Internationalen Strafgerichtshof, bei Human Rights Watch und bei einer internationalen Anwaltskanzlei.
Gabriel Schürch studierte Rechtswissenschaft an den Universitäten Luzern und Neuchâtel und schloss 2020 seinen Master (MLaw Luzern/Neuchâtel) ab. Anschliessend war er als Substitut in einer Anwaltskanzlei tätig. Seit 2022 doktoriert er im Bereich des Natur- und Heimatschutzrechts und wirkt als Assistent am Lehrstuhl für Staats-, Verwaltungs- und Europarecht von Prof. Dr. iur Biaggini.
Cédric Schütz studierte Rechtswissenschaft an der Universität Zürich. Er ist als wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Straf- und Strafprozessrecht von Prof. Dr. Gunhild Godenzi tätig und verfasst seine Dissertation über die Konkurrenz von Rechtfertigungsgründen.
Kateryna Shapovalova erlangte sowohl ihren BLaw- als auch ihren MLaw an der Nationalen Universität Jaroslaw der Weise und ergänzte ihr akademisches Profil mit einem Bachelor-Abschluss in Buchhaltung und Revision von der Nationalen Universität Semyon Kuznets. Derzeit schreibt sie ihre Dissertation im Bereich des Arbeitsrechts an der Universität Zürich. Sie ist Co-Leiterin der AI and Law Community bei den UZH Digital Society Initiatives und hat zudem ein Fellowship des DSI Excellence Programme erhalten.
Gabriel Steffen studierte Rechtswissenschaft an der Universität Zürich (MLaw) und absolvierte im Rahmen des Masterstudiums ein Austauschsemester an der Sciences Po Paris. Seit Abschluss des Studiums arbeitet er an der Universität Zürich als wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Staats-, Verwaltungs- und Europarecht unter besonderer Berücksichtigung von Demokratiefragen von Prof. Dr. iur. Andreas Glaser und schreibt eine Dissertation zur Bedeutung des autonomen Nachvollzugs als Grundlage für die Anerkennung der Gleichwertigkeit im Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU.
Andreas Thier, studierte Geschichts- und Rechtswissenschaften in Tübingen und München. Nach Abschluss der juristischen Staatsexamina und des Magisterexamens in den Geschichtswissenschaften promovierte und habilitierte er unter der Betreuung von Peter Landau. 2003 an die Universität Münster als Universitätsprofessor für Bürgerliches Recht und Deutsche Rechtsgeschichte berufen, wechselte Andreas Thier 2004 an die Universität Zürich. Hier ist er als ordentlicher Professor für Rechtsgeschichte, Kirchenrecht, Rechtstheorie und Privatrecht tätig.
Vera Raguth Tscharner studierte Rechtswissenschaft an der Universität Zürich. Sie ist als wissenschaftliche Assistentin am Lehrstuhl für Straf- und Strafprozessrecht von Prof. Dr. Gunhild Godenzi tätig und verfasst ihre Dissertation im Schnittstellenbereich des Polizei- und Strafprozessrechts.
Subira von Euw studierte Rechtswissenschaft an den Universitäten Zürich und Lausanne. Sie ist als wissenschaftliche Assistentin am Lehrstuhl für Öffentliches Recht mit internationaler und rechtsvergleichender Ausrichtung von Prof. Dr. Daniel Moeckli tätig und verfasst ihre Dissertation im Bereich des Polizeirechts.
Fiona Zilian, MLaw (Basel/Genf), Advokatin, studierte Rechtswissenschaft an den Universitäten Basel und Genf. Im Jahr 2022 erwarb sie das Anwaltspatent des Kantons Basel-Stadt. Seither arbeitet sie als wissenschaftliche Assistentin am Lehrstuhl für Privatrecht mit Schwerpunkt ZGB von Prof. Dr. iur. Walter Boente an der Universität Zürich. Fiona Zilian promoviert im Bereich des Kindesunterhaltsrechts. Im Rahmen ihres Forschungsprojekts verbrachte sie im Frühjahr 2024 einen viermonatigen Forschungsaufenthalt am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht in Hamburg.
4
Herausgeberinnenverzeichnis
Jasmina Bukovac studierte Rechtswissenschaft an der Universität Zürich. Nach ihrem Abschluss arbeitete sie in einer Grossbank, in diversen Anwaltskanzleien sowie beim Departement des Innern des Kantons Schaffhausen. 2020 erlangte sie das Anwaltspatent des Kantons Zürich. Sie war als wissenschaftliche Assistentin am Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht sowie Rechtsetzungslehre von Prof. Dr. Felix Uhlmann tätig und wirkte daneben bei diversen Administrativuntersuchungen mit. Sie arbeitet derzeit beim Eidgenössischen Finanzdepartement und verfasst eine Dissertation im Bereich des Kartellrechts.
Pia Hunkemöller studierte Rechtswissenschaft an der Universität Zürich und schloss ihr Studium 2015 ab. Anschliessend absolvierte sie ein Hochschulpraktikum beim Bundesamt für Energie und das Auditorat am Bezirksgericht Zürich. 2018 erhielt Pia Hunkemöller das Anwaltspatent des Kantons Zürich. Danach war sie als Anwältin in Winterthur vorwiegend in den Bereichen Privatrecht und Wirtschaftsrecht tätig. Seit November 2021 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl von Prof. Dr. Felix Uhlmann an der Universität Zürich.
Clio Zubler studierte Rechtswissenschaft an den Universitäten Zürich und Lausanne. Sie ist Doktorandin an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich und forscht in ihrer Dissertation zum Ausgabenreferendum. Zudem arbeitet als wissenschaftliche Assistentin an Prof. Glasers Lehrstuhl für Staats-, Verwaltungs- und Europarecht unter besonderer Berücksichtigung von Demokratiefragen.
I
Gastbeiträge
Zeit und Zeitlichkeit, Recht und Rechtswissen
Perspektiven und Beobachtungen
Andreas Thier
Inhaltsübersicht
Recht und Rechtswissen aus der Perspektive von Zeit und ZeitlichkeitDer temporal turn der Geistes- und SozialwissenschaftenPerspektivierungenDie breite Gegenwart des RechtsVergangenheit und Geschichtlichkeit im RechtDas Zukünftige und das RechtSchlussbemerkungRecht und Rechtswissen aus der Perspektive von Zeit und Zeitlichkeit
Der temporal turn der Geistes- und Sozialwissenschaften
Etwa seit 2010 hat sich in der geistes- und sozialwissenschaftlichen Forschung ein Trend eingestellt, der als temporal turn[1] bezeichnet worden ist: «Zeit» ist vermehrt zum perspektivischen Anknüpfungspunkt von Forschungen nicht allein in den traditionell «zeit-nahen» Geschichtswissenschaften[2] geworden, auch im Feld der Literaturwissenschaften,[3] der Theologie[4] und der Philosophie[5] ist die Auseinandersetzung mit Zeit-Fragen immer häufiger zu beobachten. Das gilt auch und gerade für die Sozialwissenschaften,[6] haben doch etwa Politikwissenschaften[7] und Soziologie[8] ihrerseits mit wachsender Intensität die Frage nach der Bedeutung von Zeit im Zusammenhang von politischen Ordnungen und gesellschaftlichen Verbänden gestellt. Es ist kaum möglich, eine eindeutige Antwort auf die Frage nach den Hintergründen dieser Entwicklung zu geben. Eine Geschichte der Zeitdeutungen im 20. und im frühen 21. Jahrhundert müsste erst noch geschrieben werden.[9] Eine solche Darstellung könnte bei der kantischen These ansetzen, dass Zeit «kein empirischer Begriff» und «keine Bestimmung äußerer Erscheinungen» sei, sondern «nichts als die subjektive Bedingung […] unter der alle Anschauungen in uns stattfinden können»[10]. Sie könnte dann beginnen bei der Erschütterung des naturwissenschaftlichen Weltbildes durch die Relativitätstheorie und die dadurch ausgelöste Grundlagenkrise der Physik,[11] sie müsste zudem die These von der «Unreality of Time», die John McTaggart Ellis McTaggart 1908 vortrug,[12] oder den existenzphilosophisch gelenkten Blick auf «Sein und Zeit» des Individuums von Martin Heidegger[13] einbeziehen. Eine Geschichte der Zeitdeutungen im 20. Jahrhundert hätte weiterhin die Ausweitung des Blicks auf die Vergemeinschaftung von Zeit zu thematisieren, wie sie zunächst 1912 im Postulat von Émile Durkheim deutlich wurde, dass nämlich Zeit auch «pensé par tous les hommes d’une même civilisation»[14], also als Produkt kollektiver Vorstellungen zu deuten sei, eine Überlegung, die im Konzept der «Social Time» von Pitirim Sorokin und Robert Merton elaboriert wurde,[15] die bei Norbert Elias zur These von «Zeit» als sozialem Symbol führte[16] und die in der These Niklas Luhmanns von der Zeit als notwendiger «Sinndimension» von Kommunikation und damit sozialer Systeme[17] eine bis heute prägende Fortentwicklung[18] fand. Eine Geschichte der Zeit in der Moderne und in der Postmoderne müsste darüber hinaus auch die Frage beantworten, wie es sich erklären lässt, dass seit dem ausgehenden 20. Jahrhundert immer stärker Phänomene wie etwa die «Politics of Time»[19] oder nunmehr «Chronopolitics»[20] oder auch Phänomene von «Chronocenosis»[21] ebenso zum Gegenstand der Analyse wurden wie die Wahrnehmung zerbrochener oder aus den Fugen geratener Zeit.[22] Schliesslich, aber nicht zuletzt, wäre dann auch die durch Studien etwa über Zeitdeutungen in Asien[23] nahe gelegte Hypothese zu prüfen, dass Zeitdeutungen von kulturellen Kontexten abhängen und deswegen von einem «cultural pluritemporalism»[24] gesprochen werden könnte.
Im vorliegenden Rahmen wesentlich ist vielmehr der Befund, dass die Frage nach der Bedeutung von Zeit für Recht und Rechtswissen seit der Mitte des 20. Jahrhunderts zunächst noch etwas verhalten,[25] aber seit dem Beginn des 21. Jahrhunderts zunehmend häufiger gestellt wurde. Zwar verhallte der Ruf von Marie Theres Fögen, ihres Zeichens langjähriges Mitglied der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich, «Vom Raum zur Zeit» im Jahr 2006[26] noch weitgehend ungehört, doch später einsetzende Titelgebungen wie «Law and Time»[27], «Time, Law, and Change»[28], «The EU and Constitutional Time»[29], «Zeit und Internationales Recht»[30], «Intertemporales öffentliches Recht»[31] oder einfach «Legal Time»[32], um nur einige Beispiele zu nennen, belegen ein inzwischen offenbar sehr starkes Interesse an solchen Themenstellungen, das auch durch den vorliegenden Sammelband noch einmal mit Nachdruck bestätigt wird.
Perspektivierungen
Wenn im Folgenden gleichwohl versucht werden soll, der Beziehung von Zeit und Recht nachzugehen, dann kann es im vorliegenden Rahmen nur darum gehen, einige Überlegungen und Vermutungen zu formulieren. «Zeit» soll dabei verstanden werden als Gesamtheit von Erscheinungen, die anknüpfen bei «Phänomenen von Sukzessivität»[33]. Das umfasst dann die Unterscheidung zwischen einem «Vorher», einem «Nachher» und einem «Jetzt», schliesst aber auch Zustände der Dauer und der Beschleunigung ebenso ein wie Unterbrechungen oder auch den Stillstand. Davon abzugrenzen ist die Dimension von «Zeitlichkeit», mit dem die individuelle oder auch die kollektive Wahrnehmung und Deutung von Zeit und die dazu entwickelten Praktiken bezeichnet werden sollen. Zur «Zeitlichkeit» zählen dann etwa Konzeptionen von Geschehensabläufen in der Form der Geschichtsschreibung oder auch das Auswählen von und das Verhandeln darüber, welche Deutungen von Zeitmodi – etwa im Zusammenhang der Zeitmessung oder bei der Festlegung von Fristen – verbindlich sein sollen.[34] Unter Recht soll die Gesamtheit von Normen mit Anspruch auf durchsetzbare Verbindlichkeit verstanden werden.[35] Mit «Rechtswissen» gekennzeichnet werden soll die Kenntnis von Normen und deren Inhalten, aber auch das Wissen von Methoden, Interpretationen und Ordnungsentwürfen zeitgenössischer Rechtsnormen.
Recht und Rechtswissen sind dem Ansatz nach abhängig von Zeit und Zeitlichkeit:[36] Bereits die Gültigkeit rechtlicher Normen hängt in der Regel davon ab, dass ein Zeitpunkt für ihr Inkrafttreten festgesetzt wird. Rechtliche Ordnungen operieren immer auch mit Fristen, sei es im Zusammenhang mit dem Verfahrensrecht oder im Kontext von Bestimmungen über Verjährungen, Verwirkungen oder auch Rechtserwirkungen. Im Fall des Gewohnheitsrechts ist die Zeitdimension «Dauer» sogar tatbestandlich in den Tatbestand der Rechtsentstehung integriert. In allen Fällen wesentlich ist dabei die Existenz von Zeitordnungen, von Messgrössen dieser Dauer etwa in Form von Jahr, Monat, Tag und Stunde. Die Bedeutung der Sinndimension Zeit[37] entfaltet sich also auch und gerade im Recht.[38] Umgekehrt ist das Funktionieren von sozialen Verbänden von der Existenz verbindlicher Regeln über die Messung von Zeit und die dazu verwendeten Ordnungsgrössen abhängig. Erst durch rechtliche Normen werden solche Ordnungen der Zeitmessung generell verbindlich.
Allerdings ist es kaum möglich, aus Rechtsnormen allein solche Referenzen zu bilden. Recht und Rechtswissen sind deswegen stets auf zeitgenössische Deutungen von Zeit angewiesen, sie sind damit verflochten mit historisch wechselnden Dimensionen von Zeitlichkeit, eine Wechselbeziehung, die etwa in der Geschichte der Kalenderreformen[39] oder in der Geschichte der Stunde[40] sehr anschaulich wird. Allerdings ist der Umgang von Recht und Rechtswissen mit solchen Dimensionen der Zeitlichkeit alles andere als neutral. Regelungen über die Zeit sind immer auch ein Stück weit von Interessen aus den Feldern der Politik, der Wirtschaft und der Kultur bestimmt. Typische Beispiele sind die Zeitregime in totalitären Regimen[41] oder im Zusammenhang mit kolonialen Imperien als «constitutive of imperial power»[42]; die Forschungen zu «Chronopolitics»[43] setzen hier an und es liegt auf der Hand, dass insbesondere die rechtshistorische Forschung in diesem Feld viele Anknüpfungspunkte der Analyse finden kann.[44]
Im vorliegenden Rahmen soll allerdings versucht werden, eine andere Perspektive zu begründen: Zeit ist im Verhältnis zum Recht keine monolithische Grösse. Im Zusammenhang mit dem Recht und insofern auch im Rechtswissen entfalten sich je unterschiedliche Dimensionen von Zeit und Zeitlichkeit. Die wichtigste Zeitdimension von und für rechtliche Normativität ist dabei die Gegenwart, denn sie ist der temporale Ort, in dem der Geltungsanspruch von Recht umgesetzt wird (dazu unten II.). Recht ist aber immer auch auf die Vergangenheit angewiesen, die nicht allein Bezugspunkt rechtlicher Regelungen sein kann, sondern vor allem der Ursprung für Geltungsbehauptungen rechtlicher Normativität (dazu unten III.). Recht hat aber aufgrund seiner sozialen Funktion als Garant von Erwartungssicherheit auch eine ausgeprägte Beziehung auf die Zukunft, die, wie es scheint, vor allem seit der Entstehung der Moderne wachsende Bedeutung gewonnen hat (IV.). Ausser Betracht bleiben müssen im vorliegenden Rahmen andere temporale Phänomene wie Dauer, Unterbrechung, Ewigkeit und auch Beschleunigung.[45]
Die breite Gegenwart des Rechts
Seit einiger Zeit wird über die These diskutiert, dass Zukunft und Vergangenheit keine eigenständigen Zeitebenen bilden, sondern abhängig von der Gegenwart sind.[46]Helga Nowotny hat bereits 1989 die These «vom unaufhaltsamen Verschwinden der Kategorie Zukunft und ihrer Erstreckung durch etwas, das ich erstreckte Gegenwart nenne», formuliert.[47] Eine deutlich erweiterte Konzeption ist dann von François Hartog entwickelt worden, der argumentiert hat, in der globalisierten Gegenwart des 21. Jahrhunderts habe «the present […] extended both into the future and into the past», denn die Zukunft werde aus der Gegenwart her bestimmt insbesondere «through the notions of precaution and responsibility, through the acknowledgement of the irreparable and the irreversible […]», während die Vergangenheit von der Gegenwart aufgesogen werde etwa durch «the drive to make everything into heritage […] and last but not least the notion ‹debt›».[48] In ähnliche Richtungen zielen die Überlegungen von Hans Ulrich Gumbrecht über «Unsere breite Gegenwart»[49].
Ohne dass es hier möglich wäre, diese Ansätze näher zu untersuchen,[50] fällt im Blick auf das Recht gleichwohl auf, dass rechtliche Normativität in der Tat zuerst und vor allem in der Gegenwart zu verorten ist. Das beruht auf dem Umstand, dass sich Rechtsgeltung – also der Verbindlichkeitsanspruch rechtlicher Normativität – stets erst in der Gegenwart aktualisiert. Das gilt auch im Fall der Rückwirkung etwa von Gesetzen,[51] denn auch wenn damit Sachverhalte der Vergangenheit geregelt werden, so aktualisieren sich die konkreten Wirkungen – etwa die Verpflichtung zur Steuerzahlung – immer erst in der Gegenwart,[52] frühestens nach der Publikation des Gesetzes.[53] Insofern sind rückwirkende Normen «nichts anderes als die Beurteilung der Vergangenheit mit Kategorien der Gegenwart»[54]. Entsprechendes gilt für das Handeln der Verwaltung. Nur scheinbar anders ist die Situation im Fall gerichtlicher Urteile, die regelmässig auf der Auseinandersetzung mit Sachverhalten der Vergangenheit beruhen. Doch die Rechtsanwendung, also die gerichtliche Bewertung solcher Sachverhalte findet erst in der Gegenwart statt.[55] Dem entspricht es, dass die Grundlage dieser Bewertung, also der gerichtlich festgestellte Sachverhalt, gerade nicht identisch ist mit dem Sachverhalt, der in der Vergangenheit belegen ist, sondern notwendig immer eine in der Gegenwart erstellte Rekonstruktion ohne Anspruch auf absolute Wahrheit.[56]
Entsprechendes gilt für die Zukunftsdimension: Es ist zwar tatbestandliches Element von Bedingungen i.S.v. Art. 151–157 OR, sich auf Ereignisse in der Zukunft zu richten.[57] Aber der Eintritt der Bedingung und die dadurch ausgelösten Rechtswirkungen entfalten sich erst dann, wenn das Ereignis in den Horizont der Gegenwart eingetreten ist. Dem entspricht es, dass sich in der dogmengeschichtlichen Entwicklung der Schwerpunkt der Bedingungswirkung zunehmend auf die Gegenwart verschob und mit der Lehre von der Anwartschaft eine Vorwirkung der Bedingung postuliert,[58] also die Gegenwartsverankerung der Bedingung zusätzlich verstärkt wurde.
Rechtsnormen lassen somit im Prozess ihrer Anwendung Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in einem Gegenwartshorizont verschmelzen.[59] Bisweilen ist deswegen sogar die These vertreten worden, eine rechtshistorische Auseinandersetzung mit der Zeitdimension von Recht sei letztlich nicht möglich, weil alle Rechtsnormen auf serielle Wiederholbarkeit angelegt und deswegen stets ausschliesslich gegenwartsgebunden seien.[60] Die Behauptung von der «Wiederkehr der Rechtsfiguren»[61] lässt sich dann als dogmenhistorische Fortsetzung dieser Überlegungen deuten, wird hierbei doch, überspitzt ausgedrückt, die Dogmengeschichte mit der Gegenwart der Rechtsdogmatik verschmolzen. Noch markanter ist diese Position greifbar in einer Debatte der Völkerrechtswissenschaft. Hier ist für eine «legitimate role of anachronism in international legal method» argumentiert worden. Dazu solle «the past, far from being gone» gezielt «as a source or rationalisation of present obligation» genutzt werden.[62] Damit einher geht bezeichnenderweise eine dezidierte Antikritik an antipresentistischen Positionen.[63] Diese Diskussion kann hier nicht näher betrachtet werden.[64] Sie verdeutlicht jedenfalls besonders plastisch die Tendenzen zu einer offensichtlich inzwischen auch von Teilen der Rechtswissenschaft angestrebten Ausweitung der Gegenwart des Rechtswissens auf die Geschichte von Recht und Rechtswissen. Das führt zur Frage, welche Funktionen und welche Bedeutung Vergangenheit und Geschichtlichkeit für Recht und Rechtswissen haben. Dem soll im Folgenden nachgegangen werden.
Vergangenheit und Geschichtlichkeit im Recht
Angesichts der präsentischen Qualität von Rechtsanwendung und Rechtsdurchsetzung im Blick auf die «current authority»[65] von Rechtsnormen wie etwa der Verfassung könnte man meinen, dass die Vergangenheit von Recht und Rechtswissen ohne normative Bedeutung ist. Allerdings würde das offensichtlich zu kurz greifen. Jede positive Rechtsnorm hat einen Ursprung, der ihre Geltungsanordnung legitimiert. Dem entspricht der Hinweis auf das Beschlussorgan – etwa die Bundesversammlung – und vielfach auch die Angabe der Kompetenznorm des entsprechenden Handelns im Ingress von Gesetzen,[66] und dem entspricht auch der Text von Verfassungspräambeln, in denen regelmässig der Versuch unternommen wird, die Verfassungsgebung in den Zusammenhang eines kollektiven historischen Selbstverständnisses zu stellen[67] und damit mit den Mitteln des Historischen und des Verfassungsrechts ein Element kollektiver Identität zu schaffen.[68] Solche Verweisungen auf den Ursprung der Norm und vor allem auf die Autorität der normsetzenden Instanz verdeutlichen ein wichtiges Element in der Beziehung zwischen geltendem Recht und Geschichte: Durch die Referenz auf die Vergangenheit werden geschichtliche Elemente in den Gegenwartshorizont des positiven Rechts hineingeholt. Dieser Mechanismus ist nicht auf Verfassungspräambeln und den Ingress von Gesetzen beschränkt und reicht über legitimierende Funktionen hinaus. Nicht selten verweist der Gesetzgeber auf Praktiken der Vergangenheit und ordnet deren Verbindlichkeit auch in der Gegenwart an wie etwa in Art. 1 Abs. 3 ZGB, wenn dort die gerichtliche Rechtsetzungsermächtigung an die «bewährte Lehre» gebunden wird,[69] oder im Verweis auf die «teachings of the most highly qualified publicists of the various nations» in Art. 38 Abs. 1 lit. d des IGH-Statuts.[70]





























