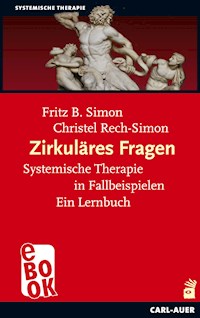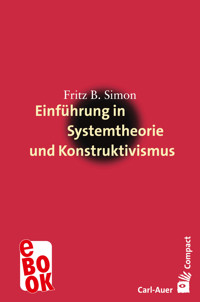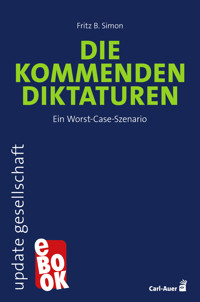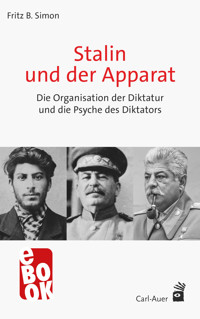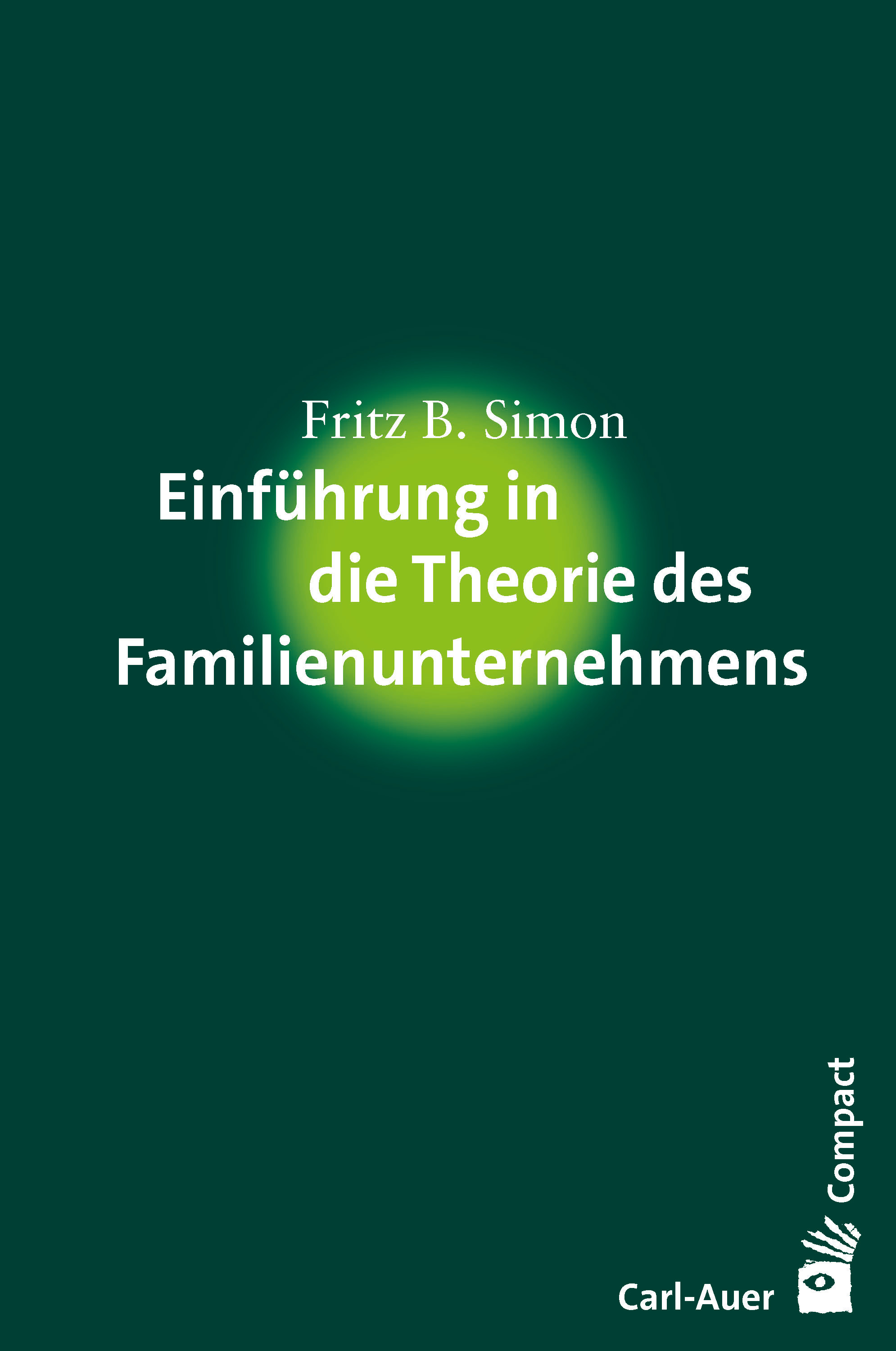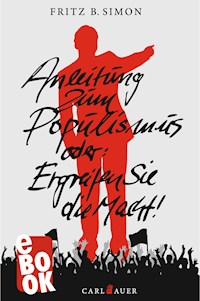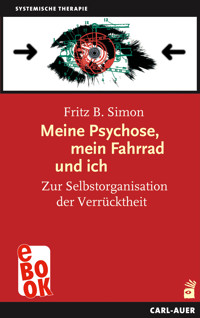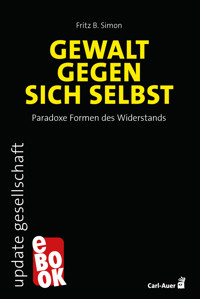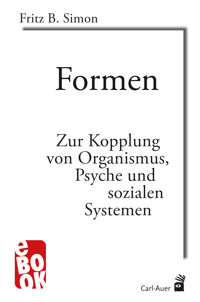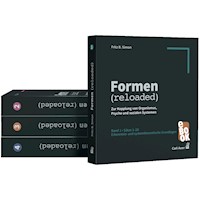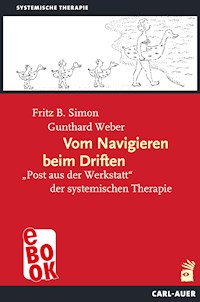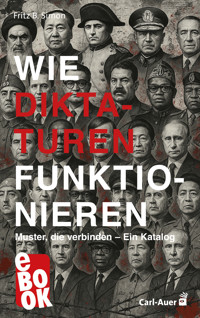
26,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carl-Auer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wir sind dabei – ob wir es wollen oder nicht Lange Zeit erschien es wie ein unwahrscheinlicher Alptraum, dass sich eine Diktatur auf dem Boden einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung breitmachen könnte. Die aktuellen Ereignisse weltweit zeigen etwas anderes. Dabei lernen wir auch, dass die Übergänge zu einem autoritären Regime fließend sein können, Staatsbürger:innen an vielen Stellen ein Auge zudrücken, der Hoffnung folgend, dass es so schlimm schon nicht kommen wird. Wer genau erkennen und bewerten will, was sich am politischen Horizont abzeichnet, muss verstehen, wie Diktaturen funktionieren und wie Diktatoren dafür sorgen, dass sie sich als solche etablieren können. Fritz B. Simon nutzt dazu das reiche Instrumentarium der Systemtheorie und legt überzeugend dar, welche idealtypischen Muster Diktaturen in ihrer Entstehung und Erhaltung ausgebildet haben. Besonders aufmerksam wird man das Kapitel über die Beendigung von Diktaturen lesen und darin erfahren, wie es Gesellschaften gelingt, den Worst Case zu beenden und das Heft erneut in die Hand zu nehmen. Solchermaßen ertüchtigt, kann man genauer beobachten und besser verstehen, was gerade geschieht. Wir sind dabei, ob wir es wollen oder nicht. Der Autor: Fritz B. Simon, Dr. med., Professor für Führung und Organisation am Institut für Familienunternehmen der Universität Witten/Herdecke, Psychiater, Psychoanalytiker, Systemischer Therapeut und Organisationsberater. Mitbegründer der Simon, Weber & Friends Systemische Organisationsberatung GmbH. Autor bzw. Herausgeber von ca. 300 wissenschaftlichen Fachartikeln und 37 Büchern, die in 15 Sprachen übersetzt sind. Zuletzt erschienen Stalin und der Apparat, Die kommenden Diktaturen und Gewalt gegen sich selbst - paradoxe Formen des Widerstands.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Carl-Auer
Fritz B. Simon
Wie Diktaturen funktionieren
Muster, die verbinden – Ein Katalog
2025
Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats des Carl-Auer Verlags:
Prof. Dr. Dr. h. c. Rolf Arnold (Kaiserslautern)
Prof. Dr. Bernhard Pörksen (Tübingen)
Prof. Dr. Dirk Baecker (Dresden)
Prof. Dr. Kersten Reich (Köln)
Sebastian Baumann (Mannheim)
Dr. Rüdiger Retzlaff (Heidelberg)
Dr. Carmen Beilfuß (Magdeburg)
Prof. Dr. Wolf Ritscher (Esslingen)
Dr. Michael Bohne (Hannover)
Dr. Dirk Rohr (Köln)
Prof. Dr. Ulrich Clement (Heidelberg)
Dr. Wilhelm Rotthaus (Bergheim bei Köln)
Dr. Angelika Eck (Karlsruhe)
Prof. Dr. Arist von Schlippe (Witten/Herdecke)
Prof. Dr. Jörg Fengler (Köln)
Dr. Gunther Schmidt (Heidelberg)
Torsten Groth (Münster)
Prof. Dr. Siegfried J. Schmidt † (Münster)
Reinert Hanswille (Essen)
Jakob R. Schneider (München)
Dr. Barbara Heitger (Wien)
Prof. Dr. Jochen Schweitzer † (Heidelberg)
Prof. Dr. Johannes Herwig-Lempp (Merseburg)
Prof. Dr. Fritz B. Simon (Berlin)
Prof. Dr. Bruno Hildenbrand (Jena)
Dr. Therese Steiner (Embrach)
Prof. Dr. Karl L. Holtz (Heidelberg)
Prof. Dr. Dr. Helm Stierlin † (Heidelberg)
Prof. Dr. Heiko Kleve (Witten/Herdecke)
Karsten Trebesch (Dallgow-Döberitz)
Dr. Roswita Königswieser (Wien)
Bernhard Trenkle (Rottweil)
Prof. Dr. Jürgen Kriz (Osnabrück)
Prof. Dr. Sigrid Tschöpe-Scheffler (Köln)
Prof. Dr. Friedebert Kröger (Heidelberg)
Prof. Dr. Reinhard Voß (Koblenz)
Tom Levold (Köln)
Dr. Gunthard Weber (Wiesloch)
Dr. Dr. Kurt Ludewig (Münster)
András Wienands (Berlin)
Dr. Stella Nkenke (Wien)
Prof. Dr. Rudolf Wimmer (Wien)
Rainer Orban (Osnabrück)
Prof. Dr. Michael Wirsching (Freiburg)
Dr. Burkhard Peter (München)
Prof. Dr. Jan V. Wirth (Meerbusch)
Umschlaggestaltung: B. Charlotte Ulrich
Umschlagmotiv: B. Charlotte Ulrich (KI-generiert)
Redaktion: Vera Kalusche
Satz: Verlagsservice Hegele, Heiligkreuzsteinach
Printed in Germany
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck
Erste Auflage, 2025
ISBN 978-3-8497-0617-3 (Printausgabe)
ISBN 978-3-8497-8569-7 (ePUB)
© 2025 Carl-Auer-Systeme Verlag
und Verlagsbuchhandlung GmbH, Heidelberg
Alle Rechte vorbehalten
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Informationen zu unserem gesamten Programm, unseren Autoren und zum Verlag finden Sie unter: https://www.carl-auer.de/.
Inhalt
Einleitung und Agenda
I. Machtergreifung
1 Willkürherrschaft
2 Disruptiver/revolutionärer Wandel
2.1 Militärputsch/Militärdiktatur
2.2 Volksaufstand
2.3 Bürgerkrieg
2.4 Postkoloniale Machtübernahme
2.5 Marionetten-Diktaturen
2.6 Verbindende Muster disruptiven/revolutionären Wandels zur Diktatur
3 Inkrementeller, evolutionärer Wandel
3.1 Zwischen Terrorismus und Wahlkampf
3.2 Schleichende (inkrementelle) Transformation demokratischer in diktatorische Strukturen
4 Die Logiken von disruptiver und inkrementeller Machtergreifung
4.1 Disruptive Machtergreifung
4.2 Inkrementelle Machtergreifung
5 Gründe gesellschaftlichen Wandels/Umsturzes
II. Machterhalt
1 Kommissarische vs. souveräne Diktatur
2 Demokratie vs. Autokratie
3 Die Funktion der Gewaltenteilung
4 Typen von Diktaturen
4.1 Timokratie
4.2 Kleptokratie (»Tinpot«)
4.3 Tyrannei
4.4 Totalitarismus
5 Organisation(en) des Machterhalts – Entscheidungsprämissen
5.1 Formale Strukturen / Verbindliche Kommunikationswege
5.2 Informelle Strukturen / Informelle Kommunikationswege
5.3 Kulturelle Muster
5.4 Zweck-Programme289
5.5 Konditional-Programme291
5.6 Personen
6 Der Umbau gesellschaftlicher Strukturen
6.1 Politisches System
6.2 Rechtssystem
6.3 Wirtschaftssystem
6.4 Wissenschaft
6.5 Erziehungssystem
6.6 Kunst
6.7 Religion
6.8 Gesundheitssystem
6.9 Andere gesellschaftliche Funktionen und Funktionssysteme
7 Praktiken des Machterhalts
7.1 Kommunikationsmedien (Verbreitungsmedien)
7.2 Überwachung/Kontrolle
7.3 Korruption
7.4 Terror/Folter
III. Machtverlust
1 Ende der Diktatur vs. Ende des Diktators
2 Dynastiebildung – Unsterblichkeitsfantasien
2.1 Kulturelle Unterschiede der Dynastiebildung
2.2 Zur Funktionalität der Dynastiebildung
3 Gewaltsamer Umsturz
3.1 Palastrevolution
3.2 Putsch, Bürgerkrieg
3.3 Interventionen von außen (fremde Nationen / Organisationen)
3.4 Muster des gewaltsamen Umsturzes
4 Friedlicher Machtwechsel
IV. Die Diktatur der Zukunft und die Zukunft der Diktatur
1 Muster, die verbinden
2 Kommunikation – Verbreitungsmedien
3 Kontrollversuche – Überwachung
4 Spaltung/Polarisierung – Deregulierte Märkte
5 Außenfeind/Sündenbock – Identitäten
6 Klimawandel – Marktlogik
7 Zur Funktionalität und Dysfunktionalität von Diktaturen
8 Zum Schluss: Eine (leider) pessimistische Prognose
Anmerkungen
Literatur
Über den Autor
Einleitung und Agenda
»Meine zentrale These lässt sich nun in Worten andeuten: Das Muster, das verbindet, ist ein Metamuster.
Es ist ein Muster von Mustern.
Und genau dieses Metamuster definiert die weitreichende Verallgemeinerung, dass es in der Tat Muster sind, die verbinden.«
Gregory Bateson1
Autoritäre Staatsformen sind weltweit auf dem Vormarsch. Diktatorische Herrschaft, die im Laufe der Menschheitsgeschichte keine Ausnahmeerscheinung, sondern, wenn man es genauer betrachtet, der Normalfall war, gewinnt an Popularität; und die Demokratien des westlichen Modells scheinen nur regional und während einer kurzen Phase der Geschichte politisch bestimmend gewesen zu sein. Diese autoritativen Tendenzen sind nicht nur in den Ländern des globalen Südens, d. h. den ehemaligen, meist europäischen Kolonien, festzustellen, sondern auch Europa und die USA sind durch die Wahlerfolge rechtsextremer, demokratiefeindlicher Parteien bedroht.
All dies ist Anlass genug, sich mit dem Phänomen der Autokratie, insbesondere der Diktatur, näher zu beschäftigen. Wenn hier von »der« Diktatur gesprochen wird, dann soll damit nicht geleugnet werden, dass unterschiedliche Formen der Diktatur im Laufe der Geschichte wie auch in der Gegenwart zu beobachten waren und sind, sondern es soll ihre Familienähnlichkeit betont werden. Es gibt bestimmte dynamische und strukturelle Muster von Gesellschaften, die generell charakteristisch für Diktaturen sind und sie miteinander verbinden. Um deren Analyse soll es im Folgenden gehen.
Auch wenn es schon meterweise Literatur zum Thema gibt und sich die Frage aufdrängt, ob es wirklich etwas Neues darüber zu sagen gibt, so scheint der Versuch dennoch der Mühe wert, aus einer systemtheoretischen Perspektive die idealtypischen Muster der Entstehung, Erhaltung und auch des Endes von Diktaturen zu beschreiben, zu erklären und zu bewerten. Dabei ist besonders die Einsicht Gregory Batesons zu berücksichtigen, dass die kleinste Überlebenseinheit in der Evolution nicht ein isoliertes System ist, sondern stets die Einheit
aus dem System und der für sein Überleben relevanten Umwelt.2 Im Blick auf autoritative Systeme heißt dies, dass nie allein die innenpolitischen Situationen, in denen sie sich etablieren, in die Analyse einzubeziehen sind, sondern stets auch der historische und kulturelle Kontext. So hat, um das vorwegzunehmen, eine Diktatur im postkolonialen Afrika mit seinen Stammesstrukturen andere Funktionen als in Europa. Und in China oder Korea ist die Lage wiederum anders, da die konfuzianische Tradition autoritären Strukturen generell eine andere Bedeutung zuschreibt, als dies in europäischen Staaten der Fall ist, die eine (wenn auch manchmal nur kurze) demokratische Geschichte durchlaufen haben. Wenn die analysierten autokratischen Herrschaftsmuster im Folgenden relativ leidenschaftslos beschrieben werden, so bleibt dabei ihre moralische oder ethische Bewertung bewusst ausgeblendet. Stattdessen ist der Fokus auf die jeweilige Funktionalität oder Dysfunktionalität der unterschiedlichen autokratischen Herrschaftsformen gerichtet. Versucht wird, eine (soweit das einem in einer Demokratie sozialisierten Autor möglich ist) neutrale Außenperspektive einzunehmen und auf undemokratische Regimes, Kleptokratien, Diktaturen, totalitäre Systeme usw. zu blicken – so wie ein Naturforscher auf eine Ameisenkolonie und deren Dynamik und Organisation schauen würde: neugierig, interessiert und, zugegeben, auch erstaunt und gelegentlich fasziniert.
Das Interesse gilt dabei den sozialen Strukturen, die den Diktator bzw. die Diktatur an die Macht gebracht haben, ihre Macht stabilisieren oder auch zu ihrem Ende führen. Das Spektrum reicht also von der spezifischen Kultur des Landes, der weltpolitischen Konstellation, den sozio-ökonomischen Verhältnissen und den bestehenden und sich verändernden politischen Organisationen bis hin zu konkreten Handlungsmustern der politischen Akteure.
Der Aufbau der vorliegenden Studie folgt dem politischen Lebenszyklus des Diktators, d. h. der zeitlichen Abfolge von der Machtergreifung über die Regierungszeit bis zum Ende der Herrschaft. Dies ist nicht immer mit dem Tod des Diktators verbunden, sondern es bleibt manchmal auch nur beim Machtverlust und dem Gang ins Exil. Das wiederum ist auch nicht immer mit dem Ende der Diktatur gleichzusetzen. Denn es kommt oft nur zum Austausch des Diktators, ohne dass sich das diktatorische System in seiner Struktur verändert. Auch wenn der Text formal dem Lebenszyklus von Diktatoren und/oder Diktaturen folgt, so stehen Personen nicht im Mittelpunkt des Interesses. Die psychische Struktur und die Muster der Psychodynamik von Diktatoren, wie etwa die bei fast allen zu beobachtende Paranoia, sind sicher der Analyse wert, sie sollen hier dennoch zugunsten der sozialen Muster vernachlässigt und allenfalls als Randbedingungen erwähnt werden. Dass die Wechselbeziehungen zwischen sozialer und psychischer Dynamik sehr relevant sein können, habe ich am Beispiel Stalins und der Sowjetunion an anderer Stelle thematisiert (»Stalin und der Apparat. Die Psyche des Diktators und die Organisation der Diktatur«3). Die implizite These der hier vorgenommenen Schwerpunktsetzung ist (etwas zugespitzt), dass weniger Diktatoren die Diktatur erschaffen, sondern eher die Diktaturen sich für sie passende Diktatoren suchen.
Die Form des vorliegenden Buches hat gewisse Ähnlichkeiten mit dem Katalog einer Bibliothek: Er repräsentiert, was alles in ihren Regalen lagert; ganz analog sollen hier die Muster diktatorischer Systeme kategorisiert und benannt werden. Wahrscheinlich ist der Vergleich mit einer Bibliothek gar nicht so weit hergeholt, denn wie das Bücherverzeichnis verweist auch der vorliegende »Katalog« auf vielerlei Geschichten mit ihrer eigenen Dramaturgie. Wie der Begriff Katalog suggeriert, geschieht dies im Folgenden durch Auflistung der Muster und Funktionen von Diktaturen, ihrer Machtergreifung, des Machterhalts und des Machtverlusts. Während bei der Durchführung der Studie eine Vielzahl von Fallbeispielen analysiert wurde, um die verbindenden Muster herauszudestillieren, werden in der hier präsentierten Darstellung in umgekehrter Reihenfolge zunächst die festgestellten Muster präsentiert, und erst danach werden zur Illustration unterschiedliche Fallvignetten dargestellt. Die Hoffnung ist, dass der Leser – im optimalen Fall – nachvollziehen kann, wie die zunächst dargestellten Muster funktionieren. Da die jeweiligen historischen Kontexte im Sinne der System-Umwelt-Überlebenseinheit nicht einfach »weggedacht« werden können, sind diese Falldarstellungen manchmal länger ausholend, manchmal auch kürzer und mit einfacheren Strichen gezeichnet. Dass angesichts der Vielzahl untersuchter Diktaturen und Diktatoren die Darstellungen zwangsläufig skizzenhaft bleiben, lässt sich kaum vermeiden. Die Auswahl der konkreten Fallbeispiele war nicht zwangsläufig, denn es hätten jeweils auch andere Beispiele gewählt werden können. Aber es geht hier um die Illustration idealtypischer Fälle, die es erlauben, als verallgemeinerbare Exemplare betrachtet zu werden. Auf die Präsentation vieler gleichermaßen geeigneter Beispiele (wie etwa Kambodscha/Pol Pot oder Venezuela/Maduro) wurde deshalb verzichtet. Totalitären Systemen ist größere Aufmerksamkeit gewidmet als weniger ins Alltagsleben der Bürger eingreifenden Formen autokratischer Herrschaft.
(Um eine – sicher berechtigte – Kritik vorwegzunehmen: Die Falldarstellungen beziehen ihre Informationen in der Regel aus Sekundärliteratur wie etwa Biografien, und ihre Auswahl spiegelt die Selektionskriterien des Autors wider, die – leider, aber wohl unvermeidlich trotz aller Bemühungen – keinen Anspruch auf Objektivität erheben können.)
Wer sich durch die Menge der Falldarstellungen überflutet oder gelangweilt fühlt, kann sie überschlagen, ohne dass ihm die wichtigsten Schlussfolgerungen der Studie entgehen dürften.
Zurück zur Form des Katalogs: Wie in einer Bibliothek wird versucht, Etiketten an Regale zu heften, das heißt hier: die einzelnen referierten Typen von Diktaturen zu kategorisieren. So wird, zum Beispiel, zwischen einem disruptiven Umsturz des politischen Systems und seinem schleichenden Wandel unterschieden. Derartige Kategorien können nicht immer trennscharf angewendet werden, da oft irgendwelche Mischformen zu beobachten sind. So kann es zunächst, wie beispielsweise in der russischen Oktoberrevolution, zunächst zu einem revolutionären Umsturz gekommen sein, woran sich ein schleichender Wandel von der kollektiven Führung durch Gremien der Kommunistischen Partei zur Diktatur eines Einzelnen (Stalins) anschloss. Die Zuordnung, die im Folgenden vorgenommen wird, spiegelt daher die hier vorgenommene Bewertung der Relevanz der unterschiedlichen beschriebenen Aspekte des jeweiligen autoritativen Systems.
Im Schlusskapitel über die Zukunft der Diktatur und die Diktatur der Zukunft wird dann gewissermaßen reflektiert, welche Konsequenzen aus der Geschichte bzw. den Geschichten der Diktaturen gezogen werden können. Sie geben wenig Anlass – um das vorwegzunehmen – zum Optimismus. Falls es in den Londoner Wettbüros die Möglichkeit geben sollte, auf den Erfolg zukünftiger Staatsformen zu wetten, so sollte man sein Geld besser nicht auf Demokratien als die wahrscheinlichen Gewinner setzen.2
11 Bateson (1979), S. 19.
2Ich danke Michael Hutter, der eine erste Version des Textes kritisch gelesen und mir wichtige Hinweise gegeben hat.
I. Machtergreifung
1 Willkürherrschaft
Wenn wir heute von Diktaturen sprechen, so beziehen wir uns in der Regel auf den Unterschied zu Demokratien im westlichen Sinne. Doch die sind in der Menschheitsgeschichte ein sehr junges Phänomen – und es gibt gute Gründe für die Hypothese, dass dies auch nur eine vorübergehende Episode der Geschichte darstellt. Denn solange es soziale Systeme gibt, angefangen von Familiengruppen über Stämme, autonome Städte bis hin zu Staaten, waren sie in der Regel hierarchisch und oft auch autokratisch organisiert. Demokratien, wie wir sie in den USA und Westeuropa nach dem Zweiten Weltkrieg für »normal« halten bzw. (wohl besser) hielten, sind erst mit dem Nationalstaat entstanden, der sich zwischen dem 17. und 20. Jahrhundert, d. h. nach dem Westfälischen Frieden und vor bzw. nach dem Ersten Weltkrieg, entwickelte. Und dass nicht mehr ein Fürst oder gottgegebener Herrscher an der Spitze eines Staats steht, sondern ein Wahlvolk bestimmt, wer regieren darf oder muss, ist – wenn man mal von den ziemlich unvollkommenen Demokratien des griechischen und römischen Altertums (die nie alle Bewohner umfassten) absieht – erst mit der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung (1776) und der Französischen Revolution (1789) der Fall.
Wenn nach dem Beginn einer Diktatur und der Dynamik ihrer Etablierung gefragt wird, muss jeweils der Unterschied zum Status vorher benannt und reflektiert werden (historischer Kontext). Denn es macht ja einen Unterschied, ob zum Beispiel eine Demokratie oder eine Monarchie durch eine Diktatur ersetzt wird. Auch die meisten Monarchen konnten autokratisch herrschen. Daher war für die Bevölkerung der Unterschied zur Diktatur wahrscheinlich weniger groß, als wenn die Strukturen einer wenn auch oft nicht besonders gut etablierten Demokratie beseitigt wurden.
Was alle autokratischen Regimes verbindet, ist, dass der Herrscher niemandem Rechenschaft schuldet für das, was er tut. Er übt die uneingeschränkte Macht aus, entscheidet und erntet die Resultate. Im Unterschied zu den westlichen Demokratien ist die Macht des Diktators nicht dadurch begrenzt, dass er Gesetzen unterworfen wäre bzw. seine Macht durch andere Autoritäten begrenzt würde (Stichwort: Gewaltenteilung) und Gesetze auch ihm gegenüber durchgesetzt werden könnten. Ganz generell ist die absolute Macht eines Herrschers (das muss keine reale Person sein, sondern kann auch ein Gremium oder eine Organisation sein) daran gebunden, dass sie sich willkürlich und unvorhersehbar verhält. Falls ein Machthaber sich an irgendwelche Regeln – wo immer er sie herhaben mag – hält, ist seine Macht faktisch begrenzt. Denn dann kann sein Verhalten mit einer ziemlich großen Wahrscheinlichkeit vorhergesagt und in Rechnung gestellt werden. (Das ist auch der Effekt des erratischen Verhaltens von Möchtegern-Autokraten, unabhängig davon, ob dies als Zeichen ihres Willens zur Macht oder der Demenz gedeutet wird.) Entscheidend ist, um es auf eine Formel zu bringen und zu betonen: Willkür-Entscheidungen sind das Merkmal der Unterscheidung autoritativer Regimes.
Das bedeutet in der Praxis des Regierens aber nicht, dass es in Autokratien keine Gesetze gäbe, sondern dass der Herrscher die ultimative Quelle der Gesetzgebung ist und sie jederzeit – ohne dies legitimieren zu müssen – ändern kann.4
Der Unterschied zwischen der Diktatur und anderen Formen der Autokratie lässt sich wohl am besten so beschreiben, wie Xenophon5 vor etwa 2500 Jahren den Unterschied zwischen Tyrannei und Königtum definierte. Leo Strauss fasst dessen Sicht folgendermaßen zusammen:
»Königtum ist eine Form der Regierung, die über darin einwilligende Subjekte ausgeübt wird und in Übereinstimmung mit den Gesetzen der Städte erfolgt; Tyrannei ist eine Form der Regierung, die über Subjekte ausgeübt wird, die nicht damit einverstanden sind, und nicht in Übereinstimmung mit Gesetzen, sondern mit dem Willen des Herrschers erfolgt.«6
Mit dieser Definition sind wir nicht mehr an den Unterschied zwischen westlicher Demokratie und Diktatur gebunden, wenn wir die Frage der Machtübernahme eines Diktators untersuchen, sondern wir können auch analysieren, wie – um in der Terminologie Xenophons bzw. Leo Strauss' zu bleiben – aus einem von seinem Volk akzeptierten König ein Tyrann wird, den es eigentlich gern loswerden würde.
Da aber auch Demokratien in unserem heutigen westlichen Verständnis nicht ohne Herrschafts- und Regierungsformen auskommen, kann die Frage, ob die Regierung Gesetzen folgt und mit Billigung oder gegen den Willen der Bevölkerung ausgeübt wird, auch als generelles Unterscheidungskriterium genommen werden. Diktaturen, die wir hier im Folgenden untersuchen wollen, sind dadurch definiert, dass der oder die Herrscher gegen den Willen der Bevölkerung regieren und sich keinen Gesetzen, die nicht von ihnen beschlossen oder gebilligt wurden, zu unterwerfen haben. Die Transformation zur Diktatur kann daher generell als Übergang von einer an Gesetze (als höherer Macht) gebundenen Regierung, die das überwiegende Einverständnis der Bevölkerung besitzt, in eine Willkür-Regierung, die auch gegen den überwiegenden Willen der Bevölkerung an der Macht bleibt, definiert werden. Demokratien sichern sich (das ist einer der Aspekte dieser Staatsform) dadurch gegen diktatorische Tendenzen der Regierenden ab, dass das Wahlvolk ohne Gewalt seinen Herrscher beseitigen kann, indem es ihn abwählt (ohne sich der Mühe einer Revolution oder des Tyrannenmords unterziehen zu müssen).
Dies vorausgesetzt kann der Fokus der Aufmerksamkeit auf die Dynamiken und Muster der Transformation von einer an Gesetze gebundenen und in der Bevölkerung verankerten Staatsform zur Diktatur richten: Kommt es zu einer disruptiven, d. h. sprunghaften Transformation oder geschieht dies durch einen inkrementellen, d. h. schleichenden Wandel? Dabei lassen sich unterschiedliche Varianten der Disruption beschreiben, vom Militärputsch bis zum Volksaufstand. Und bei den evolutionären Veränderungen finden sich ebenfalls Varianten, die über etliche Zwischenstufen pfadabhängig und längerfristig zur Diktatur führen.
Dass derartige historische Entwicklungen zu einem entscheidenden Maße von den jeweils aktuellen kulturell-gesellschaftlichen und institutionellen Bedingungen als relevanten Kontexten abhängen, macht es nötig, sie in jede Analyse mit einzubeziehen. Aber nicht nur diese sozialen Dimensionen spielen eine Rolle, auch die konkreten Personen müssen als bedeutsam betrachtet werden. Selbst wenn alle nur denkbaren sozialen Bedingungen die Entwicklung einer Diktatur wahrscheinlich machen, so muss sich doch jemand – meist ein Mann – finden, der die Macht tatsächlich ergreift. Dazu ist nicht jeder fähig oder bereit. Hier kommt also eine psychologische Dimension ins Spiel, die im Folgenden aber, wie erwähnt, ausgeblendet bleiben soll. Es geht allein um soziale Dynamiken und Muster, nicht um die Psyche der Diktatoren – oder gar ein Bestiarium – der Diktatoren.
2 Disruptiver/revolutionärer Wandel
Die Disruption, d. h. die radikale Umwälzung gesellschaftlicher Verhältnisse, ist eigentlich stets mit der Anwendung von Gewalt verbunden. Das ist nicht erstaunlich, wenn man berücksichtigt, dass Macht generell auf der Möglichkeit der Anwendung von Gewalt beruht – sei es konkreter Gewalttaten, sei es deren Androhung.7 Daher liegt es nahe, dass in solche Umwälzungen meist das Militär involviert ist. Es verfügt über die Machtmittel, die dem gemeinen Bürger nicht zur Verfügung stehen. Der Militärputsch und im Anschluss an ihn die Militärdiktatur sind daher – unabhängig von der jeweiligen lokalen Kultur oder den sozio-ökonomischen Bedingungen – eine weltweit zu findende Methode, eine Transformation der Staatsform herbeizuführen.
Dennoch zeigt die Geschichte, dass sich auch immer wieder die unbewaffnete Bevölkerung empört oder Parteien und Guerilla-Gruppen den Umsturz initiieren bzw. in einer Revolution eine Regierung stürzen oder zu stürzen versuchen. Dies gelingt allerdings nur selten, da die jeweils etablierten Regierungen die Befehlsgewalt über das Militär haben und in der Lage sind, jede Revolte und jeden Volksaufstand niederzuschlagen. Wenn dies nicht gelingt, kann es auch zum Bürgerkrieg kommen, in dem die Vertreter der alten Ordnung und ihre Feinde miteinander um die Herrschaft kämpfen. Welche Muster der Disruption sich dabei beobachten lassen, soll im Folgenden skizziert werden.
2.1 Militärputsch/Militärdiktatur
Das Muster der Militärcoups des 20. Jahrhunderts in Europa war charakteristisch für den sich manifestierenden, die Welt in »West« und »Ost« spaltenden Konflikt zwischen zwei um Dominanz ringende Ideologien: Kapitalismus vs. Sozialismus.
Muster »Militärdiktatur«
Das Militär ist eine staatliche Organisation. Seine Funktion für das Überleben des Staats besteht darin, den bewaffneten Kampf um seine Integrität bestehen zu können, falls er gewaltsam durch äußere Feinde bedroht werden sollte. Militärische Strukturen sind streng hierarchisch, aber als organisatorische Einheit selbst der jeweiligen Regierung hierarchisch untergeordnet. Die Ziele beider unterscheiden sich nicht, soweit es um das Überleben und den militanten Schutz der Integrität des Staates geht.
Dass das Militär auch dazu benutzt wird, die Integrität anderer Staaten zu verletzen, indem ein Angriffskrieg begonnen wird, ist zwar in der menschlichen Geschichte häufig genug vorgekommen (zuletzt beim Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine), gehört aber nicht zu den primären Überlebensfunktionen des Militärs für den Staat; deswegen werden solche Angriffe auch meist als Präventivschläge bezeichnet, also nur zeitlich vorgezogene, antizipatorische Verteidigungsaktionen.
Die auf Sicherung und Verteidigung eines Staates gerichtete Funktion des Militärs ist konservativ, das heißt, es schützt den Status quo. Dies steuert auch die Selektion des Personals, soweit dies nicht im Rahmen einer Wehrpflicht der individuellen Entscheidung entzogen ist. Wer allerdings Berufssoldat wird und Karriere beim Militär macht, tut dies wohl kaum, weil ihn seine revolutionäre Haltung dem Staat gegenüber dafür besonders qualifizierte. Die politische Orientierung des militärischen Führungspersonals liegt in der Regel im Spektrum von dem, was in der öffentlichen Diskussion als »mitterechts« bis »rechts-extrem« bewertet wird.
Wenn man den potenziellen Konflikt mit einem äußeren Feind als Identität stiftenden Existenzgrund des Militärs akzeptiert, so ist es nicht ohne Ironie, wenn das Militär eines Landes sich gegen die formale Macht einer Regierung wendet und, statt sich deren Weisungsbefugnis und Oberbefehl unterzuordnen, sie wie einen »äußeren« Feind behandelt. Das Freund-Feind-Schema wird beibehalten, die formale Konstruktion des Weltbildes und die Identität des Militärs bleibt unbeschädigt, nur dass nun eine neue Innen-außen-Unterscheidung zwischen Freund (= innen) und Feind (= außen) vorgenommen wird. Die Regierung wird zum äußeren Feind, den es zu bekämpfen gilt, was – scheinbar logisch – zum Putsch führt. (Dass Demokraten alarmiert sind, wenn eine Regierung – wie die Donald Trumps in seiner zweiten Amtszeit – das Militär gegen die eigene Bevölkerung einsetzt, ist daher nicht nur verständlich, sondern logisch.)
In den beiden unten skizzierten Fällen (dem Putsch der Generäle in Chile und Spanien) liegt der Grund dafür in der zum Zeitpunkt des Putsches bestehenden weltpolitischen Situation. Die Welt war gespalten in die genannten zwei ideologischen Sphären: Auf der Außenseite der Unterscheidung, d. h. der als Feind definierten, stand das »Gespenst, das in Europa umging«, der Sozialismus oder Kommunismus (was meist nicht klar unterschieden wurde). Auf der Innenseite stand dann irgendein anderes Gesellschaftssystem, was konkret sehr unterschiedlich strukturiert sein konnte, aber angesichts der integrierenden Definition des Außenfeindes auch keiner differenzierenden Definition bedurfte. Trotz des zeitlichen Unterschieds zwischen den zwanziger und siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts und zwischen Spanien und Chile war dies ein weltpolitisch gemeinsamer Nenner. Der Außenfeind wollte – und das ist der entscheidende Punkt – eine Veränderung der aktuellen Struktur des Wirtschaftssystems und damit der Gesellschaft. Die republikanische Regierung in Spanien wollte Veränderungen in Richtung Sozialismus, die chilenische Regierung unter Salvador Allende machte ebenfalls Anstalten, den Staat in dieser Richtung umzubauen. So wurden sie für die informellen Machthaber des jeweiligen Staates – die etablierten Oberschichten – zu Repräsentanten des Außenfeindes im Inneren. Dies lieferte die Legitimation dafür, dass das Militär aktiv wurde und die Generäle als Vertreter der Machteliten den inneren Außenfeind beseitigten, um »ihren« Staat und damit die Privilegien der Oberschicht zu schützen.
Um es auf eine abstrakte Formel zu bringen, lässt sich das Muster, das zum Militärputsch führt, folgendermaßen beschreiben: Der jeweilige Staat ist ideologisch und in den aktuellen Lebensbedingungen gespalten. Auf der einen Seite steht eine herrschende, reiche Oberschicht (»Elite«, »Oligarchie«, »Plutokratie«), die über die Ressourcen des Staats verfügt und keinerlei Interesse an einer gesellschaftlichen Veränderung hat. Auf der anderen Seite steht ein mehr oder weniger großer Teil der Bevölkerung, dem es ökonomisch weit weniger gut geht. Es gibt eine klare Oben-unten-Unterscheidung der Bevölkerung, die mit massiven Ungleichheiten der Lebensbedingungen verbunden ist. Diese Ungleichheit wird in der Regel ideologisch begründet (z. B. als »Meritokratie«). Wenn nun aufgrund demokratischer Spielregeln eine Partei an die Macht kommt, deren Programm es ist, diese Ungleichheiten zu reduzieren (»Sozialismus«), und auch tatsächlich Veränderungen in Angriff nimmt, kommt es zum Putsch. Er dient dazu, die bestehenden Ungleichheiten zu erhalten. Dies gelingt am besten, wenn man denen, die ein Interesse an ihrer Beseitigung haben, den Einfluss nimmt und eine autokratische Regierung einsetzt. Die demokratische Volkssouveränität wird kurzerhand beendet. Das Militär übernimmt die Macht. Das ist in der Regel zunächst eine Junta der Befehlshaber der unterschiedlichen Streitkräfte, entwickelt sich angesichts der Machtunterschiede innerhalb des Militärs dann, der Logik hierarchischer Systeme folgend, zur Herrschaft eines einzelnen Generals oder Oberst.
Einschränkend ist der Darstellung dieses Musters anzufügen, dass es im Kontext einer europäisch-christlichen Kultur zu verorten ist, wie sie sich nach der Aufklärung entwickelt hat. In kulturellen Kontexten, in denen dem autonomen Individuum, seiner Willensfreiheit oder allgemeiner gesagt: den Menschenrechten ein geringerer Wert zugebilligt wird, haben der Putsch des Militärs und die sich daraus entwickelnden Diktaturen eine andere Funktion.
Spanien (Francisco Franco)
Die 1931 demokratisch gewählte republikanische Regierung, die ein sozialistisches Programm verfolgte, wurde von den etablierten Machteliten des Landes, die mit dem Militär verbündet waren, nicht stillschweigend hingenommen. Es kam zu deren Widerstand und schließlich 1936 zu einem Putschversuch. Doch der Versuch der gewaltgestützten Machtübernahme des Militärs wurde von der Regierung mit Gegengewalt beantwortet: Die Folge war ein Bürgerkrieg. Diese Geschehnisse folgten einem in Spanien vertrauten Muster: der Oszillation zwischen den Regierungsformen Republik und Autokratie (Monarchie, Diktatur):
Spanien war im 19. Jahrhundert für 23 Monate eine Republik (»Erste Republik«: 11.2.1873–29.12.1874), an deren Spitze – jeweils nur kurzzeitig – nacheinander fünf verschiedene Präsidenten standen. Nach vielfachen Kämpfen unterschiedlicher republikanischer und monarchistischer Fraktionen brach die Republik schließlich aufgrund der Parteinahme großer Teile des Militärs zusammen, und es kam zur Restauration der Monarchie unter dem Hause Bourbon. Alfons XII. wurde zum König proklamiert.8 Er starb im November 1885, wenige Monate bevor sein Sohn und Thronfolger Alfons XIII. geboren wurde. Der war zwar formal von Geburt an König, doch bis zu seinem 16. Lebensjahr fungierte seine Mutter als Regentin.
Die sozialen Gegensätze in Spanien schienen zum Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts unüberbrückbar, der Staat war in einem desolaten Zustand:
»Die Staatsfinanzen waren ungeordnet und die innenpolitischen Verhältnisse chaotisch. In 120 Jahren registrierte man mehr als 100 Regierungen, zwei Dutzend Militärputsche und zwei Bürgerkriege. Weltpolitisch war die einstige Großmacht nahezu bedeutungslos geworden.«9
Dem König gelang es nicht, eine integrierende Politik durchzusetzen. Die Korruption und Erstarrung der gesellschaftlichen Strukturen sorgten für Dauerkonflikte.
In Norden Marokkos, einem spanischen Protektorat, kam es Anfang der 1920er Jahre im Rahmen des sogenannten Rif-Kriegs zu kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Berberstämmen und Truppen der spanischen Protektoratsmacht. Nach der Niederlage gegen die Aufständischen im Jahre 1921 in der Schlacht bei Annual war die spanische Regierung so geschwächt, dass es erneut zum Putsch der Militärs kam. Unter Führung des Generals Miguel Primo de Rivera wurde schließlich 1923 eine Diktatur etabliert, die von den konservativen Machteliten wie auch der katholischen Kirche gestützt wurde. Gewerkschaften und »Linke« unterschiedlicher Gruppierungen wurden systematisch unterdrückt. Aber auch die Kompetenzen und die Macht des Königs wurden radikal beschnitten. Er hatte sich de facto dem Diktator unterzuordnen, das heißt, seine Aufgaben erschöpften sich ab da in zeremoniellen Angelegenheiten.
Von Beginn an hatte Primo de Rivera verkündet, dass seine Herrschaft zeitlich begrenzt sein sollte, bis das Land konsolidiert sei. Obwohl dies nicht gelang, musste er 1930 zurücktreten, da sonst Aufstände und Unruhen drohten.10
Bei den ersten (Kommunal-)Wahlen nach 1923 errangen die Republikaner einen klaren Sieg. Sie proklamieren daraufhin am 14. April 1931 in Madrid die Republik. Der König ging, ohne auf seinen Thron zu verzichten, ins Exil.11
Die Zweite Republik bestand – wenn auch durch starke soziale interne Konflikte erschüttert – bis 1936 bzw. 1939 (je nachdem, ob man den Beginn oder das Ende des 1936 begonnenen Bürgerkriegs als ihr Enddatum definiert).
Im Spanischen Bürgerkrieg standen sich dann aber nicht nur zwei innerspanische Parteien gegenüber, sondern Spanien wurde zum Schlachtfeld der Ideologien: Kommunismus bzw. Sozialismus vs. Faschismus. Es blieb kein interner spanischer Konflikt, sondern externe Mächte (besser: Diktaturen) mischten sich ein und spielten eine entscheidende Rolle. An erster Stelle sind hier Nazi-Deutschland (Hitler) und das faschistische Italien (Mussolini) zu nennen. Sie lieferten nicht nur den putschenden Militärs unter General Franco Waffen, sondern schickten auch eigene Truppen in den Kampf (z. B. die deutsche »Legion Condor«). Auf der Gegenseite unterstützte die Sowjetunion (Stalin) die republikanischen Truppen. Unter den vielen freiwilligen Ausländern, die in Spanien kämpften, finden sich etliche, zu der Zeit (noch) mit dem Kommunismus sympathisierende Intellektuelle, die ihre Erlebnisse in Spanien auch literarisch verarbeiteten (Ernest Hemingway, Arthur Koestler, George Orwell, um nur einige Namen zu nennen).
Nach drei Jahren erbitterter Kämpfe hatten sich die Franquisten, auch aufgrund der stärkeren und konsequenteren Unterstützung durch Hitler-Deutschland und Mussolini-Italien, durchgesetzt. General Franco etablierte sich für die nächsten 40 Jahre als Caudillo (Führer), d. h. als Alleinherrscher.
Portugal (António Salazar)
1926 kam es auch in Portugal zu einem Militärputsch. Allerdings stellte sich heraus, dass die neuen Machthaber von der ökonomischen Situation des Landes, vor allem durch die hohe Verschuldung und die mit ihr verbundene Gefahr, von ausländischen Mächten/Gläubigernationen dominiert zu werden, vollkommen überfordert waren. In dieser Situation wurde António Salazar, Professor für Ökonomie an der Universität von Coimbra, 1928 zum Regierungsmitglied ernannt. Er schien in der Lage, Antworten auf die sich den Militärs stellenden ökonomischen Fragen zu liefern.12
Der Fall Salazar ist also nicht eindeutig zu kategorisieren: Unmittelbar erfolgte seine Machtübernahme geordnet und friedlich. Er »ergriff« die Macht nicht aktiv, sondern sie wurde ihm übertragen. Doch bevor dies geschah, ereignete sich der Putsch durch das Militär, das heißt, die Machtergreifung erfolgte, wenn auch nicht durch die Anwendung physischer Gewalt, so doch widerrechtlich durch das Militär als Organ der staatlichen Gewaltanwendung. – Wer hätte sich dagegen zur Wehr setzen können (außer der Bevölkerung insgesamt in Form von Generalstreik o. Ä.)?
1930 erreichte Salazar den Zenit seiner Karriere: Er wurde Ministerpräsident (und blieb das für die nächsten 36 Jahre, die er als Diktator das Land beherrschte, bis zu seinem Tod). Seine Form der Diktatur unterschied sich von den zeitgenössischen faschistischen Diktaturen Hitlers und Mussolinis, da er nicht durch eine populistische Massenbewegung oder Massenpartei an die Macht gelangt war. 1932 führte er eine neue Verfassung ein und begründete so den »Estado Novo«. Dieser hatte eine strenge hierarchische Struktur, gekennzeichnet durch ein Ein-Parteien-System, eingeschränkte Meinungsfreiheit und ein autoritär-repressives Regime.
Bemerkenswert ist, dass Salazar als Diktator lediglich Ministerpräsident war, es neben ihm aber auch noch einen Staatspräsidenten gab, der allerdings machtlos blieb, solange Salazar gesund war.
Chile (Augusto Pinochet)
Analog zur politischen Gemengelage in Spanien vor dem Bürgerkrieg war in Chile im Jahre 1970 ein »Linker« zum Präsidenten gewählt worden: Salvador Allende. Er war Kandidat der Volksfront. Sein Programm war es, auf demokratische Weise sozialistische Reformen des Staates durchzuführen. Dies betraf vor allem die Wirtschaft. Er wollte die Ausbeutung von Bodenschätzen (Kohle, Kupfer etc.), Banken sowie ausländische Großunternehmen verstaatlichen, und im Rahmen einer umfassenden Bodenreform sollte das im Eigentum von Großgrundbesitzern befindliche Land an Kleinbauern und Kollektive verteilt werden. In etlichen Bereichen der Wirtschaft wurde von Marktmechanismen Abschied genommen, zum Beispiel wurden die Preise für Grundnahrungsmittel und Mieten staatlich festgelegt, Schule und Gesundheitsfürsorge wurden kostenlos zur Verfügung gestellt.
All diese im Widerspruch zur Logik von Märkten erfolgenden Maßnahmen führten zur Steigerung der Inflation auf 160 % im Jahre 1972. Ein großer Teil der Verstaatlichungen betraf US-Firmen. Dass diese Maßnahmen von den USA nicht mit sonderlicher Sympathie beobachtet wurden, ist wenig verwunderlich. Aber auch die Bevölkerung zeigte sich zunehmend unzufrieden. Spätestens als die Inflation aufgrund der Flutung des Marktes mit Geld durch den Staat auf 600 % stieg, war die Zeit für einen Umsturz reif. Ein Putsch des Militärs, das eng mit der wirtschaftlichen Oberschicht des Landes verbunden war und die offene Unterstützung der US-Regierung sowie die heimliche Unterstützung der CIA fand, wurde geplant.13
An den Vorbereitungen und Planungen des Putsches war Pinochet, der spätere Diktator und zu der Zeit Oberbefehlshaber der Armee, ursprünglich nicht beteiligt; er wurde erst hinzugezogen und in die Pläne eingeweiht, als diese schon weit fortgeschritten waren. Die Oberbefehlshaber der Marine und der Luftwaffe waren dabei führend. Als vorsichtiger Taktierer, der sich so lange bedeckt hielt, bis die weitere, wahrscheinliche Entwicklung absehbar war, bezog Pinochet erst spät – unmittelbar vor dem Putsch – Stellung und schloss sich den Putschisten an.
Am 11.9.1973 fand der Putsch statt, die Moneda, der Amtssitz des Präsidenten Allende, wurde von Soldaten umzingelt und belagert:
»Allende lehnte die Kapitulation ab. Die Luftwaffe begann, den Regierungspalast Moneda zu bombardieren. Diese Bombardierung war militärisch nicht mehr notwendig, aber Allende durfte nicht entkommen und die Putschisten wollten wohl ein für alle sichtbares Exempel statuieren. Um unnötige Opfer zu vermeiden, bat Allende die meisten Anwesenden, die Moneda zu verlassen. Dann begann das Heer, das Gebäude zu stürmen. Einige der Leibwächter schossen auf die Soldaten, ohne sie lange aufhalten zu können. Daraufhin beging Allende Selbstmord.«14
Das Militär übernahm die Rundfunkstationen und verbreitete die ihm dienlichen Informationen bzw. die passende Propaganda. Der befürchtete Widerstand unterblieb, und es kam auch nicht zu dem einkalkulierten Bürgerkrieg.
Die Junta bestand aus zunächst vier Generälen. Sie legte keinen Zeitpunkt für ein Ende der Militärherrschaft fest. Pinochet beanspruchte für sich als Oberbefehlshaber des Heeres, des stärksten Teils der Truppen, die Rolle des Junta-Chefs. Er nutzte damit die faktischen Machtunterschiede zwischen dem größten Truppenteil und den schwächeren Teilen (Luftwaffe, Marine), ungeachtet der Rolle, die er beim Putsch gespielt hatte. Denn Pinochet hatte dabei nur eine Nebenrolle inne. Die Führungsrolle sollte alle zwei Jahre zwischen den Mitgliedern der Junta rotieren, was aber später von Pinochet ignoriert wurde.
So entwickelte sich nach und nach aus der Herrschaft einer vierköpfigen Junta die Alleinherrschaft Pinochets. Insofern haben wir es zum einen mit einer radikalen Disruption beim Wechsel von der Regierung Allende zur Militärjunta zu tun, und zum anderen, innerhalb der Junta, mit einem kontinuierlichen Wandel von einer kollektiven Führung mit einem Primus inter Pares hin zur Alleinherrschaft Pinochets.
2.2 Volksaufstand
Während der Putsch im zuvor dargestellten Muster die Funktion hat, die Veränderung gesellschaftlicher Machtverhältnisse zu verhindern (= die Ungleichheit der Lebensverhältnisse aufrechtzuerhalten), steht der Volksaufstand, die Rebellion großer Teile der Bevölkerung, auf der anderen Seite des Spektrums: Es wird die Beseitigung von Ungleichheit gefordert, meist unter dem Schlagwort »Gerechtigkeit«.
Die Massen gehen auf die Straße und stürmen die Symbole der Macht und der beklagten Ungleichheit: Regierungsgebäude wie Schlösser, Präsidentenpaläste, Ministerien, Gefängnisse, aber auch Parlamente, die vermeintlich das Volk repräsentieren. Und an denen, die für die Unterschiede verantwortlich gemacht werden, werden aggressive Impulse ausgelebt: vom Vandalismus an und in den Häusern der Reichen, dem Abfackeln von Luxuslimousinen bis hin zum Lynchmord an denen, die sich dem wütenden Mob in den Weg zu stellen versuchen.
Muster »Volksaufstand«
Obwohl die Französische, Russische und die Iranische Revolution, die hier als Beispiele dienen, in unterschiedlichen zeitlichen und kulturellen Kontexten erfolgten, weisen sie doch einige Gemeinsamkeiten auf, die als Merkmale von Volksaufständen (bzw. generell: von Massenbewegungen) verallgemeinert werden können.
Massen sind selbstorganisierte soziale Systeme, die spontan aufgrund der Synchronisierung der Emotionen einer großen Zahl von Individuen zustande kommen.15 Unzufriedenheit mit den aktuellen gesellschaftlichen Verhältnissen ist in der Regel solch eine Emotion, die zum Beispiel immer dann Massen in Bewegung setzt, wenn die ökonomischen Bedingungen sich verschlechtern und das rein physische Überleben – etwa durch Hunger – bedroht ist. Es können aber auch andere Werte infrage gestellt oder missachtet sein, wie etwa die individuelle Freiheit oder, wie in der Französischen Revolution postuliert, die Gleichheit aller Menschen, oder auch, wie im Falle der Islamischen Revolution im Iran, die ideologisch als gegeben oder notwendig erachtete Ungleichheit zwischen Menschen. Die Gründe für die jeweiligen zur Empörung führenden Affekte können höchst verschieden sein. Was eine Masse integriert, sind selten irgendwelche positiv definierten Ziele der gesellschaftlichen Veränderung, sondern ein negativ definiertes Ziel, konkret: die Negation des Status quo, d. h. der Sturz der aktuellen Regierung. Damit ist zunächst nur der Wunsch nach einer Veränderung verbunden, nicht aber die konkrete Vorstellung einer bestimmten alternativen Gesellschaftsform.
Solche spontan entstehenden Bewegungen werden in der Regel durch repressive Maßnahmen der Obrigkeit zerstreut und ruhiggestellt, d. h. niedergeschlagen (mit Betonung auf Schlagen, denn gegen die Demonstranten auf den Straßen und Plätzen werden die mit Schlagstöcken bewaffnete Polizei und das Militär als »Ordnungskräfte« eingesetzt). Meist reichen, den heutigen Möglichkeiten der Technik entsprechend, Wasserwerfer und Tränengas. Im Extremfall wird auf die Protestierenden geschossen, und es fließt Blut. Die vermeintlichen »Rädelsführer« – oder auch eine willkürlich zusammengesammelte Zahl von Bürgern – werden aus dem Verkehr gezogen und ins Gefängnis geworfen oder umgebracht. Im zaristischen Russland schickte man sie in einer Unzahl von Fällen in die Verbannung oder ins Exil, um so für alle wahrnehmbare Exempel zu statuieren. Das alles war auch im Iran wie im vorrevolutionären Frankreich oder bei der Niederschlagung der russischen Revolution von 1905 der Fall, um bei den unten ausführlicher dargestellten Beispielen zu bleiben.
Wenn es nicht gelingt, durch Repression wieder »Recht und Ordnung« herzustellen, und die aktuellen Machthaber tatsächlich die weiße Fahne hissen, das heißt, wenn die Massen ihren vermeintlichen Sieg auf den Straßen feiern, ist aber nicht viel gewonnen. Es ist ein Problem aller Massenbewegungen, dass es nach einem gelungenen Umsturz völlig offen ist, wohin die Reise geht. Das zwangsläufig entstehende Machtvakuum eröffnet vielerlei Optionen für unterschiedliche Zukünfte. Und in dem Machtvakuum zerbröselt die Einheit der Masse, die die Regierung auf den Barrikaden noch vereint bekämpfte. Sie spaltet sich in mehrere, sich gegenseitig bekämpfende und um die Macht ringende Interessengruppen. Die einen wollen die alten gesellschaftlichen Verhältnisse restaurieren, die anderen irgendwelche, meist gegensätzliche gesellschaftlichen Utopien verwirklichen usw. Die Folge scheint eine unvermeidliche Konsequenz und ein regelhaft beobachtbares Muster: Es entsteht Chaos, das heißt, es kommt über eine längere Zeit zu einem mehr oder weniger anarchischen bzw. anomischen Zustand. Lokal werden immer wieder kurzfristig bestimmte Spielregeln des Umgangs miteinander praktiziert, um im nächsten Moment durch andere abgelöst zu werden. Im (gar nicht so seltenen) Extremfall kommt es zum Bürgerkrieg. Die Berechenbarkeit des alltäglichen Lebens ist reduziert, seine Komplexität nimmt zu. Der Bedarf nach Komplexitätsreduktion steigt, sodass nach einer Weile – auch ohne Bürgerkrieg – bei der Mehrheit der Bevölkerung der Wunsch nach Ordnung und Stabilität aufkommt. Das ist dann die Zeit für die Machtübernahme durch eine sogenannte »starke« Persönlichkeit, die Komplexitätsreduktion und Beseitigung der Unsicherheit verspricht. Alles scheint besser als weiter das Chaos zu ertragen. Falls der Machtkampf in Form eines Bürgerkriegs ausgetragen wird, übernimmt der Sieger bzw. die Siegerpartei – niemand gewinnt einen Krieg allein – die Macht.
In Russland, und das ist ein Unterschied zu den beiden anderen Beispielen, war die Phase der Anomie nur kurz und die Dynamik dadurch anders, dass die Bolschewiki im Handstreich die Regierung und damit den gesamten Regierungsapparat übernahmen. Damit hatten sie nicht nur die Kontrolle über die das staatliche Machtmonopol sichernden Organisationen wie Armee und Geheimpolizei, sondern – und das dürfte der entscheidende Faktor gewesen sein – auch über die Infrastrukturen, die den Staat und das Alltagsleben der Bürger sicherten. Doch das war kein Aspekt der Selbstorganisation, sondern zielgenau gesteuert von Leo Trotzki.
In seiner kleinen Schrift »Technik des Staatsstreichs« analysiert Curzio Malaparte16 Trotzkis handwerklichen Ansatz der Machtübernahmen: Er bestand darin, dass er überhaupt nicht auf den Volksaufstand setzte (auch wenn er die Gelegenheit nutzte), sondern auf eine kleine, schlagkräftige Gruppe entschlossener und koordiniert handelnder Akteure. Sie hatte die Aufgabe, ganz gezielt die für das Überleben bzw. das Funktionieren des Staates neuralgischen Punkte zu besetzen und zu kontrollieren: »Wir benötigen eine kleine Truppe, kaltblütig und gewalttätig, in der Taktik des Aufstands trainiert.«17 Er sah im Aufstand eine Maschine, die der Techniker bedürfe, um sie in Bewegung zu setzen, und die niemand stoppen könne.18
Für den Staatsstreich war es nach Trotzkis Meinung nicht wichtig, sich um die Regierung oder die Bürokratie zu scheren, auch das Parlament spielte für ihn keine Rolle. Und es hatte seines Erachtens auch keinen Sinn, mit Maschinengewehren um die Macht zu kämpfen. Denn der Staat beruhe darauf, dass die technische Organisation funktioniert, d. h. die Elektrizitätswerke, die Eisenbahn, die Telefone und Telegrafen, die Häfen, die Gasometer, die Wasserleitungen19 – kurz gesagt: die Infrastrukturen, die ein »normales«, geordnetes Leben ermöglichen. Wer sie kontrollierte, konnte Chaos produzieren, brauchte keinen Generalstreik, keine Anwendung von Waffen. Und das war es, was Trotzki im Oktober 1917 in Leningrad tat (auch wenn er dies nicht in dieser Weise explizit theoretisch entfaltete). Mit nicht mehr als 1000 Mann übernahm er im Handstreich de facto die Kontrolle über den Staat.20
Statt auf die Bewegung von Massen auf den Straßen setzte er also auf eine schlagkräftige, gut organisierte Mannschaft von Spezialisten: Mechaniker, Elektriker, Telegrafen, Ingenieure usw., die sich mit den Funktionen und dem Betreiben der technischen Infrastrukturen des Staates auskannten. Und die von ihm entworfene Technik des Staatsstreichs war erfolgreich. Aus systemtheoretischer Sicht war dabei die Kontrolle über die Mittel der Kommunikation von zentraler Bedeutung, denn auf diese Weise wurde verhindert, dass der Widerstand gegen den Coup koordiniert und organisiert werden konnte. Nun konnte Lenin die Herrschaft antreten. (Dass die Technik des Staatsstreichs sich von der des Machterhalts unterscheidet, musste Trotzki am eigenen Leib erfahren, als er von dem auf die Macht der Bürokratie setzenden Stalin ausmanövriert und schließlich umgebracht wurde.)
Ein weiterer Erfolgsfaktor der russischen Revolution war, dass eine Organisation – die kommunistische Partei – die Macht übernahm und dadurch keine »Suchphase« nach einer neuen Struktur, wie exemplarisch in der Französischen Revolution, nötig wurde. Die Partei behielt zum großen Teil die staatlichen Strukturen bei, setzte sich selbst aber an deren Spitze. Auch im Iran konnten sich die Mullahs wohl deswegen gegen die anderen Prätendenten der Macht durchsetzen, weil sie sich auf bereits bestehende, das Land umfassende organisatorische Strukturen der schiitischen Glaubensgemeinschaften stützten.
Hierarchie verspricht eine Lösung, wann und wo immer große Unsicherheit besteht und auf keine etablierten, kulturell tradierten Verfahrensweisen zur Bewältigung von Unsicherheit zurückgegriffen werden kann. In den nachfolgend dargestellten Beispielfällen waren es natürlich nie Einzelpersonen, die schließlich die Unsicherheit beseitigten, indem sie die Macht übernahmen, sondern soziale Einheiten. In der Französischen Revolution war es das Militär, das Napoleon die Möglichkeit eröffnete, die Macht zu erringen; im Iran waren es die schiitischen Geistlichen, in Russland die kommunistische Partei. Erst im Laufe des Geschehens übernahm dann schließlich einer der Beteiligten – sich seinen früheren Mitstreitern gegenüber durchsetzend – die Macht.
Wenn eine Person auf das Spielfeld tritt, die – wie auch immer legitimiert – sich als vertrauenswürdige Autorität präsentiert, so ist das früher aufständische Volk nur allzu bereit, sich unterzuordnen und eine autoritäre Herrschaft jubelnd zu begrüßen.
Das alte Regime wird, das ist die Quintessenz von Volksaufständen, durch ein autoritäres Regime ersetzt. Der Grund dafür ist, dass Massen, die sich selbstorganisiert entwickeln, als soziale Systeme nicht von Dauer sind. Sie verfügen über keine stabilen bzw. stabilisierenden Strukturen. Die sie hervorbringenden Emotionen halten – wie Gefühle generell – nicht längerfristig, sie verpuffen, und mit ihnen die individuelle Energie und Initiative, die nötig ist, um eine Masse als handelnde Einheit zu erhalten. Hinzu kommt, dass Massen als soziale Systeme nur zu relativ simplen, wenig differenzierten Handlungen fähig sind. All das, was ihnen fehlt, um langfristig gesellschaftliche Bedeutung zu gewinnen und zu erhalten, können nur Organisationen liefern. Sie können gewährleisten, dass sich bestimmte sachliche wie auch soziale Ziele unabhängig von der aktuellen Motivation von Individuen auf Dauer verfolgen lassen, denn in Organisationen sind die Mitglieder austauschbar.
In Massenbewegungen wie der Französischen und Iranischen Revolution kam es erst zur Beendigung der anomischen Phase, als in Frankreich eine Organisation (das Militär), repräsentiert durch ihren Führer Napoleon Bonaparte, die Macht übernahm; und im Iran wurden das Machtvakuum und der Machtkampf der unterschiedlichen Interessensgruppen erst beendet, als es den wohlorganisierten islamischen Geistlichen um Ayatollah Chomeini gelang, die Konkurrenten aus dem Feld zu schlagen.
Wenn Massenproteste und Volksaufstände gegen eine autokratische Regierung durch eine wohlorganisierte Gruppe von Berufsrevolutionären gehijacked und für ihre eigenen Ziele genutzt werden, dann besteht die Chance auf langfristige Wirksamkeit und Veränderung. Wenn solch eine Organisation – wie in Russland die kommunistische Partei – im Handstreich die staatliche Macht an sich reißt, entwickelt sich ein anderer Prozess als in einer Massenbewegung, die sich bzw. der Selbstorganisation überlassen bleibt. Massenprozesse depotenzieren sich dadurch selbst, dass sie sich nicht fortsetzen, wenn niemand die ständige Reproduktion der Erregung und Empörung organisiert und so für die Aufrechterhaltung der Bewegung sorgt. Wo zum Beispiel eine revolutionäre Partei die Steuerung und Regie des weiteren Verlaufs des Prozesses übernimmt, kann das Versanden des Aufstands verhindert werden. Auch wenn ein derartiger Prozess nicht einseitig kontrolliert werden kann, so schafft die Involvierung einer Organisation einen qualitativen Unterschied: Er ist nicht mehr auf die unwahrscheinliche Gleichschaltung der Gefühle einer großen Zahl sich spontan erregender und solidarisierender Individuen angewiesen, sondern die Kontinuität und Fortdauer des revolutionären Geschehens kann nunmehr als Aufgabe der Organisation – eines durch sachliche Ziele definierten sozialen Systems – gesichert werden. Aus der spontanen Empörungsenergie wird ein zu organisierender Prozess, eine Verwaltungsaufgabe, deren »Vollzugsbeamte« austauschbar sind.
Frankreich (Napoleon Bonaparte)
Am 14. Juni 1789 versammelte sich in Paris eine Menge von Bürgern vor der Bastille, einer von Söldnern bewachten Festung, die als Staatsgefängnis diente. Da es seit mehreren Wochen Unruhen gab, wollten sie der dort lagernden Waffen habhaft werden. Der Kommandant ließ auf die Leute feuern, es wurden mehr als 90 Personen getötet, was die Menge veranlasste, sich zu bewaffnen und erneut die Bastille zu belagern. Die Besatzung, keine 100 Mann, kapitulierte, der Kommandant und einige der Wachsoldaten wurden getötet und die Festung gestürmt. Insgesamt wurden lediglich sieben Gefangene befreit, die weiter keine bedeutende Rolle für die Ereignisse spielen sollten.
Bereits einen Tag nach diesen Ereignissen begann – selbstorganisiert – der Abriss der Bastille, ohne dass irgendeine höhere Autorität dazu den Auftrag gegeben oder ihr Einverständnis gegeben hätte: Symbol der Beseitigung der Despotie.21
Der Sturm auf die Bastille wird bis heute als Beginn der Französischen Revolution gefeiert. Sie sollte zehn Jahre bis etwa 1799 dauern, wobei der Sturm auf die Bastille de facto lediglich eine symbolische Rolle spielte.22
Das »Ancien Regime« des Bourbonen-Königs Ludwig XVI. war bereits in den Jahren zuvor aufgrund einer Finanzkrise und Hungersnot ins Wanken geraten, was zu Unruhen unter der Bevölkerung geführt hatte. Vor der Revolution herrschte in Frankreich – dem Modell absolutistischer Herrschaft – eine kleine Schicht Privilegierter, die aus »dem alten Blut- und dem neuen Geldadel« bestand. »Die alte Ständeordnung wurde durch einen neuen Gegensatz von Arm und Reich gekreuzt.«23
Diese Situation hätte wahrscheinlich durch einige die Struktur der Gesellschaft nicht infrage stellende Reformen bewältigt werden können. Mit ihrer Hilfe hätten die offensichtlichen Ungleichheiten zwischen den Machthabern und dem Rest der Bevölkerung abgemildert und die Lage befriedet werden können. Da dies nicht geschah, wurden die Spannungen immer brisanter und führten schließlich zur Revolte, die zur Revolution anwuchs.
Die These, dass es zu den Unruhen – beginnend bei den Bauern – gekommen ist, weil die gesellschaftlichen Ungleichheiten ein Maß erreicht hatten, das nicht mehr auf die Akzeptanz der breiten Bevölkerung setzen konnte, wird durch die 1789 verkündeten »Menschenrechte« gestützt:
»Der erste Artikel der Rechteerklärung begann mit den Worten: ›Von ihrer Geburt an sind und bleiben die Menschen frei und an Rechten einander gleich.‹«24
Zu den proklamierten Bürgerrechten gegenüber dem Staat gehörte u. a. Teilnahme an der Gesetzgebung, gleicher Zugang zu Ämtern, Steuergleichheit, Gewaltenteilung und die Rechenschaftspflicht von Beamten; und als individuelle Menschenrechte: Freiheit, Eigentum, Widerstand gegen Unterdrückung, Sicherheit.25
Doch es ist ein langer Weg von der Proklamation solch abstrakter Werte zur Operationalisierung in einer konkreten Staatsform. Der Weg der Irrungen und Wirrungen der Französischen Revolution kann im Rückblick in mehrere Phasen eingeteilt werden:
»An eine Vorphase (1787–1789), die als Revolte der Aristokraten oder als Vorrevolution der Privilegierten bezeichnet wird, schließen sich drei Hauptphasen an. Die erste Phase (1789–1792) gilt als die Revolution des besitzenden Bürgertums oder die Zeit der konstitutionellen Monarchie. Die zweite Phase (1792–1794) kann man die Revolution des radikalen Bürgertums oder die Zeit der Republik nennen. Die dritte Phase (1794–1799) ist die Restauration des besitzenden Bürgertums oder die Zeit des Direktoriums.«26
Nachdem zunächst die absolutistische Form der Monarchie in eine konstitutionelle umgewandelt wurde, kam es zur Ausrufung der Republik, zur Hinrichtung Ludwig XVI., zu diversen Kriegen mit immer noch monarchisch regierten Nachbarstaaten, zur Gründung des Wohlfahrtsausschusses. Unter der Leitung von Danton und Robespierre wurde eine blutige Terrorherrschaft errichtet: Sie kostete – die Schätzungen variieren – zwischen 25.000 und 40.000 vermeintlichen Gegnern der Revolution das Leben. Sie wurden guillotiniert, das heißt, die Hinrichtung wurde maschinell rationalisiert.27
Die traditionellen Strukturen des Staates, ja, der Kultur wurden radikal destruiert (was sich beispielsweise in der klaren Trennung von Kirche und Staat sowie der Einführung eines neuen Kalenders zeigte), aber an ihre Stelle konnten sich keine zuverlässigen neuen Strukturen etablieren. Es gab keine zuverlässigen und Berechenbarkeit gewährleistenden Regeln, an denen sich der Einzelne orientieren konnte. Das eröffnete auf der einen Seite ungeheure, bis dato ungeahnte Freiheiten des Einzelnen, auf der anderen Seite war der Preis, der zu zahlen war, eine ebenso ungeheure und bis dato ungeahnte Unsicherheit des Einzelnen.
Dies war die gesellschaftliche Lage, in der Napoleon Bonaparte der Aufstieg an die Spitze der Armee und schließlich des Staates gelang. Er wurde zum Diktator, der sich selbst zum Kaiser krönte. Als General und schließlich Oberbefehlshaber war er es, der die Kriege der Republik gegen die Außenfeinde führte. Und da er dabei sehr erfolgreich war und sich als genialer Heerführer bewies, konnte er auch innerhalb der staatlichen Strukturen sein strategisches und taktisches Geschick nutzen, um an die Macht zu gelangen.