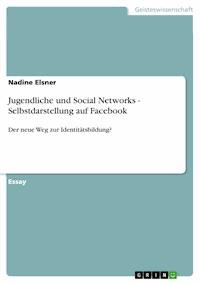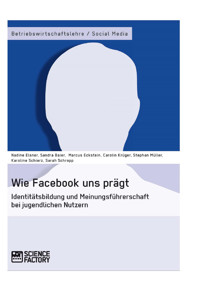
Wie Facebook uns prägt. Identitätsbildung und Meinungsführerschaft bei jugendlichen Nutzern E-Book
Nadine Elsner
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Science Factory
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Beeinflusst uns Facebook? Und falls ja, welche Faktoren lenken unser Verhalten im größten Social Network der Welt? Inzwischen hat Facebook über eine Milliarde Nutzer und besonders Jugendliche lieben es, zu posten, zu kommentieren und mit anderen in Kontakt zu treten. In diesem Band wird dargestellt, wie sich das Netzwerk auf die Identitätsbildung Jugendlicher auswirkt und inwieweit das Thema Meinungsführerschaft eine Rolle beim Nutzungsverhalten spielt. Aus dem Inhalt: Selbstdarstellung in sozialen Netzwerken, Identitätsbildung mit Facebook, Identitätsforschung, Bedeutung von Facebook, Meinungsführer auf Facebook, Mediensozialisation von Jugendlichen, Risiken sozialer Netzwerke.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 135
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Impressum:
Copyright © 2013 ScienceFactory
Ein Imprint der GRIN Verlags GmbH
Druck und Bindung: Books on Demand GmbH, Norderstedt, Germany
Coverbild: http://pixabay.com
Wie Facebook uns prägt.
Identitätsbildung und Meinungsführerschaft bei jugendlichen Nutzern
Jugendliche und Social Networks - Selbstdarstellung auf Facebook. Der neue Weg zur Identitätsbildung? Von Nadine Elsner 2012
Einleitung
Die Lebensphase Jugend
Der Weg zur eigenen Identität
Social Networks – Facebook
Identitätsfindung über Facebook
Fazit
Literaturverzeichnis
Meinungsführerschaft auf Facebook. Eine Untersuchung zur Identifizierung von Meinungsführern und ihrem Nutzungsverhalten im Social Web von Sandra Baier, Marcus Eckstein,·Carolin Krüger, Stephan Müller, Karoline Schierz 2012
Einleitung
Gesellschaftliche Relevanz: die Bedeutung von Facebook und dem Web 2.0
Forschungsfrage
Theoretische Grundlagen
Stand der Forschung
Methodischer Teil
Durchführung
Datenauswertung
Erwartete Ergebnisse
Kritik und Ausblick
Literaturverzeichnis
Anhang
Identitätsspielraum Internet: Die Relevanz des Handlungsspielraums jugendnaher sozialer Netzwerke für die Identitätsarbeit Jugendlicher am Beispiel von Facebook von Sarah Schropp 2012
Abbildungsverzeichnis
Gegenstand, methodisches Vorgehen und Zielsetzung der Arbeit
Sozialisation im Jugendalter und Mediensozialisation
Traditionelle und aktuelle Identitätsforschung
Soziale Netzwerke
Chancen virtueller Identitätskonstruktionen von Jugendlichen in sozialen Netzwerken
Resümee und Relevanz für die Pädagogik
Quellen- und Literaturverzeichnis
Jugendliche und Social Networks - Selbstdarstellung auf Facebook. Der neue Weg zur Identitätsbildung? Von Nadine Elsner 2012
Einleitung
Das Web 2.0 und seine berühmteste Plattform „Facebook“ wird immer mehr zum Thema in der öffentlichen Berichterstattung. Zunehmend legen sich Menschen dort ein Profil an und kommunizieren über das Internet mit Freunden, Bekannten und auch Fremden. Seit der erfolgreichen Verbreitung von Smartphones ist es mittlerweile auch von unterwegs möglich, die Neuigkeiten auf Facebook zu überprüfen und natürlich zog dieser Trend auch nicht an den Jugendlichen vorbei. Bisher wurde im Zusammenhang mit Medien und der Identitätsbildung Jugendlicher jedoch lediglich von Fernsehinhalten, Zeitungen, Kinofilmen und Musik gesprochen und das Internet wurde dabei weitestgehend außen vor gelassen. Da selbiges jedoch eine immer größere Relevanz für jugendliche Personen bekommt, hat sich mir die Frage gestellt, ob ein Teil ihrer Identitätsbildung mittlerweile auf Social Network Plattformen wie Facebook stattfindet? Dafür möchte ich in meiner Arbeit zunächst klären, was unter Jugend und Identität verstanden wird, die neuen Begriffe Web 2.0 und Social Networks erläutern, um dann kurz auf die erfolgreichste Plattform „Facebook“ einzugehen. Anschließend soll geklärt werden, wie die Identitätsfindung im Internet funktioniert und welche Gründe es für eine Verlagerung in das Web 2.0 geben könnte.
Die Lebensphase Jugend
Fällt der Begriff Jugend, scheint im allgemeinen Sprachgebrauch zunächst klar zu sein, was gemeint ist, und Assoziationen wie Pubertät, sowie körperliche und psychische Entwicklungen drängen sich auf. In der Wissenschaft ist der Begriff jedoch nicht eindeutig bestimmt, je nach Forschungsrichtung existieren unterschiedliche Auffassungen davon, was genau die Lebensphase Jugend ausmacht, wie lange sie andauert und ob sie sich im Laufe der Zeit verändert hat.
Zunächst kann grundsätzlich festgehalten werden: Wenn von Jugend gesprochen wird, dann befindet sich die Person in einer Phase zwischen Kindheit und dem Erwachsensein, dessen Kategorisierung oftmals an dem biologischen Alter festgemacht wird. Die zeitliche Eingrenzung der Jugendphase erstreckt sich meistens von 13 bis 25 Jahren, wobei die Grenzen dieser Zeitspanne nicht immer eindeutig zu bestimmen sind (Vgl. Zimmermann 2006: 155). Letztere Festlegung ist aber auch gerade im Zusammenhang mit politischen Rechten (Wahlberechtigung) und juristischen Bestimmungen (Jugendstrafrecht) von Bedeutung (Vgl. Litau 2011: 21). Die Lebensphase Jugend besteht in ihrer jetzigen Form erst seit dem Wechsel vom 19. Zum 20. Jahrhundert in Deutschland. Zuvor existierte diese Zwischenphase nicht und man sprach lediglich von Kindern und Erwachsenen (Vgl. Villáyi/Witte/Sander 2007: 11).
Das Alter ist jedoch nicht ausreichend, um die Lebensphase Jugend vollständig zu definieren, da mit ihr verknüpfte Aufgaben und Probleme nicht allein über diese Art der Kategorisierung erfasst werden können und im Zweifelsfall das Bild der Jugend sogar verfälscht wird. Zudem ist es nicht möglich von „der“ Jugend zu sprechen, da sie genauso heterogen differenziert ist wie die Gesellschaft, der sie angehört. Sowohl verschiedene Jugendkulturen als auch Lebensstile machen eine eindeutige Typologisierung beinahe unmöglich (Vgl. Litau 2011: 21-22). Doch trotz der fehlenden einheitlichen Definition dieser Phase kann festgehalten werden, dass es währenddessen zu „zahlreichen […] Veränderungen in der psychosozialen Entwicklung“ (Litau 2011: 22) kommt und „Menschen in dieser Lebensphase körperliche, geistige, emotionale und soziale Entwicklungen und Veränderungen“ bewältigen müssen (vgl. ebd.). Des Weiteren sehen sie sich mit einigen Aufgaben konfrontiert. Dazu gehören unter anderem „die Akzeptanz der eigenen körperlichen Erscheinung, die Übernahme der männlichen oder weiblichen Geschlechterrolle, der Aufbau neuer und reifer Beziehungen zu Altersgenossen beiderlei Geschlechts und die emotionale Unabhängigkeit von den Eltern und von anderen Erwachsenen“ (Vgl. Tillmann 2006: 33).
Der Weg zur eigenen Identität
Den wichtigsten Entwicklungsschritt stellt meines Erachtens jedoch die Identitätsfindung dar. Durch die körperlichen Veränderungen setzt auch gleichzeitig ein kognitiver Entwicklungssprung ein, der zu einer stärkeren Selbstreflexion führt und sich Jugendliche dadurch erstmals bewusst mit ihrem Selbstbild auseinandersetzen (Vgl. Tillmann 2006: 32). In diesem Prozess wird versucht, eine klare Abgrenzung zu den Eltern und auch anderen Gleichaltrigen zu vollziehen. Deutlich wird dieser Versuch durch die Wahl eines eigenen Mode- und Musikstils und neu gesetzten Freizeitpräferenzen. Die zentrale Frage, welche diesen Prozess ständig begleitet, lautet: „Wer bin ich?“ oder „Wer bin ich in einer sozialen Welt?“. Den größten Einfluss auf die Identitätsforschung hatte bisher der Entwicklungspsychologe Erik Homburger Erikson. Er konstruierte unter anderem das Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung und stellte in diesem Kontext auch seine Identitätstheorie auf, deren zentralen Begriff „Identität“ ich im Folgenden kurz erläutern werde, um mich im weiteren Verlauf auf sein Konzept und seine Vorstellung von Identität stützen zu können.
Den Kern seiner Überlegungen bildet der Begriff Identität. Erikson versteht darunter „das bewusste oder unbewusste Erleben der ‚Ich-Kontinuität‘“ (Erikson 1973: 18). Der Mensch macht in dieser Phase also die Erfahrung, dass er trotz verschiedener Aufenthaltsorte oder unterschiedlichen Kontaktpersonen im Kern die gleiche Person bleibt und gleichzeitig auch von anderen als immer diese wahrgenommen wird (vgl. ebd.). Der Weg dahin ist mit vielen Krisen, Problemen, Selbstzweifeln, Ängsten, Unsicherheiten, aber auch von Erwartungen des (persönlichen) Umfelds geprägt. Die Identitätsbildung in der Jugendphase kann also als ein selbstaktiver Prozess verstanden werden, als „doing identity“ (Tillmann 2008: 63). Eine ebenso wichtige Rolle spielt der Kontakt zu Gleichaltrigen. Da diese mit ähnlichen Ängsten und Problemen zu kämpfen haben, verspüren die Jugendlichen eine Art Erleichterung, wenn sie sich in dieser komplizierten Lebensphase verstanden fühlen.
„Um Identität herzustellen und damit das eigene Erleben zu ordnen, zu bearbeiten und letztlich auch zu begreifen, suchen die Jugendlichen die Nähe zu Ihresgleichen. […] In der Peer- Group finden sie Aufmerksamkeit, Empathie und Zuneigung. […] Dort werden ihre eigenwilligen Identitätsentwürfe wertgeschätzt und sie zu neuen Experimenten ermutigt.“ (Tillmann 2008: 192)
Ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zur eigenen Identität gelingt in der deutlichen Abgrenzung zu den eigenen Eltern oder anderen Personengruppen in der Gesellschaft. Dies erfolgt meist durch die Wahl der Kleidung, des besonderen Sprachgebrauchs oder des Musikgeschmacks (Vgl. Meier 2008). Doch es ist zu beobachten, dass diese Form der Abgrenzung immer schwieriger wird. Eltern hören heute oftmals die gleiche Musik, tragen ähnliche Kleidung und auch in ihren Sprachgebrauch fließen immer mehr jugendtypische Wörter ein. In den letzten Jahren ist fast schon ein Trend zum „Jungsein“ entstanden. Es ist „in“ jugendlich (geblieben) zu wirken und manch Mutter ist nur noch schwierig von ihrer jugendlichen Tochter zu unterscheiden. Möglicherweise könnte diese gesellschaftliche Entwicklung eine Ursache dafür sein, warum sich Jugendliche das Internet als neuen Raum zur Identitätsbildung erschlossen haben.
Um herauszufinden, wie Identitätsbildung im Internet funktioniert und ob eine Verlagerung dieser auf Social Network Plattformen wie Facebook stattgefunden hat, soll zunächst im Folgenden geklärt werden, was unter diesen Begriffen zu verstehen ist.
Social Networks – Facebook
Immer häufiger stößt man im Alltag auf die Begriffe Web 2.0 und Social Networks oder auch Soziale Netzwerke. Doch wofür stehen diese Formulierungen und welche Funktionen bieten Social Networks wie Facebook an?
Der Begriff Web 2.0 steht für eine Entwicklung des Internets, die sich in den letzten zehn Jahren herausgebildet hat. Der Nutzer wird immer mehr ein Teil des Internets und bestimmt dessen Inhalte aktiv mit (Vgl. ITWissen 2012a). Dies kann unter anderem in sogenannten Blogs passieren, die inzwischen auch für den traditionellen Journalismus zur immer größeren Konkurrenz werden, oder eben in Social Networks. Diese bieten den Benutzern die Möglichkeit, mit anderen Nutzern über des Internets zu kommunizieren, Beziehungen aufzubauen und Inhalte (Fotos, Videos, Software) auszutauschen (Vgl. ITWissen 2012b). Zu der wichtigsten und erfolgreichsten Plattform hat sich Facebook entwickelt. Ursprünglich entwickelt von Mark Zuckerberg im Jahr 2004 für die Havard-Studenten, wurde es im Jahr 2006 auch für den Rest der Bevölkerung freigegeben und findet mittlerweile nicht nur in den USA, sondern weltweit großen Anklang (Vgl. Kneidinger 2010: 59). Inzwischen nutzen über 840 Millionen Menschen weltweit diese Plattform und alleine in Deutschland hat sich die Nutzerzahl im Zeitraum Juli 2009 bis Juli 2010 verdreifacht (von 3,5 Millionen auf 10 Millionen Menschen) (Vgl. Statista 2012).
Die Funktionsweise von Facebook ist simpel. Jeder Nutzer besitzt ein eigenes Profil, auf dem er persönliche Daten, Fotos, Videos und sogenannte Statusmitteilungen veröffentlichen und mit seinen Online- Freunden teilen kann. Je nach Privatsphäre Einstellung können auch fremde Personen auf diese Inhalte zugreifen. Auch immer mehr „Stars“ nutzen Facebook und betreiben eine sogenannte „Fanseite“, die man „liken“ kann, um auf diesem Weg Informationen und Bilder zu erhalten oder in seltenen Fällen sogar mit ihnen in Kontakt treten zu können. Diese Möglichkeit scheint besonders für Jugendliche interessant, da sie so ihren Idolen näher sein können.
Identitätsfindung über Facebook
Laut der JIM-Studie (Jugend, Information, Multi-Media) des Medienpädagogischen Forschungsverbundes Südwest aus dem Jahr 2010 besuchen 70% der 12- bis 19-Jährigen täglich Online-Communities wie Facebook. Insgesamt verbringen sie täglich circa zwei Stunden im Internet, wobei die Zahl mittlerweile höher sein müsste, da inzwischen viele auch von unterwegs mittels Smartphone das Internet nutzen.
Sowohl die Selbstpräsentation als auch der Kontakt zu Freunden, Fremden und berühmten Persönlichkeiten wird ihnen durch Facebook ermöglicht und anhand der Zahlen wird deutlich, dass diese Funktionen mit großer Begeisterung genutzt werden und Social Networks eine immer größere Rolle im Leben der Jugendlichen einnehmen. Daraus folgend liegt es nah, anzunehmen, dass das Agieren auf der Plattform auch zur Identitätsbildung der jungen Personen beitragen könnte.
Wie zuvor erläutert, besteht die Hauptfunktion bei Facebook im Erstellen eines eigenen Profils, auf dem man sich mittels Fotos, Videos und Statusmitteilungen präsentieren kann. Anders als im „realen“ Leben kann der Jugendliche selbst bestimmen, was er von sich preisgibt und welches Selbstbild er dadurch vermittelt. Es findet eine Art digitale Präsentation der eigenen Person statt, eine bewusste Inszenierung seiner selbst. Das Internet wird von vielen als neuer sozialer Raum begriffen, in dem sie interagieren und sich ausprobieren können. Es bietet „neue Formen der Identitätsbildung“ (Kneidinger 2010: 46) und „durch die fehlende direkte Präsenz der Kontaktpersonen besteht hier sogar die Möglichkeit, vollkommen neue Identitätsaspekte ‚auszutesten‘, was im realen Kontext aufgrund gewisser Vorerwartungen und Einschätzungen in dieser Form nicht möglich wäre“ (ebenda).
Fernab von fremden Erwartungen an die eigene Person und Vorurteilen, die den Jugendlichen begegnen könnten, ist es möglich, sich selbst auszuprobieren und ein Selbstbild, eine Identität, zu erschaffen, mit der man sich identifizieren kann. Besonders Jugendliche, die sonst eher verschlossener und unsicher sind, können sich auf Social Network Plattformen frei ausleben und ausprobieren.
Es wird ein sogenanntes „Identitätsmanagement betrieben, bei dem bewusst persönliche Daten präsentiert werden, um die eigene Person vorzustellen“ (Vgl. Kneidinger 2010: 50). Zudem besteht genau wie im „realen“ Leben die Möglichkeit, Verhaltensweisen oder das Aussehen von Gleichaltrigen, sportlichen oder musikalischen Idolen zu imitieren, für die eigene Identität aufzunehmen und anschließend auf dem Facebook-Profil zu präsentieren.
Das Internet bietet des Weiteren die Möglichkeit, sich weitestgehend ohne „elterliche Kontrolle darzustellen und sich online als attraktive Kontakte oder auch bewusst als außerhalb der Gesellschaft stehend“ (Schorb 2008: 4) zu präsentieren. Dies ist besonders in dem Zusammenhang interessant, dass es aufgrund der bereits angesprochenen gesellschaftlichen Entwicklung, dem Trend zum „Jungbleiben“, immer schwieriger wird, sich von den eigenen Eltern oder anderen erwachsenen Personen abzugrenzen.
Fazit
Zusammenfassend lässt sich sagen: Das Internet und seine Communities bilden für die Jugendlichen eine Art neuen sozialen Raum, in dem sie sich weitestgehend fern von elterlicher Kontrolle und gesellschaftlichen Vorerwartungen inszenieren und ausprobieren können. Im Laufe der vergangenen Jahre hat sich ein neuer Experimentierraum entwickelt, in dem sie nach ihren Vorstellungen und Möglichkeiten eine eigene Identität entwickeln können. Das Internet liefert ihnen dafür „Bühne, Werkzeug und Quelle“ (Tillmann 2008: 77). Die Medien sind heutzutage also ein wichtiger Faktor für die jugendliche Identitätsbildung und sollten daher auch weiterhin im Mittelpunkt der öffentlichen Betrachtung stehen. Denn auch wenn das Internet viele positive Möglichkeiten für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen bietet, so dürfen die negativen Aspekte nicht in den Hintergrund geraten. Das Web 2.0 birgt auch einige Gefahren, besonders dann, wenn die Medienrezeption, also die Art und Häufigkeit der Nutzung, ohne (elterliche) Kontrolle stattfindet. Auf vielen Internetseiten existiert ein relativ freier Zugang zu gewalttätigen oder pornografischen Inhalten, welche die kognitive Entwicklung stark beeinflussen können. Auch der Suchtfaktor sollte nicht außen vor gelassen werden. Durch die Möglichkeit, sich relativ frei und nach eigenen Wünschen präsentieren zu können, kann es passieren, dass sie sich eine Art Schweinwelt oder Parallelwelt aufbauen. Die Vergangenheit hat bereits Fälle aufgezeigt, in denen Jugendliche den Kontakt zum realen sozialen Umfeld verloren und sich in die Welt des Internets geflüchtet haben. Zudem veröffentlichen die Jugendlichen relativ gedankenlos private Daten, die in den meisten Fällen für die gesamte Öffentlichkeit frei zugänglich sind. Es fehlt ihnen meist die Weitsicht, zu welchen Problemen oder Gefahren dies auf lange Sicht führen kann. Es ist jedem möglich, beispielsweise auf Fotos zuzugreifen und diese für fremde Zwecke zu missbrauchen. An diesen Problemen arbeiten bereits seit einiger Zeit Medienpsychologen und -pädagogen, die Programme entwickeln und Aufklärungsarbeit leisten. Für die Zukunft wäre es interessant, das Thema noch näher aus Sicht der Jugendlichen zu betrachten. Was bieten ihnen Soziale Netzwerke und helfen sie ihnen auf der komplizierten Suche nach der eigenen Identität? Dazu könnte eine empirische Studie durchgeführt werden, in der die Jugendlichen zu diesem Themenkomplex noch näher befragt werden.
Literaturverzeichnis
Erikson, Erik H.: Identität und Lebenszyklus. Drei Aufsätze. 2. Auflage Frankfurt am Main 1973.
Hugger, Kai- Uwe: Digitale Jugendkulturen. Wiesbaden 2010.
IT Wissen (a): Das große Online- Lexikon für Informationstechnologie: Web 2.0. Zugriff über: http://www.itwissen.info/definition/lexikon/Web-2-0-web-2-0.html [Stand: 23.02.2012]
IT Wissen (b): Das große Online- Lexikon für Informationstechnologie: Soziale Netzwerke/ Social Networks. Zugriff über:
http://www.itwissen.info/definition/lexikon/Soziales-Netzwerk-social-network.html [Stand: 23.03.2012]
Kneidinger, Bernadette: Facebook und Co. Eine soziologische Analyse von Interaktionsformen in Online Social Networks. Wiesbaden 2010.
Litau, John: Risikoidentitäten. Alkohol, Rausch und Identität im Jugendalter. München 2011.
Medienpädagogischer Forschungsverbund Südewest: JIM 2010. Jugend, Information, (Multi-) Media. Basisstudie zum Medienumgang 12- bis 19- Jähriger in Deutschland. Stuttgart 2010.
Meier, Tatjana: „Mama, du bist peinlich“. In: Focus Online 2008. Zugriff über: http://www.focus.de/schule/familie/erziehung/psychologie/psychologie_aid_234142.html [Stand: 23.01.2012]
Schorb, Bernd: Identitätsbildung in der konvergenten Medienwelt. In: Wagner, Ulrike/ Theunert, Helga(Hrsg.): Neue Wege durch die konvergente Medienwelt. Studie im Auftrag der bayerischen Landeszentrale für neue Medien. München 2006, S. 149-160.
Schorb, Bernd/ Wagner, Ulrike: Mediale Identitätsarbeit. Zwischen Realität, Experiment und Provokation. In: Theuner, Helga (Hrsg.): Jugend- Medien- Identität. München 2009, S.81- 93.
STATISTA: Anzahl der aktiven Nutzer von Facebook in Deutschland von Juli 2009 bis Juni 2010. Zugriff über:
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/70189/umfrage/nutzer-von-facebook-in-deutschland-seit-2009/ [Stand: 23.02.2012]
Tillmann, Angela: Identitätsspielraum Internet. Lernprozesse und Selbstbildungspraktiken von Mädchen und jungen Frauen in der virtuellen Welt. München 2008.
Villányi, Witte/ Dirk, Matthias/ Sander, Uwe: Einführung: Jugend und Jugendkulturen in Zeiten der Globalisierung. In: Villányi, Dirk/ Witte, Matthias/ Sander, Uwe (Hrsg.): Jugend und Jugendkulturen in Zeiten der Globalisierung. Weinheim/ München 2007, S. 9-19.
Meinungsführerschaft auf Facebook. Eine Untersuchung zur Identifizierung von Meinungsführern und ihrem Nutzungsverhalten im Social Web von Sandra Baier, Marcus Eckstein,·Carolin Krüger, Stephan Müller, Karoline Schierz
Einleitung
Stephan Müller