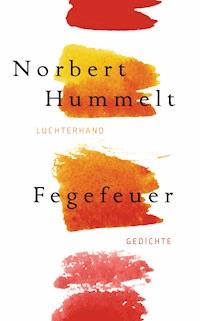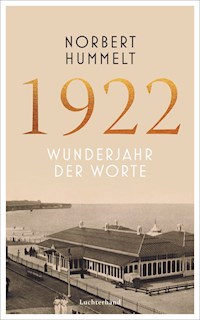6,99 €
6,99 €
oder
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein Grundlagenwerk über das Entstehen von Gedichten
Von der Einrichtung der Arbeitswerkstatt, den ersten poetischen Eingebungen über das Entwerfen und schließlich das Schreiben von Gedichten wird aus der Sicht des Autors Norbert Hummelt und der des Lektors Klaus Siblewski auf alle wichtigen Aspekte eingegangen, die beim Schreiben von Gedichten eine entscheidende Rolle spielen. Dieses Buch ist das erste in seiner Art zu einem Thema, das nicht nur Autoren interessiert, sondern alle Literatur- und Lyrikliebhaber.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2010
0,0
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Wie Gedichte entstehen – Teil 1
I. DER EINFALL
Ursprünge
Theorien der Eingebung
Wege zum Gedicht
II. DAS GEDICHT
Der erste Vers
Aufschreiben
Schreibgeräte, Korrekturen
Das Schriftbild
Ausgraben
Stil
Lektorat
Zitate, Lektüren
Vollendung
III. DER GEDICHTBAND
Debut
Komposition
Gesamtkunstwerk
Ankommen
Lesungen
Weitermachen
Ende und Anfang
Epilog
Wie Gedichte entstehen – Teil 2
I. DER EINFALL
Abschied
Lauter Enden
Schreiben wollen
Soziale Räume
Der Anfang
Der Einfall
Kreativität
Biographisches
Rekonstruieren, Konstruieren
Klären
Der Autor wird zum Autor des Gedichts
II. DAS GEDICHT
Wenn der Rückzug einsetzt
Weiterarbeiten
Die Stellung der Lektoren
Anreichern von Texten
Selbstwahrnehmung
In der Community der Dichter
Versionen
Endfassungen
Der Lektor
III. DER GEDICHTBAND
Publizieren
Die langsame Annäherung an das Publikum
Kleiner oder großer Verlag
Der Lektor in Aktion
Bücher erfinden
Zusammenarbeit
Lebensführung
Das Ende
Copyright
VORWORT
Gedichte stehen am Anfang aller Literatur. Ihr Ursprung liegt im Ritus, und bis heute kann man ihnen anmerken, dass sie aus Gesängen und Zauberformeln hervorgegangen sind. Die meisten Menschen lernen Gedichte schon in früher Kindheit kennen, als Wiegenlied oder Abzählreim. In der Pubertät versucht sich fast jeder selbst einmal an einem solchen Gebilde, später tritt diese Beschäftigung zurück, und wenn man sich in einer Buchhandlung umschaut, kann man die Lyrik glatt übersehen. Doch trotz der marginalen Lage dieser Gattung auf dem Buchmarkt werden Gedichte auch heute noch in großer Zahl und Vielfalt geschrieben. Unter künstlerischen Gesichtspunkten ist die Situation der deutschsprachigen Lyrik gerade zur Zeit sogar ausgesprochen interessant. In Literaturzeitschriften finden erregte Debatten statt, welche Schreibweise heute angemessen ist, und dabei herrscht an ästhetischen Grundsatzerklärungen kein Mangel. Anthologien, die eine neue Autorengeneration vorstellen, gibt es ebenso wie Lehrbücher, die das klassische Repertoire der Vers- und Strophenformen erklären.
Eine wichtige Frage aber ist bislang merkwürdig unterbelichtet: wie Gedichte eigentlich entstehen. Selbst in Poetikvorlesungen bedeutender Autoren wird sie kaum berührt. Das könnte daran liegen, dass es zwei sehr unterschiedliche Grundannahmen gibt, die sich kaum miteinander vertragen: auf der einen Seite die sogenannte Genie-Ästhetik, die das Gedicht als rätselhaften Wurf ansieht, dem man sich mit analytischen Fragen gar nicht nahen darf. Auf der anderen Seite die Vorstellung, dass sich alle Kunst auf kalkuliert eingesetztes Handwerk zurückführen lässt. Beide Annahmen greifen jedoch zu kurz, und so fehlt es bis heute an einer grundsätzlichen und zugleich praxisnahen Darstellung und Reflexion des Vorgangs, in dessen Verlauf Gedichte aus dem Kopf eines Autors auf ein Blatt Papier und in ein Buch gelangen.
Das vorliegende Buch versucht, diese Lücke zu schließen, indem es aus zwei verschiedenen Perspektiven die Entstehung von Gedichten beleuchtet: aus der Sicht eines Lyrikers und der eines Lektors. Beide arbeiten seit zwölf Jahren zusammen und stehen seither in einem intensiven Gespräch. Während der Lyriker die eigene Erfahrung des Schreibens zur Grundlage seiner Überlegungen über das Entstehen von Gedichten nimmt, bildet für den Lektor am anderen Ende des Schreibtischs die Arbeit mit den verschiedensten Autoren, deren Gedichtbände er im Verlag ermöglicht und begleitet hat, den Ausgangspunkt seiner Darstellung.
Dabei wird das Entstehen von Gedichten in drei Phasen erfasst, die jeweils ausführlich erörtert werden: der Einfall – das Gedicht – der Gedichtband. Die Phasen bedingen und durchdringen einander, aber jede dieser Phasen hat ihre eigenen Problemstellungen. So wird die Frage, wie ein Lyriker eigentlich zu seinen Einfällen kommt, zwar häufig und gerade im Anschluss an Lesungen immer wieder gestellt, aber fast immer nur salomonisch beantwortet, da die meisten Lyriker darauf bedacht sind, ihre Betriebsgeheimnisse zu hüten. Ziel der Darstellung dieser ersten Phase ist es, die anspruchsvollen Theorien, die zur Frage der Eingebung existieren, an die tatsächliche Schreibpraxis rückzubinden. Wann und wie diese Einfälle notiert werden, auf welchen Schreibgeräten erste Entwürfe entstehen, wie diese korrigiert und am Ende in eine Reinschrift überführt werden, gehört zur zweiten Phase, dem eigentlichen Schreibprozess. Und letztlich wird ein besonders wenig beachteter Arbeitsschritt ebenso ausführlich beleuchtet: wie aus lauter Einzelstücken ein Gedichtband komponiert wird, wie er seinen Platz in einem Verlagsprogramm findet und so am Ende zu den Lesern von Gedichten gelangt.
Da der an diesem Buch beteiligte Lyriker Gedichte schreibt, in denen autobiographische Motive eine Rolle spielen, und er überdies der Meinung ist, dass Leben und Schreiben zusammengehören, sind in seine Darstellung einige zufällige, für sein Schreiben jedoch folgenreiche biographische Aspekte eingeflossen; mit dem Gedanken, dass Übertragbarkeit nicht aus Verallgemeinerung, sondern aus Konkretion erwächst. Deshalb wird auch die Frage gestellt, wie man überhaupt dazu kommt, Gedichte zu schreiben und sich ihnen dauerhaft zu widmen. Und so treffen sich Leser und Autoren von Gedichten in der Überzeugung, dass sie sich ein Leben ohne Gedichte weder wünschen noch vorstellen können.
Norbert Hummelt, Klaus SiblewskiBerlin/München, Oktober 2009
Wie Gedichte entstehen – Teil 1
Norbert Hummelt
Er ging langsam und sinnend seine Straße, denn er musste ja einen Vers ersinnen.
Wilhelm Hauff, Das kalte Herz
I. DER EINFALL
Ursprünge
Eines weiß ich merkwürdigerweise immer: wann und wo mir der Einfall zu einem Gedicht gekommen ist. Vielleicht prägt es sich deshalb gut ein, weil mir Einfälle nie am Schreibtisch kommen, sondern unterwegs. Ich vergesse es auch nach Jahren nicht, dabei ist dieses Wissen nutzlos, denn produktiv gemacht werden kann es nicht – die Rückkehr an einen Ort, an dem ich geschrieben habe, erscheint mir zwar manchmal reizvoll, aber dann ist wieder eine andere Stunde, die für nichts garantiert, und der konfuse Lauf der Gedanken, der einmal auf etwas Bestimmtes führte, das ich mir merken konnte oder musste, ist stets und allerorten ein anderer.
An einem Tag im September 2000 fuhr ich abends mit dem Fahrrad durch Köln. Ich kam aus einem Krankenhaus in der Südstadt, wo ich eine Freundin in der Psychiatrie besucht hatte, und war auf dem Weg nach Hause. Sie war Künstlerin und hatte eine bipolare Störung, helfen konnte ich ihr nicht. Ohne schlüssigen Grund kam mir in dieser Stunde ein Scherz meines Vaters in den Sinn, den er gelegentlich zum Besten gab, auf meine Kosten. Er sagte: »Du wirst bestimmt mal Dichter werden, und wenn du Rohrabdichter wirst.« Dass ich tatsächlich einmal Gedichte schreiben und daraus sogar einen Beruf machen würde, hat er nicht mehr erlebt, denn er starb, als ich 16 war. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich genau ein Gedicht geschrieben, von dem ich nicht weiß, ob ich es ihm zeigte und damit vielleicht Anlass zu seinem Spott gab; auch hatte ich lange nicht an dieses Gedicht gedacht, bis ich es eines Tages zwischen alten Heften entdeckte. Mittlerweile ist dieses Gedicht wieder verschwunden, so dass ich langsam Zweifel hege, ob es überhaupt je entstand. Ich sehe es aber genau vor mir, auf einem gelochten DIN-A5-Blatt mit Rechenkästchen, mit Kugelschreiber beschrieben. Es hieß Herbst am Fluß und war in Stabreimen verfasst. Um diese kenntlich zu machen, hatte ich die alliterierenden Anfangsbuchstaben mit Kuli gefettet. Ich erinnere die Zeilen: »Wolken seh nach Westen ich wandern«, »Weit noch ist mein Weg« und »Es nahet die Nacht«. Als ich das schrieb, war ich vielleicht zehn oder elf und las Die Sagen der Germanen, herausgegeben von Edmund Mudrak. Dort fand ich die folgenden Verse aus der Edda, die mich zweifellos zu meinem ersten Gedicht anregten: »Urzeit war es, / da nichts noch war: / Nicht war Sand noch See / noch Salzwogen, / nicht Erde unten, / noch oben Himmel. / Gähnung grundlos, / doch Gras nirgends.« Am Anfang war also der Nachahmungstrieb, die wichtigste Voraussetzung für jede Kunstanstrengung, wenn auch meinem ersten Versuch lange kein weiterer folgte. Es ist aber gut möglich, dass die Verse aus dem Altisländischen, ein Gesang von der Erschaffung der Welt, meine erste Begegnung mit schriftlich fixierter Lyrik überhaupt waren.
Lyrik wurde bei uns zu Hause nicht gelesen, dennoch umgaben mich Gedichte in Form von Liedern und Gebeten, Letztere bekam ich täglich zu Gehör und lernte sie mitzusprechen, lange bevor ich sie verstand. Vor warmen Mahlzeiten beteten wir Aller Augen warten auf dich, nach dem Essen eine kleine Litanei, bestehend aus einem Dankgebet, einem Ave Maria und einer Fürbitte für die Toten. Die Litanei konnte aber verkürzt werden, wenn es schnell gehen musste, und in Fällen großer Eile pflegte mein Vater sie durch ein bündiges »Gut geschmeckt, lecker geschmeckt, Amen« zu ersetzen. Der einzige Lyriker, den er im Munde führte, war Wilhelm Busch, denn wann immer es passte oder nicht, warf er – recht frei nach Busch – ein »Kaum war diese Tat geschehen, hörte man auch schon ein Krähen« in die Runde. Der gereimte Zweizeiler war die ihm gemäße Ausdrucksform, er produzierte Zweizeiler auch selbst, im Spazierengehen, wenn wir eine Viehweide passierten: »Guten Tag, ihr Kühe, gebt euch keine Mühe.« Das aufzuschreiben wäre ihm nie in den Sinn gekommen, er hatte es ja im Kopf, und so existierten auch die Lieder, die zu meiner Kindheit gehörten, nur mündlich und auswendig. Sie waren da wie Naturdinge, über deren Entstehung man nicht nachdenken muss. Als ich dann lesen konnte und während der Messe das Gesangbuch studierte, fiel mir auf, dass unter jedem Lied die Urheber von Text und Melodie genannt wurden, und es ergab sich, dass einige der Lieder, die mir am besten gefielen, sogar vom selben Dichter herrührten, nämlich von Friedrich Spee. Dass aber auch viele der Lieder, die wir beim Wandern sangen, nicht anonyme Früchte vom Baum der Überlieferung, sondern von Dichtern bewusst und mit Kunst verfasste Gebilde waren, konnte ich erst später recherchieren. Und weiß so, dass jenes Heut’ noch sind wir hier zu Haus, morgen geht’s zum Tor hinaus, das meine Mutter auf jedem Gang anstimmte, nicht immer schon da war, sondern von Hoffmann von Fallersleben stammt.
Nach meinem ersten Gedicht wechselte ich in die erzählende Prosa, aber nur kurz. Mit etwa zwölf plante ich, Reiseerzählungen im Stil von Karl May zu schreiben, und legte dafür ein Werkverzeichnis an. Es entstand jedoch nur eine einzige kurze Erzählung, deren Held Old Knife hieß und die mit dem Satz begann: »Wer schon einmal droben in Montana gewesen ist, kennt auch den Yellowstone River.« Danach wechselte ich in den Sportjournalismus, in dem ich weit größere Ausdauer bewies, denn von meinem 13. Lebensjahr an gab ich sechs Jahre lang das Neusser Tipp-Echo heraus. Es war das meist aus zwei eng betippten DIN-A4-Seiten bestehende Mitteilungsblatt eines Clubs, in dem nach einem von mir erdachten System alle aktuellen Fußballspiele getippt werden mussten, und enthielt neben der Tipp-Tabelle meine Leitartikel zur Bundesliga und Nationalmannschaft. Diese Artikel las mein Vater alle, denn er musste sie auf dem Büro fotokopieren, und ich vermute, dass es diese Texte waren, die seinen auf mich gemünzten Dichter-Scherz inspirierten. Er selbst hatte beruflich deutlich mehr mit Rohrabdichtern als mit Literaten zu tun. Als Angestellter einer Wohnungsgenossenschaft war er für die Aufträge an die Handwerker zuständig. 1938 hatte er seine kaufmännische Lehre bei dieser Genossenschaft begonnen, nach nur acht Jahren Volksschule. Der Hitlerjugend gehörte er nicht an. Das wesentliche Bildungserlebnis seiner Jugend war sein Dienst als Ministrant. Er lernte die lateinischen Messtexte sprechen, ohne sie zu verstehen, aber das musste er auch nicht, weil er die rituellen Handlungen sehen konnte, die von den Worten begleitet oder bewirkt wurden. Im Krieg war er Funker an der Ostfront und kam bis auf die Krim. Seinen Feldpostbriefen kann ich entnehmen, dass er von seinem Wehrsold Bücher kaufte, die er nach Hause schickte, damit seine Mutter sie für ihn aufbewahrte. Zu seinen Lektüren dieser Zeit gehört eine umfangreiche Monographie über den Apostel Paulus. Er legte so den Grundstock für seine kleine Bibliothek, die das geistige Klima meiner Kindheit prägte, wenn ich von den Büchern auch lange Zeit nur die Rücken sah. Es waren theologische und zeitgeschichtliche Werke, aber auch Belletristik war dabei wie die Erzählungen des flämischen Dichters Felix Timmermans, die er mir vorlas; manches von Heinrich Böll, Edzard Schaper, Peter Bamm oder Pearl S. Buck. Einige dieser Bücher las ich nach seinem Tod und sie beschäftigen mich bis heute, wie Reinhold Schneiders Essaysammlung Macht und Gnade oder die Schriften des Religionsphilosophen Romano Guardini. Dazwischen nur ein einziger schmaler Lyrikband, Gertrud von Le Forts Hymnen an die Kirche, von dem mir meine Mutter einmal sagte, mein Vater habe das gemocht, sie selbst aber habe es furchtbar gefunden.
Da mein Vater zu früh starb, um meine Berufswahl beeinflussen zu können, frage ich mich bis heute, was er von meinen Gedichten halten würde, erst recht von denen, die seinem Leben und meinen Erinnerungen an ihn gelten. Manchmal denke ich, dass ich gar nicht auf das Schreiben von Gedichten verfallen wäre, wenn er länger gelebt hätte, aber das ist, wie jede Vermutung über die Gründe des Schreibens, reine Spekulation. Ganz sicher aber hat sein Tod und der Umstand, dass ich ihn bis heute vermisse, mein Verständnis dessen geformt, was ein Gedicht können sollte: Es soll das Abgesunkene und das Vergangene, das weit Entfernte und das Verlorene wieder heranholen und gegenwärtig machen, in den sinnlichen Formen von Bild und Klang. Es soll auch das immer nur im Augenblick Gegenwärtige, die Menschen und die Dinge, die Luft und das Licht, Gedanken und Gefühle in Worte verwandeln und sie so im Bewusstsein dauerhaft anwesend halten, wenn auch hinter der Glasscheibe der Sprache, wenn auch nur für die Dauer des Gedichts, die sehr kurz und sehr lang sein kann, je nachdem, ob man es nur liest oder es auch im Kopf behält, vielleicht für immer. Es dauerte nach seinem Tod jedoch sieben Jahre, bis ich wirklich mit dem Schreiben begann, weitere sechs, bis ich erstmals in Gedichten auf seinen Tod und dann auf sein Leben und auf mein eigenes zu sprechen kommen konnte, und bis zu jenem Septemberabend, als ich auf dem Fahrrad durch Köln fuhr und mir sein Spruch über Dichter und Rohrabdichter wieder einfiel, gingen weitere acht Jahre ins Land. Der flüchtige Gedanke wäre allerdings an der nächsten Straßenecke schon verpufft gewesen, wenn ich nicht plötzlich eine gereimte Antwort auf seinen Scherz im Kopf gehabt hätte. »Du wirst bestimmt mal Dichter werden, und wenn du Rohrabdichter wirst: So sprach zu mir mein Vater, dieser Dichterfürst.« Das allein war zwar noch kein Gedicht, aber es bewirkte sofort, dass ich die mich belastenden Eindrücke aus der Psychiatrie abschütteln und meine Gedanken auf meinen Vater fokussieren konnte. Und dann sah ich ihn vor mir für einen Augenblick, wie er in einem seiner karierten Hemden, in Cordhose und grauem Sakko die Wohnung verließ, um im Kiosk am Bahndamm Zigaretten zu holen, Ernte 23, die er seit dem Krieg rauchte, bis ihn ein erster Herzinfarkt davon abbrachte. Dieses Bild war wieder da in meinem Kopf, vollkommen plastisch, als sei es niemals weg gewesen. Eine Epiphanie, und als ich das Fahrrad im Hof abschloss, war das kurze Gedicht, das sie bannen sollte, bereits fertig, ich musste es nur noch aufschreiben.
aus der kindheit1
»du wirst bestimmt mal dichter werden u. wenn du rohrabdichter wirst«, so sprach zu mir mein vater, dieser dichterfürst u. ging zum büdchen zigaretten holen u. für mich einfacheiscreme in stanniolpapier.
Mit diesem kurzen Gedicht gelang es mir, eine über zwei Monate währende Schreibblockade zu brechen, die nach der Fertigstellung eines wesentlich längeren Gedichts, der 225 Zeilen umfassenden Verserzählung früchte, im verregneten Sommer des Jahres 2000 eingetreten war. Das Schreiben und Datieren dieses Gedichts bewirkte außerdem, dass ich mir diesen Tag – es war der 14. September – überhaupt einprägen konnte, denn Tagebuch habe ich niemals geführt. Wie es aber letztlich kam, dass ich in dieser Stunde und in keiner anderen dieses weit zurückschauende Gedicht schreiben konnte, dessen Stoff bereits seit über 20 Jahren fertig für mich bereitlag, blieb vollkommen unerfindlich. Was zählt, ist der gelebte Augenblick, den das Gedicht verewigt, wenn ich aufhöre, sein Autor zu sein, und beginne, sein Leser zu werden und es als etwas zu betrachten, das keineswegs von mir ist, sondern schon immer da gewesen zu sein scheint, eine Postkarte, ein Foto, ein Brief, der nur verlegt war. Zuerst aber zählt auch das nicht, sondern allein die innere Sammlung, die durch das Einsetzen des Schreibens sofort bewirkt wird, und die sich daran anschließende Euphorie, die die konzentrierte Arbeit am Gedicht verschafft, wenn sich die Möglichkeit des Gelingens abzeichnet. Wenn es stimmt, was George Steiner schreibt, dass Denken traurig macht, weil es flüchtig, unbegrenzt und nicht fassbar bleibt, dann macht Dichten glücklich, weil es das Flüchtige in eine Form bannt, die alles nicht in ihr Erfasste ausschließt. Und wenn ich selbst derjenige bin, der diese Form erschafft, dann ist das, für Sekunden, ein Allmachtsgefühl. Die Freude des Lesers mag lang sein, die des Schreibenden ist deutlich begrenzt, sie hält nur wenig länger als der eigentliche Schreibprozess an und endet, wenn das flüchtige Denken wieder einsetzt. Das Schreiben von Gedichten wirkt wie keine andere mir bekannte geistige Tätigkeit entlastend und befreiend für eine kurze Spanne Zeit, bis die Flüchtigkeit von neuem Raum greift, in Köln, im September, im Kopf und überall.
Theorien der Eingebung
Der zündende Einfall, der das Schreiben eines Gedichts in Gang setzt, kommt für mich immer überraschend. Ihm vorzugreifen durch planmäßiges Vorgehen bedeutet Unglück, und dieses Unglück tritt in Form von Gedichten ein, die ich besser nicht geschrieben hätte. Es fehlt ihnen das Lebendige, ein Glanz oder auch nur ein Schimmer, der nicht mutwillig erzeugt werden kann, sondern sich der Gnadengabe verdankt, die man Eingebung oder Einfall nennt. Dieser Einfall ist nur der Auslöser, aber ohne ihn geht nichts, und wenn er ausbleibt, bin ich als Lyriker zur Untätigkeit verdammt. Diese Untätigkeit kann, wenn sie länger anhält, zu großer Niedergeschlagenheit führen, und das ist der Grund, warum sich Lyriker wie auch andere Künstler mit dieser Abhängigkeit vom Unverfügbaren schwertun, und so sehr sie auch davon überzeugt sein mögen, dass sich ihr Werk der Planbarkeit entzieht, werden sie immer wieder auf Möglichkeiten sinnen, diese schwer begreifliche, aber deutlich fühlbare Gesetzmäßigkeit zu durchkreuzen. Oder sie überhäufen sich mit Arbeiten anderer Art, um die Leere nicht zu fühlen, die das Ausbleiben des Einfalls aufreißt. Und gerade dann, wenn sie von Ansprüchen, die vielleicht ihr bürgerlicher Beruf oder ihr Privatleben an sie stellt, sich nahezu erdrückt fühlen, kann es geschehen, dass das Gedicht mit großer Macht sein Recht fordert, nämlich die ausschließliche Aufmerksamkeit des Schreibenden, der dann für die Dauer seines Schaffens nicht mehr ansprechbar ist und somit für die menschliche Gemeinschaft nicht mehr taugt.
Gottfried Benn beschreibt die Entstehung seines frühen Zyklus Morgue als jähen Vorgang, der in einer ärztlichen Stresssituation einsetzt. »Als ich die Morgue schrieb, mit der ich begann, (…) war es abends, ich wohnte im Nordwesten von Berlin und hatte im Moabiter Krankenhaus einen Sektionskurs gehabt. Es war ein Zyklus aus sechs Gedichten, die alle in der gleichen Stunde aufstiegen, sich herauswarfen, da waren, vorher war nichts von ihnen da; als der Dämmerzustand endete, war ich leer, hungernd, taumelnd und stieg schwierig hervor aus dem großen Verfall.«
2
Dass man auch selbst Gedichte schreiben könne, darauf sei er nie gekommen, sagte mir einmal mein Onkel, als ich ihn nach einem Besuch bei mir in Köln zur S-Bahn brachte. Ich schloss daraus, dass er diese Tätigkeit nicht von vornherein verwerflich fand, und fast klang so etwas wie Trauer über eine ungelebte Möglichkeit in seinen Worten an. Mein Onkel war nach dem Tod meines Vaters der einzige ältere Mann in der Familie, und er nahm an meinem Weg in die freie Existenz des Schreibens einen gewissen Anteil, wenn er es auch lieber gesehen hätte, dass ich Lehrer geworden wäre, diesen Beruf übte er nämlich selbst aus. Er interessierte sich vor allem für die Zeitungsartikel, die ich schrieb, las aber auch in meinen Gedichten und fand zumindest eines richtig gut, das bukolische sonett, in dem sich alle vierzehn Zeilen auf -achte reimen. Er schenkte mir einmal einen Band von Ringelnatz und hätte es wahrscheinlich gut gefunden, wenn ich insgesamt eher in die humoristische Richtung gegangen wäre. Dass ich es nach seinem Tod in einigen Gedichten unternommen habe, seinen Schatten zu beschwören, wäre ihm vermutlich unheimlich gewesen. Er fehlte mir jedoch, und ich hatte das Gefühl, dass unser Gespräch gerade erst begonnen hatte in dem Moment, als es für immer abriss. Aus seinem Nachlass durfte ich mir ein paar Bücher aussuchen, und ich war sehr überrascht, dass ich dabei ein Reclam-Heft mit den Gedichten Stefan Georges entdeckte. Ich wusste nicht, dass er einmal George gelesen hatte, und hätte mich gern mit ihm darüber ausgetauscht, so wie ich auch mit meinem Großvater gern über Eichendorff gesprochen hätte, doch er starb wenige Wochen nach meiner Geburt.
Von dieser Seite, der mütterlichen, mag eine gewisse Offenheit gegenüber dem Lyrischen angelegt sein. Aus den Büchern meines Großvaters kamen zwei Bände Eichendorff auf mich, eine Gedichtauswahl und ein Novellenband. Die Neigung zur romantischen Melancholie wurde von meiner Mutter geteilt, jedoch zum Unwillen meiner Großmutter. In einer Szene, von der ich nicht mehr weiß, inwieweit meine Mutter sie mir so erzählte und inwieweit sie meiner Phantasie entsprang, denn sie fand Eingang in das Gedicht margueriten, sehe ich meine Mutter in der Küche der großelterlichen Wohnung am Bügelbrett stehen, sie singt dabei In einem kühlen Grunde, da geht ein Mühlenrad, wohl ohne zu wissen, dass dieses von Friedrich Silcher vertonte Lied auf ein Eichendorff-Gedicht zurückgeht, und wird von ihrer Mutter gebeten, dieses Singen sein zu lassen oder nicht immer nur so traurige Lieder zu singen, in diesem Moment gehen die Sirenen, sie packen die Koffer und eilen zum Bunker, es ist Fliegeralarm. Während mein Vater seine Fronterlebnisse auf lustige Anekdoten verkürzte und ich nur von meiner Mutter weiß, dass er bis zu seinem Tod vom Krieg träumte, hat meine Mutter mir häufig vom Luftkrieg berichtet. Wenn wir im Hunsrück wanderten, wo wir oft in meiner Kindheit Ferien machten, lösten die Überschallflüge der dort stationierten Amerikaner bei meinen Eltern stets die sofortige Erinnerung an den Krieg aus, so dass ich nach und nach das Gefühl bekam, die Bombennächte sogar selbst noch miterlebt zu haben. So bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass dieser Kriegshintergrund, der im Erzählen wie im Verschweigen zu meiner Kindheit gehörte, für mein Schreiben eine Rolle spielt.
Vielleicht ist die Faszination, die enge, dunkle Behausungen auf mich ausüben, eine erblich bedingte Bunkererinnerung. Oder es sind frühkindliche Bilder, Eindrücke aus den Zimmern, die ich zuallererst erblickte; manchmal fällt ein Strahl Erinnerung auf sie, so dass ich sie kurz wiedersehen kann, und die Gedichte spüren ihnen umso länger nach. Der englische Dichter Ted Hughes führt sein Schreiben auf einen Eindruck zurück, der ebenfalls von Enge und Düsternis geprägt ist: »Der eindrucksvollste Gefährte meiner frühen Kindheit war eine düstere Felswand oder das, was wie eine düstere Felswand aussah, in südlicher Richtung von unserem Haus; eine Mauer aus Stein, an der steil der Wald emporkroch und den halben Himmel ausfüllte, so dass im Winter die Sonne gerade noch darüber hinwegkam. Das war das memento mori meiner Geburt: meine spirituelle Hebamme und seither mein Pate – oder einer meiner Paten. Seit meinem ersten Lebenstag beobachtete sie mich. Wenn sie mich nicht direkt sehen konnte, als aufragende Düsternis über meinem Kinderwagen, beobachtete sie mich durch eine Art Periskop und durchsetzte sogar das Licht in meinem Zimmer mit ihrem besonderen Schatten.«
3
Meine spirituelle Hebamme ist der Ort, den ich öfter als jeden anderen in Gedichten aufsuche: die großelterliche Wohnung, in die meine Mutter mich als Säugling mitnahm, als sie an einer Wochenbettdepression litt; zwei Zimmer mit Wohnküche, in der wir jeden Sonntag zum Kaffeetrinken erwartet wurden. Ihre Wände waren mit alten Stichen und zahllosen Kalendern zugedeckt, die nicht regelmäßig abgerissen wurden, dazwischen hingen Wand-uhren, von denen keine richtig ging, sie schlugen zu allen möglichen Zeiten, und wenn einmal nicht geredet wurde, waren die Bewegungen des Kanarienvogels vernehmbar, der von einer Stange zur anderen hüpfte. Dort fühlte ich mich zugleich geborgen und verloren, ein ambivalentes Gefühl, das dem Schreiben von Gedichten förderlich ist. Den Kreis der frühen Bilder immer wieder abzuschreiten, einem rilkeschen Panther gleich, der die Stäbe abgehen muss, die ihn einschließen, ist eine der Reisen, auf die mich das Dichten geschickt hat.
Wie ich aber letztlich aufs Gedichteschreiben gekommen bin, darauf konnte ich meinem Onkel keine vernünftige Antwort geben. Ich konnte ihm nicht von einem Initiationserlebnis berichten, wie Friederike Mayröcker es für sich geschildert hat, die zu Pfingsten 1939 einen brennenden Dornbusch sah, sich bei diesem Dornbusch niedersetzte und in seinem Schatten ihr erstes Gedicht schrieb. In einem brennenden Dornbusch am Berge Horeb offenbarte sich Gott dem Mose und teilte ihm seinen geheimen Namen mit. Am Pfingsttag kam in Jerusalem der Heilige Geist in Form von Feuerzungen über die versammelte Gemeinde, wie in der Apostelgeschichte erzählt wird: »Da entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, gleich dem eines daherfahrenden heftigen Windes, und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Es erschienen ihnen zerteilte Zungen, wie von Feuer, und als sich je eine auf jeden einzelnen von ihnen niederließ, wurden alle vom Heiligen Geiste erfüllt und fingen an, in verschiedenen Sprachen zu sprechen, so wie der Geist ihnen eingab, zu reden.«
4
Die
Apostel waren nunmehr Sprachbegabte und Begeisterte, sie waren ein für allemal inspiriert und konnten so das Wort Gottes zu allen Völkern bringen.
Der Gedanke, dass sich die Inspiration göttlichen Quellen verdankt, begegnet bereits Platon. Im »heiligen Wahn«, der mit Gewalt den Sänger ergreift, wie Hölderlin in Brod und Wein beschreibt, wird der gewöhnliche Zustand des Menschen aufgehoben. Die Lehre von der göttlichen Eingebung der Schrift war seit dem Mittelalter eine Domäne der Theologen und lange allein auf die Bibel bezogen. Spätestens im Barock scheint sich eine Ausweitung dieses Gedankens auf die geistliche Dichtung ereignet zu haben, wie eine Liedstrophe von Tobias Clausnitzer zeigt: »Unser Wissen und Verstand ist mit Finsternis umhüllet, wo nicht Deines Geistes Hand uns mit hellem Licht erfüllet; gutes Denken, Tun und Dichten musst Du selbst in uns verrichten.« Das selbstbewusste Gegenprogramm zu diesem demütigen Einverständnis mit der Unverfügbarkeit der himmlischen Gaben formuliert Goethe im Prometheus. Prometheus hat den Göttern das heilige Feuer entwendet und sich damit die Verfügungsgewalt über das Schöpferische, den göttlichen Funken, verschafft. Wenn er auch zur Strafe dafür an den kaukasischen Felsen gefesselt wurde, wo ein Adler täglich seine Eingeweide fraß: Der Gedanke, Menschen formen zu können nach dem eigenen Bilde und nicht mehr von den Ratschlüssen der Götter abhängig zu sein, war ein für allemal in der Welt. Goethes frühe Erlebnisgedichte zeigen dabei einen ganz neuen Weg, woher der Dichter die Einfälle nehmen kann: aus den Tiefen des eigenen, erregbaren Gemüts, das von der größten Lust bis zur tiefsten Niedergeschlagenheit alle Stufen der Existenz in sich birgt. Allerdings bedarf es einer unbestellbaren Reizung von außen, um diese schöpferischen Erregungszustände zu erzeugen. Goethe hatte kein Problem damit, dass solche Augenblicke geschenkt sein mussten, denn er war zeitlebens mit Einfällen gesegnet. Seinem unverkrampften Schaffensdrang steht Schiller als Typus eines Dichters gegenüber, der die Eingebung mit dem Willen zwingen will. Thomas Mann hat diesen Gegensatz in seiner Erzählung Schwere Stunde deutlich ausgemalt: Während Schiller in Jena Nacht um Nacht verquält um die Vollendung des Wallenstein ringt, schickt er manchen neidischen Gedanken nach Weimar hinüber, wo dem Kollegen Goethe die Einfälle nur so in den Schoß fallen. Dieser Gegensatz ist natürlich überspitzt. Bis zu einem gewissen Grad gehören beide Momente, das Intuitive und das Konstruktive, zu jedem Autor und zu fast jedem schöpferischen Akt, nur in sehr unterschiedlichen Mischungsverhältnissen.
Selten behauptet ein Dichter, die völlige Kontrolle über sein Werk auszuüben, vom ersten Gedanken bis zur letzten Feinheit. Ein solcher Fall ist Edgar Allan Poe. In seiner Schrift The Philosophy of Composition legt er am Beispiel des Gedichts The Raven dar, »dass sich kein einziger Punkt in seiner Komposition auf Zufall oder Intuition zurückführen lässt: dass das Werk Schritt um Schritt mit der Präzision und strengen Folgerichtigkeit eines mathematischen Problems seiner Vollendung entgegenging«.
5
Nichts am Gedicht ist persönlicher Ausdruck oder innere Notwendigkeit, alles ist auf die Wirkung auf den Leser ausgerichtet. Diese soll eine Stimmung erhabener Trauer sein, weil so die von jedem Gedicht angestrebte Schönheit am besten erreicht werden kann: »Schönheit jeglicher Art bewegt in ihrer höchsten Entfaltung die empfindsame Seele unvermeidlich zu Tränen. Melancholie ist daher die rechtmäßigste aller poetischen Tonarten.«
6
Poe stellt dar, wie er jeden Schritt in der Komposition auf diesen Effekt abstellt, von der Wahl des Themas (Vergänglichkeit) über die Entscheidung für das Motiv des Raben bis zum Refrain und jenem einen Wort, das der Rabe spricht, und das die Essenz reiner Vergeblichkeit, wie er meint, am besten ausdrückt: nevermore. Sogar die ideale Länge von 100 Versen sei Vorausberechnung gewesen. Nun ist es interessant, dass Poe zu der Zeit, als er das schrieb, gerade versuchte, vom Alkohol loszukommen, und das Bedürfnis, alles in der Hand zu haben, war für ihn zweifellos elementar. Die meisten Autoren von Gedichten machen eine solche Erfahrung uneingeschränkter Kontrolle über ihr Schaffen jedoch nicht, zumindest erstreckt sie sich nicht auf den allerersten Moment der Initiation. Die späte Lyrik von Ernst Jandl ist ein Beispiel dafür, welche Ausmaße die Not des Wartens auf den Einfall annehmen kann, denn von kaum etwas sprechen diese Gedichte so oft wie vom Horror vor dem weißen Blatt: »wie oft-oft / sein ich gesessen vorn vom / weißen papieren und nicht / gefüllen sich haben mit lettern und wörtern den / weißen papieren sondern weißen geblieben es sein.«
7
Je heftiger man aber nach der Muse verlangt, um so mehr entzieht sie sich: »um ein gedicht zu machen / habe ich nichts // eine ganze sprache / ein ganzes leben / ein ganzes denken / ein ganzes erinnern // um ein gedicht zu machen / habe ich nichts«
8
, bekennt Jandl. Auch wenn niemand mehr an das Eingreifen höherer Mächte glaubt und die Ursachen der Unverfügbarkeit im Inneren des Menschen, in den Wirkungen des Unbewussten, vermutet werden, bleibt das Moment des Absichtslosen eine unverrückbare Bedingung alles Schöpferischen: Es überkommt den Dichter ohne jede Berechnung. Marcel Proust hat dafür den Begriff der unwillkürlichen Erinnerung gefunden. Die bekannte Szene aus seinem Roman Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, in der der Erzähler zufällig eine Madeleine in eine Tasse Lindenblütentee tunkt und aus diesem Geschmackserlebnis die Welt seiner Kindheit in tausend Einzelheiten und den ganzen Kosmos seines Werkes aufsteigen sieht, ist eine Schlüsselerzählung über den Vorgang der Inspiration: Sie überkommt den Dichter in einer Fülle, gegen die er sich gar nicht wehren kann, aber gerade auf solche Momente baut er seine literarische Strategie – er schöpft die Bilder aus, die ihm auf diesem Weg zuteil werden.
ENDE DER LESEPROBE
Ästhetik des Schreibens, Band 4, herausgegeben von Hanns-Josef Ortheil
1. Auflage
Originalausgabe
© 2009 Luchterhand Literaturverlag GmbH, München
In der Verlagsgruppe Random House GmbH
eISBN : 978-3-641-03759-8V002
www.luchterhand-literaturverlag.de
www.randomhouse.de