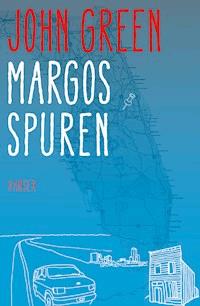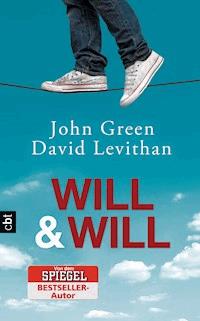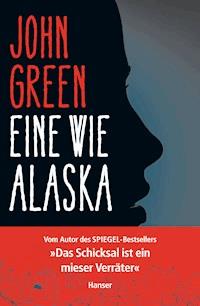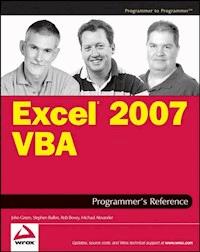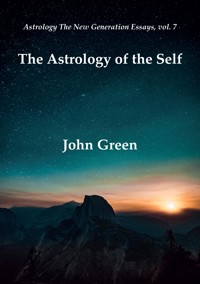Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Das erste Sachbuch des Bestsellerautors John Green: die Menschheitsgeschichte von Tastaturen über Hotdogs bis zur Schönheit des Sonnenuntergangs in der Review. John Green verbindet sein eigenes Leben mit den großen Fragen der Menschheit: Was hat ein Teddybär mit Macht und Ohnmacht zu tun oder das Googeln mit unserer Endlichkeit? Mit seinem Blick für Seltsames, Wichtiges und Überraschendes bewertet John Green die menschengemachte Gegenwart auf einer Skala von 1 bis 5. Das Anthropozän ist das aktuelle Erdzeitalter, in dem wir den Planeten grundlegend verändern. John Green versammelt Facetten dieser Epoche: Seine absurden, erhellenden und ganz persönlichen Funde spiegeln unser Leben mit allen Höhen und Tiefen. Ob „Monopoly“ oder Pest, Klimaanlage oder Internet, „Super Mario Kart“ oder Sonnenuntergänge – „Wie hat Ihnen das Anthropozän bis jetzt gefallen?“ erzählt mit großer Leichtigkeit von unserer Lebenswirklichkeit und den existentiellen Erfahrungen des Menschseins.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 412
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Das erste Sachbuch des Bestsellerautors John Green: die Menschheitsgeschichte von Tastaturen über Hotdogs bis zur Schönheit des Sonnenuntergangs in der Review.John Green verbindet sein eigenes Leben mit den großen Fragen der Menschheit: Was hat ein Teddybär mit Macht und Ohnmacht zu tun oder das Googeln mit unserer Endlichkeit? Mit seinem Blick für Seltsames, Wichtiges und Überraschendes bewertet John Green die menschengemachte Gegenwart auf einer Skala von 1 bis 5. Das Anthropozän ist das aktuelle Erdzeitalter, in dem wir den Planeten grundlegend verändern. John Green versammelt Facetten dieser Epoche: Seine absurden, erhellenden und ganz persönlichen Funde spiegeln unser Leben mit allen Höhen und Tiefen. Ob »Monopoly« oder Pest, Klimaanlage oder Internet, »Super Mario Kart« oder Sonnenuntergänge — »Wie hat Ihnen das Anthropozän bis jetzt gefallen?« erzählt mit großer Leichtigkeit von unserer Lebenswirklichkeit und den existentiellen Erfahrungen des Menschseins.
John Green
Wie hat Ihnen das Anthropozän bis jetzt gefallen?
Notizen zum Leben auf der Erde
Aus dem Englischen von Henning Dedekind, Friedrich Pflüger, Wolfram Ströle und Violeta Georgieva Topalova
Carl Hanser Verlag
Inhalt
Wie hat Ihnen das Anthropozän bis jetzt gefallen?
Einleitung
»You’ll never walk alone«
Die zeitliche Verbreitung der Menschheit
Der Halleysche Komet
Unsere Fähigkeit zu staunen
Die Höhlenmalereien von Lascaux
Duftsticker
Diet Dr Pepper
Velociraptoren
Kanadagänse
Teddybären
Die Hall of Presidents
Klimaanlagen
Staphylococcus Aureus
Das Internet
Academic Decathlon
Sonnenuntergänge
Jerzy Dudeks sportliche Leistung am 25. Mai 2005
Die Pinguine aus Madagaskar
Piggly Wiggly
Das Hotdog-Wettessen bei Nathan’s Famous
CNN
Mein Freund Harvey
Die Yips
Auld Lang Syne
Fremde googeln
Indianapolis
Kentucky Bluegrass
Das Indianapolis 500
Monopoly
Super Mario Kart
Die Bonneville Salt Flats
Hiroyuki Dois Kreiszeichnungen
Flüstern
Virale Meningitis
Pest
Wintermix
Die Hotdogs von Bæjarins Beztu Pylsur
Die Notizen-App
The Mountain Goats
Die QWERTY-Tastatur
Die größte Farbkugel der Welt
Platanen
»New Partner«
Drei Bauern auf dem Weg zum Tanz
Nachwort
Dank
Anmerkungen
Text- und Bildnachweis
Weitere Titel von John Green
Für meine Freunde, Kollegen und Reisegefährten Rosianna Halse Rojas and Stan Muller
Wie hat Ihnen das Anthropozän bis jetzt gefallen?
Diese Seite ist im Amerikanischen unter Verlegern und Buchbindern als »half-title page« bekannt, auf ihr ist zwar der Buchtitel, aber weder Autorname noch Untertitel abgedruckt. Die »half-title page« erfüllte früher eine wichtige Funktion im Druck- und Bindeprozess, ist aber heutzutage eigentlich nur noch Dekoration. Ich war noch nie ein großer Fan davon. Wenn ich als Leser bis hierher vorgedrungen bin, kenne ich den Buchtitel bereits, und falls ich doch wieder daran erinnert werden müsste, kann ich ihn auf dem Buchcover jederzeit nachlesen. Aber in dieser Zeit des Lesens am Bildschirm sind im Grunde genommen alle Facetten der Buchherstellung anachronistisch, und das Gefühl, Papier zu berühren und gedruckte Schrift zu lesen, liebe ich sehr. Also gebe ich der »half-title page« zweieinhalb Sterne.
Einleitung
Mein Roman Schlaft gut, ihr fiesen Gedanken erschien im Oktober 2017, und ich war danach gleich den ganzen Monat mit dem Buch auf Lesereise. Wieder daheim in Indianapolis bahnte ich einen Weg vom Baumhaus meiner Kinder zu dem kleinen Raum, in dem meine Frau und ich meistens arbeiten; je nach Weltanschauung ist dieser entweder ein Büro oder ein Schuppen.
Es war kein Weg im übertragenen Sinn, sondern wirklich ein Pfad im Wald. Ich rodete Dutzende von baumhohen Heckenkirschen, die in weiten Teilen von Zentral-Indiana immer mehr überhandnehmen, grub den überall wuchernden Efeu aus, streute den Weg mit Rindenmulch und fasste die Kanten mit Backsteinen ein. Ich war tagtäglich zehn oder zwölf Stunden beschäftigt, fünf oder sechs Tage die Woche, einen Monat lang. Als ich schließlich fertig war, stoppte ich, wie lange ich von unserem Büro bis zum Baumhaus brauchte. Achtundfünfzig Sekunden. Ein Waldspaziergang von achtundfünfzig Sekunden hatte mich einen vollen Monat gekostet.
Eine Woche nach der Fertigstellung des Wegs kramte ich in einer Schublade nach einem Labello, als ich plötzlich und ohne Vorwarnung das Gleichgewicht verlor. Die ganze Welt kippte und begann sich zu drehen. Mit einem Mal war ich eine winzige Nussschale auf tosender See. Meine Augen zuckten in den Höhlen und ich musste mich erbrechen. Ich kam ins Krankenhaus, und meine Welt drehte sich noch wochenlang weiter. Schließlich wurde bei mir eine Labyrinthitis festgestellt, eine Entzündung des inneren Ohres mit einem wunderbar klangvollen Namen — trotzdem eindeutig eine Ein-Stern-Erfahrung.
Zur Genesung musste ich wochenlang im Bett bleiben, konnte weder lesen noch fernsehen noch mit meinen Kindern spielen. Mir blieben nur meine Gedanken — mal trieben sie über einen schlaftrunkenen Himmel, dann wieder jagten sie mir mit ihrer Beharrlichkeit und Omnipräsenz wilde Schrecken ein. Während dieser langen, stillen Tage reisten meine Gedanken überallhin und durchstreiften die Vergangenheit.
Die Schriftstellerin Allegra Goodman wurde einmal gefragt: »Wer, finden Sie, sollte Ihre Lebensgeschichte schreiben?« Sie antwortete: »Wie es scheint, schreibe ich sie selbst, aber da ich Romanautorin bin, ist alles verschlüsselt.« Für mich fühlte es sich inzwischen so an, als glaubten mache Leute, sie besäßen den Schlüssel. Sie nahmen an, ich teilte die Weltanschauung der Hauptfiguren eines Buchs, oder sie stellten mir Fragen, so als wäre ich selbst der Protagonist. Ein berühmter Moderator fragte mich im Interview, ob auch ich beim Küssen Panikattacken hätte wie die Erzählerin in Schlaft gut, ihr fiesen Gedanken.
Durch meinen offenen Umgang mit meiner psychischen Erkrankung hatte ich solche Fragen natürlich provoziert, es strengte mich aber immer mehr an, im Zusammenhang mit erdachten Geschichten so viel über mich selbst zu sprechen, und außerdem tat es mir nicht gut. Ich antwortete dem Interviewer, nein, ich habe keine Angst beim Küssen, aber ich leide unter Panikattacken und die sind extrem beängstigend. Während ich das sagte, kam ich mir wie von mir selbst abgetrennt vor — als ob ich nicht mir selbst gehörte, sondern mich im Austausch gegen gute Presse verkaufte oder zumindest vermietete.
Während ich mich von der Labyrinthitis erholte, wurde mir klar, dass ich nicht mehr verschlüsselt schreiben wollte.
*
Im Jahr 2000 arbeitete ich einige Monate lang als studentischer Seelsorger in einem Kinderkrankenhaus. Ich war damals am theologischen Seminar eingeschrieben und wollte Pfarrer der Episkopalen Kirche werden, ließ diese Pläne aber während der Zeit im Krankenhaus fallen. Ich kam mit dem Verheerenden, das ich dort sah, einfach nicht klar. Das ist bis heute so. Stattdessen ging ich nach Chicago und arbeitete als Schreibkraft für Zeitarbeitsfirmen, bis ich schließlich bei Booklist, einer 14-tägig erscheinenden Literaturzeitschrift, eine Stelle in der Datenerfassung ergattern konnte.
Ein paar Monate später bekam ich die Chance zu meiner ersten Buchkritik, als mich eine Redakteurin fragte, ob ich gerne Liebesromane lese. Sehr gern, antwortete ich, und sie überließ mir einen Roman, der im London des 17. Jahrhunderts spielt. Während der folgenden fünf Jahre besprach ich für Booklist Hunderte von Büchern — von Bildbänden über Buddha bis zu Gedichtsammlungen — und entwickelte dabei eine Faszination für das Format der Bewertung. Bei Booklist waren die Besprechungen auf 175 Wörter limitiert, also hatte jeder einzelne Satz vielfältige Aufgaben zu erfüllen; das Buch musste ja vorgestellt und gleichzeitig analysiert werden, Lob und Bedenken in enger Nachbarschaft koexistieren.
Bei Booklist gibt es keine abschließende Bewertung nach einer Fünf-Sterne-Skala. Warum auch? Potenziellen Lesern lässt sich in 175 Wörtern viel mehr vermitteln, als es so eine Stufe auf einer Skala jemals könnte. Überhaupt ist die Fünf-Sterne-Skala bei Bewertungen erst seit wenigen Jahrzehnten gebräuchlich. Bei Filmkritiken taucht sie zwar schon in den 1950er-Jahren gelegentlich auf, bei der Bewertung von Hotels aber erst seit 1979, und bei Büchern kam sie kaum zum Einsatz, bis Amazon seine Kundenbewertungen einführte.
Dabei ist die Fünf-Sterne-Skala eigentlich gar nicht für Menschen gedacht; sie dient Datensammelsystemen und wurde daher erst im Internet-Zeitalter Standard. Künstliche Intelligenzen tun sich schwer damit, aus einer Buchrezension mit 175 Wörtern Schlüsse über die Qualität des Werks zu ziehen — Bewertungssterne sind für Computer dagegen ideal.
*
Es liegt nahe, meine Labyrinthitis symbolisch zu deuten: Die Gleichgewichtsstörung traf mich so verheerend, weil es meinem Leben an Gleichgewicht fehlte. Einen Monat lang hatte ich entlang einer schnurgeraden Linie einen Weg gebahnt und musste nun erfahren, dass es im Leben keine einfachen Pfade gibt — nur verwirrende, in sich selbst verschlungene Labyrinthe. Selbst jetzt gestalte ich diese Einleitung wie einen Irrgarten und kehre an Orte zurück, die ich eigentlich schon hinter mir gelassen zu haben glaubte.
Aber genau diese Versinnbildlichung der Krankheit ist es, gegen die ich in meinen Romanen Schlaft gut, ihr fiesen Gedanken und Das Schicksal ist ein mieser Verräter angeschrieben habe, und ich hoffe, dass Zwangsstörungen und Krebs dort nicht als Kämpfe dargestellt werden, die es zu gewinnen gilt, oder als symbolische Ausprägungen von Charakterschwächen und dergleichen, sondern als Erkrankungen, mit denen man leben muss, so gut es einem eben möglich ist. Ich habe nicht Labyrinthitis bekommen, weil das Universum mir eine Lektion über Gleichgewicht erteilen wollte. Deshalb versuchte ich, damit zu leben, so gut es mir möglich war. Sechs Wochen später ging es mir deutlich besser, aber ab und zu habe ich immer noch Schwindelanfälle, die mir Angst einjagen. Seither weiß ich mit neuer, tiefer Gewissheit, dass das Bewusstsein eine flüchtige und unsichere Angelegenheit ist. Es ist keine Metapher, wenn man behauptet, das menschliche Leben sei ein Balanceakt.
Als es mir wieder besser ging, fragte ich mich, was ich mit dem Rest meines Lebens tun sollte. Ich fing wieder an, dienstags ein Video zu drehen und mit meinem Bruder den wöchentlichen Podcast zu produzieren, aber ich schrieb nicht. Eine so lange Zeitspanne ohne den Versuch, für Publikum zu schreiben wie in jenem Herbst und Winter, hatte es nicht mehr gegeben, seit ich 14 war. Ich glaube, dass mir das Schreiben fehlte, aber auf die Art, wie einem jemand fehlt, den man früher mal geliebt hat.
*
Ich ließ Booklist und Chicago 2005 hinter mir, weil meine Frau Sarah in New York an der Graduate School angenommen wurde. Nach ihrem Abschluss zogen wir nach Indianapolis, wo Sarah am Indianapolis Museum of Art eine Stelle als Kuratorin für zeitgenössische Kunst antrat. Seither leben wir hier.
Bei Booklist habe ich so viel gelesen, dass ich mich nicht mehr erinnern kann, wann mir das Wort Anthropozän zum ersten Mal begegnet ist, es muss aber um 2002 gewesen sein. Der Begriff Anthropozän ist die vorgeschlagene Bezeichnung für das gegenwärtige geologische Zeitalter, in dem der Mensch den Planeten und seine Biodiversität grundlegend verändert hat. Nichts ist menschlicher als die Selbstverherrlichung menschlicher Leistungen, aber unser Einfluss auf die Erde ist im 21. Jahrhundert schlichtweg gewaltig.
Mein Bruder Hank, der ursprünglich Biochemiker war, hat es mir einmal so erklärt: Für einen Menschen, sagte er, sind andere Menschen das größte Problem. Du bist ihnen gegenüber ungeschützt und gleichzeitig von ihnen abhängig. Jetzt stell dir mal vor, du wärst im 21. Jahrhundert ein Fluss, eine Wüste oder ein Eisbär. Dein größtes Problem sind immer noch Menschen. Du bist ihnen gegenüber immer noch ungeschützt und immer noch von ihnen abhängig.
Hank begleitete mich im Herbst 2017 auf der Lesereise, und auf den langen Fahrten zwischen den Städten vertrieben wir uns die Zeit damit, uns gegenseitig mit absurden Google-Nutzer-Bewertungen der Orte an unserer Strecke zu überbieten. Ein User namens Lucas vergab beispielsweise für den Badlands-Nationalpark einen Stern. »Nicht genug Berg«, vermeldete er.
Seit meinen Zeiten als Buchrezensent waren alle zu Rezensenten geworden; alles und jedes musste sich inzwischen Bewertungen unterziehen. Die Fünf-Sterne-Skala wurde nicht nur an Bücher und Filme angelegt, sie galt auch für öffentliche Toiletten und Hochzeitsfotografen. Das Medikament, das ich gegen meine Zwangsstörung nehme, hat auf drugs.com mehr als 1100 Bewertungen erhalten — mit der Durchschnittsnote 3,8. Eine Szene der Verfilmung von Das Schicksal ist ein mieser Verräter wurde auf einer Parkbank in Amsterdam gedreht; auch diese Bank hat inzwischen Hunderte von Google-Bewertungen. (Mein Favorit, mit drei vergebenen Sternen, lautet in Gänze: »Es ist eine Bank.«)
Hank und ich staunten nicht schlecht über die allgegenwärtige Präsenz von Bewertungen nach der Fünf-Sterne-Skala, und ich erzählte ihm von meiner mehrere Jahre alten Idee, eine Bewertung über Kanadagänse zu schreiben.
Hank sagte: »The Anthropocene … REVIEWED.«
Tatsächlich hatte ich schon 2014 einige solcher Bewertungen geschrieben — die über Kanadagänse und auch die über Diet Dr Pepper. Anfang 2018 schickte ich diese Texte an Sarah und fragte, was sie davon hielt.
In meinen Buchkritiken kam das Wort »Ich« nicht vor. Ich sah mich als unbeteiligten, von außen beschreibenden Beobachter. Daher waren auch meine ersten Bewertungen von Diet Dr Pepper und Kanadagänse in der dritten Person geschrieben, gewissermaßen als Sachtextversion einer Geschichte aus der Sicht eines allwissenden Erzählers. Sarah las sie und merkte an, dass es im Anthropozän keine unbeteiligten Beobachter gibt — nur Beteiligte. Wenn jemand eine Bewertung schreibt, erklärte sie, dann schreibt er eigentlich eine Art Lebensbericht — hier ist, was ich beim Essen in diesem Restaurant oder beim Schneiden meiner Haare bei diesem Friseur erlebt habe. Ich hatte 1500 Wörter über Diet Dr Pepper geschrieben, ohne meine anhaltende und zutiefst persönliche Vorliebe für Diet Dr Pepper auch nur ein einziges Mal zu erwähnen.
Etwa um die Zeit, als ich allmählich wieder ins Gleichgewicht kam, las ich auch wieder das Werk meiner guten Freundin und Mentorin Amy Krouse Rosenthal, die einige Monate zuvor gestorben war. Sie hatte einmal geschrieben: »An alle, die herauszufinden versuchen, was sie mit ihrem Leben anstellen sollen: ACHTET DARAUF, WORAUF IHR ACHTET. Das ist im Grunde alles, was ihr wissen müsst.« Meine Aufmerksamkeit hatte sich so zersplittert, und meine Welt war so laut geworden, dass ich nicht mehr auf das achtete, worauf ich achtete. Als ich mich dann den Bewertungen widmete, wie es Sarah vorgeschlagen hatte, kam es mir zum ersten Mal seit Jahren so vor, als versuchte ich zumindest, darauf zu achten, worauf ich achtete.
*
Dieses Buch nahm seinen Anfang als Podcast, in dem ich einige Widersprüche der menschlichen Existenz, so wie ich sie erlebe, aufzeigen wollte. Wie können wir beispielsweise so mitfühlend und gleichzeitig so grausam sein, so hartnäckig und gleichzeitig so mutlos? Vor allem aber wollte ich die Widersprüchlichkeit menschlicher Macht verstehen: Einerseits sind wir viel zu mächtig, andererseits bei Weitem nicht mächtig genug. Wir sind zwar in der Lage, das Klima und die Biodiversität der Erde radikal zu verändern, aber nicht mächtig genug, um zu entscheiden, wie wir sie verändern. Wir sind in der Lage, die Atmosphäre unseres Planeten zu verlassen, aber wir sind nicht mächtig genug, denjenigen, die wir lieben, Leid zu ersparen.
Ich wollte auch über gewisse Punkte schreiben, an denen sich mein bescheidenes Leben und die gewaltigen Kräfte des Anthropozäns überschneiden. Anfang 2020 — ich schrieb seit zwei Jahren für den Podcast — tauchte allerdings eine gewaltige Kraft auf, in Form eines neuartigen Coronavirus. Seit damals schreibe ich über das Einzige, über das zu schreiben mir möglich ist. Mitten in der Krise — es ist inzwischen April 2021 und ich stecke immer noch mittendrin — finde ich vieles, das zu fürchten und zu beklagen ist. Ich sehe aber auch, dass Menschen zusammenarbeiten, dass sie teilen und weitergeben, was wir gemeinsam lernen, und ich sehe Menschen zusammenarbeiten bei der Versorgung Kranker und Gefährdeter. Selbst in der Trennung sind wir einander verbunden. Wie Sarah mir sagte, gibt es keine Beobachter; nur Beteiligte.
*
Am Ende seines Lebens sagte der große Bilderbuchautor und Illustrator Maurice Sendak auf National Public Radio in der Sendung Fresh Air: »Ich weine viel, weil mir Menschen fehlen. Ich weine viel, weil sie sterben und ich sie nicht festhalten kann. Sie verlassen mich, und ich liebe sie noch mehr.«
Er sagte: »Während ich älter und älter werde, wird mir klar, dass ich in die Welt verliebt bin.«
Ich habe mein ganzes bisheriges Leben gebraucht, um mich in die Welt zu verlieben, aber seit ein paar Jahren kann ich es selbst spüren. Wenn man sich in die Welt verliebt, heißt das nicht, dass man über das Leiden hinwegsieht, sei es nun menschlicher oder anderer Art. Sich in die Welt zu verlieben bedeutet für mich, zum Nachthimmel aufzublicken und zu spüren, wie der Verstand angesichts der Schönheit und Ferne der Sterne ins Schwimmen gerät. Es bedeutet, unsere Kinder an uns zu drücken, wenn sie weinen, oder zuzusehen, wenn im Juni die Platanen austreiben. Wenn mein Brustbein schmerzt, wenn sich mein Hals zusammenzieht und wenn mir Tränen in die Augen schießen, dann will ich diese Gefühle nicht an mich heranlassen. Ich möchte sie ironisch abwehren und auch sonst nichts unversucht lassen, damit ich sie nicht direkt spüre. Wir alle wissen, wie das Lieben endet. Ich möchte mich aber trotzdem in die Welt verlieben, möchte, dass sie meine Schale aufbricht. Solange ich hier bin, möchte ich alles spüren, was es zu spüren gibt.
Sendak beendete das Gespräch mit den letzten Worten, die er öffentlich äußerte: »Lebe dein Leben. Lebe dein Leben. Lebe dein Leben.«
Dies ist mein Versuch, es zu tun.
»You’ll never walk alone«
Es ist Mai 2020, und mein Gehirn ist dafür nicht gemacht.
Immer öfter sage ich »es« oder »das«, ohne es zu benennen oder benennen zu müssen, weil das, was wir erleben, so außergewöhnlich und allumfassend ist, dass die Pronomen ohne Bezugswort auskommen. Leid und Schrecken, wo man hinblickt, und ich wünsche mir, dass mir das Schreiben eine Auszeit verschafft. Trotzdem dringt es zu mir durch — wie Licht durch eine Jalousie oder Hochwasser durch geschlossene Türen.
Sie lesen das wahrscheinlich in meiner Zukunft — vielleicht in einer so fernen Zukunft, dass »das« vorüber ist. Dabei weiß ich: Wirklich vorbei wird es niemals sein; das neue Normal wird anders sein als das vergangene. Aber es wird ein neues Normal geben und ich hoffe, Sie werden es erleben, und ich hoffe, ich werde es mit Ihnen erleben.
Bis dahin muss ich in diesem leben und schauen, dass ich irgendwie Trost finde. Trost, wie ihn mir gerade eine Musical-Melodie gibt.
Im Jahr 1909 brachte der ungarische Autor Ferenc Molnár in Budapest sein neues Theaterstück Liliom heraus. Liliom, ein junger und zeitweise gewalttätiger Karussell-Ausrufer mit vielen Problemen verliebt sich in eine Frau namens Julie. Als sie schwanger wird, begeht Liliom einen Raub, um seine junge Familie zu unterstützen. Aber der Raub endet in einer Katastrophe und Liliom kommt dabei ums Leben. Nach 16 Jahren im Fegefeuer darf er seine Tochter Louise, mittlerweile natürlich ein Teenager, für einen Tag besuchen.
Liliom war in Budapest ein Reinfall, aber Molnár litt als Bühnenautor nicht gerade unter mangelndem Selbstvertrauen. Er stellte weitere Aufführungen auf die Beine, zunächst in Europa und schließlich in den USA, wo eine übersetzte Fassung 1921 gute Kritiken bekam und auch annehmbare Erlöse einspielte.
Der Komponist Giacomo Puccini hätte Liliom gern als Oper adaptiert, aber Molnár weigerte sich, ihm die Rechte zu verkaufen, denn er wollte, dass »Liliom als Theaterstück von Molnár in Erinnerung blieb und nicht als Puccini-Oper«. Stattdessen vergab er die Lizenz an das Musical-Duo Richard Rodgers und Oscar Hammerstein, die mit Oklahoma! eben große Erfolge gefeiert hatten. Damit erreichte Molnár, dass man Liliom praktisch ausschließlich als Musical von Rodgers und Hammerstein kennt, das unter dem Titel Carousel 1945 Premiere hatte.
Im Musical wird Rodgers’ und Hammersteins Lied »You’ll Never Walk Alone« zweimal gesungen — zunächst als Ermutigung für die frisch verwitwete Julie nach dem Tod ihres Mannes und dann Jahre später von Louises Klassenkameradinnen bei einer Abschlussfeier. Louise möchte nicht mitsingen. Sie ist zu aufgewühlt, doch obwohl ihr Vater für sie nun wieder unsichtbar ist, spürt sie noch immer seine Gegenwart und Unterstützung, sodass sie schließlich doch mit einstimmt.
Im Liedtext von »You’ll Never Walk Alone« wirkt wirklich nur die denkbar einfachste Bildsprache: »Walk on through the wind and through the rain«, wird uns da geraten — Stürme sind schon feinsinniger angedeutet worden. Man rät uns: »Walk on with hope in your heart«, was auf fast schon aggressive Weise banal klingt. Und dann folgt die Aussicht: »At the end of the storm, there’s a golden sky and the sweet silver song of a lark«, obwohl einen nach einem Sturm eher überall herumliegende Äste, heruntergerissene Stromleitungen und über die Ufer getretene Flüsse beschäftigen.
Und doch — bei mir wirkt das Lied. Vielleicht liegt es am vielfach wiederholten »walk on«. Ich glaube, zu den grundlegenden Dingen, die uns zu Menschen machen, gehören: 1. Wir müssen weitermachen, und: 2. Niemand ist allein unterwegs. Vielleicht fühlen wir uns alleine (irgendwann werden wir uns alleine fühlen, keine Frage), aber selbst wenn uns das Abgesondertsein gerade niederdrückt, sind wir nicht allein. Wie bei Louise auf der Abschlussfeier sind jene, die fern oder schon verstorben sind, immer noch bei uns und ermuntern uns, weiterzugehen.
Fast alle haben seither dieses Lied gecovert, von Frank Sinatra und Johnny Cash bis Aretha Franklin. Die berühmteste Version spielten allerdings Gerry and the Pacemakers 1963 ein — eine Band, die wie die Beatles aus Liverpool stammt, von Brian Epstein gemanagt und von George Martin auf Platte aufgenommen wurde. Gemäß ihrem Bandnamen änderten die Pacemakers das Liedtempo, gaben dem Trauergesang damit ein bisschen mehr Pep, und ihre Version stürmte in England auf Platz eins der Charts.
Praktisch sofort fingen die Fans des Liverpool Football Club an, während der Spiele dieses Lied zu singen. Der legendäre Clubmanager Bill Shankly meinte in jenem Sommer zum Leadsänger der Pacemakers Gerry Marsden: »Gerry, mein Sohn, ich habe euch ein Fußballteam gegeben, ihr habt uns ein Lied gegeben.«
Heute prangt »You’ll Never Walk Alone« in Schmiedeeisen über dem Tor zum Liverpooler Anfield Stadium. Daniel Agger, der berühmte dänische Verteidiger der Mannschaft, hat sich YNWA auf die Knöchel der rechten Hand tätowieren lassen. Ich bin seit Jahrzehnten selbst Liverpool-Fan,*1 und für mich ist das Lied so eng mit dem Club verbunden, dass ich schon bei den ersten Tönen der Melodie an all die Male denken muss, die ich es schon mit anderen Fans gesungen habe — mal mit überschäumender Freude, häufig verzweifelt.
Als Bill Shankly 1981 starb, sang Gerry Marsden bei der Trauerfeier »You’ll Never Walk Alone«, und es ist natürlich bei vielen Beerdigungen von Liverpool-Fans gesungen worden. Das Wunder von »You’ll Never Walk Alone« liegt für mich darin, wie gut es als Lied bei Beerdigungen funktioniert, bei Highschool-Abschlussfeiern und eben auch als Wir-haben-gerade-Barcelona-in-der-Champions-League-geschlagen-Lied. Der ehemalige Liverpool-Spieler und -Manager Kenny Dalglish stellte fest: »Von Unglück und Trauer bis zum Erfolg deckt es alles ab.« Es ist ein Lied über das Zusammenhalten, »though your dreams be tossed and blown« — auch wenn die eigenen Träume sich gerade in Luft auflösen. Es ist ein Lied über den Sturm, aber eben auch über den goldenen Himmel.
Auf den ersten Blick ist es schon seltsam, dass das beliebteste Fußball-Lied der Welt aus dem Musical-Theater stammt. Aber Fußball ist Theater, und die Fans machen es zum musikalischen Theater. Die Hymne von West Ham United lautet »I’m Forever Blowing Bubbles«, und bei Spielbeginn sieht man dort auf den Tribünen Tausende erwachsene Menschen Seifenblasen machen, während sie singen: »I’m forever blowing bubbles, pretty bubbles in the air / They fly so high, nearly reach the sky / Then like my dreams, they fade and die.« Die Fans von Manchester United haben das US-Bürgerkriegs-Schlachtlied »Battle-Hymn of the Republic« von Julia Ward Howe umgemünzt in »Glory, Glory Man United«. Die Fans von Manchester City singen »Blue Moon«, eine Nummer des Broadway-Songwriterteams Richard Rodgers und Lorenz Hart von 1934.
Großartig werden all diese Lieder durch die Gemeinschaft, in der sie gesungen werden. Mit ihnen versichert man sich der Verbundenheit, im Kummer wie im Triumph: Ob die Seifenblase nun aufsteigt oder platzt, wir singen gemeinsam.
»You’ll Never Walk Alone« ist kitschig, aber verkehrt ist es nicht. Es stilisiert die Welt nicht zu einem gerechten oder glücklichen Ort. Wir werden nur aufgefordert, weiterzugehen, mit offenem Herzen. Und wie Louise am Ende von Carousel glauben wir eigentlich nicht an den goldenen Himmel oder den lieblichen silbrigen Gesang der Lerche, wenn wir anfangen das Lied zu singen, aber an seinem Ende glauben wir ein bisschen mehr daran.
Im März 2020 machte das Video einer Gruppe englischer Rettungssanitäter im Internet die Runde, die vor einer Glaswand »You’ll Never Walk Alone« sangen, für Kollegen auf der anderen Seite, in der Intensivstation. Die Sanitäter wollten ihre Kolleginnen unterstützen. Ihnen Mut machen. Mögen unsere Träume auch »tossed and blown« sein, wir singen einander — und uns selbst — trotzdem Mut zu.
Ich gebe »You’ll Never Walk Alone« viereinhalb Sterne.
Die zeitliche Verbreitung der Menschheit
Ich war vielleicht neun oder zehn Jahre alt, als der Sprecher bei einer Vorführung im Planetarium des Orlando Science Center ohne erkennbare Regung in der Stimme erklärte, dass die Sonne in etwa einer Milliarde Jahre zehn Prozent stärker strahlen und damit die Ozeane der Erde austrocknen werde. In ungefähr vier Milliarden Jahren werde die Erdoberfläche durch die zunehmende Hitze schmelzen, und in sieben oder acht Milliarden Jahren werde sich die Sonne zu einem Roten Riesen aufblähen und die Erde verschlucken, sodass jeglicher irdische Hinweis auf das, was wir gesagt oder getan haben, in einem lodernden Feuerball aus Plasma aufgehen wird.
Wir danken für Ihren Besuch im Orlando Science Center. Zum Ausgang bitte nach links.
Es hat mich einen guten Teil der vergangenen 35 Jahre gekostet, über diese Präsentation hinwegzukommen. Später erfuhr ich, dass es sich bei vielen bekannten Sternen des Nachthimmels um Rote Riesen handelt, beispielsweise Arcturus. Rote Riesen sind sehr verbreitet. Es ist normal, dass Sterne sich aufblähen und ihre vormals bewohnbaren Sonnensysteme verschlucken. Kein Wunder, dass wir uns vor dem Weltuntergang fürchten. Ständig gehen Welten unter.
*
Eine 2012 in 20 Ländern durchgeführte Umfrage zeigte deutliche Unterschiede im Anteil derer, die glauben, das Ende der Menschheit selbst zu erleben. In Frankreich waren das 6 Prozent, in den Vereinigten Staaten 22 Prozent. Eigentlich ist das auch nachvollziehbar: Immerhin hat es in Frankreich apokalyptische Prediger gegeben — der Bischof Martin von Tours beispielsweise schrieb: »Es herrscht kein Zweifel, dass der Antichrist bereits geboren wurde.« Das war allerdings schon im 4. Jahrhundert. Die amerikanische Apokalyptik ist da jünger, von Shaker-Vorhersagen, die Welt werde 1794 untergehen, bis zu den Berechnungen des bekannten Radiopredigers Harold Camping, die Apokalypse finde 1994 statt — und als da nichts passierte, dann 1995. Camping ließ sich nicht beirren und sagte das Ende der Zeiten für den 21. Mai 2011 voraus, verbunden mit »fünf Monaten Feuer auf Erden, Schwefel und Plagen, denen Tag für Tag Millionen zum Opfer fallen [werden] bis zur Kulmination am 21. Oktober 2011 mit der endgültigen Zerstörung der Welt«. Als sich nichts von alldem ereignete, entgegnete Camping: »Wir müssen demütig einräumen, dass wir uns im Zeitpunkt geirrt haben«, wobei dazu gesagt werden muss, dass kein Mensch jemals etwas demütig eingeräumt hat, wenn er von sich als »wir« gesprochen hat. Ich muss dabei unwillkürlich an einen Rat meines Theologieprofessors Donald Rogan denken: »Sage niemals das Ende der Welt voraus. Du wirst dich mit ziemlicher Sicherheit irren, und falls nicht, dann ist zum Gratulieren niemand mehr da.«
Seine persönliche Apokalypse ereilte Camping im Jahr 2013, als er mit 92 Jahren starb. Unsere Angst vor dem Ende der Welt hat ihren Ursprung wohl zum Teil in der seltsamen Tatsache, dass für jeden von uns die eigene Welt tatsächlich enden wird, und das schon bald. Von daher sind die apokalyptischen Ängste möglicherweise ein Nebenprodukt unseres erstaunlich ausgeprägten Narzissmus. Wie soll die Welt den Tod ihres bedeutendsten Bewohners überleben — meinen? Ich glaube aber, es ist noch etwas anderes im Spiel. Wir wissen, dass wir aussterben werden, weil wir wissen, dass auch andere Arten ausgestorben sind.
»Moderne Menschen«, wie wir von Paläontologen genannt werden, gibt es seit etwa 250.000 Jahren. Das ist unsere »zeitliche Verbreitung« — so lange sind wir als Spezies präsent. Der heutige Elefant ist zehnmal so alt — seine zeitliche Verbreitung reicht zurück bis ins Pliozän, das vor mehr als 2,5 Millionen Jahren zu Ende ging. Alpakas gibt es seit ungefähr 10 Millionen Jahren — 40 mal so lange wie uns. Die Brückenechse oder Tuatara, ein in Neuseeland beheimatetes Reptil, trat vor etwa 240 Millionen Jahren erstmals auf. Sie existiert also 1000 mal so lange wie wir und war schon da, als der Superkontinent Pangäa auseinanderzubrechen begann.
Wir sind jünger als Eisbären, Kojoten, Blauwale und Kamele. Und wir sind sehr viel jünger als viele Tiere, die wir ausgerottet haben, vom Dodo bis zum Riesenfaultier.
*
Im Frühjahr 2020, kurz nachdem in den USA wegen eines neu aufgetretenen Coronavirus Schulen geschlossen und Supermärkte leergefegt wurden, schickte mir jemand eine Zusammenstellung von öffentlichen Äußerungen, in denen ich meine Angst vor einer weltweit grassierenden Infektionskrankheit erwähnt hatte. Im Podcast »10 Things That Scare Me« hatte ich ziemlich weit oben »eine Pandemie, die zum Zusammenbruch menschlicher Normen führt« aufgelistet. Schon Jahre vorher hatte ich in einem Video über die Geschichte der Welt darüber spekuliert, was wohl passieren würde, »wenn morgen ein Superbazillus auftaucht und sich über all diese globalen Handelsrouten ausbreitet«. Im Jahr 2019 sagte ich in einem Podcast: »Wir wissen, dass eine solche Pandemie irgendwann kommen wird, und müssen uns alle darauf vorbereiten.« Trotzdem bereitete ich mich nicht darauf vor. Die Zukunft kommt mir trotz ihrer Zwangsläufigkeit immer eher ungewiss und nebulös vor — bis das Gegenteil eintritt.
Die Schule meiner Kinder wurde geschlossen und mir fiel eine Maske in die Hände, die ich Jahre zuvor beim Bau eines Baumhauses gekauft hatte, um nicht so viel Sägemehl einzuatmen, aber das Ausmaß der Pandemie hatte ich immer noch nicht begriffen, als ich meinen Bruder Hank anrief und ihm sagte, dass ich Angst hätte. Hank ist der Ausgeglichene, Vernünftige, Besonnene. Das war er schon immer. Obwohl ich der Ältere bin, war Hank immer unangefochten der kluge große Bruder. Schon als wir noch klein waren, habe ich mich an ihm orientiert, um mit meinen Ängsten fertigzuwerden. Mein Gehirn kann nicht zuverlässig einordnen, ob eine gefühlte Bedrohung real ist. Deshalb sehe ich Hank an, und wenn er nicht in Panik verfällt, sage ich mir, dass auch für mich alles in Ordnung ist. Falls es wirklich ein Problem gäbe, würde Hank nicht so eine ruhige Zuversicht ausstrahlen.
Und deshalb erklärte ich Hank, dass ich Angst hätte.
»Die Spezies wird es überleben«, entgegnete er, wobei ihm die Stimme etwas stockte.
»Die Spezies wird es überleben? Mehr hast du mir nicht zu bieten???«,
Er schwieg. Ich konnte seinen bebenden Atem hören — das Beben, das er bei mir schon ein Leben lang zu hören bekommt. »Mehr habe ich dir nicht zu bieten«, antwortete er nach einem Augenblick.
Ich erzählte ihm, ich hätte sechzig Dosen Diet Dr Pepper gekauft, für jeden Tag im Lockdown zwei.
Und erst dann konnte ich das vertraute Lächeln hören, dieses Mein-großer-Bruder-ist-echt-’ne-Marke-Lächeln. »Für jemanden, der sich seit vier Jahrzehnten Sorgen wegen einer Pandemie macht«, meinte er, »hast du erstaunlich wenig Ahnung, wie so eine Pandemie funktioniert.«
*
Im Einzelhandel gilt das Prinzip, Verkäufe zu maximieren, indem man ein Klima der Dringlichkeit schafft. Sale, nur kurze Zeit! Nur noch wenige Eintrittskarten verfügbar! Derlei gewerbliche Drohungen sind gerade im Zeitalter des Internethandels fast immer frei erfunden. Trotzdem erfüllen sie ihren Zweck — wohl als Echo unserer apokalyptischen Ängste: Was das Experiment der Menschheit angeht, erfasst uns unwillkürlich eine Dringlichkeit, und vielleicht schreiten wir sogar zur Tat — ob wir nun vor der Entrückung noch eiligst Seelen retten oder uns gegen den Klimawandel engagieren.
Ich rufe mir immer wieder in Erinnerung, dass sich Martin von Tours’ Endzeitängste für ihn im 4. Jahrhundert ebenso real anfühlten, wie es meine Ängste heute tun. Vor eintausend Jahren galten Überschwemmungen und Seuchen als Vorboten der Apokalypse, denn sie deuteten auf Mächte weit jenseits unserer Erkenntnis hin. Als ich aufwuchs, im Zeitalter der Wasserstoffbomben und der zunehmenden Computernutzung, gaben das Jahr-2000-Problem und der atomare Winter die besseren apokalyptischen Befürchtungen her. Heute drehen sich die Sorgen eher um außer Kontrolle geratene künstliche Intelligenzen oder eine artvernichtende Pandemie, die uns erwiesenermaßen völlig unvorbereitet getroffen hat. Bei mir äußert sich die Sorge normalerweise in Form von Klimaangst — ein Begriff, der vor wenigen Jahrzehnten nicht einmal existierte, aber inzwischen weitverbreitet ist.
Schon jetzt ist der Mensch eine ökologische Katastrophe. Durch unser Verhalten haben wir in nur 250.000 Jahren zahlreiche Arten ausgerottet und viele andere stark in Bedrängnis gebracht. Das ist bedauerlich und außerdem in zunehmendem Maße überflüssig. Vor Tausenden von Jahren begriffen wir wahrscheinlich gar nicht, was wir taten, als wir viele Großsäuger bis zur Ausrottung jagten. Inzwischen wissen wir nur zu gut, was wir anrichten. Und wir wissen auch, wie wir unseren Fußabdruck auf der Erde verkleinern könnten. Wir könnten weniger Energie verbrauchen, weniger Fleisch essen, weniger Wälder abholzen. Aber wir entscheiden uns dagegen. Für viele Lebensformen ist die Menschheit deshalb die Apokalypse.
*
In manchen Weltanschauungen wird eine zyklische Kosmologie vertreten — der Hinduismus beispielsweise geht von einer Abfolge sogenannter Kalpas aus — jeweils viele Milliarden Jahre umfassende Perioden, jede ein Kreislauf von der Entstehung über die Erhaltung bis zum Niedergang. In linearen Endzeitvorstellungen wird das Ende der Menschheit oft als »Ende der Welt« verstanden, obwohl das Verschwinden unserer Art von der Erde aller Wahrscheinlichkeit nach gar nicht das Ende der Welt bedeuten würde, ja nicht einmal das Ende des Lebens auf der Erde.
Für uns selbst als Art und für viele andere Spezies sind wir Menschen zweifellos eine Bedrohung, aber der Planet wird uns überleben. Möglicherweise wird das Leben auf der Erde nur wenige Millionen Jahre brauchen, um sich von uns zu erholen. Es hat schon sehr viel schwerwiegendere Krisen überstanden. Beim Permischen Aussterbeereignis vor 250 Millionen Jahren wurden die Ozeane an der Oberfläche wahrscheinlich 40 Grad warm. 95 Prozent aller Arten starben aus, und die Erde war für 5 Millionen Jahre eine »Todeszone«, in der sich kaum Leben ausbreitete.
Vor 66 Millionen Jahren schlug vor dem heutigen Yucatán ein Asteroid ein. Durch den aufgewirbelten Staub, der die ganze Erde einhüllte, herrschte wahrscheinlich zwei Jahre lang völlige Finsternis. Die Fotosynthese brach komplett zusammen und 75 Prozent der Landtiere starben aus. Gemessen an solchen Katastrophen sind wir einfach nicht so wichtig. Wenn die Erde mal mit uns fertig sein sollte, wird es heißen: »Na, so toll war das ja nicht mit diesem Befall mit Menschen, aber wenigstens habe ich kein Großasteroidensyndrom bekommen.«
Besonders schwierig war der Evolutionsschritt von prokaryotischen (kernlosen) zu eukaryotischen (kerntragenden) Zellen und dann von ein- zu vielzelligen Organismen. Die Erde ist etwa 4,5 Milliarden Jahre alt, eine Zeitspanne, die meine Vorstellungskraft deutlich übersteigt. Stellen wir uns die Geschichte der Erde als ein Kalenderjahr vor; die Erde entsteht am 1. Januar und heute ist der 31. Dezember 23.59 Uhr. Erste Lebensformen zeigen sich etwa um den 25. Februar. Organismen mit der Fähigkeit zur Fotosynthese erscheinen Ende März. Mehrzelliges Leben ist erst im August oder September zu sehen. Frühe Dinosaurier wie Eoraptor tauchen vor ungefähr 230 Millionen Jahren auf, in unserem Kalenderjahr also am 13. Dezember. Der Meteorit, der das Ende der Dinosaurier einläutet, schlägt um den 26. Dezember ein. Homo sapiens hat seinen Auftritt in der Geschichte erst am 31. Dezember, und zwar um 23.48 Uhr.*2
Oder betrachten wir es anders: Vom einzelligen zum mehrzelligen Leben brauchte die Erde 3 Milliarden Jahre. Dann vergingen weniger als 70 Millionen Jahre vom Tyrannosaurus rex zum Menschen, der lesen und schreiben und Fossilien ausgraben und die Chronik des Lebens erstellen und sich um dessen Ende sorgen kann. Falls wir es nicht schaffen, jegliches mehrzellige Leben auf dem Planeten auszurotten, muss die Erde immerhin nicht wieder ganz von vorn beginnen, also alles halb so schlimm — jedenfalls bis die Ozeane austrocknen und die Planeten von der Sonne verschluckt werden.
Da werden wir aber schon Vergangenheit sein, und mit uns alle unsere Aufzeichnungen und Erinnerungen. Ich glaube, im Grunde sind es diese verlorenen Erinnerungen, die mir am Ende der Menschheit Angst machen. Wenn im Wald ein Baum umfällt, dann kracht es laut, auch wenn niemand da ist, der es hört. Wenn es aber niemanden gibt, der die Platten von Billie Holiday abspielt, dann sind diese Lieder tatsächlich nicht mehr hörbar. Wir haben viel Leid verursacht, aber auch vieles andere.
Ich weiß, dass die Welt uns überleben wird — und in mancherlei Hinsicht wird sie nach uns lebendiger sein. Mehr Vogelgezwitscher. Mehr umherziehende Tiere. Mehr Pflanzen, die durch unseren Asphalt brechen und den Planeten wieder verwildern, den wir umgestaltet haben. Ich stelle mir Kojoten vor, die in den Ruinen unserer Häuser schlafen. Ich stelle mir aber auch vor, dass unser Plastik auch dann noch an den Stränden angespült wird, wenn der Letzte von uns schon seit Hunderten von Jahren fort ist. Und ich stelle mir Motten vor, die nicht mehr um künstliche Lichtquellen schwirren und sich wieder dem Mond zuwenden.
Ein bisschen tröstet es mich, dass das Leben auch ohne uns weitergehen wird. Ich bin aber doch der Meinung, dass es die größte Tragödie der Erdgeschichte sein wird, wenn bei uns die Lichter ausgehen; ich weiß, dass wir Menschen zur Selbstüberschätzung neigen, aber ich finde, wir sind bei Weitem das Interessanteste, das je auf der Erde passiert ist.
Man vergisst allzu leicht, wie wundersam Menschen sind, wie eigenartig und liebenswert. Durch Fotografie und Kunst hat jeder von uns Dinge kennengelernt, die wir eigentlich niemals sehen könnten — die Oberfläche des Mars, biolumineszierende Fische der Tiefsee, ein Mädchen aus dem 17. Jahrhundert mit einem Perlenohrring. Durch Empathie haben wir Dinge gefühlt, die wir andernfalls nie gefühlt hätten. Und durch die weite Welt der Vorstellung haben wir große wie kleine Apokalypsen gesehen.
Wir sind der einzige Teil des bekannten Universums, der weiß, dass er sich in einem Universum befindet. Wir wissen, dass wir um einen Stern kreisen, der uns eines Tages verschlucken wird. Wir sind die einzige Spezies, die weiß, dass sie eine zeitliche Verbreitung hat.
*
Komplexe Organismen haben als Arten meist eine kürzere Lebensdauer als einfache, und die Menschheit steht vor gewaltigen Herausforderungen. Wir müssen eine Möglichkeit finden, uns zu überleben — weiter zu existieren in einer Welt, in der wir zwar die Macht besitzen, den ganzen Planeten aufzuheizen, aber nicht imstande sind, die Erwärmung aufzuhalten. Und weil unsere Technologie stetig dazulernt und vieles besser kann als wir, müssen wir vielleicht sogar unsere eigene Ersetzbarkeit überleben. Aber die Voraussetzungen, unsere Probleme zu lösen, sind besser als vor einhundert oder eintausend Jahren. Wir Menschen verfügen zusammengenommen über mehr Intelligenz denn je, mehr Mittel und Möglichkeiten und dazu das Wissen, das unsere Vorfahren angesammelt haben.
Dabei verfügen wir über eine erschreckende, fast blindwütige Ausdauer. Der Mensch der Vorzeit hatte beim Jagen und Fischen verschiedene Strategien, aber die Ausdauerjagd war sehr verbreitet. Dabei kommen Fähigkeiten im Fährtenlesen zum Tragen, aber eben auch unsere schiere Ausdauer. Stundenlang stellten wir der Beute nach, und wann immer sie floh, folgten wir, und wenn sie wieder wegrannte, folgten wir weiter, immer weiter, bis sie schlichtweg zu erschöpft war, um weiter wegzurennen. So konnten wir uns Zehntausende Jahre lang von Tieren ernähren, die schneller und stärker waren als wir.
Wir. Machen. Einfach. Immer. Weiter. Wir haben uns über sieben Kontinente ausgebreitet — sogar über einen, der eigentlich viel zu kalt für uns ist. Wir sind übers Meer zu Ländern gesegelt, die wir nicht sehen konnten, von denen wir nicht wussten, dass man sie entdecken konnte. Eins meiner Lieblingswörter ist dogged — verbissen wie ein Hund. Ich liebe verbissene Verfolgungsjagden und verbissene Entschlossenheit. Bitte nicht missverstehen — Hunde können wirklich sehr verbissen sein. Aber eigentlich müsste man dazu humaned sagen — verbissen wie ein Mensch.
Den größten Teil meines Lebens war ich der festen Überzeugung, wir erlebten gerade das letzte Viertel der Geschichte der Menschheit, vielleicht sogar ihre letzten Tage. Neuerdings glaube ich, dass derlei Schwarzmalerei die geringen Chancen für unseren Fortbestand nur noch weiter schmälert. Wir müssen kämpfen, als gäbe es etwas, um das sich zu kämpfen lohnt — als wären wir etwas, um das sich zu kämpfen lohnt, denn das sind wir. Daher bin ich überzeugt, dass wir nicht auf die Apokalypse zusteuern, dass das Ende nicht bevorsteht und dass wir eine Möglichkeit finden werden, die bevorstehenden Veränderungen zu überleben.
»Wandel«, schrieb Octavia Butler, »ist die einzige unvermeidliche, unwiderstehliche und fortdauernde Realität des Universums.« Und da nehme ich mir heraus zu behaupten, dass der Wandel ein Ende habe? Und dass die Science-Fiction-Autorin sich irrte, als sie schrieb: »Es ist das Schicksal der Erdensaat, irgendwo in den Sternen Wurzeln zu schlagen«? Inzwischen bin ich davon überzeugt, dass wir uns aufgrund unserer Hartnäckigkeit und Anpassungsfähigkeit noch für lange, lange Zeit gemeinsam mit dem Universum werden wandeln können.
Mit ihren lächerlichen 250.000 Jahren ist es schwer, der zeitlichen Verbreitung der Menschheit mehr als einen Stern zu geben. Anfangs hat mir die Antwort meines Bruders schwer zu schaffen gemacht, aber inzwischen wiederhole ich sie selbst immer wieder, unwillkürlich, und ich glaube, dass er recht hat. Er hat immer recht. Die Spezies wir es überleben — und noch eine ganze Menge mehr.
Und deshalb gebe ich unserer zeitlichen Verbreitung voller Hoffnung und Erwartung vier Sterne.
Der Halleysche Komet
Zu den Rätseln des Halleyschen Kometen zählt der Umstand, dass niemand so genau weiß, wie man ihn buchstabiert, da er nach einem Astronomen benannt ist, der seinen Nachnamen mal Hailey, dann wieder Halley und bisweilen auch Hawley geschrieben hat. Wir glauben, sprachlich sei heute viel in Bewegung mit all den neuen Emojis oder dem Bedeutungswandel von Worten wie literally, aber wenigstens können wir unsere eigenen Namen richtig buchstabieren. Ich werde im Folgenden vom Halleyschen Kometen sprechen und bitte bei den Hawleys und Haileys unter uns dafür um Entschuldigung.
Er ist der einzige regelmäßig wiederkehrende Komet, der von der Erde mit bloßem Auge beobachtet werden kann. Für seinen stark elliptischen Umlauf um die Sonne braucht der Halleysche Komet zwischen 74 und 79 Jahre, also erhellt er über den Daumen gepeilt einmal in einem Menschenleben mehrere Wochen lang den Nachthimmel — bestenfalls zweimal, wenn man die Sache gut plant. Der amerikanische Schriftsteller Mark Twain beispielsweise kam zur Welt, als der Komet über Missouri am Himmel funkelte. Vierundsiebzig Jahre später schrieb er: »Ich bin 1835 mit dem Halleyschen Kometen gekommen. Im nächsten Jahr kommt er wieder und ich erwarte, dass ich mit ihm zusammen gehe.« Und das tat Twain auch — er starb 1910, als der Komet gerade wieder erschien. Twain hatte ein wahnsinniges Gespür für Erzählstruktur, besonders in autobiografischen Dingen.
Um das Winterende 1986 kehrte Halley nach 76 Jahren zurück. Ich war damals acht. Er erschien laut Wikipedia unter den »ungünstigsten jemals verzeichneten« Umständen, sehr viel weiter von der Erde entfernt als sonst. Wegen der großen Distanz und der massiven Zunahme nächtlicher Beleuchtung war der Komet an vielen Orten mit bloßem Auge nicht zu sehen.
Ich wohnte in Orlando in Florida, wo viel Licht in den Nachthimmel hinaufscheint, aber am hellsten Wochenende des Kometen fuhr mein Vater mit mir zum Ocala National Forest, wo unsere Familie eine kleine Hütte besaß. Und am Ende eines Tages, den ich immer noch zu den besten meines Lebens zähle, sah ich den Kometen durchs Vogel-Fernglas meines Vaters.
*
Die Menschheit weiß möglicherweise schon seit Jahrtausenden, dass der Komet Halley immer wiederkehrt. Im Talmud findet sich der Hinweis auf »einen Stern, der alle siebzig Jahre erscheint und die Schiffskapitäne in die Irre führt«. Aber damals war es normal, dass Menschen im Lauf der Zeit vergaßen, was sie eigentlich schon entdeckt hatten. Vielleicht nicht nur damals, wenn ich’s mir recht überlege.
Wie auch immer, Edmond*3 Halley fiel auf, dass der Komet, den er 1682 beobachtete, offenbar einem ähnlichen Orbit folgte wie Kometen, die bereits 1607 und 1531 beschrieben worden waren. Vierzehn Jahre später dachte Halley immer noch über den Kometen nach und schrieb an Isaac Newton: »Ich bin mehr und mehr davon überzeugt, dass wir diesen Kometen seit dem Jahr 1531 nun dreimal gesehen haben.« Halley sagte daraufhin voraus, dass der Komet 1758 wieder erscheinen werde. Das tat er auch und ist seither nach ihm benannt.
Viel zu häufig konzentrieren wir uns bei der Betrachtung der Geschichte auf die Leistungen und Entdeckungen Einzelner und vergessen darüber, dass der Erkenntnisfortschritt letztlich durch große Systeme und historische Kräfte angetrieben wird. So sagte Halley das Wiedererscheinen des Kometen zwar richtig voraus, doch hatte sein Kollege und Zeitgenosse Robert Hooke bereits »eine ganz neue Ansicht« geäußert, dass manche Kometen wiederkehren. Selbst wenn wir die Erwähnung möglicherweise periodischer Kometen im Talmud außer Acht lassen, äußerten andere Sterngucker zu dieser Zeit ähnliche Ideen. In Europa gelangten im 17. Jahrhundert nicht nur Newton und Hooke, sondern auch Boyle und Galileo und Gascoigne und Pascal zu bahnbrechenden wissenschaftlichen und mathematischen Erkenntnissen, und das nicht, weil die zu dieser Zeit und an diesem Ort Geborenen zufälligerweise besonders schlau waren, sondern weil sich gerade das analytische System der wissenschaftlichen Revolution herausbildete, weil Einrichtungen wie die Royal Society gut ausgebildeten Eliten ermöglichten, effizienter voneinander zu lernen, und weil in Europa plötzlich beispielloser Wohlstand herrschte. Es ist kein Zufall, dass die wissenschaftliche Revolution in England mit dem Eintritt in den atlantischen Sklavenhandel und dem aus der Ausbeutung der Kolonien und der Arbeitskraft ihrer Menschen gewonnenen Wohlstand zusammenfällt.
Wir sollten also versuchen, Halley in diesem Zusammenhang zu sehen — nicht als einzigartiges, einem Geschlecht von Seifensiedern entsprungenes Genie, das einen Kometen entdeckte, sondern als forschenden und umfassend neugierigen Menschen — »eine Blase auf der Flut des Empire« wie wir übrigen auch, wie es Robert Penn Warren einprägsam beschrieb.
Nichtsdestotrotz war Halley brillant. Hier ein Beispiel für seine unkonventionelle Art, Probleme zu lösen, aus John und Mary Gribbins Buch Out of the Shadow of a Giant: Als er die Fläche der Countys in England ermitteln sollte, nahm Halley »eine große Karte von England und schnitt den größtmöglichen vollständigen Kreis aus der Karte heraus«. Der Durchmesser des Kreises entsprach 69,33 Meilen. Dann wog er den Kreis und die Karte, und da diese viermal so viel wie der Kreis wog, musste die Fläche von England viermal die Fläche des Kreises betragen. Von zeitgenössischen Berechnungen wich sein Ergebnis nur um ein Prozent ab.
Halleys Neugierde als Universalgelehrter führte zu einer Liste von Errungenschaften, die aus einem Jules-Verne-Roman stammen könnte. Er erfand eine Art Taucherglocke, um in einem untergegangenen Schiff auf Schatzsuche zu gehen. Er entwickelte schon früh einen magnetischen Kompass und machte wichtige Entdeckungen über das Magnetfeld der Erde. Seine Arbeiten über den weltweiten Wasserkreislauf hatten enorme Auswirkungen. Er übersetzte die Beobachtungen des arabischen Astronomen al-Battānī über Finsternis-Ereignisse aus dem 10. Jahrhundert und erkannte anhand dessen Daten die Beschleunigung des Mondorbits. Außerdem entwickelte er die erste versicherungsmathematische Tabelle und ebnete damit den Weg für die Entwicklung von Lebensversicherungen.
Halley finanzierte darüber hinaus mit privaten Mitteln die Veröffentlichung von Newtons dreibändiger Principia, weil Englands führende Wissenschaftsgesellschaft, die Royal Society, laut der Historikerin Julie Wakefield, »ihr ganzes Budget überhastet für eine Geschichte der Fische« verschleudert hatte. Halley erfasste sofort die Bedeutung der Principia, die zu den wichtigsten Büchern der Wissenschaftsgeschichte zählen.*4 »Nun sind wir wahrhaft als Tischgäste der Götter zugelassen«, sagte Halley über das Werk. »Der Irrtum unterdrückt die zweifelnde Menschheit nicht länger mit seiner Dunkelheit.«
Natürlich hatten nicht alle von Halleys Ideen Bestand. Der Irrtum unterdrückte die zweifelnde Menschheit weiterhin (und tut es immer noch). So vertrat Halley, teilweise auf der Grundlage von Newtons fehlerhaften Berechnungen der Dichte des Mondes, die Ansicht, es müsse im Innern unserer Erde eine zweite Erde geben, mit einer eigenen Atmosphäre und womöglich eigenen Bewohnern.
*
Als der Halleysche Komet 1986 erschien, hatte sich der Ansatz der wissenschaftlichen Revolution für den Erkenntnisgewinn in einem Maß bewährt, dass selbst Drittklässler wie ich über den Schalenaufbau der Erde Bescheid wussten. An jenem Tag im Ocala National Forest bauten mein Vater und ich eine Bank, indem wir Kanthölzer auf Abschnitte eines Baumstamms nagelten. Als Schreinerarbeit war das keine besondere Herausforderung, aber in meiner Erinnerung brachten wir den größten Teil des Tages damit zu. Dann machten wir Feuer, brieten uns ein paar Hotdogs und warteten, bis es richtig dunkel wurde — oder so dunkel, wie es in Zentral-Florida 1986 eben wurde.
Es fällt mir schwer zu erklären, wie viel mir diese Bank bedeutete — wie wichtig es war, dass mein Vater und ich etwas zusammen geschaffen hatten. Aber an diesem Abend saßen wir nebeneinander auf unserer Bank, die gerade breit genug für uns beide war, reichten den Feldstecher hin und her und sahen uns Halleys Kometen an, einen weißen Fleck am blauschwarzen Himmel.
Meine Eltern haben die Hütte vor nun schon fast 20 Jahren verkauft, aber kurz vorher war ich mit Sarah noch einmal übers Wochenende dort. Wir hatten gerade erst begonnen uns zu daten. Ich führte sie hinunter zur Bank, die immer noch da war. Die massiven Beine waren von Termiten zerfressen und die Kanthölzer verzogen, aber unserem Gewicht hielt sie immer noch stand.
*
Der Halleysche Komet ist beileibe nicht der monolithische kugelförmige Miniplanet, den ich mir immer vorgestellt habe, sondern eher ein erdnussförmiger Klumpen aus vielen verschiedenen Steinen — ein »schmutziger Schneeball«, wie es der Astronom Fred Whipple einmal beschrieb. Der Kern dieses schmutzigen Schneeballs ist gut 15 Kilometer lang und 7 Kilometer breit, aber sein Schweif aus ionisierten Gas- und Staubpartikeln reicht bis zu 100 Millionen Kilometer weit durchs Weltall. Im Jahr 837 n. Chr. kam der Komet der Erde sehr viel näher als üblich, und sein Schweif erstreckte sich über mehr als die Hälfte des Himmels. Als Mark Twain 1910 im Sterben lag, wanderte die Erde sogar durch den Schweif des Kometen. Die Leute kauften Gasmasken und Anti-Kometen-Schirme, um sich vor den Gasen zu schützen.
Dabei stellt der Komet Halley für uns keine Gefahr dar. Er hat zwar ungefähr dieselbe Größe wie das Objekt, das vor 66 Millionen Jahren auf der Erde einschlug und zum Aussterben von Dinosauriern und vielen anderen Arten führte, aber er befindet sich nicht auf Kollisionskurs mit uns. Im Jahr 2061 wird er der Erde allerdings fünfmal näher kommen als 1986. Am Nachthimmel wird er nicht nur Jupiter, sondern auch sämtliche Sterne überstrahlen. Ich bin dann 83 — wenn ich Glück habe.
Wenn man die Zeit in Halleys misst, anstatt in Jahren, dann sieht Geschichte gleich anders aus. Als uns der Komet 1986 besuchte, brachte mein Vater einen Personal Computer mit nach Hause — den ersten in unserem Wohnviertel. Einen Halley zuvor kam gerade die erste Filmversion von Frankenstein heraus. Beim Halley davor reiste Charles Darwin gerade auf der HMSBeagle um die Welt. Einen Halley davor waren die Vereinigten Staaten noch keine vereinigten Staaten. Einen Halley zuvor herrschte in Frankreich noch Ludwig XIV.