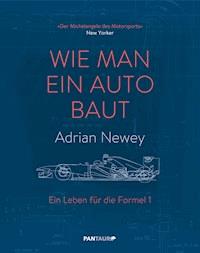
26,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 22,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: PANTAURO
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
»Der Michelangelo des Motorsports« NEW YORKER In »Wie man ein Auto baut« erzählt Adrian Newey von seiner unvergleichlichen, 35-jährigen Karriere im Formel-1-Zirkus: von den Autos, die er konstruiert hat, von den Fahrern, mit denen er zusammengearbeitet hat, und von den Rennen, an denen er mitgewirkt hat. Illustriert mit bisher unveröffentlichten Fotos und Konstruktionsskizzen, zeigt seine außergewöhnliche Lebensgeschichte, was diesen Sport so einzigartig macht: die totale Verschmelzung von Mensch und Maschine, die perfekte Kombination von Stil, Effizienz und Geschwindigkeit. Bereits im Alter von zwölf Jahren fertigte Adrian Newey seine ersten Konstruktionspläne für Autos an, als wahres Ingenieursgenie dachte er schon damals instinktiv nach den Prinzipien von Form und Gestaltung. Auf die frühen Erfolge im IndyCar folgte eine beispiellose Karriere in der Formel 1, wo er unter anderem die Weltmeister-Autos für Alain Prost, Mika Häkkinen und Sebastian Vettel konstruierte, immer mit dem einen Ziel: das Auto schneller zu machen. Neben vielen Triumphen stehen aber auch Tragödien, etwa Ayrton Sennas tödlicher Unfall 1994, als Newey für Williams tätig war. Adrian Newey, vom New Yorker als »Michelangelo des Motorsports« geadelt, schildert nicht nur 35 Jahre Formel-1-Zirkus. Er zeigt vielmehr auf umfassende und unterhaltsame Weise, wie ein Rennauto tatsächlich funktioniert. Eine bemerkenswerte Autobiografie und zugleich eine große Geschichte der Technik und des Sports. "Es ist ein Werk für Insider, aber auch für Leute, die an Sonntag-Nachmittagen gelegentlich bei der Formel 1 im Fernsehen hängen bleiben und ein bisschen mehr darüber erfahren wollen, warum ein Auto so schnell im Kreis fahren kann. Newey führt an der Hand in ein Umfeld, in der höchste Präzision, Gefühle des Alltags und Zufälle aufeinanderprallen." SALZBURGER NACHRICHTEN »Während die Rennwagen für das Erlöschen der Roten Ampeln bereitgemacht werden, geht er langsam die Wagen der Rivalen ab. Es wirkt, als würde er in dieser Zeit die Autos Zentimeter für Zentimeter mit seinen hellwachen Augen scannen. Vielleicht hat ja ein Kollege eine bessere Idee gehabt? Bei Newey schwer vorstellbar.« HANDELSBLATT
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 626
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
WIE MAN EIN AUTO BAUT
WIE MAN EIN AUTO BAUT
Adrian Newey
Aus dem Englischen übersetzt von Martin Bayer
Die englischsprachige Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel
How to Build a Car bei HarperCollins Publishers Ltd, London.
Alle Abbildungen im Buch wurden übernommen mit freundlicher Genehmigung des Autors, mit Ausnahme von: S. 57 (ISC Images & Archives/Getty Images), 77 (Bob Harmeyer/Archive Photos/Getty Images), 119 (Pascal Rondeau/Allsport/Getty Images), 153 (National Motor Museum, Beaulieu), 187 (GP Library/Universal Images Group/Getty Images), 199 (Paul-Henri Cahier/Getty Images), 229 (National Motor Museum, Beaulieu), 250 (Clive Mason/Getty Images), 291, 307 (bd. Mark Thompson/Getty Images), 341 (Athit Perawongmetha/Getty Images), 365 (Victor Fraile/Corbis/Getty Images).
Wir haben uns bemüht, alle Rechteinhaber ausfindig zu machen. Sollten Sie dahingehend Versäumnisse feststellen, so bitten wir Sie, dies zu entschuldigen und uns die korrekten Nachweise für etwaige Nachauflagen mitzuteilen.
Sämtliche Angaben in diesem Werk erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr.
Eine Haftung der Autoren bzw. Herausgeber und des Verlages ist ausgeschlossen.
1. Auflage 2018
Copyright © 2017 by Adrian Newey
Copyright © der deutschen Ausgabe 2018 Pantauro Verlag bei Benevento Publishing Salzburg–München, eine Marke der Red Bull Media House GmbH, Wals bei Salzburg, übersetzt unter Lizenz von HarperCollins Publishers Ltd.
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags, der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen sowie der Übersetzung, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Redaktion: Annette Krüger, Hamburg; Werner Jessner, Heiligenkreuz
Satz: MEDIA DESIGN: RIZNER.AT
Gesetzt aus Verlag, Plantin Std.
Umschlaggestaltung: www.b3k-design.de, Andrea Schneider, diceindustries, unter Verwendung einer Vorlage von Dominic Forbes
© HarperCollins Publishers Ltd 2017 und Originalzeichnungen von Adrian Newey
ISBN 978-3-7105-0031-2
eISBN: 978-3-7105-5001-0
INHALT
PROLOG
AM START
Runde 1WIE MAN EINEN MARCH 83G BAUT
Runde 2WIE MAN EINEN MARCH 86C BAUT
Runde 3WIE MAN EINEN 881 BAUT
Runde 4WIE MAN EINEN FW14 BAUT
Runde 5WIE MAN EINEN FW16 BAUT
Runde 6WIE MAN EINEN FW18 BAUT
Runde 7WIE MAN EINEN MP4 13 BAUT
Runde 8WIE MAN EINEN MP4 20 BAUT
Runde 9WIE MAN EINEN RB5 BAUT
Runde 10WIE MAN EINEN RB6 BAUT
Runde 11WIE MAN EINEN RB8 BAUT
EPILOG
GLOSSAR
DANK
REGISTER
PROLOG
Es war ein bewölkter Tag, Regen war vorhergesagt. Ich wusste, dass ich beobachtet wurde, und wurstelte mich mehr oder weniger elegant ins Cockpit des FW15. In wenigen Minuten würde ich im reifen Alter von 34 Jahren, nach zehn Jahren im Geschäft und mit zwei Titeln als Konstrukteursweltmeister in der Tasche, meine erste echte Runde in einem Formel-1-Wagen drehen – genau genommen meine erste echte Runde auf einer Rennstrecke überhaupt.
Es war 1993, ich war damals Chefdesigner bei Williams. Der Eigentümer des Rennstalls, Frank Williams, hatte sich überreden lassen, einen Journalisten für eine Runde ans Steuer eines unserer Wagen zu lassen. Sozusagen eine PR-Fahrt. Patrick Head, Mitgründer und technischer Leiter des Teams, fand die Idee so gut, dass er auch den leitenden Ingenieuren – sich selbst, mir und Bernard Dudot, der für die Entwicklung des Renault-Motors zuständig war – eine Runde am Steuer verschrieb.
Da saß ich jetzt also in der Box des Circuit Paul Ricard in Südfrankreich und erlebte all das aus dem Blickwinkel des Fahrers, worauf ich als Ingenieur nie so richtig geachtet hatte: den Ablauf der Startprozedur; das Jaulen und Brüllen des Motors – das Gefühl von Abgeschlossenheit und Einsamkeit im Cockpit, als ob allein schon die Lautstärke, die einem bis in die Knochen fährt, reichen würde, den Körper bewegungslos festzuhalten. Die Angst sorgt für ein intensives klaustrophobisches Gefühl.
»Schön weich einkuppeln, sonst würgst du ihn ab«, hatten sie mich gewarnt.
Abwürgen wollte ich den Motor auf keinen Fall. Da sprach der Stolz aus mir: Ich hatte den Wagen entworfen, ich würde ihn nicht abwürgen – als gäbe es einen Preis dafür.
Ich würgte ihn ab. Carbon-Kupplungen sind halt ziemlich aggressiv. Man muss mit dem Einkuppeln warten, bis der Motor 5500 Umdrehungen erreicht hat, das Drehzahllimit eines normalen Pkw-Motors. Dabei habe ich das Gaspedal kaum gestreichelt.
Sie warfen ihn wieder an, und beim zweiten Versuch schaffte ich es tatsächlich loszufahren. Ich nahm die Sache durchaus ernst. Auf der Geraden stellte ich die Traktionskontrolle ziemlich sanft ein, um mehr Sicherheit zu haben, aber es fühlte sich trotzdem an, als würde ich mit dem Wagen einen Ringkampf austragen, anstatt ihn zu fahren. Ich trug meinen Motorradhelm und befürchtete ständig, er werde mir vom Kopf gesaugt; der Kinnriemen würgte mich. Das Heulen des Motors war mir schon im Leerlauf infernalisch vorgekommen, aber auf der Strecke hörte es sich an, als sei im Cockpit der Dritte Weltkrieg ausgebrochen. Der Lufteinlass liegt ja direkt über dem Kopf des Fahrers; mir kam es vor, als ob der V10 mich anbrülle. Durch die ungeheure Beschleunigung blieb mir der Atem weg. Es fühlte sich an, als wollte mich der Wagen abschütteln, als würde er meine unbeholfenen Versuche, ihn zu kontrollieren, durchschauen. Wir glauben ja immer, dass wir unsere Maschinen beherrschen, aber für diese hier galt das definitiv nicht: 780 PS in einem Wagen, der ohne den Fahrer nur eine halbe Tonne wog, mit mir, der ich mitsamt Ausrüstung nicht mehr als 80 Kilo mitbrachte, also 580 Kilo – das ist ein sehr, sehr gutes Gewicht-Leistungs-Verhältnis. Und es war überwältigend.
Die Kupplung war damals noch ein linkes Pedal – inzwischen ist sie ans Lenkrad gewandert. Man benutzt sie ohnehin nur einmal, beim Anfahren, dann ist das linke Bein unbeschäftigt. Das rechte benutzt man dafür, Gas zu geben – wenn es nicht gerade dem Impuls, auf die Bremse zu wechseln, nachgibt und nach links wandert. Geschaltet wurde schon mit der flachen Schaltwippe am Lenkrad, damals eine neue Entwicklung, die den Weg noch nicht in Serienautos gefunden hatte. Grün, grün, orange: Drei Kontrollleuchten zeigten an, wann die Drehzahl hoch genug war, um in den nächsten Gang hochzuschalten. Ich sollte jeweils bei 14 000 Umdrehungen höher schalten.
Bei 13500 blinkt das erste grüne Licht auf. Man macht sich bereit.
Das zweite grüne folgt bei 13700. Gleich.
Bei 13900 leuchtet das orangefarbene Licht auf. Jetzt.
Schalten.
Das Ganze dauert ungefähr eine halbe Sekunde.
Langsam gewöhnte ich mich an den Lärm und bekam das Gefühl, als beherrsche ich tatsächlich den Wagen und nicht er mich. Mir fiel auf, wie intuitiv einfach die Bedienung war. Grün. Grün. Orange. Schalten. Ich sah den Kurs von Paul Ricard auf einmal aus einem neuen Blickwinkel und das Fahren eines Formel-1-Wagens aus einer ganz anderen Perspektive. Ich war über vierzig, als mich das Virus, tatsächlich selbst Rennen zu fahren, anstatt nur die Wagen zu entwerfen, richtig packte – aber die erste Infektion holte ich mir schon in diesem Augenblick.
Es fing zu regnen an. Genauer gesagt, es schüttete. Ich war ein bisschen zu selbstsicher geworden, und diese Kombination aus unerfahrenem Piloten, der sich zu viel zutraut, und Regen war gefährlich. Mein Ingenieurs gehirn begann darüber nachzudenken, wo man das untätige linke Bein besser unterbringen könnte, damit sich das Chassis noch ein bisschen schmaler und strömungsgünstiger gestalten ließ, und schon konzentrierte ich mich nicht mehr auf die Strecke. Der eine Moment Unaufmerksamkeit genügte, dass ich mit dem FW15 ins Schleudern geriet.
Zum ersten Mal am Steuer eines F1-Wagens, Ende ’93. Komischerweise sieht man mir nicht an, wie viel Angst ich hatte!
Das Gute an der Rennstrecke von Paul Ricard ist, dass sie jede Menge Auslaufzonen neben und Platz an der Strecke bietet. Man muss weit fliegen, um irgendwo anzuprallen, und das passierte mir nicht, nein, aber, ja, ich kuppelte zu langsam aus und ja, ich würgte den Motor wieder ab.
An Bord eines Formel-1-Wagens gibt es keinen Anlasser. Gerät man ins Schleudern und schafft es nicht, den Motor am Laufen zu halten, hat man zwei Probleme: Erstens ist der Motor aus, sodass Mechaniker mit einem Boxenstartermotor zu einem hinausfahren müssen, um einen wieder ins Geschäft zu bringen; zweitens steckt der Motor noch in dem Gang fest, in dem er beim Abwürgen war, und weil die Gangschaltung hydraulisch betrieben wird und erst dann wieder funktioniert, wenn sie vom Motor Saft bekommt, kann man nicht herunterschalten, wenn der Motor nicht läuft. Den können die Mechaniker aber nicht anlassen, solange noch der Gang drin ist, weil sich der Wagen dann sofort in Bewegung setzen würde. Sie bringen also einen kleinen Knarrenschlüssel mit und schaukeln den Wagen von Hand vor und zurück, während sie mit der Knarre am Ende des Schalthebels schrauben, bis das Getriebe im Leerlauf angekommen ist. Erst dann können sie den externen Startermotor ansetzen, den Motor anwerfen und dich wieder auf die Strecke bringen.
Also wartete ich. Nach fünf Minuten kamen die Mechaniker in einem Mietwagen. Mein Missgeschick brachte ihnen ein bisschen Abwechslung in den Tag, und ja, ich musste mir ein paar flapsige Sprüche anhören. Als alles wieder in Ordnung war, zog ich los, drehte Runde um Runde, fand mich immer besser hinein und fühlte mich immer mehr eins mit dem Wagen. Wie schnell ich war? Gute Frage. In Monza lässt die Strecke bis zu 350 Stundenkilometer zu. In Paul Ricard schaffte ich damals um die 280 Sachen – Alain Prost oder Damon Hill hätten sich damit in diesem Wagen nicht zufriedengegeben, aber für einen 34 Jahre alten Ingenieur beim ersten Mal am Steuer war es schnell genug.
Als ich dann im Juni darauf im FW15 gegen Christian Fittipaldi und Martin Brundle beim Goodwood Festival of Speed im »Hillclimb« antrat, war ich mit der Fahrtechnik schon ganz gut vertraut. Einen Formel-1-Wagen einfach nur zu fahren ist nämlich wirklich einfach. Gas geben, grün, grün, orange, schalten. Bremsen, lenken, durchziehen, beschleunigen. Einfach. Wie ein Videospiel.
Das Kunststück ist es, dabei schneller zu sein als alle anderen, ohne abzufliegen. Und das ist die eigentliche Herausforderung.
AM START
KAPITEL 1
Ich wurde 1958 geboren, zu einer Zeit, als alle Welt verrückt nach Autorennen war: Scalextric, Formel 1, die Monte-Carlo-Rallye. Mit zehn Jahren schaute ich zu, wie ein Lamborghini über einen Abhang stürzte und wie Mini Coopers Jagd auf Maschinen machten. Und als Kowalski in seinem Dodge Charger in den fünften Gang schaltete und den Cops in Fluchtpunkt San Francisco davonzog, rief ich verblüfft: »Er hat noch einen Gang!« Danach versuchte ich mich in meinem Kinositz zu verstecken, weil sich sämtliche Zuschauer umgedreht hatten und mich anstarrten.
Ich verschlang die Zeitschrift Autosport, die wöchentliche »Bibel« aller Motorsportbegeisterten. Während der Marathon-Rallye 1968 war ich nicht vom Radio wegzubekommen. Schon als Sechsjähriger wusste ich genau, dass meine Zukunft im Motorsport lag. Als Zwölfjähriger wusste ich, dass ich Rennwagen entwerfen wollte.
Beim Spielen mit der Scalextric-Modellrennbahn.
Meine Leidenschaften wurden zu Hause geprägt. Unser Haus lag am Ende einer ländlichen Nebenstraße in einem Vorort von Stratford-upon-Avon. Das Grundstück grenzte hinten an einen stinkenden Schweinemastbetrieb, wo mein Vater mit seinem Geschäftspartner Brian Rawson eine Tierarztpraxis betrieb. Er behandelte Kleintiere ebenso wie das Nutzvieh der umliegenden Bauernhöfe, und ich war schon von klein auf gewöhnt, ihm als Assistent den Wassereimer und die Kälberstricke zu reichen. Ich habe so viele neugeborene Kälber und Lämmer gesehen, dass es mir für mein ganzes Leben reicht.
Meine Mutter Edwina war eine attraktive Frau; ein toller Fang. Während des Kriegs hatte sie als Krankenwagenfahrerin gearbeitet. Meinem Vater war sie begegnet, als sie ihren kranken Pyrenäen-Hirtenhund zu ihm in die Praxis gebracht hatte. Ihr Vater hatte den neuen Verehrer sofort abgelehnt. »Der kommt mir nur über meine Leiche ins Haus«, hatte er geknurrt. Am Tag bevor mein Vater zum ersten Mal zu Besuch kommen sollte, starb Edwinas Vater prompt an einem Herzinfarkt.
Ich wurde am Boxing Day geboren, am zweiten Weihnachtsfeiertag. Die etwas wilde Geschichte, die dazu kursiert, geht so, dass meine Eltern gerade in der Gegend von Colchester, offensichtlich mit einer Hebamme auf dem Rücksitz in Bereitschaft, unterwegs waren, als bei meiner Mutter die Fruchtblase platzte. Es waren andere Zeiten, klar, aber auch damals bekam man wohl keine ständige Hebamme zugeteilt, falls plötzlich die Wehen einsetzten, und was sie an Weihnachten bei meinen Eltern wollte, weiß ich auch nicht. Jedenfalls klopfte mein Vater an die nächstbeste Haustür, freundliche Fremde nahmen sie auf, und schon war meine Mutter entbunden, und ich lag in einer Kommodenschublade als provisorischer Wiege.
Dann kamen die 1960er-Jahre, und meine Mutter fühlte sich vom Lebensstil der Hippies angezogen. Sie zog sich entsprechend an und war als Blumenkind damals in Stratford ein ziemlich exotischer Anblick. Sie hatte bereits einen Sohn aus erster Ehe namens Tim, was damals, als Scheidungen noch selten waren, recht ungewöhnlich war. Tim ist sieben Jahre älter als ich, und wir hatten verschiedene Interessen. Wir stritten uns immer lebhaft darum, ob wir im Fernsehen die Hitparade Top of the Pops oder die Abenteuerserie Thunderbirds anschauen sollten, die zur selben Zeit auf BBC1 und ITV liefen, aber der Altersunterschied bedeutete, dass er bald ins Internat Repton geschickt wurde und dann an die Universität ging. Später zog er nach Spanien; er gibt dort Englischkurse für Kinder. Wir sehen uns einmal im Jahr beim Grand Prix in Barcelona und freuen uns immer sehr darauf.
Sowohl mein Vater wie auch meine Mutter hatten ein ziemlich unbeherrschtes Temperament, und als angehender Teenager musste ich einige furchtbare Streitigkeiten mit ansehen. Mum zog mich immer hinein und wollte, dass ich ihre Partei ergreife, was ich im Nachhinein etwas unfair finde.
Einmal setzte ich mich aufs Rad und fuhr einfach los, um den beiden Streithähnen zu entkommen. Nach einer Stunde radelte ich dann doch lieber nach Hause zurück. Als ich bereits wieder in unserer Nebenstraße war, kam mir sehr, sehr langsam unser roter Lotus Elan (Nummernschild UNX 777G) entgegen, und im ersten Moment dachte ich verblüfft, keiner säße am Steuer. Erst als ich näher kam, konnte ich meine Mum hinter der Scheibe erkennen. Wie sie es so zu fahren schaffte – weiß der Himmel. Sie hing so tief im Fahrersitz, dass sie sich an den Masten der Telefonleitung orientiert haben muss.
Um durchzuhalten, griff meine Mutter bisweilen zur Flasche, stritt allerdings hartnäckig ab, Trinkerin zu sein, und beharrte darauf, dass sie sich nie allein einen Drink eingoss, sondern immer wartete, bis mein Vater abends gegen 19 Uhr aus der Praxis kam.
Direkt neben der Schrankbar hatte unser afrikanischer Graupapagei Goni seinen Käfig. Eines Abends, als mein Vater meiner Mutter ihren Lieblingsdrink mixte, fing Goni an, die Geräusche nachzumachen: das Ploppen, mit dem der süße Martini entkorkt wurde; das gluckernde Eingießen; »quietsch-quietsch« – die Schraubkappe der Ginflasche, gefolgt von erneutem Gluckern, schließlich das Klingeln der Eiswürfel und die Stimme meiner Mutter: »Ah, das tut gut!« Vom Papagei verpfiffen.
Auf eins konnte man sich bei ihnen aber verlassen: ihre Unberechenbarkeit. Spießig waren sie jedenfalls nicht. Als ich 13 war, schlug mein Bruder Tim, der gerade auf Semesterferien von der University of Bath zu Hause war, einen Familienausflug ins Kino vor, um Kubricks Uhrwerk Orange zu sehen. Der Film war erst ab 18 freigegeben, aber meine Eltern hatten nichts dagegen, dass ich mich als Erwachsener verkleidete – mit Hut, Brille und dem Trenchcoat meines Bruders –, um hineinzukommen. Allerdings schimpften sie anschließend mit Tim, weil er den Film empfohlen hatte. Zu offensichtlich hatte dieser ihre Bemühungen um eine liberale Erziehung mit dem Drang, ihre Kinder zu beschützen, in Konflikt gebracht.
Der Film beeindruckte mich tatsächlich so sehr, dass er sich tief in meinem Unterbewusstsein einnistete. Als ich ihn mir 40 Jahre später schließlich noch einmal anschaute, stellte ich fest, dass ich mich fast an jede Szene erinnerte. Die kühl komponierten Bilder, der stilisierte Hyperrealismus und die brutale Gewalt zur Begleitung synthetischer Beethovenklänge hatten etwas in mir bewirkt, was ich damals überhaupt nicht verstand.
Wir waren nicht gerade superreich, aber arm waren wir auch nicht. Zu den Honoraren meines Vaters als Tierarzt kamen noch die Dividenden seiner Anteile am Familienbetrieb Newey Brothers in Birmingham.
Die Traditionsfirma Newey Brothers wurde bereits 1798 gegründet und stieg mit der Zeit zum führenden britischen Hersteller von Haken und Ösen, Schnürösenverschlüssen für Kleider, Karabinerhaken für die Armee und Zeltheringen auf. 1947 kamen noch »Sta-Rite«-Haarnadeln und »Wizard«-Einfädelnadeln zum Sortiment hinzu. Noch heute kann man Ösenverschlüsse mit dem Markennamen Newey kaufen. Zweifellos dank dieser Extraeinnahmen konnte mein Vater sein Autohobby so ausgiebig betreiben – er fuhr seine Wagen nicht nur (und das auch noch ausgiebig), sondern bastelte und schraubte an ihnen herum und pflegte sie liebevoll.
Das war sein wahres Fachgebiet. Obwohl er sich im Studium auf die Biologie gestürzt hatte, um Karriere zu machen, schlug sein Herz für die Technik. Er las mathematische Fachbücher wie andere Väter einen Schmöker von John le Carré, begeisterte sich für die Ingenieurskunst, und die Fragen: Wie kann ich das anders machen? Wie kann ich es besser machen? waren eine Herausforderung, die er nur zu gern annahm. Heute, in der Formel 1, studieren wir Jahr für Jahr jede Einzelheit des technischen Reglements für die kommende Saison, und eine meiner Aufgaben – vielleicht sogar meine liebste – ist es, ins Praktische zu übersetzen, was in den Vorschriften tatsächlich steht – nicht, was die Regelmacher damit erreichen wollen. Dieser feine Unterschied öffnet oft ganz neue Wege. Ich frage mich sozusagen immer: Wie kann ich diese Vorschriften so interpretieren, dass ich etwas machen kann, das noch nie jemand vor mir probiert hat?
Diese Denkweise liegt mir einfach. Ich habe ja auch früh genug damit angefangen; mein Vater war ein ausgezeichneter Lehrmeister darin.
Es ist kein Wunder, dass eine Kombination aus der unkonventionellen Denkweise meines Vaters, seiner Autobegeisterung und seiner Bastelleidenschaft zu einer meiner frühesten Erinnerungen führte: Ich bin fünf Jahre alt, schaue aus dem Treppenhausfenster – und sehe Rauch aus den Fenstern der Garage quellen.
Unsere Garage – damals ein Anbau des Wohnhauses – war für einen Fünfjährigen eine Schatzhöhle. Dad bunkerte sich stundenlang darin ein, bastelte an den Autos und grübelte an Problemlösungen.
Zum Beispiel: Wie behandelt man Zaunpfosten richtig gründlich mit Karbolineum? Jeder normale Mensch hätte sich einfach darangemacht, ihnen einen zweiten Anstrich zu verpassen. Mein Dad hatte eine bessere Idee. Er schnitt die Bodenbleche einiger leerer Castrol-GTX-Öldosen ab, lötete die Dosen zu einer langen Röhre zusammen, stellte dann die Pfosten hinein und füllte das Ganze mit Karbolineum auf. So saugten sich die Pfosten automatisch richtig mit dem Fäulnisschutzmittel voll – einfach und effizient. Hätte es zumindest sein können. Verrückt, aber genial jedenfalls, so wie die eigenständig ausgetüftelten hand-gemachten Behälter für seine tiermedizinischen Instrumente im Kofferraum, seine selbst gebastelten Gartenwerkzeuge oder die Art und Weise, wie er das Packen für Campingfahrten nach Brecon Beacons oder Schottland anging: Er nahm einen Monat im Voraus eins unserer Schlafzimmer in Beschlag, baute eine Waage auf, um alles genauestens abzuwiegen, und sparte dermaßen fanatisch Gewicht ein, dass er sogar den Zahnbürsten die Griffe kürzte. Er hatte ein Auge fürs Detail – ein weiterer Charakterzug, der auf mich abgefärbt hat. Ich bin nicht gerade ein ordentlicher Typ – in der Familie hieß es immer, mein Vater und ich seien so unordentlich wie ich und mein Vater –, aber bei der Konzeption und dem Design von Rennwagen ist ein Auge für kleinste Details unverzichtbar.
Besonders typisch für meinen Vater war, dass er sich einen feuchten Dreck um Sicherheitsbedenken scherte, womit ich wieder bei den Zaunpfosten in ihrem Karbolineumbad wäre. Was er bei seiner genialen Methode, sie zu marinieren statt zu streichen, nicht bedacht hatte, waren die in der Garage aufgestellten Paraffinheizer, die verhindern sollten, dass bei den Motoren des Riley RMF (Nummernschild VCD 256 – ein wunderschönes Auto, das ich sehr mochte) und des roten Saab 96 mit Zweitaktmotor (den ich wegen seines hässlichen Lärms verachtete) die Ölwanne einfror.
Es kam, wie es kommen musste. Die Zaunpfosten, lässig aufrecht hingestellt, waren umgefallen, das Karbolineum war ausgelaufen, auf das brennende Paraffin getroffen – und wumm!
Beim Anblick der Flammen schossen mir zwei Gedanken durch den Kopf. In welcher Reihenfolge, weiß ich nicht mehr, aber fürs Protokoll seien sie hier angegeben: (1) Ich muss meinen Eltern Bescheid sagen und die Feuerwehr rufen, (2) Ich hoffe, der Saab ist hin und nicht der Riley.
Nachdem ich (1) umgesetzt hatte, liefen wir zur Garage und versuchten die Flammen selbst zu löschen. Dann wurde es richtig aufregend; die Feuerwehr kam und scheuchte uns vom Brandherd weg, damit wir die Einsatzkräfte nicht behinderten. Ich war natürlich traurig über den Schaden, aber auch erleichtert, dass ich nicht daran schuld war.
Murphys Gesetz ließ sich übrigens nicht austricksen: Natürlich war es der Riley, der gelitten hatte, nicht der blöde Saab.
Der Riley, den das Feuer in der Garage beschädigte.
KAPITEL 2
Ich habe einen Fahrer, der mich zur Arbeit und wieder nach Hause bringt. Entschuldigung, wenn das nach Angeberei klingt, aber es hat einfach praktische Gründe. So habe ich ein bisschen Zeit, meine E-Mails durchzusehen (ich lasse sie immer ausdrucken; das ist zwar nicht sehr ökologisch, aber so kann ich auf den Ausdrucken herumkritzeln und mir Notizen machen) und vor allem nachzudenken. Meine Gedanken drehen sich, wenn nichts dazwischenkommt, eigentlich immer um Gestaltung und Formen, um Probleme und Lösungen, und ich verliere mich leicht in ihnen. Früher kam ich oft zu spät, weil ich vor lauter Geistesabwesenheit falsch abgebogen war oder meine Ausfahrt verpasst hatte. Jetzt habe ich also aus Zeitgründen und wegen der Pünktlichkeit einen Chauffeur.
Mein Büro bei Red Bull Racing in Milton Keynes hat Fenster auf den Parkplatz hinaus und liegt in einer Ecke des Technikzentrums, in dem 200 Ingenieure ihren Arbeitsplatz haben. Meetings und Verwaltungsaufgaben versuche ich möglichst auf das Mindestmaß zu beschränken und verbringe den größten Teil des Arbeitstags am Zeichenbrett mit dem Entwurf für den Wagen des nächsten Jahres oder Evolutionsstufen des aktuellen Modells. Woran auch immer ich gerade arbeite, das Ziel ist immer dasselbe, und es begleitet mich schon meine gesamte Karriere hindurch: das Auto schneller, besser zu machen.
Es ist übrigens ein echtes Zeichenbrett – als ich in der Branche anfing, gab es noch keine CAD-Systeme (Computer-Aided Design), und obwohl die meisten Kollegen inzwischen darauf umgestellt haben, bin ich bei meinem Zeichenbrett geblieben. Nennen Sie mich ruhig einen Dinosaurier, aber für mich ist das Zeichenbrett sozusagen meine Muttersprache; es ist ein Stück Kontinuität, und Kontinuität ist mir sehr wichtig. Ich versuche sie immer zu erhalten. Würde ich auf CAD umstellen, müsste ich neu lernen, und das kostet nicht nur Zeit, sondern birgt auch das Risiko, dass ich mich in der neuen Sprache nicht so gut ausdrücken könnte wie in der alten.
Außerdem hat ein Zeichenbrett viele handfeste Vorteile: Man kann Teile im Originalmaßstab zeichnen, während ein CAD-System alles auf die Größe des Monitors beschränkt; und ich kann aus der freien Hand skizzieren und jeden Strich ganz nach Belieben ändern. Wie schnell ich arbeite, sieht man daran, dass ich, wenn ich voll in Fahrt bin, zwei Mitarbeiter brauche, die meine Zeichnungen in CAD-Dateien umsetzen. Und das sind nur die Skizzen, die ich für gut genug halte, um weiterverwendet zu werden; bis ich dahin komme, haben sie schon mehrere Versionen durchlaufen; mein Radiergummiverbrauch liegt nur knapp unter meinem Verschleiß an Bleistiftminen.
Am liebsten befasse ich mich mit Design-Revolutionen nach großen Reglementänderungen. Beim RB7, dem Wagen von 2011, gab es so einen Fall: Ich musste ihn so re-designen, dass das neue KERS-System Platz fand. KERS steht für Kinetic Energy Recovery System, also »Rückgewinnungssystem für kinetische Energie«, und speichert die beim Bremsen frei werdende Kraft in einer Batterie, um sie beim Beschleunigen wieder nutzbar zu machen.
Andere Designer meinten, die Batterie bringe man am besten unter dem Tank an. Gut, dort wäre sie nahe am Schwerpunkt, einigermaßen kühl und leicht zu verkabeln. Ich wollte aber aus aerodynamischen Gründen den Motor möglichst weit nach vorn im Rumpf verschieben, um das Heck der Karosserie schmaler gestalten zu können, und das ging eben am besten, wenn man die schwere KERS-Batterie nach hinten packte, sodass der Motor weiter vorn ein Gegengewicht zu ihr bildete. Meine Idee war also, die Batterie zwischen Motor und Getriebe zu zwängen.
Ich schlug das unserem Chefdesigner Rob Marshall vor. Seine Reaktion war ein tiefer Seufzer. »Du willst also die Batterien« – bekanntlich sehr empfindliche Teile, anfällig für Vibrationen, Kurzschlüsse, Hitze – »ausgerechnet zwischen Zylinderblock und Getriebegehäuse setzen, wo es richtig heiß wird und alles dauernd vibriert? Bist du sicher?«
Ich gab nicht nach. »Schau, Rob, ich weiß auch, dass es schwierig wird, aber wenn wir sie dort einbauen, verschafft uns das einen beträchtlichen Vorsprung, und zwar für die ganze Saison. Die anderen Teams können das in dieser Saison nämlich nicht einfach kopieren, weil sie dazu den Wagen grundlegend neu konzipieren müssten.«
Rob zog also los und besprach die Sache mit seinen Ingenieuren im Designbüro. Als er zurückkam, schüttelte er den Kopf. »Wird leider nichts. Sie sagen alle, es geht einfach nicht.«
Zeichnung 1: Position des KERS-Systems im RB7.
Mein Gefühl sagte mir, es müsse trotzdem irgendwie möglich sein. Ich zeichnete ein paar Entwürfe, in denen die Batterie in vier Zellen zerlegt war, zwei davon im Getriebegehäuse direkt vor der Kupplung und zwei direkt daneben, aber außerhalb des Getriebegehäuses. Sie saßen in eigenen kleinen Gehäusen, zu denen ich zusätzlich noch ein paar Kühlluftzuführungen zeichnete; eine Wasserkühlung hatten sie ohnehin schon.
Zum Glück ist Rob nicht nur ein Designer mit viel Kreativität, sondern auch einer mit der Einstellung, dass man etwas versuchen muss, wenn mehr Performance dabei herausspringt. Das war eine mutige, vielleicht sogar tollkühne Entscheidung – hätte es nicht funktioniert, wäre die Saison für uns verloren gewesen.
Es dauerte noch länger, als ich schon befürchtet hatte. Zu Anfang der Saison überlud sich die KERS-Batterie dauernd und war immer kurz davor, in Flammen aufzugehen. Als sie dann aber endlich zuverlässig funktionierte, verschaffte uns unser radikales Design tatsächlich einen uneinholbaren Vorteil für den Rest der Saison 2011 und legte gleichzeitig den Grundstein für die Verteidigung des Weltmeistertitels in den Jahren 2012 und 2013. Das tat meiner Vorliebe für Kontinuität richtig gut.
Wenn es altmodisch wirkt, dass ich immer noch am Zeichenbrett mit dem Bleistift arbeite, dann ist das noch gar nichts gegen meine ersten Schuljahre. Mit vier Jahren wurde ich in die örtliche Klosterschule geschickt. Die Nonnen, die dort unterrichteten, hielten es für Teufelswerk, wenn man Linkshänder war. Ich musste auf der bösen linken Hand sitzen, als ob ich die Dämonen mithilfe meines gottgefälligen Hinterns austreiben könnte.
Es hat übrigens nicht geholfen; ich bin immer noch Linkshänder. Schlimmer war, dass ich immer noch nicht schreiben gelernt hatte, als ich aus dieser Grundschule in die Oberschule Emscote Lawn in Warwick umgeschult wurde. Das brachte mir einen Platz bei den schlechten Schülern in der Hinterbank ein. Und was machen die Kinder in der Hinterbank? Unsinn natürlich.
Meine ersten aerodynamischen Versuche fanden im Rahmen einer kurzzeitigen Mode statt, als plötzlich alle versuchten, Dartpfeile aus ihren Filzstiften zu machen und sie auf die Tafel zu werfen. Wir hielten sogar Wettbewerbe ab. Ich schnitt ganz gut ab, aber dann flog einer meiner Pfeile aus einem Grund, nach dem Sie mein zwölfjähriges Ich fragen müssten, nach oben und blieb in der Styropor-Deckenverkleidung stecken. Der Französischlehrer an der Tafel drehte sich um, als ihn das kollektiv unterdrückte Lachen alarmierte, und er sah eine ganze Klasse voller Jungen, die sich die Hand vor den Mund hielten – bis auf einen, mich, der aufrecht dasaß und mit dem harmlosesten Ausdruck geradeaus schaute.
Natürlich kam der Lehrer sofort nach hinten an meinen Tisch und wollte gerade fragen, was ich da triebe, als sich der Wurfpfeil löste, mit einem halben Überschlag hinabfiel, sodass die Spitze nach unten zeigte und sich dem Lehrer seitlich in den Hals bohrte. Die Chance, dass so etwas geschah, muss 1 zu 1000 betragen haben. Geradezu märchenhaft.
Es blieb nicht das einzige Mal, dass ich Schläge mit dem Rohrstock bekam. Das andere Mal war, als ich eine Bunsenbrennerröhre zu einem Blasrohr umfunktionierte und statt des Mitschülers, auf den ich zielte, den Physiklehrer traf.
Besonders langweilig waren die Schulfeiern mit ihren endlosen Festreden. Bei einer davon hatten mein Freund James und ich kurz vorher im Wald gespielt und dabei einige Sprühdosen gefunden, die wir dann in den Müllverbrennungsofen der Schule warfen. Wir hofften, sie würden sofort explodieren, gingen hinter Bäumen in Deckung und warteten, wurden aber enttäuscht. Als das Feuerwerk ausblieb, gaben wir schließlich auf und gingen weg.
Kurz darauf begann die Schulfeier, die Eltern versammelten sich, und alle nahmen brav ihre Plätze ein, um sich pflichtgemäß zu langweilen, als auf einmal aus dem Wald eine Reihe Donnerschläge herüberdrang und ein Ascheregen auf die Bühne niederging. James und ich tauschten einen begeisterten, aber verstohlenen Blick aus und waren froh, nicht erwischt und bestraft zu werden.
Als es darum ging, einen Heißluftballon zum Abheben zu bringen, konnte ich mein Interesse am Basteln einmal zum Guten nutzen. Inzwischen verstand ich schon, dass man etwas, das aufsteigen soll, möglichst groß macht, um ein gutes Verhältnis von Oberfläche zu Volumen zu bekommen, also baute ich einen Riesenballon aus Bespannpapier auf einem Gerüst aus Drahtkleiderbügeln und befeuerte ihn mit Brennstofftabletten. Die erzeugten aber nicht genug Wärme, um den Ballon aufsteigen zu lassen, worauf ich Dads Propanbrenner in die Schule mitbrachte. Unser Klassenlehrer kam heraus, um sich das anzuschauen, stützte sich auf den Brenner und verbrannte sich dabei die Hand, was seine Abneigung gegen mich zementierte.
Zu Hause bastelte ich die ganze Zeit an Autos herum. Mein Vater hatte damals, 1968, einen roten Lotus Elan als Bausatz gekauft (andere Familien hatten große Stufenheck-Limousinen, wir hatten zweisitzige Sportwagen), den man laut Hersteller ganz einfach – »an einem Wochenende«, selbst wenn das nicht mal mein Dad schaffte – selbst zusammenschrauben konnte und so die Luxussteuer sparte, die beim Kauf eines fertigen Autos damals fällig war. Für einen begeisterten Schrauber wie meinen Dad war das ein Geschenk des Himmels, und ich wurde sein getreuer Helfer, der sich auch durch gelegentliche heftige Wutanfälle nicht davon abschrecken ließ, zuzuschauen, wie aus einem Haufen Einzelteile ein Auto entstand.
Ich versuchte mich inzwischen an Modellbausätzen. Meine Freunde klebten meistens Messerschmitts und Spitfires zusammen, also Jagdflugzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg. Bei mir waren es natürlich Autos, und mein Lieblingsmodell war das eines Lotus 49, wie ihn Jim Clark und Graham Hill fuhren, ein Bausatz von Tamiya im Maßstab 1:12.
Lotus-Gründer Colin Chapman hatte gerade in diesem Jahr das Sponsoring auf den Autos eingeführt, und das Modell war authentisch in den Gold-Leaf-Farben lackiert und hatte lauter tolle Details wie eine bewegliche Federung – alles, was man sich nur wünschen konnte. Es war also ein richtig hochwertiges Modell, aber mir gefiel am meisten, dass alle Teile mit ihren richtigen Bezeichnungen beschriftet waren. Plötzlich konnte ich all den Einzelteilen, die ich auf dem Garagenfußboden herumliegen sah, einen Namen geben. »Aha, der untere Querlenker. Das da ist ein hinterer Achsschenkel.« Für mich war das viel schöner als Französischvokabeln.
Als ich zwölf war, wurde es mir zu langweilig, fremde Entwürfe zusammenzubauen, und ich fing an, meine eigenen zu zeichnen. Ich zeichnete damals ständig – das Einzige, was ich wirklich konnte, oder besser gesagt, das Einzige, von dem ich wusste, dass ich es konnte – und schnitt Bilder aus Autosport aus, die ich dann freihändig abzeichnete und dabei mit meinen eigenen Zusätzen aufmotzte.
Natürlich kann ich jetzt im Rückblick auf meine Kindheit leicht erkennen, wie damals die Keime gelegt wurden: das Interesse an Autos, die Bastelleidenschaft – beides von meinem Vater geerbt – und dann die erste Blüte als – so kann man vielleicht sagen – Designingenieur, eine Tätigkeit, bei der es mehr als bei einem Mathematiker oder Physiker darauf ankommt, die künstlerische Vorstellungskraft der linken Hirnhälfte – das »Und wenn ich jetzt … wäre das nicht interessant?« – mit der praktischen rechten Hirnhälfte zu kombinieren, die darauf besteht, dass alles auch wirklich funktionieren muss.
Diese Verschmelzung von Fantasie mit praktischer Umsetzung fing für mich zu Hause an. Dort im Garten stand die sogenannte Werkstatt, wie mein Vater sie bezeichnete, in Wirklichkeit ein Holzschuppen mit einer kleinen Grund ausstattung: Drehbank, Ständerbohrmaschine, eine Abkantbank für Blechfalze und ein paar Werkzeuge zur Fiberglasverarbeitung. Da schlug ich meinen Arbeitsplatz auf und machte mich daran, meine Entwürfe in die Realität umzusetzen.
Das Chassis falzte ich aus Blechen, andere Teile sägte und fräste ich aus Fiberglas. Für alles, was ich nicht selbst herstellen konnte – Räder und Motor zum Beispiel – schlachtete ich fertige Modelle aus, die ich bereits gebastelt hatte. Meine Schulfreunde wohnten alle woanders, also hatte ich nicht viel Besuch und wurde zu einem kleinen Eremiten, der im Schuppen (in der »Werkstatt«, klar, Dad) in Klausur ging und an seinen Entwürfen bastelte, mit dem riesigen Radio aus den 1940er-Jahren als einziger Gesellschaft. Ich war so versunken in meiner Bastelei, dass ich einmal sogar ohnmächtig wurde, weil ich nicht merkte, wie mich das Chloroform, das ich als Reinigungsmittel benutzte, mit seinen Dämpfen betäubte.
Eine Auswahl an Schulzeugnissen.
Meine Modelle brachte ich einmal sogar für ein Referat in die Schule mit und hatte damit ziemlichen Erfolg – besonders, wenn man bedenkt, wie mittelmäßig meine Leistungen dort sonst waren. »Nicht unbegabt, wenn er sich konzentriert. Verhält sich im Unterricht leider oft extrem albern«, regte sich mein traumatisierter Französischlehrer in einem Zeugnis auf. »Uninteressiert, schlampig und ziemlich enttäuschend« nannte mich ein anderer Lehrer.
Das Problem war, dass ich Charakterzüge nicht nur von meinem Vater, sondern auch von meiner Mutter geerbt hatte. Meine Mutter war eine sehr lebhafte, stets zu einem Flirt aufgelegte Frau; sie konnte gut malen, war aber vor allem eine unabhängige Persönlichkeit; mein Vater war ein Exzentriker, die Tierarzt-version eines Caractacus Pott, des verrückten Autoerfinders aus Chitty Chitty Bang Bang, und gesegnet oder gestraft mit dem Zwang, nach unkonventionellen Problemlösungen zu suchen. Diese Mischung hat mich zwar im späteren Leben weit gebracht, war aber in der Schule eher hinderlich.
Ich erinnere mich noch, wie es in Physik um das Thema Reibung ging. »Wer hält Reibung für eine gute Sache?«, fragte der Lehrer. Ich war der Einzige, der sich meldete.
»Warum, Newey?«
»Weil, wenn es keine Reibung gäbe, könnten wir nicht mal stehen. Wir würden wegrutschen und hinfallen.«
Der Lehrer wiederholte die Frage, als ob er irgendeine Boshaftigkeit hinter meiner Antwort vermutete. Trotz des Kicherns meiner Mitschüler blieb ich dabei. Er rollte mit den Augen. »Lächerlich«, seufzte er. »Wenn Reibung etwas Gutes wäre, bräuchten wir ja kein Schmieröl, oder?«
Da wusste ich, dass ich meine ganz eigene Sicht auf die Welt hatte. Wenn ich heute darüber nachdenke, wird mir bewusst, dass ich außerdem noch ungeheuer ehrgeizig bin. Das kommt vielleicht daher, dass ich beweisen will, eben nicht immer unrecht zu haben und dass Reibung sehr wohl eine gute Sache sein kann.
KAPITEL 3
Dad war zwar ein großer Autoliebhaber, hatte aber nicht viel für Motorsport übrig, während meine Leidenschaft für Autorennen schon als Jugendlicher von Jahr zu Jahr zunahm. Bald überredete ich ihn, mit mir zu ein paar Rennen zu fahren.
Das erste war der Gold Cup in Oulton Park (Cheshire) 1972. Nachdem ich meinen Vater lange genug genervt hatte, setzten wir uns früh an einem Sommermorgen in den (zweiten) gelben Elan (Nummernschild CGWD 714K), und ich erlebte mein allererstes Autorennen.
An der Rennstrecke schlenderten wir durch das Fahrerlager – das war damals fast überall möglich –, und ich war überwältigt von dem, was ich sah, vor allem aber von den Geräuschen an der Strecke. Ich hatte so etwas noch nie erlebt. Das betäubende, dramatische Röhren der Cosworth V8 DFV-Motoren, das Heulen der BRM-V12-Maschinen; die Mechaniker, die an ihnen herumschraubten und irgendetwas reparierten – ich wusste nicht, was sie da machten, schaute aber trotzdem fasziniert zu und war unvorstellbar stolz, wenn es mir gelang, ein Teil zu identifizieren: »Dad, die nehmen gerade den Stabilisator raus!«
Richtige Rennwagen gesehen hatte ich immerhin schon einmal. Nach einem früheren heldenhaften Überredungsmarathon hatte ich es geschafft, dass mein Vater mit mir zur Racing Car Show im Londoner Olympia fuhr. Aber das Rennen in Oulton Park war das erste Mal, dass ich sie sozusagen in freier Wildbahn erlebte, in ihrer natürlichen Umgebung und, noch wichtiger, in Bewegung. Die Strecke ist ziemlich wellig, und die Wagen waren damals weich gefedert. Ich beobachtete wie hypnotisiert das wilde Auf und Ab der Karosserien, als die Wagen über die Steigung an der Start-Ziel-Linie donnerten. Ich war bereits vorher vernarrt in den Rennsport, aber an jenem Tag verliebte ich mich regelrecht.
Das zweite Rennen, das ich erlebte, war der Grand Prix 1973 in Silverstone. Jackie Stewart startete von der Pole Position, und ich bekam einen Hamburger. Stewart auf der Pole war damals ein gewohnter Anblick, aber der Hamburger für mich war eine Seltenheit, weil mein Vater einen unglaublichen Hass auf Junk Food hatte. In solchen Sachen gab es bei ihm nur alles oder nichts, keine Kompromisse. Als es hieß, die Ärzte hielten Salz für gesund, trank er an heißen Tagen Salzwasserlösung, um seinen Salzspiegel konstant zu halten. Als es später hieß, die Ärzte hielten Salz doch für ungesund, strich er es völlig von seinem Speiseplan und wollte es nicht einmal im Kochwasser für die Erbsen dulden.
Mit einem Cosworth DFV bei der Racing Car Show.
An jenem Nachmittag aber – aus welchem Grund auch immer, vielleicht als Ausgleich dafür, dass wir diesmal nicht das Fahrerlager besichtigten wie beim Gold Cup – machte Dad eine Ausnahme vom Junk-Food-Verbot und kaufte mir einen Hamburger an einem Stand nahe der Woodcote-Tribüne. Woodcote war damals eine sehr schnelle Kurve am Ende der Runde, kurz vor der Start-Ziel-Linie.
Wir setzten uns auf unsere Plätze, um uns den Start anzuschauen, und ich erlebte verzaubert mit, wie Jackie Stewart im Nu einen Vorsprung von bestimmt fast hundert Metern auf das Feld herausgefahren hatte, als er nach der ersten Runde aus der Kurve in die Gerade einbog.
Dann passierten zwei Dinge zugleich. Erstens verlor der junge Südafrikaner Jody Scheckter, der damals gerade bei McLaren angefangen hatte, in der Wood-cote-Kurve die Kontrolle über seinen Wagen und verursachte eine Massenkarambolage – eine der größten in der Geschichte der Formel 1, und sie spielte sich direkt vor meinen Augen ab.
Zweitens ließ ich vor Schreck meinen Hamburger fallen.
In meiner Erinnerung läuft die Szene so ab, dass sämtliche Tribünenzuschauer aufsprangen, als die Wagen auf der Strecke ineinanderknallten und in Stücken in alle Richtungen flogen. Eine Ansaughutze wirbelte durch die Luft, gefolgt von Staub und Rauch, der die Sicht auf die Strecke nahm. Das war aufregend, aber auch beängstigend – gab es Verletzte, womöglich Tote? Musste es eigentlich, aber ich weiß noch, wie erleichtert ich war, als ein Fahrer nach dem anderen unverletzt aus dem Schrotthaufen kletterte (die schlimmste Verletzung war ein Beinbruch). Als sich die Aufregung gelegt hatte, war klar, dass es jetzt ewig dauern würde, bis die Streckenposten die Bahn wieder frei gemacht hätten. Da gab’s nur eins: Ich kletterte unter die Tribüne, sammelte meinen Hamburger wieder auf und aß ihn zu Ende.
Mit 13 wurde ich dann auf die Repton School verfrachtet, ein angesehenes Internat in Derbyshire. Mein Großvater, mein Vater und mein älterer Bruder waren dort zur Schule gegangen, also war es keine Frage, dass ich auch dorthin musste. Zum ersten Mal war ich jetzt ein »Interner«, aber auch Repton wurde zu einer akademisch eher unergiebigen Lebensphase.
Nur war es in Repton viel schlimmer für mich als an der Emscote-Lawn-Grundschule; dort war ich nämlich bei meinen Mitschülern beliebt gewesen und hatte trotz schlechter Leistungen im Unterricht wenigstens keine Prügel oder Hänseleien zu ertragen. In Repton war ich ein Ausgestoßener.
An diesem Internat war damals und ist vielleicht heute noch Schulsport sehr wichtig. Ich war ein durchschnittlicher Fußballspieler, hoffnungslos im Cricket und im Hockey noch schlechter. Die einzige Mannschaftssportart, bei der ich mithalten konnte, war Rugby, und das wurde damals in Repton nicht gespielt, warum auch immer. Ich musste mich also damit zufriedengeben, ein ganz guter Geländeläufer zu sein, aber das bringt einem nicht gerade tosenden Applaus und Popularität ein. Ich wurde das ständige Ziel der Angriffe (körperlich angegriffen wurde ich nur ein Mal) zweier Schüler aus dem Jahrgang über mir, die mir die ersten beiden Jahre in Repton ziemlich schwer machten. Der größte Feind aber war die Langeweile. Ich bekämpfte sie, indem ich mich in meine eigene Welt zurückzog – ich entwarf und zeichnete Rennwagen, baute Modelle und entdeckte etwas ganz Neues: Kartfahren.
Die Kartrennbahn in Shenington. Ich sehe sie noch genau vor mir. Mit 14 war ich zum ersten Mal da, nachdem ich meinen Vater überredet hatte, mit mir hinzufahren. Bei diesem ersten Besuch schauten mein Vater und ich nur den anderen Kindern und ihren Vätern bei einem freien Trainingstag zu. Uns wurde schnell klar, dass es zwei unterschiedliche Sorten Kart gab: die getriebelosen mit 100 Kubik ohne Kupplung und Gangschaltung und die Karts mit umgebautem Motorradmotor und einer Schaltung.
Bei den getriebelosen Karts war das Problem, dass man sie nur starten konnte, wenn die angetriebenen Hinterräder den Boden nicht berührten. Das hieß in der Praxis, dass der Fahrer neben dem Kart herlief, während ein armer Helfer (gewöhnlich der Vater des Fahrers) hinterherrannte und das Heck vom Boden anhob. Beide mussten dann ein genau getimtes Manöver hinlegen, bei dem der Vater das Heck fallen ließ und der jugendliche Fahrer gleichzeitig ans Steuer sprang. Ich fand es ziemlich beängstigend, wie immer wieder der Vater zu früh losließ und der Sohn es nicht auf den Fahrersitz schaffte, sodass das Kart ohne Passagier weiterfuhr und dann gemächlich mit vielleicht 20 Stundenkilometern bis in die Streckenbegrenzung am Ende der Box ausrollte, während die Zuschauer in Deckung gingen, unweigerlich gefolgt von viel Geschrei, weinenden Kindern und so weiter.
Das war als Slapstick ganz nett, aber angesichts der bekannten Ungeduld meines Vaters entschied ich mich doch lieber für die teureren geschalteten Karts, die man im Leerlauf mit allen vier Rädern auf dem Boden starten konnte.
Meinem Vater war inzwischen etwas anderes aufgefallen. »Soweit ich das beurteilen kann«, meinte er nachdenklich, »sind die meisten Jungs nicht hier, weil sie es selbst wollen, sondern weil ihre Väter sie hierhergeschleppt haben.«
Was sollte das heißen? Ich war schon jetzt entschlossen, mir ein Kart zuzulegen. Da gab es keinen Zweifel mehr. Aber Dad gab auch nicht nach: Ich würde beweisen müssen, dass ich es ernst meinte. Er machte mir einen Vorschlag: Ich sollte auf mein eigenes Kart sparen, und auf jedes Pfund, das ich verdiente, würde er eins drauflegen.
In den Sommerferien schuftete ich wie besessen. Ich ging in der Nachbarschaft herum und bot mich für Arbeiten in Haus und Garten an. Ich mähte Rasen, wusch Autos und verkaufte Pflaumen aus unserem Garten. Es gelang mir sogar, von einer älteren Nachbarin den Auftrag für ein Gemälde ihres Hauses mit Vorgarten zu bekommen. Allmählich sparte ich so genug zusammen, dass es für ein gebrauchtes Kart aus den Kleinanzeigen hinten im Karting Magazine reichte. Es war ein Barlotti (Ken Barlow aus Reading stellte sie her, aber er glaubte, sie brauchten einen italienisch klingenden Namen) mit einem Villiers-9E-Motorradmotor und 199 Kubik Hubraum. Es war ziemlich niedergeritten, aber es war ein Kart, und – wichtig – ein Anhänger war im Angebot mit inbegriffen.
Ich schaffte es zu zwei Trainingssessions in Shenington, aber die Stoppuhr zeigte gnadenlos, dass die Kombination aus altem Kart und neuem Fahrer (mir) so langsam war, dass der Abstand zum Zweitlangsamsten riesig war. Inzwischen war es mir aber, in meinem zweiten unglücklichen Schuljahr in Repton, gelungen, von dem Lehrer, bei dem wir zweimal in der Woche Werkunterricht hatten und mit dem ich mich gut verstand, die Erlaubnis zu bekommen, das Kart in die Werkstatt der Schule mitzubringen, sodass ich abends und am Wochenende daran schrauben konnte. Im Januar 1973 fuhren mein Vater und ich also im Kleintransporter der Tierarztpraxis (Nummernschild PNX 556M) mit Kart und Anhänger in der Schule vor.
Endlich konnte ich die langen, öden Stunden der »Freizeit« im Internat sinnvoll füllen – ich nahm den Motor auseinander, setzte ihn neu zusammen, revidierte auch das Getriebe und baute einen neuen zweiten Gang ein (der alte sprang immer heraus), belegte die Bremsen neu und so weiter.
In den nächsten Sommerferien ging es zurück nach Shenington, aber nach weiteren zwei Tagen wusste ich, dass das Kart und ich immer noch zu langsam waren. Auseinandernehmen und wieder zusammensetzen hatte das Ding nicht entscheidend schneller gemacht. Ich musste zu drastischeren Maßnahmen greifen – der Motor lieferte nicht genug Saft, und der Rohrrahmen war gegenüber dem der schnellen Jungs veraltet. Für den Motor brauchte ich einen größeren 210-Kubik-Kolben und einen neuen Upton-Aluminiumzylinder statt des gusseisernen. Das hieß weiter Autowaschen und sonstige Aushilfsarbeiten, und mein Vater verdoppelte auch weiterhin jedes Pfund, das ich verdiente. Das neue Chassis würde schwieriger werden; dafür musste ich Schweißen und Löten lernen. Also meldete ich mich für einen zehn-tägigen Schweißerkurs bei der BOC in der sehr passend benannten Plume Street [BOC: British Oxygen Company, ein Schweißgashersteller; plume: Rauchwolke, besonders nach Explosionen (A. d. Ü.)] im Norden Birminghams an.
Dafür musste ich jeden Morgen um sechs aufstehen, den Linienbus von Stratford nach Birmingham nehmen, um pünktlich um neun dort zu sein, den Tag mit einem Haufen gelangweilter Arbeiter in ihren Dreißigern zu verbringen, die meistens von ihren Chefs zu diesem Kurs verdonnert worden waren, und abends gegen neun schließlich wieder nach Hause zu kommen.
Ich schien Talent zum Schweißen und Löten zu haben, jedenfalls machte ich schneller Fortschritte als die anderen Kursteilnehmer, und das nahmen sie mir übel. Mein Oberschichtakzent, den ich im Internat beigebracht bekommen hatte, war ihnen ein willkommener Anlass für Spott und Hohn. Ich lernte, dass man sich in einer solchen Umgebung am besten anpasst, und versuchte mit dem »Brummie«-Akzent des echten Birminghamer Arbeiters zu sprechen. Als ich aufs College kam, sollte sich das auszahlen. Schade nur, dass dieser Dialekt ein so furchtbares Genäsel ist; ich versuche schon lange, ihn unauffällig wieder loszuwerden!
Bewaffnet mit meiner neuen Superkraft kam ich an die Schule zurück und schweißte ein Chassis. Während der Weihnachtsferien baute ich den Motor mit einem Upton-Zylinder neu auf und bastelte mit der Hilfe eines Freundes sogar eine elektronische Zündung nach dem Schaltplan in einer Elektronikzeitschrift.
Zum Sommersemester war das Kart fertig, ich rollte es frohgemut aus der Werkstatt und wollte starten. Beim ersten Versuch – nichts. Ich rollte es wieder zurück und bastelte weiter. Der Zündzeitpunkt war falsch eingestellt.
Am nächsten freien Nachmittag versuchte ich es wieder. Dieses Mal schoben zwei Freunde das Kart nach Leibeskräften an, ich ließ die Kupplung kommen, und mit einem lauten Knall und einer blauen Rauchwolke aus dem Auspuff sprang es an.
Der aus der Sendung Top Gear bekannte Motorsportjournalist Jeremy Clarkson war damals ebenfalls Schüler in Repton und erinnert sich noch lebhaft an diesen Abend. Er hat den Reportern mehrfach schmeichelhafte Geschichten darüber erzählt – ich hätte das Kart aus Einzelteilen selbst zusammengebaut (stimmt nicht) und sei damit wie ein Irrer im Innenhof des Internats herumgerast (stimmt auch nicht).
Die erste Probefahrt war in Wirklichkeit nur ein Herumtuckern um die Kapelle, hatte aber dennoch fatale Folgen, als einer der beiden Freunde, die angeschoben hatten, sich in einer Kurve verschätzte, das Kart gegen eine Wand setzte und dabei die Hinterachse verbog. Das war ärgerlich, weil ich jetzt auf eine neue sparen musste. Wenigstens leistete der Schuldige auch einen Beitrag dazu.
Wirklich schlimm war aber, dass der Direktor nachschauen kam, was das für ein Lärm war. Das hätte mich nicht überraschen sollen – es war schließlich ein Rennkart mit Zweitaktmotor. Kein Auspufftopf dämpfte das infernalische Kreischen, das sich wie der Überraschungsangriff eines Schwarms von Roboter-Riesenhornissen anhörte. Der Direktor zeigte sich wenig begeistert von meinem Hobby und verbot mir, das Kart künftig mit in die Schule zu bringen. Aber eigentlich war das auch schon egal, im folgenden Semester kam ich nämlich auch nicht mehr zurück.
Jeremy erzählt der Presse gern noch eine zweite Geschichte, in der ich vorkomme: In den 1970er-Jahren seien zwei Schüler aus Repton geflogen – der eine sei er gewesen, der andere ich.
Das bringt mich zu …
KAPITEL 4
Da mein Mittelschulabschluss (damals O-Level genannt, heute wäre es das General Certificate of Secondary Education oder GCSE) näher rückte, schlurfte ich eines Tages pflichtschuldigst zum Berufsberater, der ein gelangweiltes Auge auf meine höchst durchschnittlichen Noten warf, hustete und mir vorschlug, ich könnte mich für ein Studium im Bereich Geschichte, Englisch und Kunst einschreiben. Ich dankte ihm für die Mühe und ging wieder.
Natürlich hatte ich andere Pläne. Die Arbeit am Kart hatte mir zweierlei gezeigt: erstens, dass ich vermutlich nicht aus dem Holz geschnitzt war, aus dem Rennfahrer sind, weil das Kart mit mir am Steuer trotz aller Mühe, die ich mir gab, und trotz allen Tunings an der Maschine einfach nicht schnell genug wurde.
Zweitens aber hatte ich gemerkt, dass es nicht schlimm war, wenn ich kein Rennfahrer wurde, denn es hatte zwar Spaß gemacht, das Kart zu fahren, aber mein wahres Interesse lag woanders. Was ich wirklich beruflich machen wollte – weil ich sowieso schon meine ganze Zeit hineinsteckte und mir sagte, ich sei nicht ganz schlecht darin –, war, Autos zu entwerfen, genauer gesagt, Rennwagen schneller zu machen.
Sehr zur Erleichterung meines Vaters – die Schulgebühren in Repton waren ziemlich hoch – beschloss ich, das Internat zu verlassen und stattdessen am Warwickshire College of Further Education in Leamington Spa einen ONDKurs zu belegen, der mir das Äquivalent von A-Level-Abschlüssen in den belegten Fächern einbringen würde [OND: Ordinary National Diploma; das GCE Advanced Level Certificate (A-Level) ist ein britischer Bildungsabschluss, der als Voraussetzung für ein Hochschulstudium etwa dem deutschen Abitur entspricht. (A. d. Ü.)].
Ich konnte es gar nicht abwarten. In Repton war ich beim Alkoholtrinken in den Pubs des nahen Burton-on-Trent erwischt worden, hatte mir damit den Ruf eines Rebellen eingefangen und wollte ihn auch gar nicht wieder loswerden. Meine Haltung zum Unterricht schwankte zwischen Gleichgültigkeit und Ablehnung (mit gelegentlichen anarchischen Anfällen), und die Schule erwiderte diese Einstellung. Es war von Anfang klar, dass wir nicht in Frieden voneinander scheiden würden, und so kam es auch.
Am Ende jedes Semesters organisierte die sechste Klasse traditionell ein Konzert für alle Schüler. Wie gewöhnlich fand es in der sogenannten Pears’ School statt, einem ehrwürdigen Gebäude mit eichener Täfelung und kunstvollen Buntglasfenstern. Seit der Einweihung im Jahr 1886 trotzte es den Stürmen der Zeit – zwei Weltkriegen und wer weiß was noch für Konflikten – und war der ganze Stolz der Schule. In dieser historischen Kulisse sollte die Progrock-band Greenslade auftreten.
Wie viele Jugendliche damals liefen wir gern wie Hippies herum: lange (zumindest etwas längere) Haare, große bunte Umhängetaschen, Schlaghosen. Unsere Musik war Psychedelic Rock: Santana, Genesis (noch mit Peter Gabriel, wohlgemerkt), Supertramp, die Average White Band und natürlich Pink Floyd.
Das Internat missbilligte das. Um die gefährliche Ausbreitung von Plateauschuhen zu bekämpfen, gab es bereits eine Schulvorschrift, laut der nur solche Schuhe getragen werden durften, bei denen man keine Pennymünze aufrecht durch die Lücke zwischen Absatz und Sohle schieben konnte. Schlau wie ich war, hatte ich daraufhin Absatz und Sohle mit einem Stück Aluminium verbunden und konnte so meine Plateauschuhe auch in der Schule tragen, ohne gegen den Wortlaut des Gesetzes zu verstoßen (die Verbindung zu meiner heutigen Tätigkeit springt ins Auge, stimmt). Die Schulleitung fand das nicht amüsant, und im Lehrerzimmer wuchs mein Ruf als Rebell nur noch mehr.
Aber ich schweife ab. Der große Vorteil der Schlaghosen war, dass man darin prima Alkohol schmuggeln konnte. Wir aus der fünften Klasse jedenfalls klebten uns Taschenflaschen mit Gin, Wodka und was auch immer wir sonst an Spirituosen bekommen konnten, mit Klebeband ans Schienbein und gingen dann mit wehenden Hosenbeinen ins Konzert, die Schmuggelware sicher darunter versteckt.
Greenslade begannen zu spielen. Ehrlich gesagt, musste man wahrscheinlich auf einem LSD-Trip sein, um die Musik zu genießen, aber wir waren vollauf damit beschäftigt, unseren eingeschmuggelten Alkohol in die unschuldige Cola zu gießen und uns langsam, aber sicher volllaufen zu lassen.
Ein heißer Sommer, das Ende des Semesters, ein Haufen Jugendlicher, harte Drinks, dazu die zersetzende Wirkung von Progressive Rock mit zwei Keyboards – eine gefährliche, explosive Mischung. Die Stimmung geriet ziemlich schnell außer Kontrolle, und niemand war mehr außer Kontrolle als ich.
Wie bei den meisten Rockkonzerten hatte der Tontechniker sein Mischpult in der Mitte des Zuschauerraums, um den Sound kontrollieren zu können. Mein Platz war ganz in der Nähe, und als der Mann kurz pinkeln ging, war ich auch schon hinter seinem Pult und schob sämtliche Regler ganz nach oben.
Die Band spielte weiter. Das Getöse aus Rückkopplungseffekten, Bassdröhnen, kreischenden Keyboards und schierer plötzlicher Lautstärke war ungeheuer. Ohne uns um den Tinnitus zu kümmern, der uns unweigerlich bevorstand, gerieten wir alle außer Rand und Band. Einen kurzen Moment lang, bevor der Tontechniker zurückkam und der Direktor eingriff, herrschte absolute Anarchie.
Noch Jahre später behauptete Jeremy Clarkson, etwas Lauteres habe er nie gehört. Wie wir bereits gesehen haben, neigt Jeremy zur Übertreibung, aber in diesem Fall hat er wahrscheinlich recht. Es war sehr, sehr laut.
Meine Strafe? Ich wurde in die Ambulanz der Schule geschleppt und bekam zwangsweise den Magen ausgepumpt. Das war natürlich völlig übertrieben und genau genommen eine Menschenrechtsverletzung. Sie machten es einfach, um sich für meinen Streich zu rächen.
Am Tag darauf stellte sich heraus, dass der Lärm mit seinen Vibrationen die Bleifassungen der historischen Buntglasfenster gelockert hatte und die Fliesen der Fensterlaibungen gesprungen waren. Das brachte das Fass zum Überlaufen. Meine Eltern wurden in die Schule bestellt.
Meine Mutter fuhr in ihrem Porsche vor (Nummernschild WME 94M). Typisch Mum: wie üblich in Weiß, mit passenden weißen Stiefeln und in der Hand eine eingetopfte Lilie als Mitbringsel. Sie wusste, dass der Direktor etwas für Lilien übrig hatte, und ließ nie eine Gelegenheit aus, ihren Charme wirken zu lassen. »Hallo, Lloyd. Schön, Sie zu sehen. Das hier ist für Sie.« Sie setzte sich und stellte dem Direktor die Pflanze auf den Schreibtisch. »Geht es um Adrian? Er ist doch sicher brav gewesen, oder?«
In diesem Fall aber verpuffte ihr Charme. »Richtig, es geht um Adrian«, erwiderte der Direktor knapp. »Leider war er überhaupt nicht brav. Ganz und gar nicht. Um genau zu sein: Er hat sich derartig aufgeführt, dass Sie ihn bitte mit nach Hause nehmen. Er ist in Repton nicht länger willkommen.«
Meine Mutter schaute vom Direktor zu mir und zurück. Sie hob das Kinn. »Nun, wenn Sie die Sache so sehen, Lloyd, möchte ich auch meine Lilie wiederhaben. Komm, Adrian, wir gehen.«
Ich weiß nicht, wie es bei Jeremy ablief, aber so war es bei mir, als ich von der Schule flog. Ich verließ Repton unter düsteren Wolken, aber erleichtert, dem Internat endlich zum Abschied winken zu können (nicht ohne Zeige- und Mittelfinger zum V des Siegeszeichens zu recken).
Später bin ich aber doch zurückgekommen, wenn auch nur ein einziges Mal, als ich gemeinsam mit meinem Vater an einem Geländelauf »Schüler gegen alte Reptilien« teilnahm. Ansonsten aber war ich nicht gerade traurig, als sie mich hinauswarfen. Der Gipfel ist natürlich, dass in der Ruhmeshalle des Internats für prominente ehemalige Repton-Schüler, wie ich höre, heute auch Bilder von Jeremy und mir hängen.
KAPITEL 5
Nachdem ich das Internat hinter mir gelassen hatte, ging es in meinem Leben bergauf. Ich fuhr das Kart endlich bei einem Rennen in Shenington, und obwohl wir nicht gerade Weltspitze waren, schafften wir es immerhin, nicht aus dem Feld abzureißen, und waren mehrere Sekunden schneller als zwölf Monate zuvor.
Zufällig stellte sich dabei heraus, dass die Metallklinge, die ich an das Ende der Kurbelwelle geschweißt hatte, genau die richtige Breite hatte, um der elektronischen Zündung in beiden Drehrichtungen den richtigen Zündzeitpunkt zu geben, also auch wenn der Motor rückwärts lief. Das Denkwürdigste an meinem Rennwochenende war dann nämlich, dass ich im Training in der Haarnadelkurve ins Schleudern kam und die Kupplung gezogen haben muss, während ich noch rückwärts rollte. Als ich sie dann wieder kommen ließ, hatte ich zu meiner Verblüffung plötzlich vier Rückwärts- statt vier Vorwärtsgänge! Das ungläubige Staunen der Zuschauer, als ich den Rest der Runde bis ins Fahrerlager rückwärts absolvierte und dabei über die Schulter schauen musste, um zu steuern, bringt mich heute noch zum Schmunzeln. Der Streckenchef war allerdings weniger begeistert von meinen Leistungen.
Außerdem begann ich an einem sogenannten »Special« zu bauen, einem straßentauglichen Sportwagen, der ganz nach meinen eigenen Zeichnungen entstehen sollte. Das war ein ehrgeiziges Projekt, und obwohl ich es schließlich aufgab, lernte ich doch viel dabei und sammelte wertvolle neue Erfahrungen. Die erste davon war, dass ich bei meinen Recherchen auf einen Mann namens Ian Reed von Delta Racing Cars in Surrey stieß, der genau so ein Fahrzeug gebaut hatte. Ich erhoffte mir wichtige Tipps und Tricks von ihm und schrieb ihn an.
Nach einem kurzen Briefwechsel lud mich Ian auch schon in die Fabrik ein, schaute sich einen halben Tag lang meine Zeichnungen an und beriet mich bei Konzeption und Gestaltung des Wagens wie auch bei meiner Berufslaufbahn.
Zweitens steckte ich jede Menge Zeit in den Entwurf, und das war entscheidend. Es heißt, um in einer Fertigkeit Experte zu werden – sei es Tennis, Geigenspiel, Kochen, was auch immer –, müsse man mindestens 500 Stunden trainieren, am besten ab etwa acht Jahren bis in die Pubertät, wenn man am empfänglichsten ist und am besten und schnellsten lernt.
In meinem umgebauten Go-Kart mit Pedalantrieb.
Ohne das bewusst geplant zu haben, befolgte ich genau diesen Ratschlag. Ich übte, so wie schon immer. Zu meinem achten Geburtstag und gleichzeitig als Weihnachtsgeschenk (diese Kombination lernt jeder zu fürchten, der um Weihnachten herum Geburtstag hat) hatte ich ein pedalgetriebenes Go-Kart bekommen. Ich ruhte nicht, bis ich es mit eigenen Karosserieteilen umgebaut hatte, damit es wie ein Formel-1-Bolide aussah. Später bekam ich ein Carlton-10-Gang-Rad, das ich leichter machte, indem ich Aussparungen in die Rahmenrohre bohrte und die stählerne Sattelstütze durch eine selbst gebaute aus Aluminium ersetzte. Darauf war ich sehr stolz – bis sie eines Tages durchbrach.
Obwohl der »Special« nie richtig fertig wurde, war das Projekt eine wichtige Fingerübung. Man kann ja schließlich auch nicht nur in der Werkstatt leben, und der »arme alte Special« stand jetzt in Konkurrenz mit meinem neuen Leben am College, mit meinen Freundinnen und vor allem – seit ich 17 war – mit Motorrädern.
Im ersten Semester als Collegestudent war ich die fünf Kilometer bis zur Bushaltestelle in Stratford geradelt und hatte dort den Linienbus nach Leamington genommen. Viele meiner Kommilitonen im Kurs (wir waren um die 15, nur Jungs, kein einziges Mädchen) fuhren eine Yamaha FS1E oder ein Puch-Moped, und einer namens Andy, schon ein bisschen älter, hatte sogar eine Norton Commando, also ein richtiges Motorrad, und war damit der Coolste. Die Gespräche in den Pausen zwischen den Seminaren und in der Mensa drehten sich hauptsächlich um Motorräder, und ich war fasziniert. Außerdem war ich glücklich, dass mein Vater meine neue Begeisterung teilte, weil er bei der Armee als Kradmelder gedient hatte. Er war sogar so begeistert, dass er mir als nächstes Geburtstags-/Weihnachtsgeschenk (manchmal ist die Kombination halt doch ganz nützlich) ein eigenes neues Bike anbot. Ich war überrascht, nachdem er bei den Karts so gezögert hatte, aber natürlich ziemlich froh. Eigentlich hatte ich an eine Ducati 250 gedacht, aber dann las ich in der Motorradzeitschrift Bike einen Testbericht über die Moto Morini 350 Sport, damals ein relativ neues Modell. Dad war einverstanden, und so wurde ich zum 17. Geburtstag stolzer Besitzer der Maschine. Fahren durfte ich sie allerdings noch nicht: Für Fahranfänger galt eine gesetzliche Hubraumbegrenzung von 250 Kubikzentimetern. Also kaufte ich für 25 Pfund eine abgewirtschaftete BSA C15 (Baujahr 1958), bis ich den Führerschein hatte, während mein Dad aufopferungsvoll die neue Morini »einfuhr« (er legte ungefähr anderthalbtausend Kilometer dabei zurück).
Der Sommer 1976 war lang und heiß, genau richtig für meine neue Motor-radleidenschaft, auch wenn der Teer des Straßenbelags in der Hitze weich wurde und vielen meiner Kumpels Unfälle bescherte. Ich wurde enthusiastisches Mitglied des örtlichen Motorradclubs namens »Shakespeare’s Bikers«, der sich jeden Mittwochabend um sieben im Cross Keys traf, und war bei vielen Wochenendtouren mit von der Partie. Auf einmal hatte ich eine neue Leidenschaft, neue Freunde aus allen Schichten (durch das College und den Motorradclub), und dank dieses Netzwerks gehörten jetzt auch Mädchen zu meinem Sozialleben. Dazu kam noch die damals aktuelle Punkbewegung, ein willkommenes Gegenmittel zu dem weichgespülten Sound von Donny Osmond und Konsorten. Bei Feten, auf denen diese neue anarchische Musik lief, konnte auch ich endlich tanzen, den einzigen Tanz, den ich wirklich gut kann – Pogo.
Ich liebte mein Motorrad. Unter uns Bikern gab es echte Kameradschaft und ein Gefühl der Freiheit, das ein Auto einfach nicht vermitteln kann. Eine kurze Zeit lang redete ich mir sogar eine Zukunft als Motorraddesigner ein, wusste dabei allerdings im Innersten, dass ich einfach die kurze selige Verknalltheit einer neuen Liebe durchlebte und gut daran tat, meinem – schließlich ebenso verstiegenen – eigentlichen Ziel treu zu bleiben, Rennwagendesigner zu werden.





























