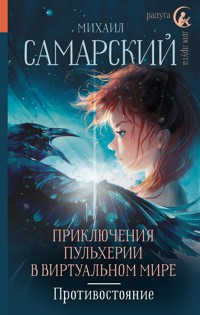10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Das fröhlich-subversive Training für mehr Selbstbewusstsein.
Der Umgang mit unseren Mitmenschen gestaltet sich mitunter kompliziert und wenig ersprießlich. Leiden wir dann noch unter Schüchternheit, Versagensangst oder Unsicherheit, scheitern wir rasch dabei, souverän und entspannt ein Gespräch zu beginnen. Das Selbstwertgefühl ist im Keller, schlimmstenfalls meiden wir solche Situationen in Zukunft. Damit es nicht so weit kommt, präsentiert Vladimir Levi – auch als russischer Dale Carnegie bekannt – seine schräg-wirksamen Methoden, um Menschen für sich einzunehmen oder selbstbewusst Smalltalk zu meistern. Dabei ist sein Praxisprogramm nicht nur anwenderfreundlich, sondern zugleich hinreißend komisch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Buch
Wie man sich Freunde macht erlaubt uns einen Blick in das Behandlungszimmer von Vladimir Levi und Dmitrij Sergejewitsch Kstonov und verrät uns ihre Erkenntnisse, wie man Freunde gewinnt. Was uns die beiden Doktoren bieten, ist keine stringente Erzählung über Theorie und Praxis der Kommunikation, sondern eine Collage aus Geschichten, Praxisgesprächen, philosophischen Plaudereien und praktischen Übungen, die nahezu jedes Kommunikationsproblem beleuchten.
Autor
Vladimir Levi, geb. 1938 in Moskau, arbeitete nach Beendigung seines Studiums als Arzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Wissenschaftlich engagierte er sich im Feld der Suizidologie (Selbstmordforschung und -prävention) und war an der Einrichtung des ersten Telefonseelsorge-Notrufs in der Sowjetunion beteiligt. Heute arbeitet er freiberuflich als Psychotherapeut. Seine zahlreichen Bücher zur Persönlichkeitsentwicklung oder zum Autogenen Training sind Klassiker und wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt.
Vladimir Levi
Wie man sich Freunde macht
100 höchst ungewöhnliche Strategien
Aus dem Russischen von Felix Eder
Die russische Originalausgabe erschien 2003 unter dem Titel „Искусство быть другим“ bei Торобоан in Moskau, Russland.
Dieses Buch erschien erstmals 1989 unter dem Titel Ein anderer sein.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
1. Auflage
Deutsche Erstausgabe April 2019
© 2019 Wilhelm Goldmann Verlag, München
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Originalausgabe: © Психология, 2003
© Vladimir Levi, 2009
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: mauritius images/dieKleinert/Susanne Tessari
JG ∙ Herstellung: cf
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN 978-3-641-18651-7V001
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Inhalt
Eingang in eine exotische Welt
Vorwort des Übersetzers
1. Am Anfang war das Spiel
Wie man die Kommunikationsmuskeln entwickelt
2. Sag mir, wer dein Freund ist
Ein Schlüssel, der alle Türen öffnet
3. Die Spiegel im Land hinter den Spiegeln
Wie man mit der Selbstbewertung umgeht und Beziehungen klärt
4. Der Kampf mit dem Schatten
Wie man seine Kraft errät
5. Lichtschatten
Leben und Rolle
Epilog
Anstelle eines Nachworts Vorwort des Autors zur Neuausgabe 2003
Eingang in eine exotische Welt
Vorwort des Übersetzers
Nein, dieses Buch ist kein Ratgeber. Ein Ratgeber ist ja nichts anderes als eine ausführliche Handlungsanleitung: Wenn du das und das und das tust, dann bist du am Ende ein glücklicher Mensch. Dass es für das Funktionieren dieses Konzepts keine Garantie gibt, wissen wir spätestens, seit Mose von Gott die Zehn Gebote erhalten hat. Obwohl es sich um einfache, kompakte Vorgaben handelt, sind sie so schwer zu befolgen, dass auf der Erde Mord und Totschlag herrschen, nicht zuletzt, weil sich manche sogar auf diese Gebote berufen. Das war wohl der Grund dafür, dass Jesus das System vereinfacht und die ererbten Empfehlungen zu einem Konzentrat verdichtet hat: den Glauben, die Hoffnung und die Liebe.
Mit diesem Dreisatz umzugehen überfordert allerdings den Menschen offenbar noch mehr, und er wünscht sich, dass ihn jemand an die Hand nimmt und ihm sagt, wie er sich in bestimmten Situationen verhalten soll. So entstehen Katechismen und Ratgeber. Schnell sind die drei Gebote auf dreihundert Seiten aufgebläht, und entsprechend groß ist die Hoffnung auf ihre Wirkung. Aber wir wissen alle aus Erfahrung: Wie viele Ratgeber wir auch lesen, am Ende sind wir überfordert. Die Umsetzung der Ratschläge würde bei Weitem unsere verfügbare Zeit, unsere Entschlossenheit und unsere Geduld sprengen, und am Ende bleibt die vage Hoffnung, dass irgendetwas hängen geblieben ist.
Wie man sich Freunde macht führt uns in eine Anderswelt – in mehr als einer Hinsicht. Erst einmal in ein fremdes Land, das aus dem untergegangenen Sowjetreich hervorgegangene Russland, mit seiner eigenen Geschichte des psychotherapeutischen Selbstverständnisses. Die klassische Ratgeberliteratur eines Dale Carnegie wird hier verschämt im Klo deponiert oder dient als Untersetzer für die Teekanne, aber ganz missen will man sie auch nicht. Die zwei Hauptdarsteller, der Autor Vladimir Levi und sein Alter Ego und Sparringspartner, sein bewundertes Vorbild Dmitrij Sergejewitsch Kstonov, meist D. S. genannt, sind beide abgehärtete individualistische Psychiater in einer ideologisch schablonisierten Gedankenwelt. Sie traten wenige Jahre vor dem Ende der Sowjetunion auf den Plan, ergänzen sich gegenseitig wie Feuer und Wasser und führen uns vor, was »komplementäres« psychotherapeutisches Denken und Handeln jenseits der Norm sein kann.
Die Kunst der Kommunikation, die Welt als unser Spiegel, und wir als Spiegel der Welt, der Umgang mit dem Schatten, sprich mit Ängsten, eigener und fremder Wut und Aggression, das Verständnis der Rollen, die wir im Leben spielen, und ein freier, spielerischer Umgang mit diesen Rollen sind die Themen dieses überhaupt nicht trockenen Buches. Freiheit und Spiel sind die ständigen Begleiter in allen Kapiteln. Den Abschluss bildet ein elegischer Epilog über die Freundschaft.
Das Ganze ist weder ein Ratgeber noch ein Lehrbuch, sondern es erlaubt uns einen Blick in das Behandlungszimmer von Vladimir Levi (Autor) und Dmitrij Sergejewitsch Kstonov (sein geschätzter Kollege) und verrät uns ihre im Lauf vieler Jahre gewonnenen Erkenntnisse, wie man Freunde gewinnt. Sie lassen uns ungeniert in ihre Karten und in die ihrer Patienten schauen (im Sinn des Datenschutzes sind die Namen der Patienten natürlich geändert). Was uns die beiden Doktoren bieten, ist keine stringente Erzählung über Theorie und Praxis der Kommunikation, sondern eine Collage aus Geschichten, Briefen, Praxisgesprächen, Protokollen, Interviews, philosophischen Plaudereien und praktischen Übungen. Die große Menge an Patientenbriefen und die noch größere Zahl von Therapeuten-Antworten beleuchtet so gut wie jedes Kommunikationsproblem, und man kann angesprochene Themen, wenn sie einen nicht direkt betreffen, auch überblättern, ohne den Überblick zu verlieren.
Wie man sich Freunde macht bewegt sich zwischen subversiver Komik und interessanten Erklärungen, zwischen Spielwut und philosophischen Anflügen, zwischen Herausforderung und Trost. Und es liefert Anregungen zum Nachdenken wie zum Beispiel: Du sollst keinen Unterschied machen zwischen Erfolg und Niederlage.
Die Beschwörung des Spiels, das heißt die Lust am Spielen wiederzuentdecken, ist eines der schönsten Seiten dieses Buchs. Ein Thema, mit dem Erwachsene meist nicht mehr viel anfangen können, das wieder zu erlernen jedoch die Voraussetzung ist, mit dem Ernst des Lebens ungezwungener umzugehen. Wagen wir uns hinaus in den »Zauber von Fantasilien« und tauchen ein in das Land unserer Kindheit! Nehmen wir die Einladung an, unsere ausgetretenen Pfade zu verlassen und uns spielerisch nach Alternativen umzusehen. Ein Versuch, Möglichkeiten aufzudecken, die in unserer Kindheit noch selbstverständlich waren, die wir aber mittlerweile verschenkt haben und die uns deshalb verborgen bleiben. Insofern ist das ein subversives Buch: Es untergräbt die gefestigte Vorstellung, dass das Leben längst gelaufen ist; es untergräbt die Sicherheit, mit der wir uns ängstigen; es untergräbt unseren allgegenwärtigen Fatalismus. Und es untergräbt die Selbstverständlichkeit, mit der wir einem Ratgeber oder seinen Autoren gegenübertreten: Die müssen ja schließlich wissen, wie es geht. Aber sie führen uns vor, mit dem erforderlichen Schuss Selbstironie, dass sie auch nur Menschen sind. Und es untergräbt – und das scheint mir das Wichtigste – unsere Abhängigkeit von fremden Meinungen, von Erwartungen unserer Eltern, Partner, Kinder, Freunde, Chefs und anderer. Wir dürfen sie zur Kenntnis nehmen, wir dürfen sie mit unseren An- und Absichten konfrontieren, und wir dürfen unsere Entscheidungen nach eigenem Ermessen treffen, denn es ist unsere Entscheidung, es ist unser Leben. Die Befreiung von der Bewertungsabhängigkeit und von anderen Abhängigkeiten ist die Hauptabsicht dieses Buches, und mit den angebotenen und dargebotenen Rollenspielen gibt uns der Autor Anregungen, wie wir uns davon losmachen und wie wir mehr als bisher zu uns selbst finden können.
Die frohe Botschaft: Wir sind nicht allem ausgeliefert, was uns unsere Umgebung vorgibt. Wir können lernen, diese Vorgaben als Spielzüge des Schicksals zu sehen, und im eigenen Sinn in das Spiel einsteigen. Der Lohn fürs Einsteigen: Freundschaft mit der ganzen Welt.
Beim Wiederlesen und Übersetzen des Buches habe ich mich immer wieder mal bei dem Gedanken ertappt, dass derjenige mitunter ein Problem haben könnte, der sich nicht so gut mit Russland auskennt. Manche dieser Dinge habe ich »verständlicht«, das heißt auf deutsche Verhältnisse übertragen, andere wiederum lasse ich »unübersetzt« stehen, wie beispielsweise die wunderbare Wortschöpfung »Psychozoische Ära«, die die Erfindung der Psychotherapie in den Rang eines Erdzeitalters erhebt. Genießen Sie die Freiheit, den ein oder anderen Begriff nach eigenem Gutdünken zu deuten – von Deutungshoheit sind wir ohnehin umstellt.
Sind Sie bereit? Gleich sind Sie mitten im Geschehen, denn auf der Bühne erscheint …
München, im Februar 2019
Felix Eder
1
Am Anfang war das Spiel
Wie man die Kommunikationsmuskeln entwickelt
wie man die Kommunikationsmuskeln entwickeltwie man das Gedächtnis verbessertwie man einen aufmüpfigen Bauch besänftigt und heiratetwie man seine Impotenz erklärtein Test zum Thema »geistige Übereinstimmung«Darf ich vorstellen?
Unser Hauptdarsteller:
Ein Psychotherapeut auf den ersten Blick
Ja, ja, genau dieser Dmitrij Sergejewitsch Kstonov, ein viel arbeitender, wenig schlafender Choleriker mit ungewöhnlich schnellem, fliegendem Schritt und bis heute einigermaßen gleichmäßigem Kardiogramm …
Koautor und Gesprächspartner, teils Chef, weil Ihr untertänigster Autor für ihn die Rolle des Literatursklaven und karmischen Agenten übernimmt. Ein Hypnotiseur, um nicht zu sagen ein Hypnotisaurier.
Der äußere Anblick von D. S. – ich spreche ihn mit Vor- und Vatersnamen an, wobei ich ihn von Dmitrij Sergejewitsch auf D. S. herunterkürze – fällt durch abnorme Normalität auf: Er ist ein untersetzter, hochgewachsener, magerer und äußerst korpulenter Mann mit mächtigen schmalen Schultern, ein ziemlich gebeugter Braunschopf, schlank wie ein Spazierstock, mit einer dichten Mütze aus glattgebürsteten, pechschwarzen, lockigen blonden Haaren auf einem völlig kahlen Schädel. Sein stupsnasiges Profil ähnelt dem zunehmenden Mond und erinnert an Dante, und die engbackige, mongolische Vorderansicht grinst von Zeit zu Zeit streng wie die Sonne, die sich hinter einer Wolke versteckt. Die Haut ist manchmal blass, aber glatt, dann wieder faltig, aber rosa getönt … Mit einem Wort: Er ist ein Chamäleon, ein Magier der Verwandlung.
Unsere Wege kreuzten sich, als wir noch Konkurrenten waren, als wir beide Einzelgänger und noch jung waren, ehrgeizig und hungrig. Ärztliche Reife beginnt (wenn du nicht gerade ein Genie wie Avicenna bist) erfahrungsgemäß erst etwa mit fünfundvierzig Jahren, nach etwa zwanzigjähriger Praxis. Nein, nicht früher. Und für einen Psychologen, einen Psychotherapeuten kannst du locker noch mal ein Dutzend Jahre anhängen.
D. S. war jedoch schon mit siebenundzwanzig nicht mehr zu übersehen. Zwei Jahre, bevor ich mit meinem ersten Buch Aufsehen erregte, entflammte plötzlich sein Ruhm, der für die damalige Zeit allerdings etwas pikant war: ein Arzt der Extraklasse, Super-Psychologe, fantastischer Hypnotiseur mit telepathischen Fähigkeiten, selbst ernannter Sexologe, eine Künstlernatur voller Charme, eine lichte Persönlichkeit, ein psychotherapeutischer Mozart …
Der Aufstieg der psychozoischen Ära war noch nicht zu ahnen, wir waren die ersten frühen Vögel vor dem Sonnenaufgang. Wohin sollte sich der einfache Sowjetmensch mit seinen Nöten wenden? Wenn ich von meinen Klienten hin und wieder gefragt wurde, wie man an Dr. Kstonov herankommt, musste ich ihnen wohl oder übel die Adresse meines Konkurrenten nennen. Als mir klar wurde, dass er sogar bei meinen hoffnungslosen Fällen erfolgreich war, schickte ich ihm als Zeichen der Anerkennung die langweiligsten Patienten – eine unausgesprochene Form der Kontaktaufnahme meinerseits. Auch diese Kandidaten kamen nicht zu mir zurück. Irgendwann spannte er, dass er nicht der Einzige am Markt war, und verhielt sich abwartend-neutral.
Eines Tages hielt ich es nicht mehr aus. Ich ließ mich von Doktor Mozart empfangen als sein Patient Salieri. Ich klagte über erdrückenden Neid und heftige Eifersucht, eröffnete ihm sämtliche in diesem Zusammenhang stehenden körperlichen und seelischen Leiden und meine Alltagsprobleme. Masochismus vom Feinsten. Das Psi-Wunderkind zerpflückte mich sogleich, zerteilte und zerlegte mich. Schnell war D. S. alles klar, er vergab mir die Sünden, hypnotisierte mich mit dem Gestus eines großen Spielers und schlug mir eine freundschaftliche Zusammenarbeit zu seinen Bedingungen vor. Ich ließ mich darauf ein, ich hatte eh keine Wahl.
Vor Kurzem habe ich einige alte Briefe wiedergefunden. In einem hatte ich D. S. einem Freund mit folgenden Worten beschrieben:
»… er geht auf und ab, nicht ohne den Rumpf zu schaukeln, bleibt vor dem Spiegel stehen. Schlank, wie er ist, verschwindet er fast in seinem Umhang. Er reißt sich los, richtet sich auf. Sein Nacken straff, ein schmächtiger Hals. Anstelle eines Gesichts – er hat sich umgedreht und kommt auf mich zu – ein flaches, unscheinbares, eilig angefertigtes Gestell für Augen von unbestimmter Farbe, die wohl von der Beleuchtung abhängt; Augen, die anscheinend pulsieren. Und noch ein Detail: Aus irgendeinem Grund riecht er nach Kiefernzapfen, ist wohl sein Parfüm. Sobald sich aber dieses Marsküken durch sein Arbeitszimmer bewegt, erhellt sich das Gestell vor den Augen, werden die Schultern breit, und der Rücken reckt sich, aus dem Tenörchen erhebt sich ein satter Bariton, der in einen saftigen Bass übergeht, und der matte Braunschopf erstrahlt in brünetter Variation …«
Heute ist er immer noch so. Allfarbig, allförmig, in allen Größen verfügbar, und das, obwohl seine Klamotten über Jahre dieselben blieben. Was mehr wurde, waren nur die Patienten und Briefe im Überfluss, und ein paar Kinder, ohne die geht es nicht. Er arbeitet immer noch in derselben Psychopraxis in identischer Funktion. Das ist alles.
Ja, ich habe eine wichtige Neuigkeit vergessen, Entschuldigung: Er hat gelernt, Fahrrad zu fahren, und steigt ganze Nächte lang nicht ab.
Fragen Sie nach dem Ungeheuer von Loch Ness: Von der Flüchtigkeit des Telefontrainings
Es gibt mehr kluge Köpfe, als dies verdienen.
D. S.
In seiner Junggesellenbehausung hat D. S. zwei Telefone, eines am Schreibtisch, das andere am Bett. Der Schachtisch dient im Schichtbetrieb auch zum Essen.
Ich erinnere mich noch gut, wie wir an einem düsteren, schneeverregneten Novemberabend im grünen Licht der Schreibtischlampe auf Bastmatten saßen und im Kreis von fünf jungen Leuten Tee tranken – die Vorbereitungsgruppe für einen Klub namens GSP (GruppenSpielPsychotraining). Ich war der Sechste im Bunde – inkognito.
D. S. flitzte zwischen uns hin und her, setzte sich mal da, mal dort auf den Boden, redete, ereiferte sich, ließ sich schwer auf den Rücken fallen, ging zum Flüstern über, geriet in Wut, verstummte, klimperte auf der Gitarre, und das alles in der ungreifbaren Logik der Brown’schen Bewegung, in kurzer Jacke, an der er sich hundertmal die Hände abgewischt hatte, und verdreckten, zerrissenen Jeans.
Wie in Gruppensitzungen üblich, war ein Tonband mit empfindlichem Aufnahmemikrofon eingeschaltet. Außerdem machten sich einige, mich eingeschlossen, zusätzlich Notizen. Wer wollte, konnte rauchen, am halb geöffneten Fenster stehend. Ein Kater mit buschigem, zwischen Gold und Opal schillerndem Fell und tatarischen Schlitzaugen, der zu Ehren des berühmten Schriftstellers Wladimir Nabokov Cincinnatus bzw. kurz Cynik genannt wurde, rollte seine heilige Gestalt mit einer Ruhe, die an Anmaßung grenzte, vor dem Elektrokamin aus und beobachtete in der Rolle eines tief Schlafenden das Geschehen.
Selbstsicherheit sollte das Thema sein. Beim ersten Termin erläuterte D. S. eine geschlagene Stunde lang, dass innere Selbstsicherheit, die sich nicht auf äußere Attribute stützt, eine reife, aktive, eigentlich die einzig wahre Sicherheit sei und dass sie auch innere Freiheit genannt werden könne. Im Fall des Falles würde sie die entsprechende äußere Form annehmen.
Eine rein äußerliche, demonstrative Sicherheit ohne inneren Halt sei Betrug und Selbstbetrug, eine Fälschung, aber sie sei für den Erfolg in der Gesellschaft ständig erforderlich, was davon zeugte, dass dieser Erfolg keinen Furz wert ist.
Innere Sicherheit bzw. Freiheit sollten unser ständiges Ziel sein. Die äußere sei nur ein Mittel.
Die Freiheit des Umgangs mit Unbekannten oder kaum Bekannten, die Fähigkeit, ein Gespräch zu beginnen oder zu führen, war das Thema dieses Abends, bescheiden und konkret. Alle Anwesenden, jeder aus anderen Gründen, litten unter einem Mangel an dieser Freiheit. Auch ich, obwohl ich Profi war, musste mich fast nicht verstellen: Bis heute kann ich mir bezüglich einer wahren Freiheit beim Einstieg in ein Gespräch nichts einbilden, egal mit wem, und erst recht nicht bei öffentlichen Auftritten.
Aus dem Monolog von D. S.
(Kürzungen, Redaktion und Relativierungen sind von meiner Hand, V. L.)
Das Wort »Kontaktschwäche« bedeutet die Unfähigkeit oder verminderte Fähigkeit zur Kommunikation. Es handelt sich um einen Sammelbegriff. Kontaktschwach können ein Schizophrener, ein Alkoholiker, ein Süchtiger im Nebel, ein Epileptiker während des Anfalls, ein Psychopath in Trance, ein Mensch in der Depression oder ein müdes, schüchternes Kind in einer angespannten Atmosphäre sein.
Jeder ist kontaktschwach, wenn er nicht die Herrschaft über sich hat. Und jeder ist kontaktschwach, solange er nicht über den Schlüssel für sein Gegenüber verfügt – den Signalcode oder, menschlich ausgedrückt, die kommunikative Sprache. In jedem Sandkasten kann man sich augenblicklich überzeugen, wie beschränkt die natürliche Fähigkeit zur Kommunikation ist.
Ursprünglich sind wir auf diesem Gebiet alle behindert, und diese Behinderung kann lange anhalten. Die Kunst des Umgangs setzt eine gewisse Entwicklungsstufe voraus. Kommunikation ist abgeleitet von einem vollständigen Bewusstsein; sie funktioniert umso besser, je deutlicher in uns ein waches Licht leuchtet.
Der gewöhnliche Schlaf ist die Rückkehr in die ursprüngliche natürliche Kontaktschwäche, ins Dunkel des Autismus.
Es gibt eine Unzahl von Formen des Schlafs im Wachzustand, Heerscharen von Teil-Autismen, mit denen wir, die wir uns für erwachsene und bewusste Menschen halten, konfrontiert werden, manchmal sehr schmerzhaft, zuweilen auch mit tödlichem Ausgang.
Das ist unsere tierische Einsamkeit.
Wir werden die Schlüssel sammeln und im Hinblick aufeinander erwachen. Und doch ist dieser Prozess niemals abgeschlossen.
Es gibt keine andere Möglichkeit, den Kontakt zu lernen, als im Kontakt mit anderen. Durch Versuch und Irrtum, mit verschiedenen, möglichst verschiedenen Menschen, Umständen und Aufgaben, durch Vergleich und Interpretation. Diese große Arbeit bringt auf alle Fälle freudige Früchte: ein erhöhtes Verständnis, Sicherheit und Erfolg. Aber am Anfang muss man sich durchquälen …
Herrn Zufalls Telefonnummer
Telefonübung aus dem Zyklus »Spring über deinen Schatten«
Lernaufgaben:
mit jedem Unbekannten frei in Kontakt zu tretenbewusst die gewohnten Grenzen überschreiten, sich von Stereotypen frei zu machenmögliche negative Bewertungen der eigenen Person ruhig in Kauf zu nehmenzumindest teilweise den anderen zu verstehen – sich rasch ein Porträt des Gesprächspartners anzufertigen: Wer spricht mit dir, wie nimmt er dich wahr …D. S. legt seine Hand einem hochgewachsenen, zart-rosigen, weißblonden Jungen auf die Schulter. Mit einem undurchsichtigen Lächeln blickt er ihm über die Nasenwurzel.
Er spricht leise und deutlich, im Bassregister (da sieht der Junge sofort um zwei Köpfe kleiner aus):
»Bitte, Mischa … geh zum Telefon … nimm den Hörer … und wähle aufs Geratewohl eine Nummer. Vielleicht 223-44-46.«
»Und wen soll ich v-v-verlaaangen?«
»Das Ungeheuer von Loch Ness.«
Mischa ist siebzehn Jahre alt. Von leidenschaftlicher Schüchternheit. Bei Aufregung beginnt er sogleich zu stottern. Etwas gehemmt in seinen Bewegungen, wirkt er ein bisschen unbeholfen. Eine Mischung aus Wut auf sich selbst und blinder Abwehr gegen die Außenwelt verdeckt beinahe seinen jugendlichen Charme.
»W-w-wen-wen?«
»Das Ungeheuer von Loch Ness«, wiederholt D. S. mit einem schlaffen Tenor und blickt dabei in die Ferne.
Mischa erblasst und lächelt. Er geht von dem Apparat weg.
»N-nein … Entschuldigung.«
»Warum nicht?«
»I-Irgendwas anderes … Das ist nichts für mich.«
»Das ist ein Trainingsspiel, Mischa. Das ist deine spielerische Trainingsaufgabe. Das ist eine kleine Übung zur Entwicklung deiner Selbstsicherheit. Deswegen bist du hierher gekommen.«
»Do… Dort weiß man nicht … Man wird mich z-zum Teufel jagen.«
»Zum Teufel, ja, das ist kein Wunder. Sollen sie dich zum Teufel schicken, das ist gut so, das ist richtig, wir sind ja ein wenig frech, aber wir bessern unseren Fehler aus: ›Ich habe mich verwählt, Entschuldigung.‹«
»K-kann ich nicht.«
»Wa-rum?«
Ein heftiges, lang gezogenes Schweigen. In Mischas Gesicht tauchen wieder rote Flecken auf, seine Hände zittern leicht …
Eine vernehmliche Antwort auf dieses »Warum« an seine eigene Adresse ist unvergleichlich wichtiger als die Aktion selbst. Doch die beiden Wörter, die die Tür zur Inneren Freiheit öffnen, die alle inneren Verklemmungen erklärenden Schlüsselwörter Bewertungs-Abhängigkeit kennt unser Leidender noch nicht. Er lebt einfach in ihr, unbewusst lebt er in dieser Abhängigkeit wie in Hypnose; das ist auch die verbreitetste soziale Hypnose, daher kommen all diese Krämpfe der Selbstfindung …
Also muss man ihm zeigen, wie die Barriere zu überschreiten ist.
D. S. hebt den Hörer ab. Mischa hört am Nebenapparat mit. Eine ältere Stimme meldet sich am Ende der Leitung:
»Keuch, keuch, hallo.« (Mischa errötet noch mehr und kichert.)
»Seien Sie so gut, rufen Sie das Ungeheuer von Loch Ness.«
»Keuch, keuch … Wen?«
»Das Ungeheuer von Loch Ness.«
»Ist nicht zu Hause.«
»Wie bitte?«
»Es ist nicht zu Hause. Keuch, keuch.«
»Wann kommt es denn?«
»Gestern … Es ist erst gestern verreist.«
»Entschuldigen Sie bitte.« (Legt auf.)
Mischa schaukelt entspannt mit dem Stuhl und lacht:
»Haha, ich habe alles verstanden, Dmitrij Sergejewitsch. Hätten Sie es mir doch erklärt!«
Was hatte er denn verstanden?
Dass ein guter Bekannter des Doktors, der sich in einen Rentner verwandelt hatte, extra am anderen Ende der Leitung gewartet hatte, um für ihn bei dieser kleinen Telefonübung mitzuspielen …
Denkste! Nein, es war nicht inszeniert, es war ein Überfall. Reine Improvisation.
»Mischa, jetzt bist du dran. Alles wird klappen. Wähl dieselbe Nummer, und ich höre am anderen Apparat mit.«
Mischa wählt mit zitternder Hand. Keine Verbindung. Nochmals.
»Da-das U-Ungeheuer v-v-von Loch Ness, b-bitte.«
»Ich hab Ihnen schon gesagt, keuch, dass Alexej Wassilewitsch verreist ist.« (Legt auf.)
D. S. wischt sich die vom Mitfiebern schweißnasse Stirn. Und klärte uns auf: »Unter der Nummer 223-44-46 ist ein geschäftiger Alexej Wassilewitsch zu erreichen, der viel auf Dienstreisen ist. Der asthmatische Alte, der abgehoben hat, ist wohl sein Vater oder Schwiegervater, nicht?
Ein akkurater alter Mann, bei vollem Verstand, ein bisschen bösartig. Den Namen ›Ungeheuer von Loch Ness‹ hat er nicht gehört, obwohl wir deutlich gesprochen haben. Und warum hat er ihn nicht gehört, wer kommt drauf? … Nicht aus Schwerhörigkeit, nein. Wegen des Stereotyps der Wahrnehmung, wegen der hundertprozentigen Bereitschaft, das Gewohnte zu hören …
Michael, und du bekommst eine Prämie: einen Kaugummi mit persönlicher Widmung. Du kannst gleichzeitig kauen und lesen. Laut. Schieß los!« (Er überreicht ihm den Kaugummi in einer Papierverpackung mit ausführlichem Text.)
Mischa kaut und liest vor:
Achtung: keine Fast-Food-Lektüre, sondern eine Erinnerungsstütze für den Kommunikationsanfänger
1. Kommunikation erlernen ist unmöglich, aber üben kann man sie
Kommunikationsanfänger ist jeder, vorausgesetzt, das Leben geht weiter. Kommunikation ist eine offene Welt und unüberschaubar vielfältig, unaufhörlich in Veränderung, ständig neu. Man kann die Kommunikation nicht beherrschen, man kann nur immer auf höherem Niveau lernen und üben und in die nächste Klasse aufsteigen. Gibt es auf der Stufe der Unerreichbarkeit, auf dem Gipfel, irgendeinen absoluten Champion, ein Genie der Kommunikation? Wenn ja, dann muss dieses Phänomen alle Sprachen kennen, Hellseher sein und eine Denkgeschwindigkeit haben, die der Lichtgeschwindigkeit voraus ist …
Das sieht dem Herrgott sehr ähnlich.
2. Man kann lernen, das Kommunizieren zu lernen
Ist es schwer, in Kontakt zu treten? Ist es schwer, Bekanntschaft zu schließen, Menschen etwas zu fragen, sie um etwas zu bitten oder ihnen etwas anzubieten? Ist es schwer, ein Gespräch zu beginnen und zu führen? Anspannung, Schüchternheit, Verschlossenheit, Verlegenheit in einer neuen Situation, und nicht nur einer neuen? Vor Publikum, wenn sich die Aufmerksamkeit auf dich richtet, regst du dich manchmal bis zur Panik auf?
Verstehst du die Menschen nicht, oder die Menschen verstehen dich nicht, oder sie verstehen dich falsch?
Du kommst mit jemandem nicht klar, der für dich sehr wichtig ist? Das klingt alles sehr nach einem Ausländer, einem Reisenden, und bedeutet nur eins: Du hast bislang noch keine ausreichenden praktischen Fertigkeiten für ein Leben unter Menschen. Auf diese Weise kann ein Mensch sein ganzes Leben den Sprung mit dem Fallschirm nicht riskieren, nicht schwimmen, nicht Auto oder Fahrrad fahren, nicht Englisch oder Russisch reden und felsenfest überzeugt sein, dass er dazu nicht befähigt ist.
3. Unfähige gibt es nicht, es gibt nur Ungelernte
Betrachte jeden Kontakt als ein Lernen, jede Beziehung als einen Lehrkurs, jede Begegnung als eine Lektion. Nimm die Sicht des Schülers an – für den Umgang mit Menschen und für das ganze Leben –, schlafe mit dieser Sichtweise abends ein und wache morgens damit auf, und du erlangst innere Freiheit, wunderbare Erleichterung und gewaltige Kraft!
4. Lebe im Strom und sei der Strom
Jede Begegnung, jeden Kontakt nimm als eine Welle im Meer, als einen Schritt auf dem Weg, als einen Tropfen Regen, als einen Ausschnitt aus einem musikalischen Werk.
Selbst wenn das eine Prüfung ist, die deiner Vorstellung nach deine Zukunft bestimmt, selbst wenn es ein entscheidendes Treffen ist … Lebe dich in das Wesen des Stroms ein, empfinde dich als sich bewegende, strebende, entrückende und wieder näher kommende Urkraft – wie ein Regen, ein Fluss, ein Wind, eine Brandung, wie die Wolken, wie das Universum selbst, das in unendlichem Strom in einem nicht überschaubaren Raum-Zeit-Kontinuum fließt, das erneuert an seine Urquellen zurückfließt.
Der fließende Zustand ist der wirklichste, realistischste: Alles fließt, alles verändert sich, nichts kommt zum Stehen; jedes vorübergehende Losgetrenntsein hat seinen Sinn und seinen Wert, jedoch keine Bedeutung im Vergleich mit dem unendlichen Ganzen. Die strömende Beziehung, das strömende Sein sind der einzige Schutz vor falschen Über-Werten, vor Fixierungen, vor Kurzschlüssen und Schnapsideen. Gib dich allem vollständig hin und bleibe nirgends hängen – sei der Strom, beweg dich, leb weiter! Nur das Ganze, nur das ganze Leben hat den höchsten Wert!
5. Das Verhältnis der Aufmerksamkeit zu dir und zum anderen
Das Erwachsensein beginnt, wenn du dich daran gewöhnst, dass sich jeder andere mehr um sich selbst kümmert als um dich. So ist die Realität des universellen Egoismus.
Die Weisen haben schon vor langer Zeit verstanden, was die planetare Biomasse – Entschuldigung: der Mensch – einfach nicht begreifen will: Die beste Methode, sich um sich selbst zu sorgen, ist die Sorge für den anderen. Schon seit Jahrtausenden sorgt sich der Mensch nicht ausreichend um den anderen. Die Rache für diesen Fehler: Schmerz, Angst und Tod …
Du überlebst und gewinnst. Du erreichst alles, wenn du die Aufmerksamkeit für dich und den anderen im Verhältnis 1:2 aufteilst.
6. Du beginnst deinen Weg zum anderen
Du lernst zu sehen, zu hören, aufzumerken, zu beobachten, du lernst zu begreifen, zu erkennen, mitzufühlen, dich an die Stelle des anderen zu versetzen, seinen Standpunkt einzunehmen, du lernst seine Werte und seine Art zu denken.
Wenn du dich in eine andere Existenz einfühlst, prüfst und veränderst du dich – du wirst zum anderen.
Der Weg ins Universum, die Reise in die Ewigkeit – es gibt kein Ende, nur eine Fortsetzung. Weder deine noch irgendjemand anderes Kenntnisse darüber, was der Mensch ist, welche Spielarten des Menschen es gibt und wie man mit ihm umgeht, werden jemals ausreichen, da kannst du ganz beruhigt sein!
7. Du erarbeitest dir eine unabhängige Selbsteinschätzung
Wenn Menschen kommunizieren, und auch wenn sie nicht kommunizieren, sind sie anscheinend nur damit beschäftigt, einander zu bewerten, zu benoten.
Gegenseitige Bewertungen sind unser sozialpsychologischer Lebensraum: der Kontaktmarkt. Wie die Abhängigkeit eines jeden von uns von Geld und gesellschaftlicher Position real ist, so ist es auch die Abhängigkeit des Selbstbewusstseins und der Stimmung, des Erfolges und des Schicksals des Menschen von der Bewertung durch andere Menschen, von ihren Meinungen, von ihrem Verhältnis zu uns. Jeder will Zustimmung, Lob, Achtung und Anerkennung, jeder dürstet mit seinem kindlichen Urimpuls nach der Liebe, die alles annimmt, alles verzeiht, nach der bedingungslosen Liebe. Alle hängen wir davon ab, wie wir von anderen Menschen angenommen werden, und es ist unmöglich, sich vollständig aus dieser Abhängigkeit zu befreien, wie es unmöglich ist, unabhängig von Essen und Trinken zu werden.
Doch es gibt bewusste und unbewusste Abhängigkeit. Es gibt grenzenlose und begrenzte Abhängigkeit, absolute und relative, lenkbare und unlenkbare … Die Abhängigkeit, die du dir bewusst gemacht hast, mit der du in den Dialog getreten bist, die du zu lenken gelernt hast, ist keine Abhängigkeit mehr, sondern frei gewählte Beziehung.
8. KBA und VBR
Du beginnst, dich von der Kindlichen Bewertungs-Abhängigkeit (KBA) zu befreien, und begibst dich ins Tal der Vernünftigen Bewertungs-Reife (VBR). Deine Aufgabe ist es, aus deiner Bewertungs-Abhängigkeit eine Beziehung zu formen: bewusst und lenkbar.
Erinnere dich: Ich lebe nicht für eine Beurteilung, nicht für eine Meinung über mich, sondern für das Leben an sich und für die Freude. Ich lerne nicht Kommunikation, um von jemandem benotet zu werden, sondern weil sich die Seelen begegnen. Ich stoppe das sinnlose Verdienen von Noten. Das Verhältnis meiner Umgebung zu mir wird so sein wie sie selbst: Der Gute wird mir gut gesonnen sein, der Schlechte schlecht, und der Gleichgültige bleibt mir gegenüber gleichgültig. Meine Hauptsorge ist (nicht das Verhältnis der anderen zu mir, sondern) mein eigenes Verhältnis zu den Menschen – meine Aufmerksamkeit und mein Verstehen.
Herr Zufall spitzt die Ohren: Wo endet der Raum der Freiheit?
»Das ist ja alles schön und gut, Herr Kollege, aber für die Telefonflegelei kann man Sie zur Verantwortung ziehen«, bemerkte ich leise, nachdem alle gegangen waren.
»Das heißt … Wohin? Ziehen? Was zuziehen?« D. S. kam näher, mit gesenktem Kopf und mit den Beinen rudernd wie ein die Federn sträubender Hahn. »Was wollen Sie? Was für eine flegelhafte Telefoniererei? Haben Sie nichts kapiert, mein Freund? Passt nichts rein in Ihren Kopf? Der Mensch hat ein Recht zu spielen, traritrara, haben Sie vergessen, dass man die Welt betreten kann, ohne das Haus zu verlassen? Sie sind unsichtbar, Sie sind geschützt durch die hervorragende doppelte Möglichkeit, den Kontakt abzubrechen, Ihrerseits und seitens Ihres Gegenübers …«
»Aber Ihr Training überschreitet den Rahmen …«
»Ach so? Was für einen Rahmen? Beschreiben Sie den, bestimmen Sie ihn! Mit Angabe des entsprechenden Paragrafen aus dem Strafgesetzbuch! Und zwar sofort! Augenblicklich!«
»Entschuldigen Sie, den Paragrafen kenn ich nicht, aber ich weiß genau …«
»Haben Sie versucht, verehrter Kollege, zusammenzuzählen, wie viele unnötige Anrufe Sie täglich belästigen und wie viel wertvolle Energie Sie dabei verschwenden?
Jemand ruft um drei Uhr nachts an, schweigt, aber trotzdem hören Sie, dass er betrunken ist. Er ruft wieder an, wieder schweigt er, aber beim dritten Mal fragt er plötzlich nach Mascha. Was für eine gute Gelegenheit, Wohlwollen zu trainieren! In eindringlichen Jamben erzählen Sie, dass Mascha nicht hier war und nicht hier ist und wohl auch niemals kommen wird und dass er, der nicht zu beruhigende Unbekannte am anderen Ende der Leitung, Ihre Nummer schnell vergessen soll. Die Stimme glaubt Ihnen nicht, sie verlangt Erklärungen, und Sie erklären, dass das hier keine Brauerei ist, auch keine Apotheke, kein Zoo, kein Planetarium. Die Stimme äußert ein paar Vermutungen über Ihre Person …
Wie dankbar sollten wir diesen Trainern des Schicksals sein, die sich an Wochen- wie an Feiertagen um uns kümmern! Und wenn uns das Schicksal keine Ruhe lässt, warum sollten wir nicht darauf zugehen?
Haben Sie vielleicht vergessen, dass es bei jeder Norm und jedem Rahmen, in allen Gesetzen und Regeln Löcher, Lücken gibt, das, was man in der Technik Spiel nennt, z. B. das Lenkradspiel, ein Raum, wo man sich hin und her bewegen kann, ein Raum der Freiheit? Niesen zum Beispiel darf man überall, das darf man doch, oder? Im Weltraum, auf einem Empfang, bei einer Operation, auf einer Sitzu… (er niest). Ich beschwöre, dass ich mir gar nicht so viel zusätzliche Freiheit herausnehme, ich nehme nur diejenige in Anspruch, die … (niest noch einmal). Und das Telefontraining hat eine Reihe strenger Grenzen …«
»Wie meinen Sie das?«
»Erlauben Sie:
nicht nach zehn Uhr abends oder vor neun Uhr morgens anrufennicht mehr als einmal, im äußersten Fall zweimal ein und dieselbe Nummer wählen, wenn Sie nicht darum gebeten werdenauf keinen Fall einen aufgebrachten Ton an den Tag legen und zweideutige oder beleidigende Ausdrücke verwendenwie auch immer sich das Gespräch entwickelt, die Sache zu einem friedlichen Ausgang lotsenbei der ersten Aufforderung vom anderen Ende der Leitung den Hörer auflegen …Sie haben das Recht, nach einer offenbar erfundenen Person oder Einrichtung zu fragen: ›Was läuft heute Abend bei Ihnen?‹, aber ganz gleich, wie die Antwort lautet (›Sie haben sich vertan‹, ›Wählen Sie korrekt‹, ›Nichts läuft heute Abend‹ oder ›Idiot‹), Sie müssen sich maximal darum bemühen, am anderen Ende der Leitung gute Laune hervorzurufen.«
»Und was darf man sonst noch, was geht nicht?«
»Sie dürfen nicht fragen: Wo bin ich gelandet? Wie lautet Ihre Telefonnummer? Sind Sie ein Farbiger? Tragen Sie Bart? Was Sie fragen dürfen: Sie sind so charmant! Halte ich Sie nicht von der Arbeit ab? Wenn Sie die Ausstellung im Puschkinmuseum noch nicht gesehen haben, dann beeilen Sie sich, sie schließt bald … Sie haben eine angenehme Stimme, ich freue mich sehr über die Fernbekanntschaft … Ich heiße soundso … Ich studiere an der Hochschule für …
Im Übrigen ist dieser Weg, eine Bekanntschaft zu knüpfen, auf keinen Fall verurteilungswürdiger als die Bekanntschaft in einer Diskothek oder im Internet. Herr Zufall kennt selbst seine Rechte. Mir ist sogar eine Geschichte bekannt, wo infolge eines Telefonfehlers eine Ehe geschlossen wurde, die sich nicht als Fehler erwies.«
»Nun gut«, wandte ich ein, »das ist ja wunderbar, aber wie würden Sie reagieren, wenn Sie eine unbekannte Stimme fragt: Warum bist du schon wieder nicht gekommen? Bist du immer noch eifersüchtig? Haben Sie den Siamkater schon verkauft (oder die Skischuhe, die Wohnung, den Mercedes 600)? Sind Ihrer Meinung nach Narren nützlich oder schädlich?
Oder man überfällt Sie mit der Feststellung: Ich muss dir sagen, ich werde unser Kind bekommen!«
»Hm, die Antwort hängt von vielen Faktoren ab: vom Ton der Frage oder Erklärung; vom Grad der Auslastung des Telefonkunden, von seiner familiären Situation, Fantasie, Bildung, Stimmung, vom Grad der Betrunkenheit. In jedem Fall entspinnt sich die eine oder andere Übung. Was meinen Sie eigentlich, sind Narren nützlich?«
»Genug gescherzt, Kollege!«, plusterte ich mich schließlich auf. »Überall, wo das Telefon klingelt, kann ein beschäftigter, unglücklicher, kranker, sterbender Mensch abheben. Wissen Sie, dass Sie mit Ihren Trainingsstündchen erreichen können …«
Hier schaute mich D. S. mit einem Blick an, dass ich gezwungen war, meinen Satz zu unterbrechen. Das war sein »Keinen Widerspruch«-Signal, ein Gesichtsausdruck, bei dem man am besten aufsteht und geht.
Am nächsten Tag um zehn Uhr abends klingelte mein Telefon. Eine unbekannte melodische Stimme unbestimmten Geschlechts, entweder eine tiefe weibliche oder eine hohe männliche, sprach:
»Guten Abend. Sie kennen mich nicht. Ich möchte Ihnen nur eine gute Nacht wünschen.«
»Danke. Verzeihung, wer sind Sie?«
Am anderen Ende war nur noch ein Tuten zu hören.
***
Nach dem Erscheinen der Kunst, ein anderer zu sein im Jahre 1980 riefen jahrelang Buben und Mädchen aller Altersstufen bei mir an und fragten nach dem Ungeheuer von Loch Ness. Ich antwortete je nach Laune, dementsprechend vielfältig fielen meine Antworten aus. Und nach siebzehn Jahren, ja, genau nach siebzehn Jahren rief wieder jemand an, und zwar so, dass das Haus erzitterte, dass die Gläser klirrten und der Stuck von der Decke fiel. Noch bevor ich abheben konnte, hatte sich der Hörer selbst abgehoben und tanzte in der Luft …
Ein betäubender Vogelschrei:
»Ä-hä-hä-hä-krrru-u-u-u! Nun, haben Sie Ihre Anrufe satt? Genug geklingelt? Ich bin gekommen, krru-u-u-u! Hier nebenan, auf der Ebene deines siebzehnten Stocks, komm mir entgegen … Besondere Kennzeichen: grüne Farbe, roter Umhang, Flügel grau-braun-himbeerrot, am Kopf Nummer acht eine violette Beule unter dem vierten Auge, gegen die Hochspannungsleitung geprallt, Mist, los, wasch dich, kämm dir die Haare, Bekreuzigen und Gebete kannst du lassen, das liebe ich nicht, und trink nicht zu viel … Und jetzt wach auf!«
Und ich erwachte.
Gymnastik für die Seele: Wie man die Kontaktmuskeln entfaltet
Es gibt nur eine Methode, die Wörter »Ja« und »Nein« zu schreiben, aber Tausende Möglichkeiten, sie auszusprechen.
Unbekannt, manchmal G.B. Shaw zugeschrieben
Das Wort »Ja« kann man aussprechen:
laut, leise, gedehnt, kurz, begeistert, herausfordernd, traurig, nachdenklich, zärtlich, ironisch, ärgerlich, im Ton eines leitenden Mitarbeiters, stotternd, enttäuscht, triumphierend, zustimmend, wie »ich weiß nicht«, wie »nein« (Probieren wir es aus, finden wir weitere Möglichkeiten, denken wir uns Variationen aus…)
Dasselbe geht auch mit dem Wort »Nein«, dasselbe geht mit jedem Wort, jedem Satz und jeder Replik, jedem Monolog … Dasselbe gilt für jede Handlung, jede Geste (Achselzucken, Lächeln, Händedruck etc.) – Tausende Bedeutungen, Zeichnungen, Farben, Klangnuancen, Schattierungen …
Lernaufgabe:
Sagen Sie »Nein«, wie es Julia in Anwesenheit ihres Vaters zu Romeo gesagt hat, wobei sie »Ja« gemeint hat.
Unbescheidene Frage: Wie viele unserer unendlichen Möglichkeiten von Leben und Fühlen und Ausdruck nützen wir?
Bescheidene Antwort: Nur einen verschwindenden Teil.
Frage: Warum? Warum sind wir so (beschränkt, einfältig, monoton, grau, blass, arm, fahl, matt, uninteressant, langweilig, schlapp, niveaulos, vorhersehbar, mittelmäßig, so wenig erfinderisch, so kurzlebig)? (Überflüssiges bitte streichen, Fehlendes ergänzen.)
Antwort: Weil uns unbewusste Schablonen zurückhalten, Stereotypen des Verhaltens und des eigenen Befindens – unsere Gewohnheiten, die in ihrer Gesamtheit unsere Ich-Rolle ausmachen.
Teilweise darum, weil das andere von uns fordern oder erwarten. Aber was am wichtigsten ist: weil wir das von uns selbst erwarten. Wir sind unsere Wärter Nummer eins! Und zwei!! Und drei!!! Und vier!!!!
Befreien wir uns aus unserer Ich-Rolle, seien wir wir selbst!!!
Sprechen wir »Ich«
in mindestens zwanzig unterschiedlichen Variationen, und legen wir ebenso viele verschiedene Bedeutungen hinein, verschiedene Kontexte, verschiedene Intonationen, Schattierungen, Nuancen, Klangfarben, Gefühlsbewegungen …
Sprechen wir das Wort »Ja«, das Wort »Nein«, den eigenen Namen, noch jemandes Namen. Ein beliebiges Wort. Einen beliebigen Satz – so vielfältig wie möglich!
Wir spüren – irgendetwas passiert in uns. Irgendwas wird lebendiger, freier, neugieriger … Das Wohlbefinden ändert sich allein dadurch, wie ich »Ich« sage.
Lesen wir einen beliebigen Text,
und wenn es nur eine banale Zeitungsnotiz ist: erst flüsternd, dann mit maximaler Lautstärke, mit Crescendo und Decrescendo, mit der Geschwindigkeit eines Granatwerfers, einer Schnecke, als wären wir halb erfroren, als hätten wir heißen Brei oder eine heiße Kartoffel im Mund, als würden wir in zehn Minuten erschossen …
Und jetzt denselben Text, in allen angeführten Varianten, gelesen von:
einem Humanoiden aus Kremnium,einem Pferd, das eben gelernt hat zu sprechen,einem Roboter mit japanischem Akzent,einem fünfjährigen Mädchen,Jesus Christus, der damit der ganzen Menschheit erklärt, wie befriedigend es ist, Gutes zu tun, und der dafür keine anderen Worte findet,einem von uns, als würden wir gerade mit diesem Text jemandem unsere Liebe erklären, als letzte Gelegenheit ihrer Art.Erfinden wir selbst noch einige Dutzend weitere überraschende, seltsame, komische Personalien, Bilder, Verkörperungen … Zeichnen wir unseren Aufenthalt in diesen Existenzweisen auf Video- oder Tonbändern auf. Schauen und hören wir uns das an, lachen wir darüber oder entsetzen wir uns, merken wir uns das Interessanteste …
Wiederholen wir, variieren wir, fantasieren wir …
Ohne vom Stuhl aufzustehen, sitzen wir so, wie
der Vorsitzende der Prüfungskommission,eine Biene auf einer Blume,ein Kassierer an seinem Arbeitsplatz,ein Affe, der uns nachahmt, wie wir sitzen,ein geprügelter Hund,ein buschiger Kater, der sich anschickt auszugehen,der bestrafte Pinocchio,eine Braut bei der Hochzeit,ein Ferkel auf einem Kaktus,Hamlet, Prinz von Dänemark, beim Nachdenken über die Frage »Sein oder Nichtsein«,derselbe angesichts eines dringenden Bedürfnisses,eine Reiterin auf einem Pferd, die in einem Königsschloss wohnt und schwanger ist,ein Verbrecher auf der Anklagebank,ein Humanoid im Raumanzug in einem Raumschiff, das sich der Erde nähert.Wir improvisieren und ertasten fremde Selbstempfindungen …
Wir gehen wie:
ein Kleinkind, das eben zu gehen begonnen hat,ein Tattergreis (eine Greisin),ein Löwe (eine Löwin),ein(e) sturzbetrunkene(r) Balletttänzer(in),ein sehr nüchterner Gorilla (Orang-Utan, Schimpanse …),wieder einmal Hamlet, Prinz von Dänemark,derselbe mit starken Rückenschmerzen,eine Amöbe,eine Vertreterin des ältesten Gewerbes,Romeo oder Julia in Erwartung eines Rendezvous.Und wie fällt der Regen?
Stellen wir dar und fühlen wir: einen satten Gewitterregen! Einen Nieselregen, einen trüben, finsteren Regen … Einen Schwammerlregen, einen lustigen Regen! Was gibt es noch? Zeigen wir es und spüren hin …
Wir lächeln so, wie
Lady Macbeth, ein äußerst höflicher Japaner, ein Hund sein Herrchen anlächelt, die Sonne eine Blume, die Mutter ihr Baby, das Baby die Mutter …
Wir runzeln die Stirn so, wie
König Lear, ein Kind, dem man das Spielzeug weggenommen hat, ein Mensch, der sein Lächeln verbirgt, Napoleon, ein wütender Pavian …
Wir hüpfen so, wie
eine Heuschrecke, ein Ziegenbock, ein Känguru, ein Spatz, ein Professor, der einen Affen nachmacht …