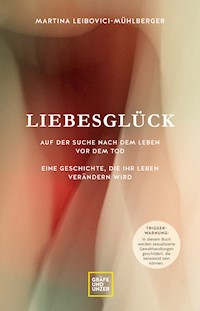16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gräfe und Unzer Edition
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: Edition Gesellschaft
- Sprache: Deutsch
Konstantin, 5 Jahre, hat während Corona einen Waschzwang entwickelt, Selina, 12 Jahre, hat während der Pandemie in der Einsamkeit ihres Kinderzimmers den Kontakt zu allen Freundinnen verloren, Maria, 14 Jahre, hat während der Corona-Pandemie aufgehört zu essen. Geblieben ist Konstantins Waschzwang und Selinas Sozialphobie und Marias Eltern hoffen auf einen baldigen Therapieplatz zur Behandlung der Essstörung ihrer Tochter. Betrachtet man die derzeitigen Daten zur psychischen Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen, so könnte man zur Ansicht gelangen, dass hier eine verlorene Jugend heranwächst. Dabei könnten doch gerade die Erfahrungen der Pandemie zum Dreh- und Angelpunkt dafür werden, dass nun eine besonders starke und selbstbewusste nächste Generation heranreift, die mit ruhigem Geschick und Umsicht später das Ruder übernehmen wird. Wir müssen sie nur richtig begleiten. Österreichs bekannte Ärztin, Psychotherapeutin und Erziehungsexpertin berichtet aus ihrer Praxis, analysiert in diesem Buch die Auswirkungen der Coronakrise auf die Kindesentwicklung in allen Altersstufen und setzt klare Leitlinien für eine Erziehung, durch die unsere Kinder gleichzeitig zu Gewinnern und Errettern des Globus werden können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 219
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Hinweis zur Optimierung
Unsere eBooks werden auf kindle paperwhite, iBooks (iPad) und tolino vision 3 HD optimiert. Auf anderen Lesegeräten bzw. in anderen Lese-Softwares und -Apps kann es zu Verschiebungen in der Darstellung von Textelementen und Tabellen kommen, die leider nicht zu vermeiden sind. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Impressum
© eBook: 2022 GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH, Postfach 860366, 81630 München
© Printausgabe: 2022 GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH, Postfach 860366, 81630 München
Gräfe und Unzer Edition ist eine eingetragene Marke der GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH, www.gu.de
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, sowie Verbreitung durch Bild, Funk, Fernsehen und Internet, durch fotomechanische Wiedergabe, Tonträger und Datenverarbeitungssysteme jeder Art nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages.
Projektleitung: Claudia Bruckmann
Lektorat: Dr. Arnold Klaffenböck
Covergestaltung: Ki36 Editorial Design, München, Bettina Stickel
eBook-Herstellung: Maria Prochaska
ISBN 978-3-8338-8224-1
1. Auflage 2022
Syndication: www.seasons.agency
GuU 8-8224 07_2022_01
Unser E-Book enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Im Laufe der Zeit können die Adressen vereinzelt ungültig werden und/oder deren Inhalte sich ändern.
Die GU-Homepage finden Sie im Internet unter www.gu.de
www.facebook.com/gu.verlag
GARANTIE
LIEBE LESERINNEN UND LESER,
wir wollen Ihnen mit diesem E-Book Informationen und Anregungen geben, um Ihnen das Leben zu erleichtern oder Sie zu inspirieren, Neues auszuprobieren. Wir achten bei der Erstellung unserer E-Books auf Aktualität und stellen höchste Ansprüche an Inhalt und Gestaltung. Alle Anleitungen und Rezepte werden von unseren Autoren, jeweils Experten auf ihren Gebieten, gewissenhaft erstellt und von unseren Redakteur*innen mit größter Sorgfalt ausgewählt und geprüft. Haben wir Ihre Erwartungen erfüllt? Sind Sie mit diesem E-Book und seinen Inhalten zufrieden? Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung. Und wir freuen uns, wenn Sie diesen Titel weiterempfehlen, in ihrem Freundeskreis oder bei Ihrem Online-Kauf.
KONTAKT ZUM LESERSERVICE
GRÄFE UND UNZER VERLAG
Vorwort
Als wir im Dezember 2019 das erste Mal hörten, dass in China eine Virusepidemie ausgebrochen wäre und von einer Übertragung durch Fledermäuse und gerüchteweise von einem geheimen Labor in Wuhan geredet wurde, schüttelten wir den Kopf und meinten, die Sache ginge uns wohl so viel an, wie wenn in China ein Fahrrad umfiele.
Als wir im März 2020 in bisher unvorstellbarer Weise den ersten Lockdown erlebten und die Welt bereits den globalen Mobilitätsatem anhielt, waren wir noch der Überzeugung, dass der ganze Spuk in wenigen Wochen in den Griff zu bekommen wäre. Die nächsten Monate haben uns eines Besseren belehrt, uns zwischen Bangen und Hoffen auf wirksame Gegenmaßnahmen seelisch hin und her geschleudert.
Als wir im Dezember 2020 die ersten Impfungen, doch nicht genug Serum an der Hand hatten, begann das Rattenrennen um die Poleposition.
Als wir dann merkten, dass das Virus sich durch Mutation in vielen Fällen sehr erfolgreich unseren Bemühungen um Gegenwehr entziehen konnte, stieg unsere Beängstigung erneut.
Als wir schließlich im Frühling 2021 realisierten, dass nun das zweite Pandemiejahr anbrach, begannen die sozioemotionalen Auswirkungen der Krise immer sichtbarer zu werden.
In der Zwischenzeit, nach mehr als zwei Jahren, haben wir verstanden, was globale Interdependenz heißt, nämlich, dass es uns sehr wohl etwas angeht, wenn in China ein Fahrrad umfällt, weil alles mit allem verbunden ist und voneinander abhängt. Und gleichzeitig sind wir in unserem Alltagsleben bei rigorosen Kontrollen angelangt. Beim Einkaufen, in der Gastronomie, wenn sie gerade nicht Lockdown hat, oder beim Friseur müssen Impfpass und/oder aktueller PCR-Test vorliegen. Und zum Datenabgleich sollte der Reisepass oder Ausweis gleich stets zur Hand sein. Handelsangestellte sowie Sicherheitsleute werden zu Vollzugsorganen, und in Österreich wurde mit erstem Februar 2022 eine allgemeine, mit Strafe versehene Impfpflicht als Abwehrwaffe im Krieg gegen das Virus installiert. Denn wir befinden uns im Krieg, wie auch der Tarnanzug eines Generalmajors der Gesamtstaatlichen Covid-Krisenkoordination, kurz GECKO-Kommission, deutlich macht.
Auf jeden Fall sind wir in der Zermürbung angekommen, die durch ein tägliches lebensfeindliches Klima, das unseren Bedürfnissen als Sozialwesen nicht Rechnung trägt, entsteht. Und wir sind nun am Ende des zweiten Pandemiejahrs auch in den schrecklichen Zustand einer Spaltung des Landes geraten, die Freunde entzweit und sogar bis in Familien hineinreicht.
Wir haben alle gelitten, und die alte Normalität unseres sozialen Lebens mit freier Bewegung und ohne dass bei einer Umarmung eines Mitmenschen Angst mitschwingt, wirkt bereits wie eine ferne, unwirkliche Reminiszenz an eine vergangene Zeit.
Doch am meisten haben unsere Kinder und Jugendlichen gelitten, denn in ihrem Lebensabschnitt geht es um Erfahrungen, die das Weltbild formen. Und dieses Weltbild, das Corona entwirft, ist in dunklen Grautönen angelegt. Aber welche Auswirkungen hat diese ganze veränderte Sozial- und Angstkultur auf unsere Kinder im Detail? Die Konsequenzen sind vielschichtig, hängen vom jeweiligen Lebensalter und seinen Anforderungen ab und geben Grund zu ernster Besorgnis für die heranwachsende Generation. Im November 2021 berichtete der Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Abteilung des Universitätskrankenhauses Wien in einem Interview von seiner Einschätzung einer möglichen Verdopplung der Suizidraten bei Kindern sowie einem steilen Anstieg von Angst-, Körperbild- und Essstörungen. Sozialphobien sind ein großer Renner im Gefolge von Covid-19. Studien zeigen uns, dass große Teile der Jugendlichen nicht mehr an die eigene Zukunft glauben können und sprechen von alarmierenden Zahlen von Ausbildungsabbrechern, denn durch Distance Learning und Schul-Lockdown hat sich die Bildungsschere nun ganz weit geöffnet. Das sind Tausende stille Opfer von Corona, soziale Sterbezahlen. Und jetzt im Mai 2022 zeigt uns das gerade laufende Mental-Health-Jugendvolksbegehren, wie schlimm es um unsere Zukunftsgeneration bestellt ist. Jeder zweite Jugendliche leidet bereits an Depressionen und jeder sechste hat wiederholt Suizidgedanken – Tendenz steigend!
Da kann man nicht weiter wegsehen! Dem muss man sich stellen! In meinem Fall heißt dies, zur Feder zu greifen.
Der erste Teil dieses Buches ist dem Hinsehen gewidmet. Er versucht die Auswirkungen, die das Corona-Management auf das Alltagsleben unserer Kinder entwickelt hat, anhand von erlebten Beispielen für die unterschiedlichen Lebensalter zu beleuchten.
Im zweiten Teil geht es um die psychosoziale Notfallhilfe für unsere Kinder. Wie können wir als verantwortungsvolle Erwachsene Kindern in dieser so wichtigen Zeit ihrer Entwicklung unter den gegebenen Bedingungen am besten beistehen?
Der dritte Teil lädt die Leserschaft zu einer Position kritischer Distanz ein, so als würden Sie sich ins Weltall zoomen und den Film unserer Spezies betrachten. Dieser Abschnitt ist der genauso infamen wie atemberaubenden These gewidmet, dass gerade in jener Krise unsere allergrößte Chance für eine Veränderung zum globalen Besseren liegen könnte.
Im vierten Teil wird klar, dass es mit unserer Welt nun Kopf oder Spitz steht. Das Kapitel legt dar, dass die menschliche Spezies über zwei ganz wesentliche Merkmale verfügt, die bisher nicht nur ihr Überleben, sondern ihren Aufstieg in die lichte Höhe der Futterkette bewirkt haben.
Im fünften Teil werden acht Erziehungsziele ausgeführt, die unsere Kinder fit für die Zukunft machen und diese Zukunft, gemäß einem gelingenden evolutionären Auftrag, zu einer positiv beglückenden gestalten werden.
Im Ausklang begeben wir uns in die Zukunft selbst und erleben in einem Stimmungsbild, was dies bedeutet und was auf uns zukommt, sollte es nicht gelingen.
Was Corona unseren Kindern angetan hat
Eigentlich hatte ich vorgehabt, in der kurzen Mittagspause meines Praxisalltags in den nahen Park zu eilen, um die Sonnenstrahlen eines der ersten wirklichen Frühlingstage im März in mich aufzusaugen. Irgendwie war es seltsam, aber dieses Jahr spürte ich ein ganz besonderes Bedürfnis nach der Wärme des Erwachens der Natur. Der Wunsch schien mir von ganz tief drinnen zu kommen, so als würde ich mich meiner eigenen Lebendigkeit vergewissern müssen. Frühjahr 2021, mehr als ein Jahr Pandemie fordert eben seinen Tribut. Doch dann kam alles anders, als ich es mit naiver Leichtigkeit geplant hatte.
Auf den ersten Blick wirkte der Park so wie immer um diese Jahreszeit. Die Zweige waren zwar noch winterkahl, aber bereits mit fühlbarem Bersten an den äußersten Spitzen gefüllt, und die milde Luft gab eine leise Vorahnung auf den nächsten Sommer. In Beeten hatten sich Märzenbecher ans Licht gekämpft und boten ersten Insekten Landeplatz und Labung. Eigentlich perfekt, die Szenerie. Doch im Nachhinein betrachtet, erscheint mir jene Begebenheit, die ich in dieser Idylle erlebte, wie die mögliche Gestaltwerdung zukünftigen Unheils, ganz so, wie sich dem Augur Spurinna einst am Vogelflug eröffnet hatte, dass an den nahenden Iden des März Roms größtem Herrscher Gaius Julius Cäsar der Tod bevorstünde.
Der Anlass hätte banaler nicht sein können, die Wirkung nicht erschreckender. Außer mir sind nur wenige Besucher im Park, vor allem einige Mütter mit Kinderwagen. Ein Kleinkind, das sich im Alter wohl gerade zwischen seinem zweiten und dritten Geburtstag bewegt, sitzt in seiner jagdgrünen Gummihose da, vertieft in sein Spiel, in der flachen Sandkuhle. Allerlei leuchtend buntes Plastikspielgerät liegt griffbereit. Mit Rechen, Schaufel und Kübel scheint der Bub hier auch schon einige Vorarbeit geleistet zu haben. Nun beginnt er einen Monstertruck mit passender Bereifung auf seinem Parcours zu bewegen, wobei er neben ihm her kriecht und das Motorengeräusch laut nachahmt. Damit scheint er die Aufmerksamkeit eines etwas jüngeren Kindes erregt zu haben. Mit torkelnden Schritten setzt es sich in Richtung des Buben in Bewegung, um sich neben ihm niederzulassen und nach dem Truck zu greifen. Das ist allerdings nicht ganz nach den Plänen des Truckfahrers, der seinen Unwillen durch entschlossen abwehrende Äußerungen sowie mit dem deutlichen Wegschieben des Gegenübers vom Spielzeug zum Ausdruck bringt. Der jüngere Knirps schnappt sich daraufhin den roten Sandkübel und greift nach der dazu passenden Schaufel. Doch der energische Truckpilot hat augenscheinlich im Unterschied zum jüngeren Kind bereits ein solides erstes Verständnis von Besitz entwickelt, zumindest was den eigenen angeht, und erlebt hier einen Raubversuch. Dass so etwas Widerstand und Strafe verdient, liegt auf der Hand – auf genau derselben, die dem Räuber entschlossen ins Haar fährt und sich dort festkrallt.
In dem Moment, als beide Kinder ineinander verkeilt sind, werden ihre Mütter aufmerksam. Jene des älteren Jungen war wohl zuvor durch das Geschwisterchen im Buggy abgelenkt gewesen, die des jüngeren Buben durch ihr Handy, das sie auch jetzt noch fest umklammert und wie einen Schild in die Höhe hält. Mit raschen Schritten ist die erste Mutter bei ihrem Sohn und reißt ihn vom anderen Kind weg, als gälte es, ihn vor den Zähnen eines Raubfisches zu retten. „Können Sie nicht auf Ihr Kind aufpassen?“, herrscht sie die ebenfalls in der Zwischenzeit bei ihrem Sohn angelangte andere Mutter heftig an. Deren Kind sitzt nun vollkommen verdutzt im Sandbett und hält noch immer mit seinen patschigen Händen das Beutestücke fest umklammert. Während seine Mutter unter heftigem Protest ihres Sprösslings seinen Griff lockert, Kübel und Schaufel demonstrativ neben den Truck stellt und ihr Kind ebenfalls zu sich hochnimmt, verteidigt sie sich: „Ist ja wohl nichts passiert! Sind doch Kinder.“
Für die erste Mutter scheint diese Antwort erst recht der Beweis dafür zu sein, dass die andere den Ernst der Lage nicht kapiert hat. „Abstand halten! Ist Ihnen das nicht klar? Wo leben Sie?“, faucht sie. War ihr Ton zuerst hoch alarmiert, so klingt sie jetzt vielmehr entrüstet, wütend, zurechtweisend und eindeutig deutlich schulmeisternd. „Sie sind wohl auch eine von diesen Corona-Leugnerinnen“, schiebt sie noch verächtlich nach, „und vollkommen verantwortungslos.“
Die andere Mutter wirkt jetzt deutlich überfordert von der Heftigkeit der Kontrahentin und vielleicht sogar etwas schuldbewusst. Jedenfalls zieht sie sich ohne weiteren Kommentar, aber mit gleichzeitig abwehrenden Armbewegungen zum Stützpunkt ihrer Parkbank und ihrem Kinderwagen zurück.
Die erste Mutter blickt sich nun um, als würde sie Zustimmung suchen. Wieder einmal wünsche ich mir Unsichtbarkeit in dieser schon lange als Glaubensfrage ausgetragenen Coronakrise, in der zunehmend die Verhältnismäßigkeit in der Diskussion aus dem Fokus gerät und Polarisation und Gegnerschaft entstehen. Ich würde jetzt ungern instrumentalisiert werden. Was mich hingegen tatsächlich stark beschäftigt und mich viel mehr als dieser Streit angerührt hat, war der Blick der Kinder, die gebannt ihre Mütter als Taktgeberinnen und Weltbildbegründerinnen beobachtet hatten. Eine klassische Lernsituation von erhöhter Relevanz war das hier für die beiden Kleinen gewesen. Denn schließlich hatten ja beide Mütter starke Affekte, also ein emotionales Mitschwingen gezeigt. So etwas, wie das eben, musste also einfach etwas bedeuten. Und damit war es hoch relevant für die Buben gewesen.
Ist ja auch logisch, wenn man den Blickwinkel unserer Spezies einnimmt und noch so am Beginn des Lebens steht wie die beiden Knirpse in der konfliktbeladenen Sanddüne eines Wiener Innenstadtparks. Viel können wir am Anfang nämlich wirklich nicht, und viele vorgeformte Programme, wie soziales Leben zu gestalten ist, sind uns tatsächlich nicht auf der Festplatte des Gehirns aufgespielt. Dafür ist Letzteres aber auch extrem plastisch, wahnwitzig anpassungsfähig und unwahrscheinlich lernwillig, genau genommen eigentlich wie ein Schwamm, der in der jeweiligen Umgebung alles aufsaugt. Fazit: Es dauert nur einige Jahre, bis wir es draufhaben, wie es in unserer jeweiligen Umwelt so läuft und was man von uns erwartet. In gewisser Weise könnte man sagen, dass in unserem Hirn ein Abdruck der uns umgebenden sozialen Welt mit ihren Regeln, Erwartungen, Selbstverständlichkeiten und dem hier Gebräuchlichen entsteht. Damit haben wir Orientierung gewonnen und kennen uns aus. Das geht mit einem Gefühl von Erwart- und Planbarkeit einher und bewirkt, dass wir in dieser uns vertrauten Welt keinen Stress haben.
In Summe ist es ein langer, umfassender und schwieriger Prozess, jene Sozialisierung, die es dafür braucht, dass wir mit sicherem Gefühl im Bauch später auch allein durch die Welt ziehen können. Ganz zu Beginn agieren unsere Eltern und die Familie als erste Vermittler zwischen der uns umgebenden Welt sowie ihrem Funktionieren und uns. Etwas später wirken bereits Kindergarten, Schule und die Gesamtgesellschaft, die ganz heftig und mit modernen Medien immer früher in das Leben der Kinder hineinspielen. Das Ganze nennt man Erziehung, und sie bestimmt maßgeblich, welche Kultur wir im Umgang miteinander ausbilden und als richtig erleben.
Aber was war das eben gerade für eine Lernsituation für diese Knirpse gewesen, für sie, die doch noch ganz am Anfang ihres Lebens stehen? Welche Lehre nahmen die Buben unmerklich mit in ihr weiteres Aufwachsen? In welcher Weise hatte der Meißel sozialen Lernens unter der Kraft des Hammerschlags dieser Erfahrung das Gesamtbild des Umgangs miteinander geformt?
Die unbestrittene Hauptquelle für die Herausbildung ihrer zukünftigen eigenen Einschätzung, wie Dinge und Situationen, die in ihrem Leben geschehen, zu bewerten sind, waren für beide in dieser Lebensphase eindeutig noch ihre primären Bezugspersonen, also Mütter und Väter. Was haben jene Buben gerade eben aus allererster Hand über die Welt gelernt? Was könnten sie wohl aus dieser Situation mitgenommen haben? Und welche Botschaft wurde ihnen soeben über sozialen Umgang vermittelt?
Wie viele Situationen von Alarmiertheit seiner Mutter, wenn sich ihm ein anderes Kind nähert, hatte der ältere Junge bereits erlebt? Und wie viele werden wohl noch kommen, sollten diese Pandemie und die mit ihr verbundene Umgangskultur vielleicht noch ein Jahr oder gar länger weiter anhalten? Wie aber wird sich dies auswirken auf eines der wirklichen Grundprogramme, die jedes Kind in seinem Kopf trägt – dem nach sozialer Nähe und unmittelbarem Kontakt mit anderen? Sicher nicht förderlich, sondern gegenläufig. Wie lange muss man ein Kind wohl vom unmittelbaren haptischen Kontakt mit seinen Altersgenossen zurückhalten, bis das lebendige Bedürfnis nach dem anderen Menschen, die Neugierde auf den anderen, zum Erliegen kommt, das ursprüngliche Programm nach Kontakt nachhaltig überschrieben ist?
Auch wenn ich keine fertigen Antworten auf diese Fragen parat hatte, so bereiteten sie mir im Resonanzkörper meiner eigenen gefühlten gewachsenen Existenz als Mensch, so wie ich Menschsein und menschliches Miteinander interpretiere, deutliches Unbehagen. Solche Gefühle kenne ich, bin immer wieder einmal von ihnen getroffen worden, immer dann, wenn ich mit Zeugnissen des Verlusts von Menschlichkeit konfrontiert werde, unser Sein als empathisches Sozialwesen verloren geht. Aber war das hier denn so ernst zu nehmen?
Die Mutter des Truckpiloten hatte ihren Sprössling, jetzt wo die andere das Feld geräumt hatte, wieder auf den Boden gelassen. Den roten Sandkübel und die Schaufel stieß sie mit der Fußspitze beiseite, nicht ohne dem Jungen einzuschärfen, die Gegenstände nicht anzurühren.
Kurz darauf war sie vom Kinderwagen mit einer Packung Wischtücher und einem keimtötenden Reinigungsmittel zurückgekommen, um die Griffe von Kübel und Schaufel ordentlich zu desinfizieren. Währenddessen kommentierte sie ihr Tun als wichtige Maßnahme. Schließlich richtete sie sich auf, bedachte ihren Sohn mit einem weichen Lächeln und meinte: „So, Sebastian, nun ist alles wieder in Ordnung. Jetzt kannst du wieder ganz allein im Sandkasten spielen.“
Trotz der Banalität und Alltäglichkeit der ganzen Szene ist hier irgendetwas Grauenhaftes im Gange, schoss es mir durch den Kopf, und ich beschloss, lieber im geborgenen Raum meiner mir seit 30 Jahren vertrauten Praxis Schutz zu suchen.
Auf dem Weg zurück zur Ordination begleiteten mich trübe Gedanken. Vergleichbare Situationen, wie jene eben – zwei Kleinkinder in der Auseinandersetzung um ein Spielzeug –, habe ich mit meinen vier Kindern auch zuhauf erlebt. Und doch waren die damaligen Abläufe und damit verbundenen Lernerfahrungen, die aus solchen Begegnungen des Lebens gezogen wurden, ganz anders gestaltet.
Damals, und ich bin der Überzeugung, dass dies genauso auch für die Zeit bis knapp vor Corona galt, haben halbwegs vernünftige Eltern ihren Sprösslingen zuallererst einmal die Möglichkeit zur selbstständigen Auseinandersetzung eingeräumt. Wenn diese aus dem Ruder zu laufen drohte und der Streit nach dem Modell des Faustrechts zu degenerieren schien, griff man maßvoll und ordnend ein. Stets waren die Interventionen darauf ausgerichtet, die Aggressionen zu mildern und stattdessen eine Perspektive anzuregen, die im anderen nicht einen Widersacher, sondern einen potenziellen Spielgefährten erblicken lässt. Das andere Kind konnte vielleicht seinen Wunsch, dabei sein zu wollen, nur unzureichend ausdrücken, versuchten wir unseren Töchtern und Söhnen beizubringen. Einladen und teilen galten als die richtige Kompassrichtung. Gemeinsam war besser als einsam. Dieser prosoziale Grundsatz war eindeutig fixer Bestandteil einer verbindenden Erziehungskultur.
Doch jetzt waren über Nacht und ohne es überhaupt in seinen Konsequenzen zu reflektieren, plötzlich antisoziale Interventionen zum akzeptierten Standard neuer Erziehungspraktik aufgerückt.
Diagnose: verhaltensauffällig
Die erste Klientin des Praxisnachmittags trug nicht gerade dazu bei, meine Stimmung zu heben. Karin war die Mutter des fünfeinhalbjährigen Konstantin. Allein seinetwegen, wegen gravierender Verhaltensauffälligkeiten, suchte sie mich heute auf. Sonst gab es noch Vater Jim, einen Softwareentwickler aus Kalifornien, und die zweijährige kleine Schwester Konstantins mit Namen Noel in seiner bisher glücklichen Familie, wie Karin hervorhob. Aber auch ihre Stimmung war wie meine auf einem Tiefpunkt, und wenn man es genau nahm, so bezogen wir beide unseren Unmut – ich meine tristen Überlegungen und sie ihre an solide Verzweiflung grenzende Aufgelöstheit – aus ein und derselben Quelle. Das sollte sich rasch herausstellen.
Konstantin war während seiner gesamten Säuglings- und Kleinkindperiode ein unauffälliges Kind gewesen, ein Wonneproppen, wie seine Mutter betonte, und bravourös im Durchlaufen aller Entwicklungscharts. Bis vor wenigen Monaten wurde er geschätzt als ein beliebter Spielkamerad im Kindergarten, wo er als unerschrockener Forscher und Eroberer stets an vorderster Front stand, wenn es Neues zu entdecken galt.
Die Misere, deretwegen sie mich heute so dringlich konsultierte, hatte mit der bisherigen positiven Gefügtheit seiner Existenz allerdings gründlich aufgeräumt und wahrscheinlich schon viel früher begonnen, als man sich auf Elternseite bewusst gewesen war. „Wir haben das alles leider nicht rechtzeitig erkannt, waren zuerst sogar davon angetan, wie vernünftig er sich verhalten hat“, räumte Karin sogleich schuldbewusst ein.
So wie sie mir gegenüber tief in sich und nicht nur in einem der Lederfauteuils des Praxiszimmers hineingesunken saß, machte sie den Eindruck gänzlicher Überforderung und Fassungslosigkeit. „Wenn wir geahnt hätten, wo das alles hinführt“, die Stimme bricht ab. Ihr Blick sucht in dem meinen einen Ausweg.
Die Situation rund um Konstantin ist allerdings tatsächlich ernst. Und Karin hat recht. Alles hat so unauffällig – und man könnte sogar sagen „gefällig“ – begonnen, hat sich gleichsam wie ein Beweis dafür angelassen, mit wie viel Vernunft dieses so feine Kind den jäh veränderten Lebensumständen zu begegnen vermochte.
Dann erzählte mir Konstantins Mutter eine Alltagsgeschichte aus Pandemiezeiten: Ihre eigene Mutter, Konstantins Großmutter, war vergangenes Jahr nach Ostern an Corona erkrankt. Im Nachhinein gesehen, hatte sie Glück im Unglück gehabt. Zwar hatte sie hospitalisiert werden müssen, da es für wenige Tage kritisch ausgesehen hatte, aber ein Aufenthalt auf der Intensivstation mit Beatmung war ihr dann doch erspart geblieben. Doch das wusste man natürlich damals noch nicht. Und während all dieser Zeit hatten selbstverständlich große Angst und Bangen das gesamte Familienleben bestimmt. Das war mehr als nachvollziehbar, wenn man die täglichen gebetsmühlengleichen Aufrufe der Medien bedachte oder die Bilder aus Norditalien, Spanien sowie den USA, die uns ein Sterben am Fließband vorspiegelten.
Konstantin liebte seine Großmutter ganz besonders und fühlte sich innig mit ihr verbunden, da sie ihn bereits von frühester Kindheit an intensiv betreut hatte, zumal Karin schon nach wenigen Wochen Mutterschutz ihre berufliche Tätigkeit wieder aufgenommen hatte. Er ängstigte sich gemeinsam mit der gesamten Familie, die sich fast stündlich zum Zustand von Karins Mutter austauschte.
Darüber hinaus hatte er dieses Konzept der „unsichtbaren winzigen Tierchen, die einen schrecklich krankmachen können und überall sind“ gerade verinnerlicht und eine fixe Idee geboren: Auf einer der Zeichnungen, die er für seine Großmutter angefertigt hatte, da er sie wegen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Maßnahmen ja seit Mitte März nicht mehr hatte besuchen dürfen, hätten sich jene „Tierchen“ befunden, die seiner Oma nun so schwer zusetzten. Nichts konnte ihn davon abbringen. Seine Erklärungsmodelle, wie diese „Tierchen“ auf seine Zeichnungen gekommen seien und sich dort hatten festhalten können, um die Großmutter zu befallen, wechselten zwar, waren aber nicht zu erschüttern. Konstantin schien mit heftigen Schuldgefühlen zu hadern.
Er hatte sich angewöhnt, häufig die Hände zu waschen und seine Umgebung konstant zu ermahnen, es ihm gleichzutun. Das war zunächst ganz in Ordnung und angesichts der auch ständigen medialen Aufforderungen und der allgemeinen Renaissance von Sauberkeit sogar etwas drollig, dass der eigene kleine Sohn nun zum Hygienewächter der Familie mutierte. Nach dem Reinkommen von draußen die Hände zu waschen, nach dem Toilettengang, nach dem Spielen, vor dem Essen, das ging ja auch alles gut an und brachte ihm sogar viel Lob ein.
Doch bald fing Konstantin an, auch während des Spielens oder auch während des Essens aufzuspringen, um die Hände neuerlich zu reinigen. Damit war eine andere Spielklasse beschritten. Als er dann noch das Ritual aufnahm, seine Waschungen mehrfach hintereinander zu wiederholen und dabei mit der Wurzelbürste Finger, Handrücken und -flächen wie bei einer chirurgischen Handwäsche bearbeitete, begannen sich die Eltern ernsthaft Sorgen zu machen.
Doch jede Ermahnung, dass er übertreibe, stieß auf taube Ohren. Konstantin wusch, schrubbte und seifte wie in Trance weiter ein. Überall vermutete er jene „schrecklichen Tierchen“, die seine längst aus dem Spital entlassene Großmutter so schwer hatten erkranken lassen.
Auch im Kindergarten ergaben sich zunehmend Friktionen, weil er neben seinem zwanghaften Waschverhalten anderen Kindern nicht nur konsequent auszuweichen begann und sich weigerte, an irgendeiner Gruppenaktivität teilzuhaben, sondern ehemalige Spielgefährten auch rüde wegrempelte, sollten sie ihm zu nahe kommen. Alle Erklärungen und Ermahnungen der von ihm zuvor so geschätzten Kindergartenpädagoginnen liefen ins Leere. Gemeinsam damit, dass im öffentlichen Corona-Dialog Verunsicherung zur Übertragungswahrscheinlichkeit des Virus in elementarpädagogischen Einrichtungen herrschte, beschlossen Konstantins Eltern, ihren Sohn vorübergehend für ein paar Wochen zur „Entlastung der Situation“ zu Hause zu lassen.
„Wissen Sie“, setzte Karin erklärend, aber im Tonfall einer Entschuldigung an, „die Stimmung war auch nach der akuten Phase der Erkrankung meiner Mutter ziemlich gedrückt. Mein Mann und ich waren natürlich sicher auch sehr verunsichert damals. Meiner Mutter ging es immer noch nicht wirklich gut, kein Geschmacksempfinden und vollkommen atemlos nach nur einer Treppe. Das gibt einem schon zu denken. Sie war vor der Erkrankung noch so unwahrscheinlich vital und fit für ihr Alter. Und Jims Eltern waren während der ganzen Zeit drüben in Kalifornien allein. Jims Vater hat eine schwere COPD, Sie wissen schon, diese arge Lungenerkrankung, wo die Lungenfunktion immer weniger wird und die Leute dann immer mit einer eigenen Sauerstoffflasche rumlaufen müssen, weil sie schon bei geringster Anstrengung zusätzlich Sauerstoff brauchen. Ich muss sagen, das alles zusammen hat uns als Familie damals ziemlich zugesetzt. Wir haben uns echt mies gefühlt und hatten auch ziemlich schlechtes Gewissen, meine Schwiegereltern alleinzulassen. Wir waren tagein, tagaus schlichtweg in schrecklicher Sorge. Und dann war es ja auch in den Medien, dass eventuell in Kindergärten die Übertragung von Covid gefördert würde. Wir wollten kein zusätzliches Risiko eingehen. Wir waren einfach total überfordert und haben nicht geahnt, dass Konstantin so reagieren würde.“
In der Tat entpuppte sich der unternommene Entlastungsansatz als Pferdefuß, denn der einige Wochen später unternommene Versuch, Konstantin wieder in seine seit mehr als zweieinhalb Jahren vertraute Kindergartengruppe zurückzuschicken, scheitert fulminant. „Es war, als wäre er wieder vollkommen an den Start seiner Kindergartenkarriere zurückversetzt“, beschreibt es seine Mutter. „So, als hätte er vollkommen vergessen, dass dies sein früher so geliebter Kindergarten wäre. Er führte sich auf, als würden wir ihn dem sicheren Verderben überlassen wollen.“
Da Eltern unter den Pandemiemaßnahmen der Zutritt in das Gebäude hinein untersagt war, blieb Konstantins Familie schließlich nichts anderes übrig, als zu resignieren und den wütenden Kobold, in den ihr Sohn sich nun allmorgendlich verwandelte, wieder einzupacken und mit ihm heimwärts abzuziehen.
„Derzeit ist es so“, schließt Karin, und in ihre Stimme mischen sich Anspannung und Erschöpfung, „dass wir unter seinem Desinfektionsterror leben. Spielen mit anderen Kindern ist grundsätzlich nicht mehr drinnen, aber damit ist er ja auf Linie, auch wenn uns die Feindseligkeit, mit der er es ablehnt, beunruhigt.“
Sie hält kurz inne, als wolle sie dem Gesagten die Möglichkeit geben, sich in seiner gesamten Schwere und Paradoxie zu entfalten. Denn ist es nicht seltsam, dass Kinder, die nicht mehr mit anderen spielen wollen, mit diesem Verhalten „auf Linie“ sind? Auch ich muss unwillkürlich schlucken und habe wie so oft in den letzten Monaten für einen Moment den Eindruck, mich in einem surrealen Film zu befinden.
Dann nimmt Karin den Faden ihres Resümees wieder auf: „Konstantin weigert sich nicht nur, in den Kindergarten zu gehen, sondern will die Wohnung eigentlich gar nicht mehr verlassen. Will ich wirklich mit ihm raus, so braucht das erschöpfende Verhandlungen wie für ein zwischenstaatliches Abkommen, und ich muss ihm jede Kleinigkeit und den gesamten Weg vorher genau beschreiben. Ansonsten wäscht er beständig seine Hände, die nun schon völlig rau und schrundig sind, und verlangt nach Desinfektionsmittel, mit dem er dann peinlich genau seine Spielsachen abwischt. Das Ganze bekommt immer mehr eine tagesfüllende Dimension. Es ist einfach unerträglich.“ Damit liegt Karin, die nach ihren letzten Worten zur Bekräftigung tief seufzt, sicher richtig, und guter Rat, wie Konstantin von seiner Besessenheit zu kurieren ist, erscheint mir hier teuer.