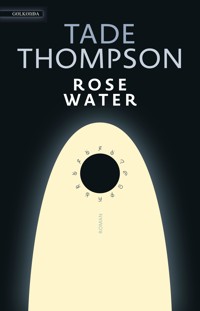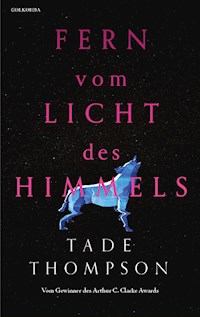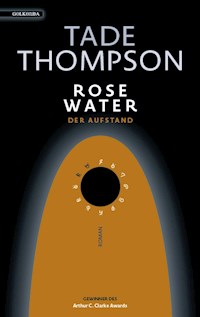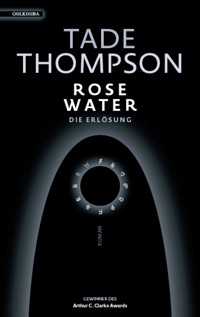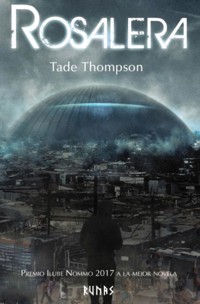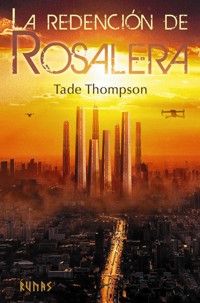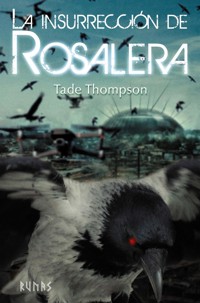10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Kleine Flunkerei, große Wirkung: Weston Kogi kommt nach langen Jahren in England zur Beerdigung seiner Tante nach Alcacia, Westafrika, zurück und macht den Fehler, sich ein bisschen aufzuspielen und die Leute glauben zu lassen, er sei in London ein Police Detective. Ist er aber nicht, nur Wachmann in einem Einkaufszentrum. Er wird von zwei rivalisierenden Rebellengruppen mehr oder weniger gezwungen, den Mord an einem Konsenspolitiker aufzuklären, bzw. den Mord jeweils der anderen Rebellengruppe anzuhängen. Zu allem Überfluss mischt sich auch noch der brutale Geheimdienst der korrupten Regierung ein. Und Kogi muss nun sehen, wie er alle gegeneinander ausspielt und einigermaßen heil aus der Nummer herauskommt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Titel
Tade Thompson
Wild Card
Thriller
Aus dem Englischen von Karl-Heinz Ebnet
Herausgegeben von Thomas Wörtche
Suhrkamp
Übersicht
Cover
Titel
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Inhalt
Wild Card
Danksagung
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Wild Card
1Die Lady neben mir, die auf dem siebenstündigen Flug drei Hochglanzmagazine gelesen und die ich vergeblich in ein Gespräch zu verwickeln versucht hatte, stieß mich mit dem Ellbogen an und schob ihren Kiefer in Richtung meines Drinks.
»Wenn Sie den nicht austrinken, wird er Ihnen weggenommen«, sagte sie.
Bevor ich irgendwas erwidern konnte, hatte sie sich schon wieder ihrem Artikel zugewandt. Keine Minute später räumte das Bordpersonal meinen Drink ab.
Fliegen. Das war noch nie so meine Sache gewesen. Bei jedem Landeanflug aus zehntausend Metern Höhe schloss ich einen Pakt mit Gott. Jetzt war es nicht anders. Ich hatte den Sicherheitsgurt festgezurrt, das Tischchen eingeklappt, die Bordbroschüren verstaut, die Rückenlehne senkrecht gestellt und klammerte mich an die Armlehnen. Ansagen wurden nicht bekanntgegeben, sondern direkt in meinen Kopf gebeamt. Mir brach der Schweiß aus, das Fahrwerk krachte auf die Rollbahn, und meine Tante war tot.
Ich hielt die Luft an, bis die Maschine, nun auf festem Boden, irgendwohin ausrollte. Draußen war es dunkel, das Terminal strahlte wie ein Leuchtturm. Die anderen Passagiere lösten die Sicherheitsgurte und schalteten ihre Handys an, bevor das Flugzeug zum Stehen kam. Ich wartete, bis das Anschnallzeichen erlosch und das Bordpersonal das Okay gab.
Willkommen auf dem Alcacia International Airport in Ede.
Niemand hieß einen in Ede City willkommen; man wurde lediglich darüber in Kenntnis gesetzt, dass man gelandet war, dann musste man selbst sehen, wie man zurechtkam oder unterging. Keiner war zum Spaß hier; nach Alcacia reiste nur, wer musste. So wie Abgeordnete der UN-Friedensmissionen. Wie UNESCO-Vertreter. So wie ich.
Der Beamte an der Passkontrolle verlangte zwanzig US-Dollar, die zusammengefaltet in die Seite mit dem Foto gesteckt wurden. Er ließ die Scheine mit vollendeter Fingerfertigkeit verschwinden. Es war erschreckend und beruhigend zugleich, zu sehen, dass sich in Alcacia nichts verändert hatte.
Wie im Tran zum Gepäckförderband. Was neue Ängste weckte, die aber unbegründet waren. Ich barg mein Gepäck. Der Flughafen erschien mir sauberer, als ich ihn in Erinnerung hatte, mehr Uniformen waren zu sehen. Ich blieb unbehelligt, bis ich zum Zoll kam, wo phlegmatische Beamte es für nötig hielten, meine Sachen zu durchsuchen. Sie fanden nichts, sahen mich trotzdem mit ihrem Mona-Lisa-Lächeln erwartungsvoll an. Für jeden zwanzig US-Dollar, zwanzig mehr, als ich für diesen Teil der Reise eingeplant hatte. Die letzten Reste meines inneren Friedens verflüchtigten sich allmählich.
Der Ankunftsbereich brodelte vor Menschen, Hitze, hartnäckiger Verbissenheit. Gewoge und Gewimmel an den Absperrungen. Leute reckten die Hälse, um ihre Liebsten zu entdecken, einige hielten Schilder hoch; die meisten schoben und drängelten nur. Mit Ausnahme einiger weniger Südasiaten waren die Gesichter schwarz. Keiner lächelte. Ich stürzte mich in die Menge und kämpfte mich zum Taxistand durch. Benutzte mein eingerostetes Yoruba, das seltsam klang, sogar für mich. Ich brauchte mehr Übung, ein paar Tage vielleicht, nur würde ich nicht lange genug bleiben, um es merklich verbessern zu können. Ein schweigsamer, sicherer Fahrer. Dunkle, windstille Nacht, keine Sterne, dafür reichlich Neon. Straßenlaternen säumten die ersten Kilometer nach dem Airport, dann gab es größere Lücken, schließlich hörten sie ganz auf. Ein appetitlicher Geruch lag im Taxi, den ich keinem bestimmten Gericht zuordnen konnte. Die Klimaanlage funktionierte, dankbar löste ich die obersten beiden Hemdknöpfe.
Das Taxi ließ mich am Ede Marriott raus. Die Frauen, die draußen herumlungerten, waren keine Gäste. Nur ihr Lächeln kostete nichts. Ich checkte ein und gab dem Hotelpagen ein Trinkgeld. Sobald er die Tür hinter sich geschlossen hatte, zog ich mich aus und machte die Dusche an. Sie funktionierte nicht. Ich drehte den Wasserhahn auf, der funktionierte, füllte die Badewanne und ließ mich ins kalte Wasser gleiten.
Fünfzehn Jahre war es her, dass ich das letzte Mal am Alcacia International Airport gewesen war. Damals waren die Passagiere mit ihren Koffern und Rucksäcken über die Rollbahn zum Flugzeug gehetzt. Es hatte eine Fluggastbrücke gegeben, die aber nicht richtig angedockt wurde, weshalb drei Passagiere in den Tod gestürzt und unzählige andere verletzt worden waren. In sich verdreht, blutüberströmt, verstümmelt lagen sie auf dem Asphalt, als ich mein Gepäck an ihnen vorbeirollte.
Damals waren hinter den Terminals Schüsse zu hören gewesen, die schlängelnde Rauchspur eines RPG-Geschosses beschrieb einen Bogen, der den Sendemast nur knapp verfehlte und in den Trümmern eines Dachabschnitts einschlug.
Ich erinnere mich, dass ich auf dem Weg zum Flugzeug, das aussah, als würde es sich jeden Moment in Startposition begeben, eine meiner Taschen verlor. Es hätte mich nicht überrascht, wenn sich die Piloten mit einem Drittel ihrer Passagiere auf und davon gemacht hätten. Immer wieder blickte ich zurück, obwohl ich wusste, dass ich meine Tante im Terminal nicht mehr sehen konnte. Ich machte mir Sorgen. Eine Frau, die keine Angst hatte, aber nicht wusste, wie sie auf sich aufpassen sollte. Mit Aberhundert Menschen stand sie vor dem Flughafen und versuchte sich vor der blutigen Revolution zu schützen, die durch Ede schwappte.
Wochenlang hatte es Studentenunruhen gegeben. Meine Tante hatte genug Geld gespart, um mir ein Ticket nach London, England, zu besorgen. Im Jahr zuvor hatte sie meine Schwester fortgeschickt. Alle hatten Angst während der heftigen Straßenschlachten, die sich die Jugendlichen mit der Polizei lieferten und dabei die Stadt in Schutt und Asche legten. Es gab Gerüchte, denen zufolge Menschen Leichen aßen, immer aber waren es Freunde oder entfernte Verwandte, die davon gehört haben wollten. Der Exodus aus der Stadt beschleunigte sich, Menschen kämpften um die begehrten Plätze auf Lastwagen, in Bussen, Güterwaggons.
Die Studierenden demonstrierten, weil die Militärregierung Wahlen versprochen und die Registrierung von politischen Parteien angeregt, anschließend die Top-Leute aller Parteien zu einer Konferenz eingeladen hatte, bei der das Konferenzgebäude ganz zufällig wegen einer »defekten Gasleitung« in die Luft geflogen war, so dass bis auf acht Teilnehmer alle ums Leben kamen. Daraufhin wurde die Wahl bis auf Weiteres abgesagt – Grund und Anlass für den Zorn und die Radikalisierung der Unistudenten.
Meine Tante schien überhaupt nicht beunruhigt. Sie wies mich nur an, den Pass an sicherer Stelle aufzubewahren und meine Bücher zu packen. Um fünf Uhr am Morgen machten wir uns auf den Weg. Ich trug zwei Kleiderschichten. Wir sahen aus wie Plünderer.
»Wenn du am Flughafen bist, ziehst du die äußere Schicht aus«, sagte sie. »Igba yen ni wa wa da bi eniyan pada.« Dann siehst du wieder wie ein Mensch aus.
»Ja, Ma’am«, sagte ich.
Wir stiegen in ihren VW Käfer Baujahr ’80 und fuhren mit dem von ihr gehorteten letzten Rest Benzin zum Flughafen. Sogar in den frühen Morgenstunden kamen wir an vier Studenten vorbei, die einen bewusstlos auf der Straße liegenden Polizisten verprügelten. Sie trampelten auf ihm herum, achtlos sickerte das Blut auf den Teer.
Trommelschläge, unterbrochen von Schüssen und Explosionen. An jeder Straßenecke brennende Autos. Durch das alles steuerte meine Tante. Als wir auf der Straße zum Flughafen in einen Stau gerieten, stellte sie den Motor ab und stieg aus. Wir gingen zu Fuß weiter. Schoben uns durch die Menge, ich hielt mein Ticket hoch über den Kopf. Sie drängelte und bestach sich den Weg frei. Ohne Ticket kam keiner ins Terminal, also ließ ich sie, gegen die Glasscheibe gepresst, zurück. Tränen traten mir in die Augen. Die Menge drängte sich gegen sie, außerdem bestand die Gefahr, dass die Gewalt noch zunahm. Ich winkte. Sie sagte etwas, was ich nicht verstehen konnte und was nicht besonders freundlich aussah.
Beim Check-in wurde ich durchsucht, mein Rektum wurde auf Drogen abgetastet. Man röntgte mich auf verschluckte Gegenstände. Es folgte eine kurze Befragung. Ich hatte Bestechungsgeld bei mir, aufgeteilt in Hunderterpacken einheimischer Dollar, die alle aufgebracht waren, bis ich zur Fluggastbrücke kam. Als die Brücke wegbrach, floh ich vor den Schreien der Verletzten und folgte der Menge, die einen anderen Weg zum Flugzeug suchte.
In den Duty-Free-Shops kam es zu Explosionen und Bränden, die schnell erstickt wurden. Die Aufständischen hatten den Taxistand erreicht, wo sie mit Raketenwerfern auf die wichtigsten Abschnitte des Terminals feuern konnten. Rauch brannte mir in der Lunge auf dem unendlichen Weg zum Flugzeug. Es sah viel zu winzig aus für die vielen Leute, die mit ihren Boardingpässen winkten, von denen die meisten gefälscht waren. Ich kannte meine Landsleute.
Schließlich das Hinaufkrabbeln auf der aufblasbaren Notrutsche – ja, man konnte sich darauf auch in die umgekehrte Richtung als vorgesehen bewegen. Wir hangelten uns hinauf wie die Teilnehmer einer japanischen Gameshow. Ich krallte mich ins Plastik, rutschte weg, fing mich, machte weiter und erreichte den Gipfel. Nach mir schafften es nur noch zwei weitere, bevor die Flugbegleiter »Sorry« sagten und die Türen schlossen.
Die Maschine setzte sich in Bewegung, ich blickte aus dem Fenster und sah Leute die Scheiben des Terminalgebäudes einschlagen. Ich konnte nur hoffen, dass meine Tante durch die Menschenmenge wieder sicher nach Hause gekommen war.
Die Flugzeugtriebwerke heulten auf. Ich wurde in den Sitz gepresst, die Maschine hob ab, und ich hatte einen Blick über die Stadt. An vielen Stellen Rauch. Dort unten starben Menschen, ich aber war in Sicherheit. Nana war ebenfalls dort unten. Meine Freundin. Ihre Eltern waren mit ihr vor Tagen in den Norden von Alcacia geflohen. Schon jetzt spürte ich die Einsamkeit, aber dann waren wir in den Wolken, und von Ede war nichts mehr zu sehen.
Jetzt, fünfzehn Jahre später, war ich zurückgekehrt, weil meine Tante gestorben war. Es gab keinen Rauch, keine fanatischen Studenten, die nach Blut und parlamentarischer Vertretung dürsteten und die mit Boden-Luft-Raketen um sich schossen. Nur ich im Hotelzimmer, wo ich tropfnass am Fenster stand, weil man in der infernalischen Hitze nur dann etwas abkühlte, wenn man duschte und das Wasser auf der Haut verdunsten ließ. Ein Fenster ins Nirgendwo. Es ging zur Wand des nächsten Gebäudes, außerdem war es zu dunkel, um irgendwas zu erkennen. Ich in der Unterwelt.
Ich schickte meiner Schwester Lynn in London eine SMS.
Sicher gelandet. Du hättest kommen sollen, nicht ich. Ich hasse es hier. Ich geb dir Bescheid, wenn ich bei der Zeremonie bin. X
Ihre Antwort kam innerhalb einer halben Minute.
Du bist ein Yoruba-Mann. Alcacia ist deine Heimat. England hast du nur gepachtet. Hör auf mit dem Gejammere, Weston. Ich liebe dich. X
Ich musste nur zwei Tage überstehen. Achtundvierzig Stunden, dann war ich wieder in London, in meinem richtigen Leben.
Ich konnte die Abreise gar nicht erwarten.
2Am nächsten Morgen machte ich mich in einem gemieteten Jeep auf den Weg zur Beerdigung. Das Satelliten-Navi benahm sich erratisch, trotzdem verfuhr ich mich im Straßenchaos der Stadt nur dreimal, was ich ziemlich beeindruckend fand. Ich hätte ein Taxi nehmen sollen. Es war ein strahlender Tag mit subtropischem Sonnenschein und so windig, dass ich die Augen zusammenkneifen musste. Am Friedhof betrachtete ich die versammelte Menge. Holzklappstühle waren aufgereiht, manche davon waren leer. Auf einem ganz hinten ließ ich mich nieder. Weil der Boden uneben war und ich auf einer kleinen Erhebung saß, hatte ich einen guten Blick über das Geschehen. Die Gäste ganz in der Nähe starrten mich finster an. Was mich nicht überraschte; entweder kannten sie mich nicht, oder sie kannten mich und hatten gedacht, ich würde nicht kommen.
Die Beerdigung also, ich erlebte sie so: Damit ich etwas zu tun hatte, während der Prediger seine Trauerrede vortrug, rief ich mir unablässig die Namen von Malariaparasiten ins Gedächtnis. Meine Angst vor Malaria war so groß, dass ich vom Proguanil und Mefloquin jeweils die doppelte Dosis genommen hatte. Am Abend zuvor hatte ich im Hotelzimmer Moskitos gejagt und mir zur Abwehr ekelhafte Chemikalien auf die Haut gesprüht.
Die Beerdigung. Die Beerdigung war der Grund, warum ich wieder in meinem Heimatland war. Meine Tante hatte sich um mich gekümmert, als ich klein war, sie hatte mir das Flugticket nach Großbritannien gezahlt und mir einen Neuanfang ermöglicht. Die finanziellen Verbindlichkeiten waren längst getilgt, aber es gab nun mal Schulden, die nicht mit der Kreditkarte zu begleichen waren. Viele Trauergäste hatten sich eingefunden, viele Leute waren aber auch nur hier, weil in den vergangenen Tagen vor dem Haus der Familie drei große Kühe angebunden gewesen waren. Die Aussicht auf was zu essen zog in dieser Gegend die Leute mächtig an.
Die Szenerie: Ede City, Alcacia. Westafrika. Ehemalige britische Kolonie, ehemaliges französisches Protektorat, ehemaliger portugiesischer Handelsposten, jetzt, im vierten Jahrzehnt seiner Unabhängigkeit, das Land meiner genetischen Zulieferer. Mittlerweile bin ich Brite, betrachte mich aber immer noch als Bürger von Alcacia.
Die Beerdigung: tränenreich, ein schrilles, tremolierendes Kreischen mit mächtigen wackelnden, halb entblößten Brüsten. Sie hatte einen Namen, den kannte ich aber nicht. Sie war eine professionelle Trauernde, die ihr beträchtliches Körpervolumen, ihre willentliche Tränensekretion und ihren einschüchternden Stimmumfang in den Dienst der emotional enthaltsameren Hinterbliebenen stellte. Die geladenen Gäste schlenderten umher und saßen auf Grabsteinen. Manche weinten leise für sich, was für Schwarzafrikaner unüblich war. Wir drücken unsere Emotionen offen aus, machen keinen Hehl aus unseren Gefühlen, kommunizieren sie mit den anderen. Meine Tränen sind größer und besser als die deinen. Ich trauere mehr als du. Ich habe sie mehr geliebt als du.
Ich saß abseits der anderen; so war das schon immer gewesen.
Mit der Zeit erkannte ich dieses oder jenes Gesicht von früher. Namen fielen mir nicht ein, also ließ ich weiter den Blick über die Menge schweifen. Träge. Verstohlen sahen sie zu mir, versuchten mich einzuordnen, erkannten mich anhand meiner Kleidung und meines Auftretens als Ausländer. Der Priester kam zum Schluss seines Vortrags, die Trauernde legte jetzt erst richtig los, flehte darum, mit meiner Tante begraben zu werden, die, wenn mich meine Erinnerung nicht täuschte, angesichts dieser mangelnden Selbstbeherrschung die Stirn gerunzelt hätte.
Der Friedhof unterschied sich nicht von denen, die ich aus England kannte. Bis auf die Zäune, die die Grenze zwischen den Toten und den Vorbeieilenden zogen. Vandalismus war so gut wie unbekannt, weil man in Alcacia eine Heidenangst vor Geistern, Zauberern und anderen übernatürlichen Scheußlichkeiten hatte. Der Zauberweg zum Reichtum bestand darin, sieben Tage und Nächte auf einem Friedhof zu schlafen, nach Ablauf dieser Zeitspanne würde dann ein Dämon erscheinen und der tapferen Seele, die dieses Tabu gebrochen hatte, das Geheimnis grenzenlosen Reichtums offenbaren. Wenn ich an einem Friedhof vorbeikam, fasste ich mir immer an den Kopf, weil ich glaubte, Geister könnten mir durch die Fontanelle die Seele entreißen. Im Ernst, das glaubte ich.
Es summte hinter meinem Ohr, ich klatschte danach, aber nicht zu eifrig; ich wollte nicht allzu sehr als Außenseiter auffallen. In der ganzen Zeit, in der ich nicht da gewesen war, Tag für Tag, hatte ich mir eingeredet, dass McDonald’s-Mampfen und eine störungsfreie Stromversorgung mich nicht verändert hätten. Lynn, wesentlich realistischer in ihrer Einschätzung, sagte mir, wir würden nie mehr nach Alcacia zurückgehen, aber der Drang dazu sei typisch für Immigranten, das sei so ein Nächstes Jahr in Jerusalem-Ding.
Als ich meinen Namen hörte, blickte ich mich um. Es fällt mir schwer, mich an meine exakte Reaktion zu erinnern, aber ich würde sagen, ich schreckte auf, worauf sogleich zaghafte Angst folgte, die an Panik grenzte. Der Grund: Churchill Okuta. Oder einfach nur: Church. Dieses Grinsen. Direkt aus meinen Albträumen von der weiterführenden Schule. Church war der fieseste Typ, der mir jemals in meinem Leben begegnet war, und das sagte einiges. Er hatte mir als Kind das Leben unerträglich gemacht, jetzt war er hier. Inzwischen war ich an die fünf Zentimeter größer als er, damals hatte er mich weit überragt. Am ersten Tag im Wohnheim war Church mit einem Ledergürtel auf mich losgegangen, um »Regeln und Rangfolge festzulegen«.
Sein Spitzname hatte damals Tippu Tip gelautet nach dem berüchtigten schwarzen arabischen Sklavenhändler. Sein Zimmer im Wohnheim nannte er Sansibar, und was darin ablief, war ebenso berüchtigt. »Nach Sansibar gehen« wurde an der Schule zum Synonym für Prügel beziehen. Jahre später wurde er der Schule verwiesen, nachdem er einen jüngeren Schüler bewusstlos geschlagen und über Nacht draußen in der Kälte an ein Geländer gefesselt hatte, weil »Hunde im Haus nichts verloren haben«. Der Junge hatte sich dabei eine Kehlkopfverletzung zugezogen und wäre fast an einer Lungenentzündung gestorben.
Jetzt stand er also vor mir, trug ein Hemd mit Kolki-Muster auf dunkelviolettem Grund. Frivol für eine Beerdigung, aber so war Church. In der Millisekunde, bevor wir etwas sagten, ging mir die Frage durch den Kopf, ob wir verwandt waren, Gott behüte. Was sonst hatte Church auf der Beerdigung meiner Tante verloren?
»Du Bastard«, sagte Church. »Seit wann bist du hier?« Breites Grinsen. Churchs Grinsen war verdammt furchterregend, weil er kleine, gleichmäßige, nach innen geneigte Zähne hatte, die an einen Hai erinnerten. Außerdem nannte er mich nicht unbedingt auf eine kumpelhafte Weise »Bastard«.
»Hallo, Church«, sagte ich. »Schön, dich wiederzusehen.«
»Lügner.«
»Wie ist es dir ergangen?«
»Weißt du doch. Ich war hier und dort, hier und dort.«
»Woher kennst du Tante Blossom?«
»Oh, ich kannte sie gar nicht. Ich geh nur gern auf Beerdigungen. Ich lass mir das Essen schmecken.«
Ich grummelte was.
»Was treibst du so? Hab gehört, du wärst nach Amerika gegangen.«
»London.«
»Ja, London. Für uns alles ein und dasselbe. Fort ist fort.«
»Wie wahr.«
»Also, was machst du?«
»Bin bei der Polizei. Bei der Mordkommission der Metropolitan Police.«
»Polizei. So, so.« Völlig sinnlos, diese Antwort. Allmählich machte sich das vertraute Gefühl der Panik breit. Wenn Church auf der Schule damals einen bei einer Lüge ertappen wollte, fing er mit irgendeinem Stuss an, so dass man versucht war, an der eigenen Aussage herumzufrickeln, sie auszuschmücken, was aber nur nahelegte, dass man was zu verbergen hatte und er das ganz genau wusste. Und wenn man dann weiterredete, wenn man ins Stammeln geriet, sich in irgendwelche Einzelheiten verstrickte und man sich in die sprichwörtliche Ecke manövrierte, begann er seinen Gürtel zu lösen.
Meine Antwort war ja durchaus gelogen, aber nur ein bisschen, und auch nur, weil ich wollte, dass er aus meiner Umlaufbahn abdrehte.
Ich hätte mich daran erinnern sollen, dass Church immer tat, was er wollte und wann er wollte. Konsequenzen waren für ihn was seltsam Abstraktes, das zu verstehen er anderen überließ.
Ein paar Area Boys kamen vorbei und erwiesen ihm lautstark Respekt, indem sie seinen Namen schrien. Er winkte ihnen zu und zuckte mir gegenüber mit den Schultern, als wollte er sagen: Was soll man machen?
Area Boys waren so was wie Allzweck-Gauner, jeder Privatunternehmer konnte sie mieten. Wollte man in Ruhe eine Party feiern, musste man sie mit Kohle, Essen und Alkohol ruhigstellen. Vor Wahlen wurden sie von Politikern angeheuert, damit sie den Wahlkampf des Gegners sabotierten. Weil die Opposition eigene Area Boys anheuerte, resultierte das gewöhnlich in prachtvollen Straßenkämpfen oder karnevalesken Drive-by-Shootings. Gelegentlich flippten sie auch einfach so aus und plünderten, vergewaltigten und töteten nach Lust und Laune.
Die, die Church ihre Ehrerbietung erwiesen hatten, trugen als Markenzeichen amerikanische Straßenklamotten. Man stelle sich fünf Typen mit Beanies und Puffas vor, und das bei einer Durchschnittstemperatur von neununddreißig Grad Celsius und minimaler Kühlung durch den Wind. Ich traute mich nicht zu lachen.
»Kommst du zur Feier danach?«, fragte Church.
»Ja, Tante Blossom war …«
»Okay, wir sehen uns dann.«
Bevor ich noch was sagen konnte, fummelte er an seinem Handy herum und schlappte zum Ausgang. Meine Freude hielt sich in Grenzen.
Ich richtete Blick und Gedanken weg von Church und wieder auf die Zeremonie. Der Prediger war fertig, die Sargträger, vier alte Männer, ließen den Sarg in die Grube, dazu kamen sachte Rhythmen von Sprechtrommeln, in die traditionelle Yoruba-Verse eingestreut wurden, von denen manche das Gegenteil einer christlichen Totenfeier wachriefen.
O d’oju ala. Ich werde dich im Traum sehen.
Die Familie rückte näher zusammen. Gut, die unmittelbare Familie. Jeder Yoruba ist ja mit allen anderen verwandt, die Definition von Familie ist ziemlich breit gefasst. Bislang hatte ich mich am Rand der Menge aufgehalten, jetzt aber drängte ich mich nach vorn. Und versteifte mich. Ich dachte nicht an Tante Blossom, ich dachte an den großen Mann in der weiten Agbada, der Erde ins Grab warf. Mein Vater, aber nicht mein Dad. Er musste etwas gespürt haben, denn in diesem Moment blickte er auf und sah mich. Keinerlei Reaktion von ihm, außer dass er mich eine halbe Minute lang anstarrte. Er hatte geweint. Das machte mich traurig, trotz allem. Als ich ein Kind war, hatte dieser Mann nie geweint oder überhaupt irgendwelche Gefühle gezeigt. Tränen waren für ihn Frauenkram, das Weinen hatte er meinem Bruder Simon und mir mit Gewalt ausgetrieben.
Neben ihm, einen Erdklumpen in der Hand und eine Kinderschar im Schlepp, stand seine neue Frau, die, die er nach meiner Mutter geheiratet hatte. Ihr Name fiel mir nicht ein. Eine geistlose Person, die ihren Hüften und ihrem Nachwuchs nach zu urteilen lediglich die Zuchtstute des Alten war. Ich hegte keinerlei brüderliche Gefühle für ihre Blagen. Nur Ablehnung.
Ein lauter Knall unterbrach meine kaltschnäuzigen Gedanken. Alle Lieder begannen mit einem donnernden, alles erschütternden Schlag, an dem man nur Gefallen finden konnte, wenn man nicht fünf Zentimeter von den Trommlern entfernt war. Einige Minuten lang war ich taub.
Bis ich am Grab stand, hatte sich die Taubheit zu einem konstanten Klingeln abgeschwächt. Ich weinte, als ich Erde auf ihren Sarg rieseln ließ. Zwei Handvoll: eine für mich und eine für meine Schwester, auch wenn Lynn Tante Blossom nicht so lange gekannt hatte wie ich. Niemand tröstete mich. Allen war es unangenehm, dass ich da war, aber das war mir egal. Ich hatte nichts Falsches getan.
Später lehnte ich am stummeligen Palisadenzaun und sah zu, wie sich die Gäste grüppchenweise auf den Weg zu Tante Blossoms Haus machten, damit sie bewirtet würden. Ein langer Schatten auf dem Gras neben meinen Füßen wurde immer länger, jemand kam auf mich zu.
»Dich hab ich nicht erwartet«, sagte Dad.
»Das hier ist eine Beerdigung, Dad. An der nimmt traditionell die Familie teil«, sagte ich.
»Ah, du sagst es. Familie. Die Familie nimmt teil. Wenn dem so ist, was machst du dann hier?«
Mein Vater, der Scherzkeks.
»Dad …«
»Nenn mich nicht ›Dad‹, Weston.«
Ich hatte immer noch Angst vor ihm. Weiß Gott, warum. Ich brauchte oder wollte nichts von ihm, er konnte mir oder meiner Schwester auch nichts mehr antun, trotzdem hatte ich einen trockenen Mund, trotzdem pochte mein Herz. Ein toller Tag, um alte Ängste wiederaufleben zu lassen.
»Tante Blossom war meine Familie«, sagte ich.
»Hmpf.« Er ließ seinen Nacken knacken. »Blossom hatte immer schon ein weiches Herz. Und sie tickte nicht richtig.« Tante Blossom war in der Tat eine freilaufende Irre gewesen, aber nie und nimmer hätte ich dem Alten zugestimmt. »Ist Lynn auch hier?«
»Ich weiß nicht, ob dich das irgendwas angeht.« Ich baute mich vor ihm auf.
Er verstummte, dann sagte er: »Wenn du zur Leichenfeier kommst, wirst du als mo gbo, mo ya behandelt. Tanzt du aus der Reihe, lass ich dich rauswerfen.« Er spuckte aus und stapfte, seinen Wanst vor sich herschiebend, davon. Als er die Warnung aussprach, war er in seinen Dialekt zurückgefallen, dem ich kaum folgen konnte. Es dürfte kaum einen Menschen geben, der so verhärtet war wie er. Erst als er schon weg war und der Zaun zu klappern anfing, merkte ich, wie sehr ich zitterte. Eine Weile lang studierte ich seinen Auswurf, der sich mit der Erde vermischte.
Eine Windbö erfasste einige Blätter, wirbelte sie um meinen rechten Fuß und trug sie die Palmen hinauf und darüber hinweg. Auf meiner Kleidung blieb eine Staubschicht zurück. Ich klopfte die Hemdsärmel ab und ging zum gemieteten Jeep, um zur Leichenfeier zu fahren.
3Die Organisatoren hatten die Straße abgeriegelt. Eine siebenköpfige Juju-Band spielte auf einer gut halben Meter hohen Bühne, die Tanzenden bevölkerten die gesamte Straße. Einige Feiernde, meistens Männer, hielten Geldscheinbündel in der Hand und klebten anderen, meistens Frauen, Scheine an Stirn oder Hals. Der Geruch teuren Parfüms vermischte sich mit dem Aroma von Kuhscheiße. Dort, wo die Kühe festgebunden gewesen waren, lag immer noch Dung. Bier, Kolanüsse, Jollof-Reis, Schnaps, Yamsbrei, Suppen und Eintöpfe waren auf den Tischen aufgebaut. Ein Feuerwerk erhellte den tintenschwarzen Himmel.
Die Beerdigung ist für den Verstorbenen, die Leichenfeier für die Hinterbliebenen.
Der Besuch der Leichenfeier war in mehr als einer Hinsicht ein Fehler. Ich hätte einfach in mein beschissenes Hotel zurückfahren und auf meinen Flug warten sollen. Die Drohung meines Vaters hatte in mir vielleicht etwas Gegenteiliges ausgelöst, etwas, was dafür sorgte, dass ich mich nicht einschüchtern ließ. Wie auch immer, ich hatte gedacht, dass die Party mich aufheitern und ihm auf den Sack gehen würde.
Noch war niemand betrunken, aber wir waren ja erst am Anfang. Ich hatte wohl zu lange in London gelebt, weil ich allen Ernstes erwartete, dass sich Nachbarn beschweren und die Polizei aufkreuzen würde, aber wahrscheinlich befanden sich die Nachbarn unter den Gästen, außerdem hatten die Organisatoren vermutlich die Polizei und die Area Boys bestochen. Blieb das Militär, das allerdings zu sehr mit den Rebellen im Norden beschäftigt war. Wie bei der Beerdigung hielt ich mich auch jetzt im Hintergrund und ließ mich an einem Tisch nieder, an dem keiner zu erkennen gab, dass er mich kannte, was mir nur recht war, besten Dank.
Die Feier nahm sich ziemlich chaotisch aus, wusste man aber, worauf man zu achten hatte, ergab alles seinen Sinn. Die Band spielte gegenüber von Tante Blossoms Haus. Der Abschnitt von der Band bis zum Eingangstor des Grundstücks verstand sich als Tanzfläche. Zu beiden Seiten der Band erstreckten sich Tische und Stühle wie in einem Vorlesungssaal, nur ohne Wände und Decke. Partylichter, bunte Glühbirnen, hingen wie ein nächtlicher Regenbogen an langen, zwischen den Straßenlaternen gespannten Kabeln. Das Haus selbst war offen, buchstäblich. Alle Türen und Fenster waren weit aufgerissen, die Kommandozentrale der Caterer, die von hier aus das Essen und die Getränke servierten.
Auf der Bühne stand ein Mann neben dem Leadsänger und flüsterte ihm Informationen zu, die er von Karteikarten ablas. Der Sänger baute die Namen in die populären Juju-Songs ein, und wer namentlich erwähnt wurde, war anschließend verpflichtet, druckfrische US-Dollar über die trauernde Familie und den Sänger zu streuen. Die Scheine mussten noch knistern.
Ich betrachtete das Spektakel der hin und her schwingenden Hintern, aufwendig gestalteter Geles und wallender Agbadas. Ich trank Palmwein. Das hier waren die Menschen, die ich als meine Familie betrachtete. Manchen ging es gut; andere sahen in ihrer fadenscheinigen Festtagskleidung aus, als lebten sie am Rand der Armut.
Ganz unten in der Nahrungskette standen jene, die sich nichts leisten konnten, was als Festkleidung durchgegangen wäre. Sie waren die Aasfresser des Ökosystems, warteten auf die Reste, die vom Tisch abfielen, oder auf Geldscheine, die in ihre Richtung geworfen wurden. Sie klauten, bettelten und bereiteten den Wohlhabenderen ein schlechtes Gewissen. Meistens waren es Kinder, klar war aber auch, dass die Eltern nur wenige Meter dahinterstanden und sich vom Mitgefühl nährten, das ihre großäugigen und rotznasigen Gören wachriefen. Sie hielten sich von den jungen Männern fern, die stöckeschwingend für Ordnung und Disziplin sorgten und die Kinder in regelmäßigen Abständen wie Fliegen verscheuchten.
Das letzte Mal, dass ich so viele Schwarze auf einem Haufen gesehen hatte, war beim Karneval in Notting Hill gewesen. Weil sich Kopfschmerzen ankündigten, stand ich auf und machte mich daran, das Haus zu inspizieren, in dem ich einen Teil meiner Kindheit verbracht hatte. Eine der Bedienungen schüttete mir Guinness über den Hosenaufschlag. Ich achtete nicht auf ihre Entschuldigung und ging einfach weiter, aber dann rief sie meinen Namen.
»Weston?«
Die Bedienungen trugen alle die gleiche weiße Uniform, dazu Häubchen, um die Frisuren zu bändigen. Die Partybeleuchtung sorgte nicht unbedingt für Helligkeit, außerdem waren fünfzehn Jahre vergangen, trotzdem erkannte ich sie sofort.
»Nana?«
»Warte kurz.« Nana stellte auf einem nahen Tisch ihr Tablett ab und trug den Gästen drei Teller Reis, eine große Kalebasse mit Palmwein und einen Serviettenstapel auf. Dann kehrte sie zu mir zurück.
»Komm mit«, sagte sie.
Ich folgte ihr ins Haus, vorbei an anderen Bedienungen, von denen manche sie grüßten und mich argwöhnisch beäugten, vorbei am Hauptfoyer, dem Treppengeländer, auf dem ich als Kind nach unten gerutscht war, vorbei an einer Gruppe Frauen, die ein Auge auf die Caterer hatten, und schließlich in eine Speisekammer, in der es nach Reis- und Weizenmehl roch. Sie verriegelte die Tür und sah mich an.
Und küsste mich.
Ich löste mich von ihr. »Nana, ich …«
»Bist du mit jemandem zusammen? Verheiratet?«
»Nein, aber …«
Sie legte mir einen Finger auf die Lippen, fuhr mir über die Wange und zog mein Gesicht wieder an ihres. Ihr Finger roch nach Reiscurry und Bier. Sie hatte sich kaum verändert. Etwas drahtiger, weniger Babyspeck, aber immer noch unverkennbar Nana. Sie küsste mich, als wäre es völlig belanglos, dass ich sie ohne Vorwarnung, ohne mich zu verabschieden, verlassen hatte. Als würde es keine Rolle spielen, dass ich nicht geschrieben, dass wir gesagt, dass wir uns versprochen hatten, wir würden uns immer lieben, und ich dieses Versprechen gebrochen hatte.
»Wir haben viel zu bereden«, sagte ich.
»Nein, haben wir nicht. Bleibst du, oder fliegst du bald wieder nach London zurück?«
»Ich fliege morgen um Mitternacht.«
»Gut. Wir haben den ganzen Tag. Ruf mich an. Ich muss wieder an die Arbeit. Es ist nicht erlaubt, mit den Gästen rumzumachen.« Sie gab mir eine Karte, entriegelte die Tür und war verschwunden. Ein Reiskäfer kroch über die Karte mit der aufgeprägten Schrift. Nana Hastruup. Consultant. Ich fragte mich, was das zu bedeuten hatte, schob die Karte in die Hosentasche und verließ die Speisekammer.
Nana. Ich hatte erwartet, dass ich ihr über den Weg laufen würde, hatte das Treffen gefürchtet und mich gleichzeitig darauf gefreut. Körperlich war sie eine typische Yoruba – dunkel, rund, vollbusig. Ihr Gehirn war ihr größter Aktivposten und ihr größtes Manko. Sie hatte eine große Klappe – das hatte ich an ihr geliebt –, aber eine junge Frau, die nicht wusste, wann sie den Mund zu halten hatte, bekam keine Heiratsanträge. Und für eine Frau in Alcacia war selbst im einundzwanzigsten Jahrhundert die Ehe alles. Sie gehörte nicht hierher. Sie gehörte nirgendwo mehr hin.
Ich betrachtete die gerahmten Fotos von Tante Blossom im Flur. Sie hatte auf allen Bildern den gleichen Blick: von gelassener Gleichgültigkeit. Schmales, zerknittertes Gesicht, tiefe Grübchen unterhalb der Wangenknochen, die Haare immer in einen Gele gewickelt. Früher hatte es dazu eine Handvoll Porträts von einheimischen Künstlern gegeben – ich im Alter von drei, Lynn als Baby, eines von Tante Blossom, eines von Tante Anice. Andere Bilder aber fehlten – wahrscheinlich hatte Dad sie abgehängt.
»Da bist du ja«, sagte Church. Er hatte zwei Small Boys – 35 cl-Guinness-Flaschen – in der Hand und reichte mir eine. Wir stießen an. »Warum versteckst du dich hier?«
»Hab mir nur die Fotos angesehen.«
»Komm mit. Zu meinen Freunden. Sei nicht so ein Oyinbo.«
Church brachte mich an einen Tisch, der so nah an der Band stand, dass ich die Nasenhaare des Frontman sehen konnte. An eine Unterhaltung war kaum zu denken. Churchs Freunde jagten mir Angst ein. Es waren drei: Lemi, Tito, Tosin. Tito und Tosin waren eineiige Zwillinge. Keiner von ihnen war in traditioneller Kleidung gekommen, was ungewöhnlich war für eine solche Zusammenkunft. Tito trug Sonnenbrille und Tarnhose. Sie blickten grimmig, nur Church lachte, aber sein Lachen hatte nichts Fröhliches an sich.
Ich trank mehr Alkohol.
»Hey, du solltest mir deinen Pass geben und sagen, dass du ihn verloren hast«, sagte Church.
Ich lachte. Aufgesetzt, spröde, überschwänglich. »Lieber nicht.«
»Doch, im Ernst.«
»Nein, Church.«
»Ich bezahl dich.«
»Ich kann nicht. Komm schon. Du weißt, was passiert, wenn man mir dahinterkommt. Du weißt noch, was ich beruflich mache?«
»Ja. Polizist. Mordkommission. Okay, wie wär’s, wenn du mich die erste Seite fotokopieren lässt?«
Jetzt war ich wieder in der Schule, wo ich mich weigerte, ihm die Lebensmittel auszuhändigen, die meine Eltern mir am Besuchstag gebracht hatten.
Ich trank mehr Alkohol.
»Morgen«, sagte ich.
Church klatschte mir auf den Rücken. »Toll.« Er wandte sich an Tosin. »Der Typ hier, der ist der einzige echte Bastard, den ich kenne.« Church stieß mich an und rief: »Sag’s ihnen. Los!«
»Ich war ein Holloway-Baby«, sagte ich und wurde ohnmächtig.
Ich erinnere mich an ein paar Dinge, während ich weggetreten war. Wiederholt glaubte ich erklären zu müssen, warum Church mich als Bastard bezeichnete. Ich war mir nicht bewusst, dass ich ohnmächtig war.
»Sag’s ihnen«, sagte Church. »Los.« Seine Stimme hallte, als wäre mein Schädel eine Höhle.
Ein Holloway-Baby ist ein ganz besonderer Bastard.
Gut, hört zu. Hier ist die Kogi-Familie. Hier sind Mummy und Daddy und drei Kinder, zwei Jungs und ein Mädchen. Sind wir nicht alle hübsch in unserem Sonntagsstaat, mit unseren fein geschrubbten Gesichtern? Nein, sind wir nicht. Nicht wenn Simon, der ältere Junge, mit vierzehn an Nierenversagen leidet. Aus keinem ersichtlichen Grund fangen beide Nieren an zu faulen, sie fällen den Jungen, lassen ihn schrumpfen, er riecht so stark nach Fäulnis, dass einem Tränen in die Augen treten, wenn man mit ihm im selben Zimmer ist.
Hier sind Mummy und Daddy, die den jüngeren Sohn, Weston, zu ein paar Weißkitteln bringen, wo er gern eine seiner Nieren spenden will. Alle sagen, wie tapfer er für einen Zwölfjährigen ist. Ihm wird ganz warm, wenn die Älteren von seiner Tapferkeit reden. Hier erträgt er tapfer die dicke Nadel beim Bluttest. Das tut weh, aber er schwitzt nur ein wenig und beißt die Zähne zusammen. Mummy und Daddy sind glücklich, dass er das macht. Hier sind Mummy und Daddy nach dem Besuch bei den Ärzten.
Sie sind mit den Ergebnissen nicht zufrieden.
Anscheinend hat der kleine Weston den Bluttest nicht bestanden, aber Daddy tut so, als hätte Mummy den Test nicht bestanden. Mummy sagt, Weston kann seine Niere nicht seinem Bruder geben, weil sie dessen Niere nicht ähnlich genug ist. Sie werden es mit seiner Schwester probieren müssen. Lynn. Aber einige Wochen später ist auch Lynns Niere nicht geeignet. Sie ist seiner auch nicht ähnlich genug.
Sieh dir Daddy an. Er ist aufgebracht. Der Babalawo kommt, und Mummy muss etwas auf ein mit einem Zauber gefülltes Horn schwören. Sieh dir die ganze Familie an, die zum Bluttest geht. Sieh dir den Bruder an, der immer kränker wird. Er heißt Simon, und er wird sterben. Mummy küsst sein aufgedunsenes Gesicht.
Daddy schläft nicht mehr zu Hause. Mummy, die Hausfrau gewesen war, muss sich etwas für den Lebensunterhalt suchen. Sie steht auf, wenn es noch dunkel ist, und verkauft in der Innenstadt zur Mittagszeit köstliche Gerichte an die Büroangestellten. Simon stirbt. Weston hat jahrelang Albträume darüber. Simon hat die körperliche Welt verlassen und sich in Westons Geist niedergelassen.
Mummy wird von einem Auto angefahren und stirbt auf der Stelle.
Lynn und Weston wurden im Royal-Holloway-Krankenhaus geboren. Sie wurden von Daddys Schwestern, Blossom und Anice, adoptiert.
Ich wachte ohne einen Kater auf. Der Traum ließ unangenehme Nachgefühle zurück, Simon versuchte mir etwas zu erzählen, aber ich konnte die Wörter nicht auseinanderhalten.
Ich hustete. Ich hatte mich in der Nacht verkühlt.
Durch die offen stehende Tür kroch der Morgen. Bei näherer Betrachtung erkannte ich, dass es keine Tür gab. Ich lag, halb wach, auf einer nackten Matratze, auf dem Boden einer Hütte. Barfuß, meine Schuhe standen neben mir, die Socken in einem von ihnen zusammengeknödelt wie eine verschrumpelte Vorhaut. Ich trug noch meine Sachen, aber sie fühlten sich verkrustet an, als hätte ich heftig geschwitzt, als hätte der Schweiß eine salzige Dreckschicht hinterlassen. Ich rieb mir den Schlafsand aus den Augenwinkeln und fragte mich, wo zum Teufel ich war. Der Boden der Hütte war festgestampfter roter Lehm. In der Ecke stand eine zusammengerollte Raffiamatte und ein malvenfarbiger Plastikpott. Ich erhob mich von der klumpigen Matratze, die die Einheimischen aus Rohbaumwolle, Stroh und aus Federn, die aus eingeschmolzenem Altmetall zurechtgebogen waren, selbst hergestellt hatten, und pinkelte.
Vor der Türöffnung war ein rostzerfressenes Buswrack zu sehen, dessen Scheiben seltsamerweise noch intakt waren. An der Seite war ein aufgemalter Spruch zu erkennen: Keine Telefonverbindung zum Himmel!
Ich klopfte mich ab. Brieftasche noch, wo sie sein sollte. Gewaltiger und tief empfundener Dank an die alten Gottheiten, dass ich meinen Pass im Hotelsafe gelassen hatte. Geruch von nasser Erde und Ganja in der Nase. Stimmen von Männern, zornigen Frauen und Kindern. Sie sprachen Yoruba, aber einen Dialekt, der mir nicht vertraut war. Ihre Sätze hatten portugiesische Elemente, das hieß, ich war nicht dort, wo ich hätte sein sollen. Das hieß, man hatte mich, während ich bewusstlos war, in den Ostteil des Landes gebracht. Ich verließ die Hütte.
Draußen musste ich wieder husten. Es hatte in der Nacht geregnet, meine Schuhe schmatzten durch roten Schlamm. Ich machte mir Sorgen um das Wildleder, was, wenn man alles bedachte, ziemlich komisch war. Ich ging durch eine Gasse mit Hütten, die der glichen, in der ich aufgewacht war, und näherte mich einer Öffnung, die vielleicht zu einem Innenhof und zu Menschen führte, die ich fragen konnte. Dann hörte ich einen Motor aufheulen, laute Schreie, die mich zu schnelleren Schritten anspornten.
Ich kam in den Hof.
Ein Mann war mit den Handgelenken an einen Pfosten gekettet, mit den Fußknöcheln an einen Pick-up. Er schrie, weil der Pick-up vom Pfosten wegfuhr. Der Motor heulte auf und kämpfte gegen die Muskeln, Sehnen und das Rückgrat des Mannes an.
Dann riss das Rückgrat, Blut und Eingeweide spritzten, dann war ich derjenige, der schrie.
4Die Gewehrmündung an meiner Stirn war ein völlig neues Gefühl. Meine ganze Welt schrumpfte auf das kalte Metall zusammen, das mir gegen die Haut gedrückt wurde. Absurde Gedanken ploppten auf. Würde ich einen kurzen Hitzeblitz spüren, bevor ich starb? Würde es wehtun? Würde ich mir in die Hose scheißen? Würde ich um Gnade flehen? Würden die Schmutzflecken jemals wieder aus meiner Kleidung gehen? Was, wenn der Schütze danebenschoss und ich verkrüppelt, aber am Leben bleiben sollte?
»Bist du ein Spion?«, brüllte der Typ mit dem Gewehr. »Du bist ein Spion?«
Er hatte einen schweren, undurchdringbaren Dialekt. Im ersten Moment dachte ich, er hätte gefragt: »Du schaust mich an?« Nicht der rechte Zeitpunkt für skurrile De-Niro-Anspielungen. Oder vielleicht genau der rechte Zeitpunkt.
»Ich bin kein Spion. Ich weiß noch nicht mal, wo ich bin«, sagte ich auf Englisch, was mir einen Schlag mit dem Gewehr eintrug. Die andere Seite meines Kopfs lag im Schlamm, den Geschmack hatte ich schon im Mund, zwischen den Zähnen: fade, kreidig, ein Hauch von welker Vegetation.
Ich vermutete, dass ich mich in einem der Rebellen- oder Milizlager befand, und verfluchte mich dafür, mich nicht mehr mit den neuesten politischen Entwicklungen in Alcacia befasst zu haben. Eine Menge versammelte sich um mich herum und debattierte, wie mit mir zu verfahren sei. Drei Kinder waren darunter, zwei davon nackt, und betrachteten mich mit ungerührter Neugier, völlig unbeeindruckt von den Waffen, der Gewalt oder den blutigen Überresten des exekutierten Mannes, die keinen Meter von mir entfernt lagen. Der Geruch von Hackfleisch verklebte mir die Nase. Ich rührte mich nicht und sagte nichts, außer dass ich kein Spion sei, aber das in meinem besten Südlondoner Englisch, in der Hoffnung, sie damit zu verwirren.
»Weston, was treibst du dort unten im Schlamm?« Church.
Ich verdrehte den Hals. Er sah auf mich herab. Nackter Oberkörper, Tarnhose, Kampfstiefel, dazu kriegte er sich gar nicht ein vor Lachen. Der Druck an meinem Kopf ließ nach, ich rappelte mich auf, kam auf die Knie, dann auf die Beine. Abrupt hörte Church auf zu lachen und ließ den palavernden Untergebenen einen Blick zukommen, der sie zum Schweigen brachte. Sie schienen sich wichtigeren Dingen zuzuwenden. Church deutete auf die auseinandergerissene Leiche, und der mit dem Gewehr stapfte darauf zu.
Für jemanden, er mir als übergewichtig erschienen war, hatte Church überraschend muskulöse Arme. Ein großer, haariger Bauch dominierte den Oberkörper. Er schwitzte. In seinem Hosenbund steckte eine Pistole. Spielerisch schlug er mir mit seiner fleischigen Pranke auf die Schulter.
»Machen wir dich mal ein bisschen sauber.«
»Tut mir leid. Manche von den Jungs sind nach einer Exekution eben ein bisschen überdreht«, sagte Church.
Ich hängte meine Kleidung an einen Nagel. Eine halbierte Kalebasse schwamm auf dem Wasser in dem Metallkübel, den er vor mich hingestellt hatte. Ich seifte mich ein, schöpfte mit der Kalebasse Wasser und spülte den Schaum weg. Ich bemühte mich, den Lehmgeschmack aus dem Mund zu bekommen, aber das Wasser schmeckte genauso.
»Manche von denen waren nie in der Schule«, sagte Church. »Die Front kann es sich nicht leisten, wählerisch zu sein. Wir brauchen Kanonenfutter.«
Die Liberation Front of Alcacia, LFA. In Guns We Trust. Das war ihr Motto, ungelogen. Erbitterte Feinde der Regierung und ihres stärksten Rivalen, der christlichen Volksarmee, der People’s Christian Army, PCA.
»Und jetzt?«, fragte ich. »Reißt ihr mir die Fingernägel raus? Politik ist mir egal, weißt du?«
»Keinem ist die Politik egal, mein Freund. Manchmal muss man nur etwas nachhelfen, damit die Leute mit ihrer Meinung rausrücken. Gib mir einen angespitzten Stock und ein Seil, und in null Komma nichts kitzle ich ihnen ihre politischen Ansichten heraus. Aber keine Angst, Weston. Du bist nicht wegen deiner politischen Überzeugungen hier. Eigentlich kommen dir deine fehlenden politischen Überzeugungen bei dem Job nur zugute.«
»Job?«
»Jemand will mit dir reden, Junge. Solange du keine dummen Fragen stellst, sollte dir nichts passieren. Trockne dir den Sack, dann gehen wir. Die Befreiung lässt man nicht warten.« Church wieherte. Offensichtlich gefielen ihm ironisch verpackte LFA-Slogans.
»Was für ein Job, Church?« Ich hoffte, ich klang ganz ruhig. Das Bild des zerstückelten Manns blitzte vor meinem inneren Auge auf. Ich spritzte mir Wasser auf den Unterleib. Seifenschaum fiel neben meine Füße und vermischte sich mit dem Schlamm.
»Das darf ich nicht sagen«, sagte Church.
Woher wusste die LFA überhaupt, dass es mich gab? Ich war ein Niemand. »Bin ich ein Gefangener?«
»Nein.«
»Was dann?«
»Nenn es Bewerbungsgespräch. Egal, wie es ausfällt, du kannst nachher nach Hause gehen.«
»Und wenn ich keine Lust habe auf dieses … Bewerbungsgespräch?«
Church sah mich mit leerem Blick an, als hätte ich einen schlechten Witz gemacht. Ich lächelte ihn an, er lächelte mich an, und alles war wieder gut auf der Welt.
Auf dem Weg durchs Lager hatte Church einige Ratschläge zu meinem Schwanz parat. Sie waren ernst gemeint. Anscheinend war ihm mein Schwanz nicht groß genug.