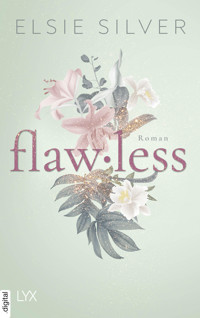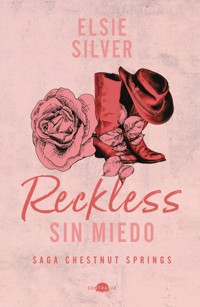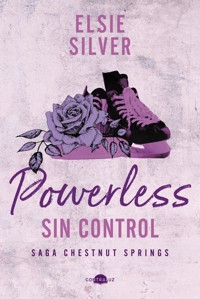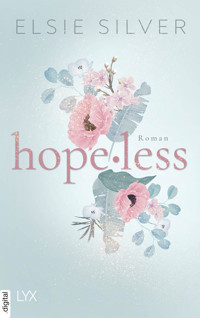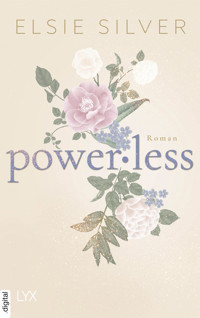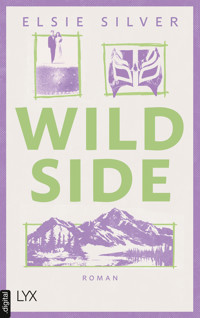
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Rose Hill
- Sprache: Deutsch
SIE HASSEN SICH LEIDENSCHAFTLICH -
UND KÖNNEN DOCH DIE FINGER NICHT VONEINANDER LASSEN
Tabitha liebt ihren kleinen Neffen über alles, und als sie Gefahr läuft, das Sorgerecht für ihn an ihren größten Feind Rhys Dupris zu verlieren, greift sie zu extremen Mitteln - sie heiratet ihn. Einen Mann, der so schweigsam wie geheimnisvoll ist, manchmal für Wochen verschwindet, dann mit Verletzungen wieder nach Rose Hill zurückkehrt und nicht darüber reden will. Doch als sie unter einem Dach leben, entdeckt Tabitha auch eine andere Seite an Rhys, eine liebevolle und fürsorgliche. Und das macht es immer schwerer für die junge Frau, ihren Ehemann zu hassen, und sehr leicht, sich in ihn zu verlieben ...
»Elsie Silvers Schreibstil ist eine wahre Offenbarung!« Ali Hazelwood
Band 3 der ROSE-HILL-Reihe von TIKTOK-Sensation und SPIEGEL-Bestseller-Autorin Elsie Silver
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 570
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Titel
Über das Buch
Leser:innenhinweis
Widmung
Anmerkung der Autorin
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
Epilog
Danksagung
Die Autorin
Die Bücher von Elsie Silver bei LYX
Impressum
Elsie Silver
Wild Side
Roman
Ins Deutsche übertragen von Katia Liebig
Über das Buch
Tabitha kann es nicht fassen, dass ihre verstorbene Schwester Erika die Vormundschaft für ihren dreijährigen Sohn an Rhys Dupris übertragen hat. Den Mann, den Tabitha mit Leidenschaft hasst, ist sie sich doch sicher, dass er als Erikas Vermieter diese aus ihrer Wohnung geworfen hat und damit eine Mitschuld an ihrem Tod trägt. Um zu verhindern, dass sie ihren Neffen verliert, bleibt ihr nur eine Möglichkeit – sie heiratet Rhys, obwohl sie alles an ihm verabscheut: seine Größe, seine Attraktivität, seine stoische Fassade und seine Schweigsamkeit. Und auch der US-Amerikaner kann seiner neuen Frau wenig abgewinnen und hat sich nur auf den Deal eingelassen, um problemlos immer wieder nach Kanada einreisen zu können. Hinzu kommt, dass er ein Geheimnis zu hüten scheint, denn er verschwindet für seinen Job regelmäßig wochenlang, um dann mit Verletzungen wieder nach Rose Hill zurückzukehren und nicht darüber reden zu wollen. Doch als sie unter einem Dach leben, entdeckt Tabitha auch eine andere Seite an Rhys, eine loyale, liebevolle und fürsorgliche. Und als sie sieht, wie er mit dem kleinen Milo umgeht und dass er mit ganzem Herzen an dem Jungen hängt, fällt es ihr immer schwerer, ihren Ehemann zu hassen, und sehr leicht, sich in ihn zu verlieben …
Liebe Leser:innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Deshalb findet ihr hier eine Anmerkung der Autorin und hier einen Contenthinweis.
Achtung: Diese enthalten Spoiler für das gesamte Buch!
Wir wünschen uns für euch alle das bestmögliche Leseerlebnis.
Euer LYX-Verlag
Liebe Leser:innen,
danke, dass ihr gemeinsam mit mir nach Rose Hill zurückkehrt, in dieses fiktive Städtchen, das auf einer realen Stadt basiert, in der ich als Kind oft meine Sommerferien verbracht habe.
Dieses Mal begleiten wir Rhys und Tabby, ein Paar, das mir einfach nicht aus dem Kopf geht. Ihre Geschichte enthält so viel von dem, was ich mir bei einer Lovestory wünsche: Liebe, Verlust, Spannung, Vergebung und dieses Gefühl ewiger Seelenverwandtschaft, bei der mir jedes Mal das Herz aufgeht.
Ich habe dieses Buch in einer eher traurigen Phase meines Lebens geschrieben und empfinde somit eine spezielle Verbindung zu diesen Menschen und diesem Ort. Es wird für immer eine ganz besondere Rolle in meinem Leben spielen.
Kurz gesagt, ich habe sehr viel Liebe hineingesteckt. Hoffentlich könnt ihr sie spüren.
xo
Für alle, die einen anderen Menschen lieben, nicht weil er oder sie perfekt ist, sondern weil sie Schönheit in all den Facetten dieses Menschen finden können.
Und für Peggy (16) und Twiggy (14), meine beiden süßen Fellnasen, mit denen ich mehr oder weniger erwachsen geworden bin. Sie waren immer dabei – College, Hochzeit, Baby. Und sie haben zusammengerollt neben meinen Füßen gelegen, während ich elf ganze Bücher und dieses hier zumindest halb geschrieben habe. Wie sagt man so schön? Hunde sind für eine kurze Zeit unsere besten Freunde, aber wir ihr gesamtes Leben lang die ihren … Und ich sage: Was bin ich doch für ein verdammter Glückspilz.
Anmerkung der Autorin
Dieses Buch erwähnt Themen wie Sucht, Drogenmissbrauch, den Tod durch eine Überdosis sowie Missbrauch und Vernachlässigung von Kindern. Ich hoffe, dass ich diese Themen mit der Sorgfalt und Aufmerksamkeit behandelt habe, die sie verdienen.
← Zurück zum Leser:innenhinweis
Liebe Leser:innen,
ich bin keine Anwältin, habe mich aber zu der hier dargestellten rechtlichen Situation juristisch beraten lassen. Zum Wohle dieser Geschichte habe ich mir dennoch ein paar Freiheiten erlaubt.
Um sicherzustellen, dass die Themen in diesem Buch mit der Sorgfalt geschildert werden, die sie verdienen, hat ein klinischer Therapeut dieses Buch von Anfang an mitgelesen und begleitet.
1. Kapitel
RHYS
Ich höre, wie es an der Tür klingelt. Und bleibe sitzen. Was auch immer sie mir da verkaufen wollen, ich will es nicht.
Also zappe ich weiter lustlos durch die Fernsehkanäle. Nach Ted Lasso fällt es mir schwer, mich auf etwas anderes einzulassen, und da ich wegen einer Verletzung nicht trainieren kann, langweile ich mich zu Tode.
Jetzt klopft es sogar dreimal kräftig an die Tür. Doch ich habe immer noch keinen Bock, sie zu öffnen. Schließlich bin ich hierher aufs Land gekommen, um allein zu sein, also tue ich so, als hätte ich nichts gehört. Hausierer ziehen schließlich immer irgendwann weiter.
Dieser hier allerdings nicht.
Jetzt klopft es fünfmal.
Wütend stehe ich auf und gehe durch den Wohnraum nach vorn, wobei ich den scharfen Schmerz in meinem Knie ignoriere.
»Was auch immer es ist, ich bin nicht inte…« Ich reiße die Tür auf und sehe … niemanden. Freier Blick auf die Straße.
»Hi. Ich bin Tabitha«, sagt eine feste Stimme, und ich senke den Kopf in die Richtung, aus der sie kommt. »Rhys, richtig?«
Vor mir steht eine Frau. Sie hat dunkles, fast schwarzes Haar. Onyxfarbene Brauen, zusammengekniffene schokoladenbraune Augen mit dichten Wimpern. Sie ist klein – was die meisten Leute im Vergleich zu mir sind –, aber ihre Körperhaltung lässt sie größer erscheinen.
Sie hat das, was man wohl »Präsenz« nennt.
Ich sage nichts, doch sie streckt trotzdem die Hand aus, um meine zu schütteln. Ohne unhöflich sein zu wollen, schaue ich darauf hinab und frage mich, was zum Teufel sie wohl von mir will. Dieses Haus hier ist mein sicherer Rückzugsort. In Kanada kennt mich niemand.
Hier in Emerald Hill lassen die Leute mich in Ruhe.
Und genau so mag ich es.
»Hi? Hallo?« Sie streckt erneut die Hand aus und erinnert mich so daran, dass ich immer noch hier stehe und sie wortlos anstarre. »Falls du kein Englisch sprichst, kann ich noch ein halbwegs passables Französisch anbieten. Ansonsten hole ich mein Handy raus, damit es übersetzt.«
Meine Lippen werden schmal, und ich ergreife ihre kleine Hand. »Ich spreche Englisch«, murmle ich, als unsere Blicke sich erneut begegnen. »Hatte bloß niemanden erwartet.«
Ich kann die Schwielen an ihrer Hand spüren, als sie meine drückt. Fest. Es ist ein guter, ordentlicher, ehrlicher Händedruck. »Wer mag es nicht, überrascht zu werden, hm?«
»Ich. Ich mag keine Überraschungen.«
Sie sieht mich nach wie vor an, so als würde sie mich mustern – abschätzen, ob ich es wert bin. Was genau ich wert sein soll, kann ich allerdings nicht sagen.
Immer noch blicken wir uns händeschüttelnd an, auch wenn diese Geste sich mittlerweile deutlich länger hinzieht als nötig.
»Nun, Überraschung!«, ruft sie plötzlich. »Ich bin die Schwester deiner neuen Mieterin. Ich helfe ihr gerade nebenan beim Einzug und muss kurz mit dir reden, solang sie weg ist.«
Blinzelnd lasse ich die Hand sinken. Ihr Tonfall vermittelt mir das Gefühl, als hätte ich irgendwas angestellt. Dabei wollte ich in der anderen Hälfte des Doppelhauses doch bloß jemanden haben, der mich möglichst in Frieden lässt und sich um alles kümmert, wenn ich nicht hier bin. Und jetzt habe ich eine kleine Terrorschwester vor der Tür stehen, die aussieht, als wollte sie mich ins Kreuzverhör nehmen.
»Wie wär’s, wenn du mich reinlässt? Wir klären, was wir klären müssen, und schon bist du mich wieder los.«
Jetzt lächelt sie.
Und dieses Lächeln ist wirklich blendend. Nicht unterwürfig oder schüchtern, nein, es ist eine Waffe, und diese Frau weiß genau, was sie tut, als sie diese jetzt auf mich richtet.
Vorhin habe ich nichts gesagt, weil ich automatisch misstrauisch bin, wenn fremde Leute vor meiner Tür stehen. Jetzt sage ich nichts, weil mein Hirn einen Kurzschluss hat und meine Augen beschäftigt sind. Sie wandern über glänzende dunkle Haare, braune Haut und geschwungene Hüften.
Ja. Tabitha, die Schwester meiner neuen Mieterin, ist heiß, sieht aus, als glaubte sie, ich könnte ein paar Leichen im Keller haben, und weiß, wie man einem die Hand schüttelt.
Irgendwie gefällt mir das.
Also trete ich beiseite und bedeute ihr reinzukommen.
Mit einem Mal wirkt sie sanfter. Ein erleichtertes Lächeln gleitet über ihre vollen Lippen, und sie wischt sich nervös die Hände an ihrer Jeans ab. Mit einem Kopfnicken und einem leisen »Danke« tritt sie ins Haus und streift die Sandalen von ihren Füßen.
Ich erwidere ihr Nicken und weise mit der Hand Richtung Küche. Die Fenster auf der hinteren Seite meines Hauses gehen auf den See hinaus. Die Aussicht ist der Hammer, und ich kann verstehen, dass sie stehen bleibt, um sie zu bewundern.
»Das ist wunderschön.«
Ich betrachte ihr Profil, wobei ich mir gar nicht erst die Mühe mache, mein Interesse zu verbergen. Ihre Schultern sind gestrafft, die vollen Lippen leicht geöffnet. »Ja, das ist es.«
Mein Blick bleibt an ihrem Mund hängen, der sich zu einem verschlagenen Lächeln verzieht, als sie sich jetzt mit einer hochgezogenen Augenbraue zu mir umdreht und ihren Blick genauso offensichtlich über mich gleiten lässt, wie ich es gerade bei ihr getan habe.
»Ein Mann weniger Worte, hm?«
»Möglich«, erwidere ich und wende mich zum Kühlschrank. »Was zu trinken?«
»Danke, aber so lange bleibe ich nicht.« Ich kann die Belustigung in ihrer Stimme hören, während sie sich auf einen Hocker an der Kücheninsel setzt.
Ich nehme mir eine kleine Flasche Mineralwasser, öffne sie und lehne mich gegen die Anrichte, sodass ich Tabitha ansehen kann. Sie legt die Hände auf die Granitplatte, verschränkt die Finger und presst die Lippen zusammen.
»Also …«, sagt sie, und ich warte.
Und warte.
Ihr Blick folgt der Bewegung meiner Hand, als ich einen Schluck Wasser trinke. Dann verschränke ich die Arme vor der Brust und sehe Tabitha an.
»Also«, wiederhole ich mit einem leichten Zucken um die Mundwinkel.
Sie atmet hörbar ein und richtet sich ein wenig auf. Kurz schaut sie zur Seite, dann wieder zu mir. »Ich komme gleich zur Sache. Erika hatte es nicht immer leicht. Es ist nicht an mir, ihre Geschichte zu erzählen, aber ich muss einfach wissen, ob sie und ihr Sohn Milo hier sicher sind.«
Ich verlagere mein Gewicht ein wenig. »Okay. Ich lebe eigentlich im Ausland und bin nur hin und wieder mal hier. Aber es gibt eine Alarmanlage.«
»Das meinte ich nicht.« Sie beißt sich auf die Unterlippe und seufzt. »Hör zu, mir ist klar, dass ich hier eine Grenze überschreite, aber meiner Schwester geht es endlich halbwegs wieder gut, und ich weiß nicht, was sie …« Sie stöhnt und fährt sich durch die Haare. »Ich hasse mich selbst dafür, dass ich es anspreche, und Erika würde mich umbringen, aber … falls du irgendwas Stärkeres als Paracetamol im Haus hast, könntest du es bitte irgendwo lagern, wo es niemand findet?«
Meine Brauen sinken nach unten, und ich beuge mich vor. »Was?«
»Rezeptpflichtige Medikamente. Ich möchte nur sichergehen, dass sie nichts davon in die Finger bekommt.«
»Sie wohnt nebenan. Nicht hier bei mir.«
Tabitha zuckt mit den Schultern und blickt wieder zur Seite. »Sie ist charmant und wunderschön und endlich wieder auf Spur. Sag niemals nie.«
Diese Frau hat keine Ahnung, wie misstrauisch ich anderen Menschen gegenüber bin, wenn sie denkt, ich könnte es auf meine neue Mieterin abgesehen haben. »Ich habe keinerlei Ambitionen, deine Schwester anzugraben.«
Sie zuckt zusammen, hat aber kein Problem damit, mir direkt in die Augen zu schauen, als sie sagt: »Nun, diese Ambitionen müssen nicht zwangsläufig von deiner Seite ausgehen.«
»Bist du …«, setze ich an, weiß aber nicht recht, was ich eigentlich sagen will. Das ist das bizarrste Gespräch, das ich je mit einem fremden Menschen geführt habe.
»Ich bin eine überaus fürsorgliche Schwester, die sich jetzt seit zwei Tagen anhören muss, wie sie von dir schwärmt. Nick einfach, wenn du verstehst, was ich damit sagen will, und wir brauchen nie wieder ein Wort darüber zu verlieren.«
Ich habe bisher vielleicht dreißig Minuten mit Erika verbracht, als ich ihr das Haus gezeigt habe. Und ein paar weitere, als ich ihr den Schlüssel übergeben und ihren Sohn kennengelernt habe. Sie schien kein Problem damit zu haben, sich um die Post und den Garten zu kümmern, wenn ich nicht hier bin. Sie ist nett. Okay, sehr nett sogar.
Zu nett?
Und ihr Junge ist niedlich.
Aber ich habe wirklich keine Sekunde daran gedacht.
Trotzdem nicke ich.
Tabitha schlägt mit der flachen Hand auf die Platte, und ihr Mund verzieht sich zu einem triumphierenden Grinsen. »Perfekt. Großartig. Gut, dass wir gesprochen haben.« Sie rutscht vom Hocker, nicht jedoch, ohne vorher noch einen sehnsüchtigen Blick durch den Raum gleiten zu lassen. »Schöne Küche. Es gibt doch nichts Besseres, als mit einer guten Aussicht zu kochen.«
»Kochst du gern?«
Sie lächelt. »Könnte man sagen.«
Wie magisch angezogen von dieser schwer einzuschätzenden Frau gehe ich um die Kücheninsel herum, doch sie ist bereits auf dem Weg zur Tür.
Tabitha marschiert genauso wieder aus dem Haus, wie sie hereinmarschiert ist. Selbstbewusst und direkt, aber auch … vorsichtig.
Könnte man sagen.
Ich frage mich, was das bedeutet. Und was genau es wohl auf sich hat mit der Geschichte ihrer Schwester.
»Sollte ich mir Sorgen machen? Wegen deiner Schwester? Als Mieterin?«
Sie dreht sich zu mir um. Die Abendsonne taucht ihr Gesicht in ein warmes Licht. Ihre Wangen sind leicht gerötet, als wäre es ihr peinlich, dass sie hier hereingeplatzt ist und so viel preisgegeben hat. Dass sie sich eingemischt hat.
»Sie hat damals in der Highschool Volleyball gespielt und sich verletzt. Die Ärzte haben ihr etwas verschrieben, das sie nicht hätte nehmen dürfen. Es ging ihr ziemlich schlecht. Nein, sehr schlecht. Aber sie hat Hilfe bekommen. Jetzt ist sie gesund. Wirklich. Sie ist eine gute Mutter. Und sie wird eine gute Mieterin sein. Darauf kannst du dich verlassen.«
In ihren Augen liegt ein Flehen, in der Art, wie sie ihr Kinn vorschiebt, Entschlossenheit – und ich bin verdammt noch mal zu weich, um mich dagegen zu wehren. Wenn sie unbedingt Hilfe braucht, wird sie die auch bekommen.
»Okay.« Ich senke das Kinn und schiebe die Hände in die Taschen meiner grauen Jogginghose. Wir alle haben unsere Geschichten, mit denen wir uns herumschlagen. Ich wäre der Letzte, der eine Frau, die ich kaum kenne, deswegen verurteilen würde.
»Aber …«
Langsam wandert mein Blick wieder nach oben. Der Klang ihres Abers gefällt mir nicht.
»Das wird sicher nicht passieren, aber falls doch: Sollte sie jemals mit ihrer Miete im Rückstand sein, könntest du mir dann bitte Bescheid geben? Tag oder Nacht, ganz egal. Es ist mir wichtig, sie an einem sicheren Ort zu wissen. Ich möchte, dass sie ein Dach über dem Kopf hat. Ich möchte, dass es Milo gut geht. Sollte es so weit kommen, werde ich die Miete für sie übernehmen.«
Sie zieht eine Visitenkarte, auf der Bighorn Bistro steht, aus ihrer Hosentasche, reicht sie mir, und ich greife – ein bisschen zu eifrig – danach.
Doch sie hält sie fest.
Mein Blick springt zu ihrem, und ich kann die wilde Entschlossenheit in ihren Augen lodern sehen. Sie hält die andere Hand hoch und spreizt den kleinen Finger ab. »Pinky Swear.«
»Pinky Swear?«
Es wird immer seltsamer.
»Ja. Schwör mir, dass du mich anrufst, falls es ein Problem gibt.«
Mit einem leisen Lachen hebe ich den kleinen Finger. »Du weißt schon, dass das nicht einklagbar ist, richtig?«
Ihr Finger schlingt sich um meinen, und ihre Augen schießen Pfeile in meine Richtung. »Ich weiß. Aber man muss schon ein echtes Arschloch sein, um einen Pinky Swear zu brechen.«
Die Frau meint es wirklich ernst. Und ich bin zu überrumpelt, um es ihr abzuschlagen.
»Ich schwöre es. Bei meinem kleinen Finger«, erwidere ich.
Einen Herzschlag lang mustert sie mich, als versuche sie die Ernsthaftigkeit meines Schwurs abzuschätzen. Dann nickt sie, löst ihren Finger und verlässt wortlos das Haus. Und ich stehe da, einen Arm an den Türrahmen gelehnt, und versuche zu begreifen, was hier gerade passiert ist.
Diese Frau.
Die ein paar Schritte den Weg hinuntergeht, stehen bleibt und über die Schulter schaut.
Kurz ertappe ich sie dabei, wie sie mich ansieht. Oder sie ertappt mich. Ehrlich gesagt ist es mir egal, wer hier wen ertappt.
Ich weiß nur, dass ich normalerweise viel Mühe darauf verwende, der Aufmerksamkeit anderer Menschen aus dem Weg zu gehen.
Aber die Art, wie sie mich ansieht, stört mich nicht im Geringsten.
2. Kapitel
TABITHA
Zwei Jahre später …
Die gelbe Tür hier vor mir ist eindeutig zu fröhlich für einen Tag wie diesen.
Die Kratzer um das Türschloss herum erzählen von vollen Händen und hastigen Versuchen, es zu öffnen. Am unteren Rand ist ein dunkelroter Fleck auf dem hellen Gelb. Vermutlich ist da ein Traubensaftkarton auf den Boden gefallen.
Milo liebt Traubensaft.
Seine Mutter ebenfalls.
Liebte.
Erika liebte – Vergangenheitsform – Traubensaft.
Hitze sammelt sich hinter meinen Lidern, und ich blinzle die Tränen fort. Weinen wird mir jetzt nicht weiterhelfen. Seit wir gestern Abend den Anruf bekommen haben, heulen sowieso schon alle um mich herum, da kann ich jetzt nicht auch noch damit anfangen.
Denn wenn ich einmal anfange, kann ich womöglich nicht wieder aufhören. Und dann wird sich niemand um alles kümmern. Aber genau das muss ich jetzt tun.
Ich muss mich um ihren kleinen Jungen kümmern. Meinen Eltern in ihrer Trauer helfen. Mein Restaurant weiterführen. Weitermachen.
Taubheit ist besser als Heulen. Zumal ich gerade aus dem Leichenhaus komme.
Also unterdrücke ich die Tränen und wippe ein paarmal auf den Füßen, als könnte ich mich so in Bewegung schaukeln.
Nach vorne, in das Haus meiner verstorbenen Schwester, um ihr Hab und Gut zusammenzupacken.
Ich muss da reingehen und habe schreckliche Angst davor. Meine Lippen verziehen sich zu einem bitteren Lächeln. Erika hätte sich nicht mehr eingekriegt, wenn sie mich händeringend so hier vor ihrer Tür hätte stehen sehen. Zu feige, um mich den Dingen zu widmen, die sie zurückgelassen hat. Ich wette, sie beobachtet mich von irgendwoher und lacht sich kaputt. Sie würde jetzt etwas sagen wie: DuhastgerademeineLeicheidentifiziert.UmeinVampirzuwerden,bräuchteichmehralszwanzigMinuten.
Ich lache leise über meinen eigenen Scherz.
Sie war nicht perfekt – das bin ich auch nicht –, aber ihr schwarzer Humor traf immer genau ins Ziel.
»Okay, Erika, ich geh ja schon. Ich geh ja schon«, murmle ich und krame nach dem Zweitschlüssel, den ich seit zwei Jahren in meiner Obhut habe.
Seit ihrem Umzug damals in dieses Haus habe ich ihn noch kein einziges Mal benutzen müssen. Weil ich dachte, es ginge ihr gut. Natürlich war mir immer bewusst, dass eine Sucht ein lebenslanger Kampf ist. Aber ich dachte, sie käme zurecht.
Ich habe mich geirrt.
Mit einem leisen Klicken schiebe ich den Schlüssel ins Schloss, lege die Hand auf den Griff und drücke mit dem Daumen gegen den Hebel. Die Tür schwingt auf. Ich atme tief ein in der Erwartung, von einem unangenehmen Geruch empfangen zu werden. Nichts.
Du voreingenommene kleine Bitch.
Ich kann Erikas Stimme klar und deutlich hören. Und irgendwie tröstet mich dieses Gespräch in meinem Kopf ein wenig. Als Kind hätte sie mich umgebracht, wenn ich es gewagt hätte, ihr Zimmer zu betreten. Jedes Mal wenn ich mir ihre Klamotten oder ihr Make-up ausgeliehen habe, gab es bei uns Zickenkrieg.
Aber wir haben uns immer wieder vertragen.
Ich lache finster und schüttle den Kopf. »Okay, Sissy.« Ich schiebe die Tür weiter auf. »Ich werde jetzt deine Klamotten und deinen Schmuck mitnehmen, und du kannst nichts dagegen tun.«
Irgendwann wird Milo ihre Sachen haben wollen. Und ich möchte, dass er ein paar Erinnerungen an sie hat. Gute.
Bei diesem Gedanken hebt sich mein Fuß endlich vom Boden und überschreitet die Schwelle.
Doch eine tiefe, misstrauische Stimme lässt mich sofort wieder erstarren. »Was tust du da?«
Mit wild klopfendem Herzen drehe ich mich langsam um. Und dann sehe ich ihn.
Rhys.
Erikas Vermieter. Der sie ohne zu zögern aus dem Haus geworfen hat. Ein einziges Mal nur hat sie die Miete nicht pünktlich bezahlt, und er hat sich nicht mal die Mühe gemacht, mich zu kontaktieren. Stattdessen hat er ihr eine Woche Zeit gegeben, ihre Sachen zu packen.
In dem verzweifelten Versuch, meiner Schwester ein Dach über dem Kopf zu sichern, habe ich Milo zu mir genommen, damit sie sich ganz auf die Suche nach einem neuen Zuhause konzentrieren konnte. Doch stattdessen ist sie komplett abgestürzt.
Es war nicht das erste Mal, dass sie ein Wohnungsproblem hatte. Als unsere Eltern sie damals vor die Tür gesetzt haben, hat sie einen Rückfall gehabt und ist im Krankenhaus gelandet, wo sie um ihr Leben gekämpft hat. Und seitdem bringt eine solche Situation sie jedes Mal komplett aus dem Gleichgewicht. Am schlimmsten war es vor Milos Geburt, als ihre Mitbewohner sie aus dem Haus geworfen haben.
Drei schlaflose Nächte lang habe ich wie eine Irre ganz Rose Hill nach ihr abgesucht. Ich war im Krankenhaus. Bei der Polizei. Im Obdachlosenheim. Unter der Brücke, die aus der Stadt hinausführt. Auf dem Campingplatz unten am Fluss, vor dem unsere Eltern uns immer gewarnt haben. Und als ich sie schließlich schmutzig und zerlumpt in einer Gasse fand, habe ich mir geschworen, sie nie wieder dort enden zu lassen.
Ihr Anblick damals hängt mir bis heute nach.
Aber dieses Mal habe nicht ich sie gefunden, sondern jemand anders – im Keller eines Hauses, dessen Besitzer Erika nicht einmal kannten. Angeblich ist sie mit einem Mann dort aufgeschlagen, zu dessen Identität niemand etwas sagen konnte. Wie sie auf dieser Party gelandet ist, wird also wohl für immer ein Geheimnis bleiben.
Ganz und gar kein Geheimnis jedoch ist die Tatsache, dass Rhys sie überhaupt erst in diese Situation gebracht hat. Er war es, der Erikas fragiles Gleichgewicht zerstört hat. Es scheint, als hätte sie gar nicht erst versucht, eine neue Bleibe zu finden. Sie hat einfach aufgegeben. Ist eingeknickt. Und wenn er mir wie versprochen Bescheid gegeben hätte, wäre sie vielleicht noch hier.
Mit einem Mal verspüre ich keine Traurigkeit mehr. Stattdessen werde ich von dem Drang überwältigt, mich wütend auf diesen riesigen Mann zu stürzen, der vor mir auf dem Rasen steht und mich böse anstarrt.
Wenn Milo mich nicht bräuchte, würde ich diesen Wichser mit bloßen Händen erwürgen und freiwillig ins Gefängnis wandern in der Überzeugung, meine Aufgabe im Leben erledigt zu haben.
Für den Moment allerdings gebe ich mich damit zufrieden, die Zähne zusammenzubeißen, zurückzustarren und hervorzupressen: »Ich brauche nicht lange.« Mir bleiben drei Tage, um die Besitztümer meiner Schwester zusammenzupacken. Danach muss ich nie wieder einen Fuß in diese gottverdammte Stadt setzen.
Der Mann vor mir neigt den Kopf zur Seite, und eine Strähne seines dunklen Haars fällt ihm in die Stirn. Es ist zu lang, und er hat ein bisschen zu viel Zeug reingeschmiert, um es hinten zu halten, sodass es fast nass aussieht. Ich konzentriere mich auf diese hässliche Strähne, damit ich nicht den Rest von ihm betrachte.
Die unglaublich breiten Schultern, seine gigantische Körpergröße, die gefährlich dunklen Augen, die schwarzen Tattoos, die sich von seinen Handgelenken bis hinauf in die T-Shirt-Ärmel ziehen, sodass ich mich unwillkürlich frage, wo sie wohl noch überall zu finden sind.
Ja, alles an diesem Mann schreit Sex.
Ich wusste immer, dass er körperlich extrem attraktiv ist. Doch jetzt weiß ich auch, dass er indirekt für Erikas Überdosis verantwortlich ist. Und dafür hasse ich ihn.
»Du kannst da nicht rein«, sagt er mit einer Stimme, die keinen Widerspruch duldet.
»Rechtlich gesehen kann ich das sehr wohl.«
Er verschränkt die Arme vor der Brust, was bei dem Umfang seiner Bizepse maximal ungemütlich aussieht. »Dein Name steht nicht im Mietvertrag, und ich habe dir nie einen Schlüssel gegeben. Zudem bezweifle ich, dass Erika es getan hat.« Eine Ader an seinem Hals pocht, und sein verächtlicher Blick macht mich nur noch wütender.
»Du bezweifelst, dass Erika mir einen Schlüssel gegeben hat?«, wiederhole ich und muss dabei fast lachen. »Du hast echt Nerven, so zu tun, als wolltest du sie beschützen.«
»Sagt die Frau, die gerade erklärt hat, da reingehen und ihren Schmuck klauen zu wollen. Wir wissen beide, dass sie dich nicht in ihrem Haus haben will.«
Mit offenem Mund starre ich ihn an. Wie kann er es wagen, so zu tun, als wüsste er, in was für einem Verhältnis meine Schwester und ich zueinander standen? »Soll das ein Witz sein?«
Er richtet sich noch ein wenig mehr auf und sieht dabei aus wie ein königlicher Wachposten. Es macht mich so wütend. Wo bitte war sein Pflichtgefühl, als er sie aus dem Haus geworfen und unseren Schwur mit Füßen getreten hat?
Unser Pinky Swear mag kindisch gewesen sein, aber ich hatte mich darauf verlassen.
Der Gesichtsausdruck dieses Arschlochs verrät nichts, ebenso wenig wie sein Tonfall, als er sagt: »Kein Witz. Wenn du dieses Haus betreten willst, brauchst du Erikas Einverständnis.«
Ich lache ungläubig auf und schüttle den Kopf. »Nun, da du ja offenbar jetzt der Erika-Experte bist, werde ich hier warten, während du zum Leichenschauhaus rüberfährst und sie um Erlaubnis fragst.«
Der menschliche Berg vor mir zuckt zusammen, als hätte ich ihn geschlagen, bevor er zögernd vortritt und mich forschend ansieht. »Wie bitte?«
»Meine Schwester ist tot.«
Gott, es laut auszusprechen ist wie ein Schuss ins Herz. Meine Stimme bricht, doch ich presche weiter voran. »Ich bin mit den Nerven am Ende, und mein Bedürfnis, mit dir zu kommunizieren, ist gleich null. Ich bin ihre nächste Angehörige, wenn du also die Polizei rufen willst, um mich von hier entfernen zu lassen« – ich wedle theatralisch mit der Hand Richtung Vorgarten, als wollte ich ein paar Zuschauer begrüßen – »nur zu, tu dir keinen Zwang an.«
Mit diesen Worten drehe ich mich wieder um und marschiere ins Haus. Ich will ihm gerade schwungvoll die Tür vor der Nase zuschlagen, da steht er schon vor mir, nur Zentimeter entfernt. Sein gigantischer Körper ragt hoch über mir auf, und seine riesige Hand stemmt sich gegen die Tür, damit sie ihm nicht ins Gesicht donnert.
Ich kann seine Wärme fühlen, die Drohung in seiner gesamten Körperhaltung spüren und den Zimtgeruch seines Haargels riechen.
»Und Milo?« Seine Stimme ist rau, und es liegt eine deutliche Drohung darin. Die bei mir verdammt schlecht ankommt.
Doch ich höre auch seine Sorge um den kleinen Jungen, denn ich empfinde sie ebenfalls. Massiv.
Mein Blick trifft seinen, irritiert von seiner Besorgnis.
In seinen dunklen Augen tost eine wahre Apokalypse. Ein flammendes Inferno. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es in meinen ganz ähnlich aussieht. Als sein Blick über mein Gesicht wandert, schiebe ich meinen Hass nach vorne ins Rampenlicht, um ihm zu zeigen, dass ich keinen Zentimeter zurückweichen werde, egal was für eine Show er gerade abzieht – oder was auch immer das hier für ein Territorialgehabe sein soll.
Ich werde ihm so wenig Informationen wie möglich geben, gerade genug, damit er endlich abzieht. »Milo geht es gut.«
Erleichterung zeichnet sich auf seinem Gesicht ab, und er weicht einen Schritt zurück.
Einen Moment lang wird er weich.
Das ist der perfekte Moment für einen Angriff.
»Pinky Swear«, ergänze ich zynisch.
Und schlage ihm die Tür vor der Nase zu.
3. Kapitel
TABITHA
Ich erwache davon, dass etwas meinen Fuß anstupst, bin aber noch so benommen, dass ich mich nur stöhnend auf die Seite drehe. Das Bett ist ungewöhnlich hart, aber im Augenblick beschäftigt mich eher mein Magen, der überraschend empfindlich reagiert, sobald ich mich bewege.
Ein tiefes »Hey« sickert von oben auf mich herab, während ich langsam zu Bewusstsein komme und mich wieder erinnere.
Die Kartons mit den Sachen meiner Schwester.
Scotch.
Kinderfotos von uns beiden.
Mehr Scotch.
Ihre Sammlung an Münzen, die sie dafür bekommen hat, clean zu sein. Zwei Jahre lang war sie das.
Und noch mehr Scotch.
Mathematisch betrachtet müsste mein Körper gerade zu mindestens zehn Prozent aus Alkohol bestehen. Die anderen neunzig sind Selbsthass.
Und es wird sogar noch schlimmer, als ich mich endlich traue, die Augen zu öffnen, und einen leicht verwildert wirkenden Riesen auf mich hinunterstarren sehe. Die dunklen Brauen betonen seinen grimmigen Gesichtsausdruck noch zusätzlich.
Ich linse zur Seite und stelle fest, dass ich mich gar nicht im Bett befinde, sondern auf dem Wohnzimmerteppich liege, umgeben von halb vollen Umzugskartons. Den ersten Tag habe ich mich noch zusammengerissen, der zweite allerdings hat mich komplett umgehauen.
Ich werfe mir einen Arm übers Gesicht, als könnte ich so verhindern, dass dieser Mann mich weiter anstarrt. »Was zum Teufel machst du hier?«
»Wir müssen reden.«
»Danke, aber ich verzichte.« Der Geruch meines Atems, der mir aus der Armbeuge entgegenschlägt, lässt mich beinahe würgen.
Das hier ist wirklich nicht mein glorreichster Moment.
»Du kannst jetzt gehen. Danke und tschüss«, füge ich hinzu, denn Rhys hat sich nicht gerührt.
»Nein.«
Über meinen Arm hinweg beobachte ich, wie er mit zwei großen Schritten zum Sofa hinübergeht und sich setzt, als gehöre ihm dieses Haus.
Okay. Es gehört ihm tatsächlich. Aber er ist … ich weiß nicht. Er bewegt sich irgendwie ein bisschen zu vertraut. Marschiert einfach hier rein. Pflanzt sich auf die Couch meiner Schwester. Weckt mich auf.
Es hat fast den Anschein, als hätte er viel Zeit hier verbracht. Mit ihr. Sie hat immer von ihm geredet, als wollte sie den Boden küssen, auf dem er wandelt, das Ganze ergibt also tatsächlich Sinn – und macht seinen Verrat an ihr noch viel schlimmer.
Ein scharfer Schmerz schießt durch meinen Kopf, als ich vom Boden aufstehe, doch ich ignoriere ihn. In Gegenwart dieses Mannes werde ich keine Schwäche zeigen. Wenn ich mich gegen eine Küche voll selbstverliebter Köche durchsetzen kann, dann doch wohl auch gegen dieses Arschloch.
Tief und gleichmäßig atmend wende ich ihm den Rücken zu und gehe in die Küche, wo die Flasche mit dem Scotch steht und mich verhöhnt. Ich lasse mir ein Glas Wasser einlaufen und zwinge meine Hände, nicht zu zittern, denn ich spüre, wie Rhys mich beobachtet. Mich analysiert.
Ich kann mir zwar einreden, dass er groß und schwer von Begriff ist, doch ich brauche mich nur wenige Sekunden in seinen dunklen Augen zu verlieren, um die Intelligenz in ihren Tiefen zu erkennen.
»Heftige Nacht gehabt?«
Mit einem verächtlichen Schnauben starre ich auf das Wasserglas hinunter. Ich weiß, dass ich es brauche, aber auch, dass es mir sehr wahrscheinlich direkt wieder hochkommen wird.
»Ich packe gerade die Sachen meiner toten Schwester zusammen. Was wohl kaum eine spaßige Beschäftigung ist. Wenn ich deine Meinung zu diesem Thema hätte hören wollen, hätte ich dich gefragt.«
Das Glas berührt meine Lippen, und ich trinke einen kleinen Schluck, bevor ich mich umdrehe und ihn ansehe. Seine schweren Schultern sind nach vorn gezogen, die Ellbogen liegen auf seinen Knien, und er hält ein paar weiße Blätter Papier in den riesigen Händen.
Ich schiebe eine Hüfte vor und funkle ihn böse an. »Was an ›Du kannst jetzt gehen‹ hast du nicht verstanden?«
»Ich habe es sehr wohl verstanden. Aber ich werde es nicht tun.«
»Vermieter müssen ihren Besuch vierundzwanzig Stunden vorher ankündigen. Das habe ich im Internet gelesen.«
Seine Kiefermuskeln zucken. »Ich bin nicht dein Vermieter.«
Meine Backenzähne mahlen. »Ach, lass den Scheiß. Ich bin auch so schon fix und fertig, da brauchst du mich nicht auch noch mit deiner Anwesenheit zu quälen. Du hast echt Nerven, mir überhaupt noch unter die Augen zu treten. Bis heute Abend habe ich alles gepackt und bin weg. Dann hast du dein Haus wieder. Und jetzt geh.«
»Ich habe Nerven? Und das sagst ausgerechnet du? In den letzten zwei Jahren bist du nicht ein einziges Mal hier gewesen, und jetzt machst du dir plötzlich Gedanken?«
Seine Worte sind wie ein Schlag ins Gesicht. Er braucht nichts weiter mehr zu sagen. Ich weiß genau, was er meint. Ich bin schuld.
Der Gedanke, dass Erika vielleicht noch leben würde, wenn ich öfter bei ihr gewesen wäre, quält mich seit Tagen. Sie hat immer gesagt, dass Rhys keine Besucher auf dem Grundstück haben wolle, und mich gebeten, nicht herzukommen. Und ich habe das respektiert, denn ich wollte mich nicht aufdrängen und wünschte mir zugleich so sehr, dass sie wieder ein gewisses Maß an Kontrolle über ihr Leben zurückgewinnen würde.
Trotzdem haben wir uns regelmäßig gesehen. Auch wenn unsere Eltern nichts mehr mit ihr zu tun haben wollten, ist Erika häufig zu mir nach Rose Hill gekommen. Und ich habe meine Arbeitszeiten im Bistro so gelegt, dass ich möglichst oft auf Milo aufpassen konnte, damit sie sich nicht ganz allein um ein kleines Kind kümmern musste. Die fünfstündige Fahrt zwischen Emerald Lake und Rose Hill hat uns nie abgehalten.
Ein Sprichwort sagt, dass es ein ganzes Dorf braucht, um ein Kind großzuziehen, aber Erika hatte keins, obwohl sie es dringend gebraucht hätte. Also war ich ihr Dorf und habe ihr so viel abgenommen, wie ich nur konnte. Und mittlerweile liebe ich diesen Jungen wie meinen eigenen Sohn.
Meine Eltern sagen, dass ich zu viel für sie getan hätte … Und doch werde ich mich mein Leben lang fragen, ob ich nicht noch mehr hätte tun können.
Die letzten Male, als sie mich gebeten hat, auf Milo aufzupassen, habe ich ein wenig unwilliger reagiert als sonst. Zumal sie mich zunehmend öfter darum bat.
Ich war müde. Überarbeitet, überfordert und ziemlich pleite. Zudem fühlte ich mich allmählich ein wenig ausgenutzt und habe ihr immer mehr Fragen gestellt, zum Beispiel warum sie mich eigentlich so oft brauchte. Mittlerweile glaube ich, dass ich da bereits gespürt habe, dass etwas nicht in Ordnung war … doch ich bin der Sache nicht nachgegangen.
Meine Augen brennen, und ich hasse mich selbst dafür. »Raus hier.«
Rhys hat immerhin so viel Anstand, die Augen niederzuschlagen, doch ich folge seinem Blick und sehe, wie die Sehnen auf seinen Handrücken arbeiten, während er mit den Unterlagen zwischen seinen Fingern spielt. »Ich kann nicht. Ich muss dir das hier geben. Und ich muss wissen, wo Milo ist.«
Sofort schalte ich auf Angriff, denn ich werde Milo unter allen Umständen beschützen. Das habe ich immer und werde ich immer. »Es geht dich einen Scheißdreck …«
»Das hier ist eine Kopie von Erikas Testament.«
Ich verdrehe die Augen. Ich liebe meine Schwester, doch die Vorstellung, dass sie so etwas wie ein Testament aufgesetzt haben könnte, ist mehr als absurd. Jedes Mal, wenn ich dieses Thema ihr gegenüber erwähnt habe, hat sie erklärt, dass sie nicht vorhätte zu sterben. Sie war vieles, aber ganz sicher nicht vorausschauend. »Bullshit.«
Was für ein dämlicher Versuch. Ich trinke noch einen Schluck Wasser und stelle das Glas dann kopfschüttelnd auf die Arbeitsplatte.
Die Sekunden vergehen in unbehaglichem Schweigen. Rhys sagt nichts.
Je länger er schweigt, desto nervöser werde ich.
Mir ist übel, doch es liegt nicht am Wasser, sondern an dem, was er gleich von sich geben wird.
»Ich bin Milos gesetzlicher Vormund. Steht alles hier. Samt Unterschrift.«
Er reicht mir die Papiere, als wären sie der Beweis. Als hätte er irgendein Recht auf meinen Neffen. Den Jungen, den ich in den vergangenen drei Jahren mit großgezogen habe.
Was für ein grausamer Scherz. Anders kann es nicht sein. Dieser Mann hier spielt mit mir. Alles andere ist undenkbar.
Ich schnaube abfällig. »Vergiss es.«
Rhys verzieht keine Miene. Er sieht mich nur an, und sein ruhiges, stoisches Gehabe bringt mich erst recht in Rage. In meinem zerknitterten T-Shirt und den schmuddeligen Leggins stürme ich durchs Zimmer und baue mich vor ihm auf.
Zornig und kindisch trete ich ihm gegen den nackten Fuß, so wie er es eben bei mir getan hat, um mich zu wecken.
Nur fester.
Er zuckt nicht mal mit der Wimper. Im Gegenteil, er legt den Kopf in den Nacken und sieht mich mit seinen dunklen Augen an. Sein Blick ist eine einzige Herausforderung. Hart wie Stahl.
»Hör zu, Arschloch. Das ist doch ein kranker Scherz. Findest du das witzig? Ich bin am Boden zerstört. Ich habe gerade meine große Schwester verloren, und du willst irgendwelche Spielchen mit mir treiben?« Ich reiße ihm die Blätter aus der Hand. Das Knistern des Papiers ist das einzige Geräusch im Raum, abgesehen von meinem schweren Atem.
»Bist du wirklich am Boden zerstört?«
Ein gequältes Stöhnen entweicht meiner Kehle. Es ist genau der Laut, den ein Kind von sich gibt, wenn es von einem Baum fällt. Wenn ihm alle Luft aus den Lungen entweicht, weil es so hart auf dem Boden aufschlägt.
Genau so fühlen sich seine Worte gerade an.
»Du kanntest Erika ja nicht einmal.«
»Doch, ich kannte sie.« Er sieht mir fest in die Augen. Sucht nach einer Reaktion. Als hoffte er, mich mit seinen Worten verletzt zu haben.
Langsam dämmert es mir. »Wart ihr … wart ihr zusammen? Sie hat es mir nie erzählt.« Und dann überkommt mich wieder der Zorn. »Du hast mit ihr geschlafen und sie dann rausgeschmissen?«
Er runzelt die Stirn und wirkt offensichtlich verletzt. »Wir waren nicht …«
»Du kennst mich nicht«, sage ich, zu aufgebracht, um mir auch nur ein einziges weiteres Wort aus diesem wohlgeformten Mund anzuhören. Die Vorstellung, dass ich ihn tatsächlich mal attraktiv gefunden habe, macht meine Übelkeit nur noch schlimmer. »Du hast keine Ahnung, wer ich bin und wie nah Erika und ich uns standen. Oder was ich alles für meine Schwester getan habe. Mit wie vielen Menschen ich ihretwegen gebrochen habe. Wie viel Schlaf es mich gekostet hat, weil ich mich um ihren Sohn gekümmert habe, nur damit sie mal ein wenig zur Ruhe kommen kann.«
Am ganzen Körper zitternd schleudere ich die Papiere durch den Raum. Sie schweben durch die Luft und verteilen sich über den Boden, doch Rhys und ich starren uns nur weiter an. »Ich liebe meine Schwester, und hier zu stehen und mir anhören zu müssen, was du zu glauben meinst, ist ehrlich gesagt noch schmerzhafter als ihr Tod. Zumal es deine Schuld war. Wenn du sie nicht rausgeworfen hättest, wäre sie überhaupt nicht da draußen gewesen und hätte keinen Rückfall erlitten.«
»Ich habe sie nicht …«
»Nein. Sag nichts. Dieser kleine Junge gehört mir. Er ist alles, was ich noch von ihr habe. Du kannst dir deinen beschissenen Vertrag sonst wohin stecken. Und jetzt verschwinde. Ich will dich nie wieder sehen.«
Die Muskeln in Rhys’ Kiefer zucken, als hätte ich ihn mit dieser Wahrheit stinkwütend gemacht. Doch als er aufsteht, weiche ich keinen Zentimeter zurück, auch wenn die Machtverhältnisse sich augenblicklich drastisch verschieben. Es ist nicht leicht, furchteinflößend zu wirken, wenn frau ihrem Gegner gerade mal bis zur Brust reicht.
Zumal einem, der nur so vor Kraft strotzt wie dieser hier.
Aber das ist mir egal. Ich bleibe, wo ich bin – die Arme vor der Brust verschränkt, die Augen zu schmalen Schlitzen verengt, die Nasenflügel gebläht.
Er geht um mich herum. Doch sein Oberkörper ist so breit, dass sich ein Körperkontakt nicht ganz vermeiden lässt. Als sein Arm meine Schulter streift, rieselt ein Schauer über meine Wirbelsäule. Ich sage mir, dass es ein Schauer vor lauter Ekel sein muss. Alles andere wäre definitiv Verrat.
Mit steifen Bewegungen und hocherhobenem Kopf geht er zur Tür, und mein Blick wandert über seinen muskulösen Körper. Ohne das geringste Anzeichen von Reue oder Schuldbewusstsein schiebt er die nackten Füße in ein Paar schwarze Vans.
»Du solltest dir trotzdem das Testament durchlesen, Tabitha«, ruft er mir noch über die Schulter zu, bevor er endgültig verschwindet.
In der Sekunde, in der die Tür ins Schloss fällt, eile ich zu den Papieren, raffe sie zusammen und lasse mich auf den Boden sinken. Mein Blick fliegt über die Zeilen. Blaue Tinte in der Handschrift meiner Schwester über einer schwarzen Linie. Mit den Fingerspitzen streiche ich darüber und denke daran, dass sie exakt dieselbe Stelle berührt hat wie ich jetzt.
Doch dann dringt die Bedeutung der Worte, die dort stehen, langsam zu mir durch.
Ich renne ins Bad und knie mich vor die Toilettenschüssel, während mein Magen sich bereits auf links dreht.
Und es liegt nicht am Scotch.
Sondern daran, dass dieses Testament schrecklich echt aussieht.
4. Kapitel
RHYS
Ich habe Erikas Schwester dabei zugesehen, wie sie mit fahlem Gesicht und hängenden Schultern Kartons voller Erinnerungsstücke in einen gemieteten Transporter gepackt hat. Habe beobachtet, wie sie ein paar Leuten vom Frauenhaus die Tür geöffnet und sie die restlichen Möbelstücke hat hinaustragen lassen. Und dann habe ich durch die dünne Wand, die die beiden Haushälften trennt, gehört, wie sie zu sich selbst gesagt hat: »Reiß dich zusammen. Rumheulen hilft dir nicht weiter.«
Und seit sie vor drei Tagen davongefahren ist, fühle ich mich wie der letzte Dreck. Nicht nur, weil die Nachricht von Erikas Tod mich tief getroffen hat, sondern auch weil ich ihrer Schwester gegenüber so ein Arschloch gewesen bin.
Als Tabitha Garrison dort draußen vor der Tür stand, war ich fest davon überzeugt, dass sie genauso schwierig ist, wie Erika sie mir beschrieben hat.
Aber jetzt? Nachdem ich sie so gesehen habe?
Diese Frau zerfließt vor Trauer, und ich bin von gar nichts mehr überzeugt.
Weshalb ich mich widerstrebend auf Tabithas Wunsch einlasse, den sie mir über meinen Anwalt hat ausrichten lassen. Sie bittet mich, nach Rose Hill zu kommen, um Milo dort zu treffen. Allerdings werde ich unangekündigt dort auftauchen, um den Überraschungsmoment für mich zu nutzen und mir die wahren Zustände dort anzusehen.
Ich weiß, wie es ist, ohne Eltern oder Familie aufzuwachsen, und kann unmöglich guten Gewissens ein Kind von seinen Verwandten losreißen, ohne mir vorher ein Bild von seiner Lebenssituation gemacht zu haben.
Gleichzeitig hat Erika sehr klar den Wunsch geäußert, dass ich mich um Milo kümmern soll – selbst wenn es bedeutet, dass ich ihn mit nach Florida nehmen muss, wo ich den größten Teil des Jahres lebe.
Und all das ist der Grund, warum ich jetzt auf dem Weg in die kleine Stadt Rose Hill bin. Warum ich all das überhaupt tue.
Für Milo.
Den kleinen Jungen mit den dunklen Locken und den großen blauen Augen. Er erinnert mich ein bisschen zu sehr an mich selbst – seine ganze Situation ein bisschen zu sehr an meine eigene.
»Das Ziel befindet sich vor Ihnen auf der rechten Seite«, verkündet das Navi, und ich trete auf die Bremse. Ich will nicht direkt vor Tabithas Haus anhalten, sondern brauche vorher noch eine Minute, um mich zu sammeln und mich umzuschauen, um mir einen Eindruck von der Umgebung zu machen.
Es wäre gelogen zu leugnen, dass ich auch gekommen bin, um nach Gründen zu suchen, warum Milo auf keinen Fall hierbleiben sollte. Doch leider musste ich feststellen, dass das Zentrum dieser kleinen Stadt sogar echt hübsch ist. Ruhiger und nicht so herausgeputzt wie Emerald Lake.
Rose Hill ist ein echtes Bergstädtchen. Dahinter erheben sich die zerklüfteten Gipfel, und unterhalb glitzert das tiefe dunkelblaue Wasser des Sees, an dem es liegt. Die Landschaft wirkt rau und wild, und ich wette, dass hier im Winter Tonnen von Schnee runterkommen. Selbst jetzt im Juni weht eine kühle Brise.
Ich steige aus dem Wagen, öffne die hintere Tür und greife nach meiner alten, abgetragenen Jeansjacke. Abschätzend wiege ich sie in der Hand, während ich überlege, ob ich sie wohl brauche oder nicht, und entscheide mich schließlich, sie lieber mal mitzunehmen.
Tief in meinem Innern weiß ich, dass ich bloß Zeit schinde, bevor ich den halben Block zu Tabithas Haus hinunterlaufe, wo mich eine unangenehme Begegnung erwartet.
Mit einem mürrischen Kopfschütteln drücke ich auf den Verriegelungsknopf des Autoschlüssels und mache mich auf den Weg. Bäume mit üppigen grünen Blättern säumen die Straße. Der Weg unter meinen Füßen zeigt die typischen Spuren der Zeit – schmale Risse und Bruchstellen, wo die Wurzeln der Bäume sich ihren Weg gebahnt haben. Das Viertel ist nicht neu, sondern besteht schon seit vielen Jahrzehnten.
Die Häuser entlang der Straße zeugen von Besitzerstolz und davon, dass man sich liebevoll um sie kümmert. Ich frage mich, ob Tabithas wohl ebenso gut in Schuss ist. Kann eine Frau, die so obsessiv arbeitet, wie Erika es mir erzählt hat, überhaupt die Zeit finden, ihren Garten so zu pflegen wie ihre Nachbarn?
Wenn sie schon keine Zeit für ihre Schwester hatte, kann sie wohl kaum Zeit für solche Dinge gefunden haben.
Bevor ich das Haus überhaupt sehe, höre ich ihn bereits. Milo.
Und es trifft mich wie ein Schlag gegen die Brust. Vor Rührung schnürt sich meine Kehle zusammen, als ich es vernehme.
Lachen.
Das eines kleinen Jungen und einer Frau. Eines tiefer und rauer, das andere eher ein hohes Kichern. Und dieses Kichern kenne ich nur zu gut.
Denn mit mir macht er das auch.
Das Lachen der Frau erinnert ein bisschen zu sehr an Erikas an einem ihrer guten Tage, und die Erinnerung daran treibt mich voran.
Nur noch ein paar Schritte, dann entdecke ich die beiden unter einem Baum in einem gepflegten Garten. Hinter ihnen erhebt sich ein malerisches Haus im Craftsman-Stil mit ausladender Veranda und großen Fenstern. Die weiße Fassade und die Backsteinsäulen, die bis unters Dach reichen, geben dem Ganzen einen altertümlichen Charme. Die Haustür leuchtet in einem hellen Apfelgrün, das sich in den Polstern der Verandamöbel und der sorgfältig gestutzten Hecke, die das Grundstück umgibt, wiederfindet.
Offensichtlich ist Tabitha absolut in der Lage, sich um ihren Garten zu kümmern.
Ich richte meine Aufmerksamkeit wieder auf sie. Sie kniet am Fuß des Baumes und spricht leise und ruhig mit ihrem Neffen. Als sie die Hand hebt, sehe ich eine gelb-schwarz gestreifte Raupe, die über ihre Handfläche krabbelt.
»Noch mal!«, ruft Milo aufgeregt.
»Okay. Aber du musst ruhig bleiben. Wir wollen den kleinen Kerl schließlich nicht erschrecken. Vorsichtig, hörst du?« Sie sieht Milo an und benutzt keine dämliche Babystimme oder so. Nein, sie spricht mit ihm, als würde er sie vollkommen verstehen.
Und das tut er. Milo mag erst drei sein, aber auf mich wirkt er manchmal fast schon erwachsen. Er hört auch sofort auf zu hibbeln, atmet tief ein und streckt langsam seine kleine Hand aus.
»Bereit?«
Er nickt und presst die Zähne in die Unterlippe, wie um sich für das bevorstehende Abenteuer zu rüsten. Tabitha legt ihre Hand an seine, sodass ihre Handflächen eine breite Ebene bilden, und die Raupe arbeitet sich zu ihm hinüber. Je weiter sie krabbelt, desto breiter wird das Grinsen auf Milos Gesicht.
Und ich? Ich kann den Blick nicht von seiner Tante abwenden.
Der elegante Schwung ihres Halses, ihre nackte Schulter, die aus dem zur Seite gerutschten Ausschnitt ihres dunkelblauen Pullis hervorschaut. Sie scheint nichts darunter zu tragen, denn ihre Brustwarzen zeichnen sich deutlich ab. Doch ich lasse meinen Blick nicht dort verweilen, sondern lasse ihn weiterwandern zu ihrem seidigen dunklen Haar, das sie lässig auf dem Kopf festgesteckt hat. Einzelne Strähnen, die sich gelöst haben, umrahmen ihr zartes Gesicht.
Doch das Attraktivste an Tabitha Garrison ist wohl der Blick, mit dem sie nun Milo ansieht, als wäre er eines der sieben Weltwunder.
Es tut weh, das zu sehen.
Es tut weh, weil es mir keinen Spaß machen wird, Milo von hier wegzuholen.
Aber genau das habe ich Erika versprochen.
5. Kapitel
TABITHA
Ich kann den Blick nicht von Milo abwenden. Sein Staunen und die Faszination auf seinem süßen Gesicht sind einfach zu schön.
Wer auch immer sein Vater sein mag, er muss wunderschöne Locken haben, denn die Locke, die Milo jetzt in die Stirn fällt, stammt ganz sicher nicht von unserer Seite der Familie, wo glatte Haare vorherrschen.
Ich habe keine Ahnung, wer sein biologischer Vater ist. Entweder hat Erika es selbst nicht gewusst, oder sie hat es mir nicht verraten. Allerdings habe ich sie auch nie gedrängt, es mir zu sagen, denn die Nachricht, dass sie schwanger sei, bekam sie während einer besonders dunklen Zeit in ihrem Leben. Milo ist der Grund, warum sie in den vergangenen Jahren so hart daran gearbeitet hatte, gesund zu werden. Und ich war einfach nur froh zu sehen, dass meine Schwester es versuchte.
Wie gebannt starrt Milo auf die haarige Raupe, die jetzt über seine Handfläche krabbelt.
»Gut. Und jetzt nimm deine andere Hand hinzu. So.« Ich hebe seine freie Hand und halte sie neben die andere, um die Fläche zu vergrößern. »So kannst du sie noch länger bei dir halten.«
»Wow«, murmeln seine kleinen kirschroten Lippen fasziniert.
»Verrückt, nicht wahr?«
Ein knappes Nicken ist alles, was ich bekomme. Er ist wie in Trance. Und ich teile dieses Gefühl, denn ich sehe so viel von meiner Schwester in ihm. Es tut mir in der Seele weh, dass sie nicht mehr hier ist, um ihn aufwachsen zu sehen.
Bisher habe ich ihm die schreckliche Nachricht noch nicht überbracht. Aber ich weiß, dass ich es bald tun muss. Zum Glück ist Milo es gewohnt, ein paar Wochen bei mir oder bei seinen Großeltern zu verbringen.
Trotzdem habe ich heute Nachmittag einen Termin mit einer Therapeutin, die mir für dieses Problem wärmstens empfohlen wurde. Denn ich möchte es richtig machen. Die richtigen Dinge sagen, Milo so gut helfen, wie ich nur kann. Ihm geben, was er braucht.
Ich mag gar nicht daran denken, dass ich ihn bald in ein anderes Land ziehen lassen muss. Wenn ich meine Gedanken dorthin wandern lasse, breche ich auf der Stelle zusammen.
Also konzentriere ich mich stattdessen lieber darauf zuzuschauen, wie Milo jetzt einen Finger ausstreckt und der Raupe damit vorsichtig über den Rücken streichelt. »Ganz weich«, flüstert er, und ich muss lächeln.
»Sie wird sich irgendwann in eine gefleckte Tussock-Motte verwandeln.«
Milos Augen weiten sich. »Das wird eine Motte?«
»Ja. So etwas Ähnliches wie ein Schmetterling. Beide sind ein Zeichen für ein gesundes Ökosystem. Sie helfen dabei, die Blüten zu bestäuben, und du weißt ja, wie wichtig das ist.«
Ich lächle ihm zu, und er lächelt zurück. Denn er weiß es tatsächlich. Wir waren schon oft zusammen Blumen pflücken. Essbare Blüten für die Dekoration der Gerichte, für Tees, als Farbkleckse auf den Bistrotischen. Man könnte wohl sagen, ich stehe auf Blumen.
Ein vorbeifahrendes Auto lässt meinen Blick zur Straße gleiten, doch es ist nicht das Fahrzeug, an dem er hängen bleibt. Es ist der unheilvolle Hüne, der dort auf dem Bürgersteig steht und zu uns hinüberschaut.
Rhys Dupris.
Der Mann, dessen Name mich verfolgt, seit ich ihn in diesem Testament gelesen habe. Er sieht gequält und gleichzeitig zum Anbeißen süß aus. Scheint sein Markenzeichen zu sein. Ich hasse es, dass ich ihn überhaupt so sehe. Aber ich kann einfach nicht anders.
Wir starren uns an, und mir sinkt der Magen in die Kniekehlen. Ein eisiges Grausen pulsiert durch meine Adern. Ich war fest entschlossen, einen Anwalt einzuschalten, ihn anzuflehen und an jeden Fetzen Empathie zu appellieren, den dieser Mann besitzen mag, damit er sich noch einmal überlegt, ob er Milo wirklich mit sich fortnehmen will. Denn dieses ganze Testament ist eine einzige Katastrophe.
Doch der finstere Ausdruck auf seinem Gesicht wirkt nicht gerade vielversprechend. Er sieht aus, als wäre er stinksauer.
»Ich hatte keine Ahnung, dass du heute kommen wolltest«, platzt es aus mir heraus, während ich, immer noch vollkommen überrumpelt, auf dem feuchten Boden hocke.
»Ich weiß«, brummt er mit dieser unendlich tiefen Stimme. Einer Stimme, bei der einem Schauer über den Rücken laufen. Doch im Moment vermittelt sie mir nur das Gefühl, beobachtet und analysiert zu werden. Beurteilt. Als hatte er eigentlich hinter diesem Busch hervorspringen und mich bei irgendetwas ertappen wollen.
Oh nein, dieser Mann bewirkt bei mir nur eins: dass sich mir die Nackenhaare aufstellen.
Weshalb mir jetzt buchstäblich die Kinnlade runterfällt, als mein Neffe neben mir den Kopf hebt, sich auf die Zehenspitzen stellt und in seiner niedlichen, zuckersüßen Kleinkindstimme kreischt: »Ree!«
Ich bin von dieser Vertrautheit so schockiert, dass ich ihn beinahe mitsamt unserer armen Raupe losrennen lasse. »Milo, Schatz, lass uns die Raupe wieder an den Baum setzen.«
Rasch greife ich nach seinem Arm und führe ihn zum Stamm. Er vibriert förmlich vor Aufregung, und ich rede mir ein, dass nur deshalb auch meine Hände zittern, während ich ihm helfe, das Tier sanft zurückzusetzen.
Kaum hat die Raupe Halt am Stamm gefunden, wirbelt Milo herum, rennt über das Gras und stürzt sich auf Rhys. Ja, er schmeißt sich ihm buchstäblich in die Arme. Als wüsste er instinktiv, das Rhys ihn auffangen wird. Als würde er ihn kennen.
Ich finde es verstörend. Ich finde es schwer erträglich, ihm dabei zuzusehen.
Und so beiße ich die Zähne aufeinander und halte den Blick fest auf den Boden gerichtet, während ich aufstehe, mir die Jeans abklopfe und verärgert feststelle, dass ich Grasflecken an den Knien habe.
Natürlich muss ich so aussehen, wenn er hier auftaucht. Kein BH. Grasflecken auf der Hose. Zerzauste Haare, die nach Kuchen riechen, weil ich bloß Trockenshampoo draufgesprüht habe. Dunkle Ringe unter den Augen, die farblich perfekt zu dem ollen Pulli passen, den ich heute Morgen kurzerhand angezogen habe.
Der einzige Pluspunkt ist wohl, dass ich heute nicht nach Scotch rieche.
Wie war das mit den kleinen Siegen?
Trotzdem weigere ich mich, vor ihm zu kuschen. Ich strecke die Schultern zurück und richte mich auf, verschränke die Arme vor der Brust und recke das Kinn wie die Königin von irgendetwas Größerem als diesem halb renovierten Haus hinter mir und meinem halb erfolgreichen Kleinstadtbistro.
Und dann betrachte ich die beiden. Rhys hat Milo auf den Arm genommen, und der kleine Junge kuschelt sich an ihn und legt den Kopf an seine gigantische Schulter.
Der Anblick könnte einen zutiefst rühren.
Stattdessen zieht sich jedoch mein Magen zusammen und pulsiert, als wäre mein Herz direkt in ihn hineingesackt.
Meine einzige Hoffnung in dieser gigantischen Shitshow war es, dass Rhys erkennt, wie sehr Milo mich liebt, und seine Großeltern, und diese Stadt. Und dass wir alle ihn ebenfalls lieben. Erika mag nicht länger unter uns sein, aber Milo wird wirklich geliebt.
Doch nur ein Narr könnte zusehen, wie dieser Mann jetzt zärtlich seine Wange an Milos legt, mit einem tiefen Atemzug die Nase in dessen Haar vergräbt und langsam die Augen schließt, und sich einreden, dass er den Jungen nicht ebenfalls auf gewisse Weise liebt.
»Du hast mir gefehlt, kleiner Mann«, brummt Rhys, bevor er den Kopf hebt und mir in die tränennassen Augen schaut. Er nickt mir zu. »Tabitha.«
»Tabby Cat!« Milo zappelt auf Rhys’ Arm und streckt sich nach mir, ein Zeichen, dass er runterwill. Rhys wirkt seltsam erschüttert. Seine Augen verengen sich, seine Nasenflügel blähen sich und ziehen sich wieder zusammen. Er sieht aus wie ein Bulle kurz vor dem Angriff.
»Ich will runter«, sagt Milo. »Ich will dir meine Raupe zeigen!«
Ohne den Blick abzuwenden, stellt Rhys ihn sanft hinunter auf den Boden und richtet sich wieder auf.
Milo greift seine Hand und zieht ihn in meine Richtung. Mein Herz schlägt schneller, als sie näher kommen.
»Sieh mal hier.« Milo zeigt auf die schwarz-gelbe Raupe, und ich stehe einfach nur da, reglos wie ein Baum, während er wiederholt, was ich ihm gerade über das kleine Tier erzählt habe. Der Ernst, mit dem er das alles vorträgt und dabei die Buchstaben durcheinanderbringt, macht es nur noch liebenswerter.
»Tante Tabby Cat und ich lieben Blumen«, beendet er schließlich seinen Vortrag mit einem nachdenklichen Nicken, bevor er seine Aufmerksamkeit wieder auf die Raupe richtet.
»Tabby Cat?«, fragt Rhys.
Ich zucke möglichst lässig mit den Schultern. »Ein alter Spitzname.«
Der Blick unter seinen schweren Brauen wandert misstrauisch über mein Gesicht, und ich schaue schnell weg. Dieser Kerl ist ein einziger gigantischer, nervtötender Mindfuck. Meine Nase kribbelt, während meine Haut unter seinem Blick prickelt und mein Herz wie verrückt schlägt. Keine Ahnung, warum ich das Gefühl habe, als würde dieser Mann gerade überprüfen, ob ich es wert bin, in Milos Nähe zu sein, aber so ist es.
Und Milo scheint mein Unbehagen zu spüren, denn er streckt den Arm aus und schlingt ihn um meinen Oberschenkel, um mich gedankenverloren an sich zu drücken.
Mein Neffe mag diese Situation hier gerade kein bisschen seltsam finden, aber ich tue es. Und so lenke ich die Unterhaltung wieder zurück auf das aktuelle Thema, ohne allzu konkret zu werden. »Also, was führt dich so unerwartet her?«, frage ich Rhys und füge deutlich leiser und zuckersüß hinzu: »Außer das Vergnügen, andere Menschen, die bereits am Boden liegen, noch ein bisschen mehr zu quälen.«
Rhys’ Kiefer spannt sich, und er verdreht die Augen.
Ihn zu ärgern fühlt sich gut an, deshalb verbuche ich es als Gewinn und mache weiter. »Ich hatte erwartet, zuerst eine Antwort auf meine Einladung zu erhalten, bevor du hier aufkreuzt.«
»Ich wollte mir ohne Vorankündigung ein Bild von der Lage machen.«
Abfällig schnaubend streiche ich mit den Fingern durch Milos dichtes Haar, als könnte das mir helfen, meine Nerven ein wenig zu beruhigen. »Die Lage ist …« Ich verstumme, als Milo den Kopf dreht und mir einen Kuss auf den Oberschenkel drückt. Er war immer schon sehr verschmust, was ich sehr an ihm liebe.
Als ich wieder zu Rhys hinüberschaue, sehe ich, wie er auf die Stelle starrt, wo kleine Kinderfinger fröhlich auf mein Bein tippen, als könnte er nicht glauben, was er da sieht.
»Die Lage ist …« Meine Worte klingen sanft, doch mein eisiger Blick sagt ihm, wie ich wirklich über ihn denke. Er ist ein Eindringling, der sich in Angelegenheiten einmischt, die ihn nichts angehen. Und er weiß einen Scheiß über mich und wie weit ich gehen würde, um die Menschen, die ich liebe, zu beschützen. »… dass ich Milo jetzt gleich zu meinen Eltern bringe. Und dann habe ich einen Termin, zu dem du mich möglicherweise begleiten möchtest, wenn du schon mal hier bist.«
Milo blickt zu mir hoch. »Ich darf zu Grandma und Grandpa?«
Rhys fühlt sich offensichtlich nicht wohl. Er verschränkt die Arme und scheint ein wenig hin und her zu schwanken.
Ich beachte ihn nicht weiter und zwinge mich zu einem Lächeln, als ich meinen Neffen ansehe. »Das weißt du doch. Und du wirst auch bei ihnen schlafen, denn ich muss heute Abend arbeiten. Morgen früh hole ich dich wieder ab.«
»Bringst du Schokocroissants mit?« Normalerweise muss ich immer grinsen, wenn er das Wort Croissant ausspricht, aber jetzt macht es mich einfach nur traurig.
Heute Morgen habe ich Milo mit ins Bistro genommen, um uns ein paar Croissants frisch aus dem Ofen zu holen. Ich habe zugesehen, wie er sich selig die Finger abgeleckt hat, und musste die ganze Zeit daran denken, wie furchtbar es sein wird, ihn nie wieder meine Backkünste verschlingen zu sehen. Die leisen Laute zu hören, die er von sich gibt, wenn er etwas mag. Zu erleben, wie seine Augen ganz groß werden, wenn er fragt, ob er noch eins haben darf.
Es hätte mich beinahe zu Tränen gerührt, aber dann ist West Belmont reingekommen und hat lachend irgendwas von seinem albernen Bowlingteam erzählt, womit er mir die perfekte Ablenkung geliefert hat, um mich wieder zusammenzureißen.
»Ich könnte …«, sagt eine tiefe Stimme.
»Natürlich! Ich wette, Grandma und Grandpa fänden das auch toll«, unterbreche ich Rhys, bevor er etwas sagen kann und damit zweifellos eine Grenze überschreiten wird. Denn es steht ihm deutlich ins Gesicht geschrieben. Ich kenne die rechtlichen Konsequenzen dieses Testaments, aber wenn er glaubt, ich würde einfach klein beigeben, ihm meinen Neffen geben und die beiden in den Sonnenuntergang reiten lassen, dann hat er sich geschnitten. »Milo, ich habe deinen Rucksack schon gepackt. Er liegt in deinem Zimmer. Geh schnell und hol ihn.«
Milo strahlt so breit, dass seine Wangen ganz rund werden, und nickt aufgeregt. »Bin gleich wieder da!« Er rennt los, dreht sich aber nach wenigen Schritten noch einmal zu uns um. »Nicht weggehen! Du nicht, und du auch nicht!«, ruft er und zeigt auf Rhys und mich.
Und dann stürmt er fröhlich durch die Haustür, ohne die Anspannung und den Schmerz zu spüren, die ihn umgeben.
»Er hat hier ein eigenes Zimmer?« Rhys’ Brauen schieben sich zusammen, als er das fragt.
Es widerstrebt mir, ihm auch nur die kleinste Information zu geben, aber er wirkt tatsächlich verwirrt. »Natürlich. Er verbringt sehr viel Zeit mit mir.«
Rhys schluckt, doch seine Miene verrät nichts. »Und er ist gern bei deinen Eltern?«
Jetzt ist es an mir, ihn verwirrt anzusehen. »Ähm, ja. Sie verwöhnen ihn nach Strich und Faden. Welcher Dreijährige würde das nicht toll finden?«
Er nickt. »Ich dachte, sie hätten keinen Kontakt zu ihm.«
»Du scheinst dir so einiges gedacht zu haben.«