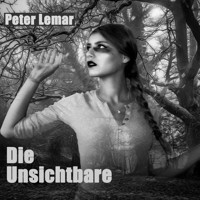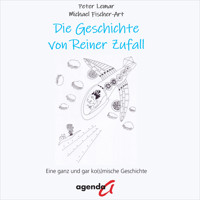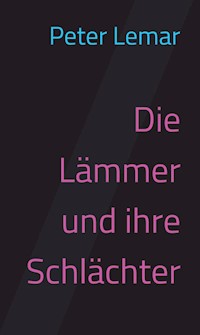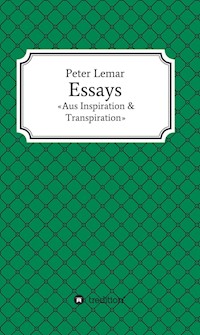Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Heute - 25 Jahre nach dem Mauerfall - erinnert nicht mal mehr der Palast der Republik an eine Zeit, die verblasst ist wie unzählige Druckerfarben in der Sonne. Von der DDR ist nichts mehr geblieben, außer dem grünen Abbiegepfeil, dem Ampelmännchen und dem Sandmann, wenn man mal die positiven Relikte betrachtet. Die negativen, angefangen von den Stasigefängnissen bis hin zur Berliner Mauer, liegen auf der Hand. Ich habe versucht, einen Hauch von DDR-Geschichte in Geschichten zu verpacken und ihn – wie den Geist aus der Flasche – noch einmal aufleben zu lassen. Aus meiner ganz individuellen Sicht natürlich. Weil ich glaube, dass es wichtig ist, einen unverstellten Blick auf unsere Geschichte zu bewahren, einen Blick, der auch empfänglich ist dafür, was zwischen den Zeilen steht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 101
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Lemar
Wilder Osten
Geschichten aus der DDR
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Ein Kind ohne Namen
Walter Ulbricht und die Lebensmittel
Seid bereit! Immer bereit!
Zur Messe
Mein Freund Thomas
Chemie Leipzig
Die Sportlerumfrage
Bei der NVA
Not macht erfinderisch
Eine sozialistische Lehrerpersönlichkeit
Eine Musikerkarriere
Back in the U.S.S.R.
Paul & Conny
Wir sind das Volk!
Begrüßungsgeld
Schlaraffenland
Wilder Osten
Willi Brandt und der Smaragd
Epilog
Impressum neobooks
Ein Kind ohne Namen
Alles fing damit an, dass ich keinen Namen hatte. Normalerweise hat jedes Kind, wenn es geboren wird, einen Vornamen. Doch bei mir war das anders: Ich hatte keinen. Ich war von Anfang an ein Sonderfall. Dementsprechend waren die Umstände, die mich sozusagen vom Namenlosen zum Namhaften machten. Man schrieb das Jahr 1958. Das war das Jahr, in dem die Sowjetunion gerade den Viermächtestatus aufgekündigt hatte. Berlin sollte innerhalb von sechs Monaten in einen neutralen Stadtstaat umgewandelt werden. Andernfalls wollte die Sowjetunion die Kontrolle der Zufahrtswege von und nach Berlin der DDR übertragen, was jedoch ebenso wenig funktionierte wie die Berlinblockade zu Zeiten des Kalten Krieges, wo die Russen schon mal versucht hatten, den Rückzug der Westalliierten aus Berlin zu erzwingen. Auch das war misslungen, weil der Westteil der Stadt über eine Luftbrücke versorgt wurde – bis Stalin nach fast einem Jahr alle Sperren aufhob.
Also 1958 befanden sich meine Eltern noch in ihrer Facharztausbildung. Prüfungen und Klausuren standen an, und so war die gesamte Situation, die mich nach meiner Geburt erwarten würde, ebenso unklar und geteilt wie die politische Großwetterlage in und um Berlin. Eine Lösung musste her. Was mich betraf, so hatten sich meine Eltern auf einen Namen nicht einigen können. Auf dem Geburtsschein stand lediglich der Familienname, kein Vorname. Es bedurfte erst eines Winks mit dem Zaunspfahl, dass das “Namensultimatum“ noch erfüllt wurde. Denn auf der Entbindungsstation der Frauenklinik, genau auf dem Zimmer, wo meine Mutter lag, lag auch eine Frau, die bereits Mutter war. Einmal rief sie vom Fenster aus ihren etwa fünfjährigen Sohn, der im Vorhof der Klinik herumtollte, weil er zur Besuchszeit nicht mit auf die Station durfte. Immer wieder rief sie seinen Namen: Elmar! Elmar!! Elmar!!! Diesem Umstand ist es zu verdanken, dass ich schließlich doch noch – sozusagen über drei Ecken – zu meinem Namen kam.
Walter Ulbricht und die Lebensmittel
Der Staatsratsvorsitzende zu dieser Zeit hieß Walter Ulbricht1. Eins seiner Markenzeichen war seine hohe und heisere Fistelstimme. Mit ebendieser Stimme hatte er zum Beispiel wenige Wochen vor dem 13. August 1961 gesagt: „Niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten“, was überhaupt nicht stimmte, denn kurz darauf war sie mit einem Schlag da. Ein anderer, oft zitierter Satz von ihm war: Jedermann an jedem Ort in der Woche einmal Sport. Das war eine unmissverständliche Aufforderung zur Körperertüchtigung, denn der Aufbau des Sozialismus erforderte starke und widerstandsfähige sozialistische Persönlichkeiten. Deshalb sorgte sich Walter Ulbricht an vorderster Front um das körperliche Wohl seiner Bürger. Und er selber ging mit gutem Beispiel voran. Es gab kaum eine Zeitung oder Zeitschrift, kaum einen Augenzeugen – die DDR-Wochenschau –, wo Walter Ulbricht nicht bei irgendwelchen sportlichen Aktivitäten zu sehen war. Überhaupt war man sichtlich darum bemüht, ihn von seiner menschlichen Seite zu zeigen, ganz nach dem Vorbild seines Kollegen aus Amerika. Fast hätte man den Eindruck gewinnen können, Ulbricht sei der kleine Bruder von Kennedy, was natürlich ein Ding der Unmöglichkeit gewesen wäre. Dafür war Ulbricht in der DDR mindestens genauso mächtig. Er war nicht nur Vorsitzender des Staatsrates, sondern auch 1. Sekretärs des Zentralkomitees der SED und Vorsitzender des Verteidigungsrates. Und irgendwann wurde sein sportlicher Satz auf „in der Woche mehrmals Sport“ erweitert – sozusagen als Steigerungsform. Schließlich sollten sich die DDR-Bürger nicht all zu lange auf ihren Lorbeeren ausruhen dürfen. Ein zweites Markenzeichen von ihm war sein Bart. Kein normaler Bart, sondern ein Spitzbart. Im Kindergarten bekamen wir nun stets zu hören und auf Bildern zu sehen, wie toll Walter Ulbricht war. Vielleicht habe ich ihn sogar im Fernsehen gesehen, denn meine Eltern hatten seit 1961 einen Fernseher, jedenfalls war ich von Walter Ulbricht so begeistert, dass ich auf der Straße Männer mit Bart ansprach. Ich zeigte auf sie und sagte zum Leidwesen aller Beteiligten: „Walter Ubricht!“ Immer wieder, wobei ich das ‚l’ vor Aufregung unterschlug. Ich war eben ein lebhaftes Kind. Aber da war noch etwas anderes. Ich weiß noch, dass wir im Kindergarten viel mit Bauklötzern spielten. Naturgemäß vielen dabei Türme um und Häuser ein, und es ging dann darum, Menschen, die dabei zu Tode gekommen waren, wieder zum Leben zu erwecken. Die bekamen dann ganz einfach ein Lebensmittel. Dieses Wort Lebensmittel hatte ich von den Erwachsenen schon des öfteren gehört. Ich kannte es und maß ihm die Bedeutung bei, die mir aus kindlicher Sicht am naheliegendsten erschien. Nach meinem Empfinden war ein Lebensmittel ein ganz besonderes Mittel, eben im wahrsten Sinne des Wortes ein Lebenstrank, der Tote wieder aufweckt. Für mich war das klar. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass das etwas ganz anderes, ganz Alltägliches, bedeuten könnte. Bis dann irgendeiner meiner Spielkameraden meinte, diese Mittel gäbe es in ganz normalen Läden zu kaufen. Jeder könnte sie kaufen. Lebensmittel wären ganz einfach die Dinge, die man essen und trinken kann um am Leben zu bleiben. Ich war enttäuscht. Ich fand diesen Begriff unpassend und irreführend. Aber was will man machen, wenn es eben so ist wie es ist.
Seid bereit! Immer bereit!
Mit sieben Jahren kam ich in die Schule. Um es gleich vorweg zu nehmen: Ich war ein guter Schüler und bin gerne in die Schule gegangen. Allerdings hatte ich vor Beginn der 1. Klasse Angst, zu versagen. Ich hatte gehört, dass wir Zensuren bekämen – von 1 bis 5 –, und dass die 5 nicht wie in der Sowjetunion die beste Zensur war, sondern die schlechteste. Was wäre, dachte ich, wenn ich immer nur Fünfen bekäme? Dieser Gedanke war angsteinflößend. Aber ich merkte sehr schnell, dass diese Sorge unbegründet war. Die Schule fiel mir eher leicht und ich zählte bald zu den besten Schülern der Klasse. Außerdem lernte ich auf der Musikschule Violine spielen und ging zum Schwimmen in die DHfK – das war die Deutsche Hochschule für Körperkultur. Meine Eltern hatten mich dort für einen Lernkurs im Vorschulalter angemeldet. Schon zwei Jahre später gehörte ich zur Leistungsklasse und holte bei Wettkämpfen viele Urkunden und Medaillen. Doch auch das ging nicht ohne Ängste. Ich brauchte Wochen, um mich zu überwinden, vom 3 Meter-Brett ins tiefe Wasser zu springen; malte Bilder, wo ich auf dem Sprungbrett stehe, mit der Unterschrift: Ich schpringe!
Ja, und das Violinespielen führte dazu, dass ich bei Elternabenden in der Schule für musikalische Untermalung sorgen durfte. Kurzum: Ich war talentiert und genoss alle Vorteile, die mein bürgerliches Elternhaus und der sozialistische Staat mir zu bieten hatten. Die Nachteile – da wie dort – traten erst später zutage. In der Schule waren sie anfangs noch nicht spürbar. Einfach deshalb, weil wir nichts anderes kannten. Es gab nur die Welt, in der wir lebten – die Welt des Sozialismus. Eine andere gab es nicht. Der Kapitalismus war veraltet, ein Relikt der Geschichte, und für uns indiskutabel. Wir wussten zwar, dass man drüben im Wohlstand lebte, dass man alles kaufen konnte, während bei uns Mangelwirtschaft herrschte und man nach Bananen und Apfelsinen anstehen musste, aber edle Ziele verlangten nun mal Opfer. Denn historisch gesehen oder gar ethisch war der Kapitalismus rückständig. Dass sich zum Beispiel die Produktionsmittel in Privatbesitz befinden oder dass wirtschaftliches Wachstum auf einer ständigen Profitsteigerung beruht, und damit auf einer immer größer werdenden Ausbeutung der Arbeitskraft, das konnte doch nicht fortschrittlich sein. Und das leuchtete auch jedem ein. Von daher glaubten wir, der Sozialismus würde den Kapitalismus irgendwann ablösen – wenn auch erst in ferner Zukunft. Aber zumindest glaubten wir daran. Also schleppten wir kiloweise Altpapier in die Schule oder in die SERO-Annahmestellen – SERO war die Abkürzung für Sekundärrohstoffe – weil wir einsahen, dass diese Rohstoffe sonst beim Aufbau des Sozialismus fehlten. Obendrein war es eine Möglichkeit, unser Taschengeld etwas aufzubessern. Nur wenn wir für die Kinder in Vietnam leere Flaschen sammelten, dann war das natürlich ehrenamtlich. Oder wir übernahmen die Patenschaft für ein Pflegeheim der Volkssolidarität. Im umgekehrten Fall hatten wir eine Patenbrigade in einem Betrieb, die uns im Rahmen des Schulfaches ESP Einblicke in den DDR-Betriebsalltag gewährte. ESP war die Abkürzung für Einführung in die sozialistische Produktion. Oder es gab Lernpatenschaften von leistungsstarken Schülern für leistungsschwache. Keiner durfte zurückbleiben, darauf wurde streng geachtet. Jeden Monat wurde ein Rechenschaftsbericht verfasst, in dem alle Ereignisse und Vorkommnisse enthalten waren, die unsere Klasse betrafen. Dazu gab es ein Gruppenbuch, selbstverständlich einen Schriftführer und mehrere Brigadeleiter, die unter anderem die Hausaufgaben kontrollierten und darauf achteten, dass das Hausaufgabenheft immer vorgetragen war. Es gab einen Milchdienst, der immer in der Milchpause die Milch holte, einen Kassierer, der für einen Monat im Voraus das Milchgeld kassierte, und es fand jede Woche ein Pioniernachmittag zu einem bestimmten Thema statt. Manchmal wurde auch ein Arbeiterveteran aus einem Patenbetrieb eingeladen, der etwas aus seinem Leben erzählte, oder ein Parteisekretär, der uns über die Parteiarbeit aufklärte. Zum 1. Mai bastelten wir immer rote oder weiße Nelken aus Krepppapier oder klebten Wandzeitungen. Und es gab zu jedem erdenklichen Anlass Fahnenappelle. Zum Beispiel, wenn Ernst Thälmann Geburtstag hatte, wenn Tag der Nationalen Volksarmee oder Republikgeburtstag war, oder irgendwelche schulischen Höhepunkte, Sportereignisse und dergleichen. Irgendwas war immer. Dann mussten wir mit Halstuch und Käppi auf dem Schulhof antreten – oder bei schlechtem Wetter in der Aula – und in Reih und Glied Aufstellung nehmen. Wenn Ordnung herrschte, wurde die Pionierfahne gehisst, ein Gelöbnis gesprochen und schließlich der Appell begonnen mit dem Gruß der jungen Pioniere. Meist trat ein ausgezeichneter Pionier hervor und rief: „Für Frieden und Sozialismus seid bereit!“ Darauf antworteten alle im Chor: „Immer bereit!“. Diese Zeremonie war für uns schon zum Ritual geworden. Es war uns so selbstverständlich wie das tägliche Auf- und Untergehen der Sonne. Und der blaue Himmel, das war für uns die Frösi, die Zeitung für die jungen Pioniere. Frösi war die Abkürzung für „Fröhlich sein und singen“. Darin wurde uns erklärt, welche Beeren oder Pilze man sammeln konnte und welche nicht, und dass es für die Forstwirtschaftsbetriebe wichtig war, dass wir Eicheln und Kastanien sammelten. Nämlich um die Erträge zu steigern und auf diese Weise mitzuhelfen, den Sozialismus aufzubauen. Die Forstwirtschaftler, und überhaupt die Arbeiter und Bauern, sollten sich auf die jungen Pioniere verlassen können. Schließlich war es unser großes Glück, dass wir in Frieden und Sozialismus aufwachsen durften, und Not und Hunger nicht am eignen Leib verspüren mussten. Aber der Kampf um den Frieden war noch längst nicht ausgefochten. Der Imperialismus drohte ständig damit, die Errungenschaften des Sozialismus zunichte zu machen, sprich: die DDR einzuverleiben und die alten Grenzen von 1937 wiederherzustellen. Dementsprechend war das Bild, das uns von Westdeutschland vermittelt wurde: Offiziell bestand es nur aus unterdrückten und ausgebeuteten Arbeitern, Lehrern mit Berufsverbot, Mietwucher oder Massenentlassungen. Und wenn die Wandzeitung über den armen Lehrer aus Westberlin, der Berufsverbot bekommen hatte, nicht rechtzeitig zum Termin fertig wurde, dann war das genau das, worauf der Klassenfeind wartete. Das würde die Gefahr eines Atomschlags geradezu heraufbeschwören. Deshalb gelobten wir immer wieder, unser ganzes Wissen und Können für die Verwirklichung der Ziele des Sozialismus einzusetzen. Seite an Seite mit dem Arbeiter an der Werkbank, dem Bauern in der LPG – der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft – oder dem Volkspolizisten.
Und so war der größte gesellschaftliche Höhepunkt die Jugendweihe. Jetzt waren wir Jugendliche und wurden in die große Gemeinschaft der Werktätigen aufgenommen. Ich weiß nicht mehr, wie oft wir in der Aula den Gang in Vierergruppen auf die Bühne probten, das Überreichen der Blumen und Urkunden. Alles wurde schon Wochen vorher geplant und durchgespielt. Wir gelobten, uns immer für die große Sache des Sozialismus einzusetzen, den Bruderbund mit der Sowjetunion zu vertiefen – denn es hieß immer Von der Sowjetunion lernen heißt Siegen lernen! – und im Geiste des proletarischen Internationalismus zu kämpfen. Die entscheidende Waffe in diesem Kampf war die marxistisch-leninistische Weltanschauung, zugleich das hervorstechendste Merkmal einer allseitig entwickelten sozialistischen Persönlichkeit. Denn Der Marxismus-Leninismus ist allmächtig, weil er wahr ist! So stand es in großen Lettern über der Tafel unseres Staatsbürgerkundekabinetts.
Ebenso gut hätte man hinschreiben können: