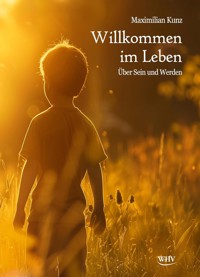
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Sich auf das konzentrieren, was im Leben wirklich zählt - wer will das nicht. Doch was genau soll das sein? Lebenskonzepte sind längst so individuell wie der eigene Fingerabdruck. Die jüngere Glücksforschung sagt, dass man Glück kaufen kann. Eine Studie beschäftigt sich gar mit der Korrelation zwischen der Penisgröße des Mannes und der PS-Zahl des gefahrenen Autos. Nein. Geld macht nicht glücklich und Reichtum Menschen zu keinen besseren. Ohnehin ist Glück etwas Kurzfristiges – erst Wohlbefinden jener kontinuierliche Zustand, der unsere Lebenszufriedenheit prägt. Wonach auch immer wir unser Lebenskonzept ausrichten: Nicht selten lässt unsere Gier uns übersehen, was wir schon alles haben. Der Vormarsch psychischer und seelischer Erkrankungen in der westlichen Welt belegt, wie oft wir nach einer falschen Form von Wohlstand streben. Wenn wir dann älter werden, wünschen wir uns Ausgeglichenheit und inneren Frieden. Weil das Leben aber endlich ist und die Zukunft nicht real, wird der nur scheinbar unendliche Moment der Gegenwart zu allem, was bleibt. So gehen wir durchs Leben – gewinnen in den schlimmsten Augenblicken Erkenntnisse und verlieren in den besten Zeit. Charakterstudie, Selbstfindungsratgeber, Seelenbuch: Willkommen im Leben besticht mit Wegweisern zu entscheidenden Lebensfragen, öffnet Handlungsoptionen und schafft mit Witz und Humor Bezug zu dem, was wirklich zählt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 350
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Maximilian Kunz
Vorwort
Einleitung
1. Almrausch
2. Paris und ein magischer Moment
3. Totale Verblendung
4. Rendezvous mit neuen Idolen
5. Gamechanger
6. Der unhörbare Ton
7. Verbindung im Schweinestall
8. Tabula Rasa
9. Gute Aussichten
10. Momentum
Maximilian Kunz
Willkommen
im Leben
Über Sein und Werden
Wolfgang Hager Verlag
Stolzalpe 2024
Maximilian Kunz
Willkommen im Leben
Über Sein und Werden
1.Auflage November 2024
© Maximilian Kunz
Wolfgang Hager Verlag
A-8852 Stolzalpe 70
www.wolfgang-hager-verlag.at
Umschlaggestaltung: Tobias Wölfler
ISBN 978-3-903443-33-4
Vorwort
Zwar bin ich der unbedeutenden Meinung, gute Geschichten erzählen zu können, meine Absicht beim Verfassen dieses Buches geht jedoch weit über die Intention der Unterhaltung hinaus.
Ich begleite darin einen Menschen und seine persönliche Entwicklung: Lebensabschnitte, Taten und Prozesse, Vergangenes und Kommendes, Außergewöhnliches wie Alltägliches - nicht immer besonders Spektakuläres. Eigentlich gar nicht so Außergewöhnliches und sogar viel mehr Alltägliches. An Bedeutung gewinnt all das erst durch die Rückschlüsse und Erkenntnisse, die ich daraus für ihn abzuleiten versuche. Diese haben mitunter Bezug zur eigenen Existenz, der Gesellschaft und unserer Rolle in ihr.
Wer nun fragt, was an gewöhnlichen und alltäglichen Erlebnissen, kombiniert mit meinen persönlichen Ableitungen daraus, so besonders sein soll und warum ich gar den Aufwand betreibe, ein ganzes Buch darüber zu schreiben, dem antworte ich: Weil all das einen Menschen formt, seine Gedanken und Handlungen prägt und letztlich seine individuelle Sicht auf die Welt ausmacht. Im Zentrum meiner Ausführungen soll der Prozess unserer dynamischen Entwicklung, die wir alle durchlaufen, stehen. Schließlich gehen wir anders von der Welt, als wir auf sie gekommen sind. Alles, was wir hier wahrnehmen und erleben, was wir durchlaufen, lässt uns gedeihen und wachsen.
Je mehr ich mich darin übe, mein eigenes Leben, meinen persönlichen Weg, der mitunter gepflastert mit für mich nicht immer leichten und teils äußerst emotionalen Begebenheiten war, besser zu verstehen, desto reicher ist die Fülle an Erkenntnissen, die ich daraus gewinne. Nicht immer sind diese angenehm, manchmal sogar schmerzhaft, so gut wie immer aber lehrreich - jedenfalls dann, wenn sie mir eine Erklärung dafür liefern, warum gewisse Dinge in meinem Leben so passieren, wie sie es eben tun. Und trotzdem: Ich würde diese gegen nichts auf der Welt eintauschen wollen, denn sie haben mich zu dem gemacht, was ich bin.
Dieses Buch ist also der Dynamik der Persönlichkeitsentwicklung gewidmet – aus der Sicht eines reflektierenden Laien. Es soll sie nachvollziehbarer, nachhaltiger und greifbarer machen – für mich und alle, die es lesen.
Im Sinne des Leseflusses habe ich mich übrigens dazu entschieden, auf ein durchgehendes Gendern zu verzichten und stattdessen an dieser Stelle ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass dieses Buch sich gleichermaßen an alle Menschen richtet – losgelöst von deren Geschlecht oder sexueller Orientierung.
Statt nun meine eigene Geschichte im Rahmen einer Autobiographie zu verfassen, habe ich mich bewusst für eine fiktive Erzählung entschieden. Dadurch möchte ich den erforderlichen Abstand sicherstellen, den ich für notwendig erachte, um mich sachlich jenen Fragen nähern zu können, die ich darin aufgreife. Die Gedanken, die ich mir bei dessen Entstehung gemacht habe, liefern mir Antworten, nach denen ich teils lange gesucht habe und durch die jedenfalls ich selbst intensiv wachsen konnte. So bin ich zur Überzeugung gekommen, dass dieses Buch auch anderen Hilfestellung bieten kann.
Durch kurzweilige Szenen, gepaart mit zunehmend tiefgehenden Anekdoten, tauche ich, Kapitel für Kapitel, tiefer in eine Geschichte ein, die Themen aufgreift, die uns alle auf die ein oder andere Art berühren. Immer wieder in die Perspektive des Erzählers wechselnd, liefere ich Gedankenanregungen, alternative Sichtweisen und Handlungsoptionen mit dem Ziel, zu einer besseren Einschätzung einer persönlichen Situation zu verhelfen oder die Notwendigkeit einer Veränderung zu erkennen. Das unweigerliche Resultat ist eine bewusstere Lebensführung durch ein erweitertes Infragestellen dessen, wer man ist und wer man sein möchte.
Wenn du in deinem Leben dazu tendierst, die Bodenhaftung zu verlieren und dich nach Erdung sehnst, wenn du in unserer oberflächlichen Gesellschaft den Tiefgang vermisst, wenn du dich voyeuristisch über soziale Medien am Leben Anderer ergötzt und literarische Abwechslung suchst - oder wenn du einfach nur auf der Suche nach Unterhaltung bist, dann bist du mir willkommen. Ganz besonders dann, wenn dein Weltbild, aus welchen Gründen immer, ins Wanken geraten ist oder ins Wanken geraten muss, weil du auf dem sogenannten Holzweg bist, so wie ich es häufig war, und du das entweder schon erkannt hast oder noch erkennen musst, ehe du dich selbst finden kannst.
Während ich dieses Buch geschrieben habe, wurde ich, wann immer ich davon erzählt habe, erschreckend oft gefragt, ob ich mich dabei künstlicher Intelligenz bedienen würde. Bücher wie dieses, die zutiefst Menschliches aufgreifen, sind den Aufwand immer wert, geschrieben zu werden - und zwar von Menschen für Menschen. Der menschliche Verstand ist etwas, das künstliche Intelligenz nicht ersetzen kann. Ihr fehlt sowohl die Seele als auch das Bauchgefühl. Der durch und durch menschliche Inhalt dieses Buches richtet sich also an alle, die sich wieder mehr als Mensch spüren und stolz darauf sein wollen.
Ich stelle den Anspruch, das Ernsthafte, das Tiefgehende mit dem Unterhaltsamen, dem Oberflächlichen und Banalen zu verknüpfen, weshalb ich versuche, die Geschichte so zu skizzieren, dass sie unsere Fantasie ebenso wie unseren Verstand anregt, uns also zum Nachdenken bringt. Das aber unbedingt mit einem Lächeln im Gesicht - weil das Nachdenken, wenn es erst in die Tiefe geht, rasch unbequem werden kann.
Sollte es mir gelingen, ein Stück weit dazu beizutragen, dass auch nur ein Mensch wieder Erdung erfährt, Halt und Vertrauen gewinnt oder das eigene Leben auch nur einen Deut intensiver wahrnehmen oder einordnen kann, dann habe ich mehr erreicht, als ich mir erträumt hätte.
Wenn du jetzt noch da bist, diese Zeile also noch liest, dann gehörst du nicht zu der überwiegenden Mehrheit, die – statistisch gesehen – ein Buch schon nach dem Kauf zur Seite legt, und mein Buch wahrscheinlich zu jenen, die dein Interesse insoweit geweckt haben, dass du bis hierhergekommen bist. Das freut mich sehr. Ich danke dir von Herzen und begrüße dich zu dieser Geschichte.
Einleitung
„Wer einmal sich selbst gefunden, kann nichts auf dieser Welt mehr verlieren.“ (Stefan Zweig)
Wir alle reisen durch unser Leben. Es beginnt mit unserer Geburt und endet mit unserem Tod. In der Zeit dazwischen erfahren wir eine Entwicklung. Es ist die Entwicklung unseres Körpers, unseres Geistes, unserer Werte, Ansichten und Meinungen, unseres Wesens und unserer Identität. Diese Lebensreise inhaltlich einzugrenzen ist nicht einfach, wenngleich es für jeden Einzelnen Grenzen gibt: Intellektuelle, zum Beispiel in Form unserer Gedanken, emotionale, etwa in Form unserer Gefühle, physische, beispielsweise hinsichtlich unseres Lebensraumes, darüber hinaus soziale, religiöse, spirituelle und viele mehr.
Die Reise, an die ich denke, wenn ich im Folgenden von Lebens- oder Entwicklungsreise spreche, beinhaltet diese und viele weitere Aspekte. Sie bezieht sich auf die Entwicklung, die jeder von uns auf dieser Welt im Laufe der Zeit vollzieht. Demnach haben die Geschichten in diesem Buch viele Inhalte: Kindheit, Familie, Freundschaft, Liebe, Selbstfindung, Glück, Tod und manche mehr, die ich unter dem Begriff Leben zusammenfassen möchte.
Laut gängigem Verständnis umfasst das Leben die Sammlung aller Erfahrungen eines Individuums beziehungsweise verstehen wir darunter eine Prozessform, die alle Lebewesen gemein haben und die uns von toter Materie unterscheidet. Soweit die sachliche und durchaus nüchtern ausfallende Definition.
Hört man Philosophen darüber sinnieren, so geht deren Ansatz für gewöhnlich in eine alternative Richtung. Bei ihnen steht nicht die Frage im Vordergrund, was eine Lebensform erfüllen muss, um als Mensch zu gelten, sondern, welche Optionen innerhalb der Lebensform Mensch grundsätzlich bestehen. Ergo gehören dazu nicht nur Fähigkeiten wie Laufen, Sehen oder Sprechen, sondern auch Handlungen wie das Gründen einer Familie, das Ausüben von Sport, das Lieben, Reisen oder das Beginnen eines Krieges. All das sind Optionen, die im Verlauf unserer Kulturgeschichte Teil unserer Lebensform geworden sind. Damit steht nicht mehr die Frage, was den Menschen als Menschen definiert, zentral, sondern im Prinzip die Breite an Handlungsoptionen, die uns innerhalb der uns gegebenen Lebenszeit zur Verfügung steht. So ergibt sich eine schier unendliche Farbpalette an möglichen Lebensinhalten und Ausrichtungen. Beginnen wir diese zu evaluieren – was wir zwangsläufig tun, sobald wir Entscheidungen treffen, etwa um deren Konsequenzen abzuwägen, so kommen Emotionen, also Gefühle, die uns beim Treffen von Entscheidungen beeinflussen, hinzu.
Emotionen, unsere Gefühle und Empfindungen, sind die vielzitierte Würze des Lebens. Darüber, und was es letztlich ausmacht, kursieren unzählige Weisheiten in sämtlichen Kulturen und Religionen – und das längst nicht mehr nur von Philosophen. Wir alle kennen Geschichten wie die von dem Lehrer mit dem Krug. Darin möchte ein Lehrer seinen Schülern eine Lektion über und für das Leben mitgeben. Um ihnen seine Essenz auch bildlich zu vermitteln, stellt er einen Glaskrug vor seiner Schulklasse auf einen Tisch. Der Krug ist leer und die Schüler warten gespannt, was er damit tun würde. Er holt hinter dem Tisch einen Sack mit Golfbällen hervor und füllt den Krug so lange damit, bis keiner mehr hineinpasst. Dann fragt er die Anwesenden, ob sie den Krug für voll hielten. „Ja“, so die einhellige Antwort. Dann holt er einen weiteren Sack, gefüllt mit Kieselsteinen, und befüllt den Krug so lange, bis auch die Zwischenräume damit ausgefüllt sind. Er wiederholt seine Frage - und wieder sind sich die Anwesenden einig, dass der Krug voll sei. Schließlich holt er einen zweiten Krug, gefüllt mit Sand, hinter dem Tisch hervor und leert so viel davon in den ersten Krug, bis alle Zwischenräume sich füllen und der Krug randvoll ist. Ein letztes Mal wiederholt er seine Frage. Einigkeit. Der Krug ist nun vollends gefüllt.
„Der Krug ist ein Abbild unseres Lebens“, so der Lehrer. Die Golfbälle stehen dabei für die essenziellen Dinge: Familie, Freunde, Leidenschaften, die Kieselsteine für alle anderen Dinge, die auch wichtig sind: das Zuhause, der Job, das Auto. Der Sand repräsentiert alles, was übrigbleibt. Das Kleinzeug eben. Wenn man allerdings zuerst den Sand in den Krug füllt, so bleibt kein Platz für den Kies und die Golfbälle. Ähnlich ist es im Leben. Wenn wir unsere ganze Energie für das Kleinzeug aufwenden, bleibt uns nichts mehr für die wirklich wichtigen Dinge. „Schaut daher“, so legt der Lehrer den Schülern nahe, „besonders auf jene Dinge, die dafür verantwortlich sind, dass ihr glücklich seid. Die Golfbälle. Setzt Prioritäten. Denn alles andere ist nur Sand“, schließt er.
Das Setzen von Prioritäten spielt eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, ein ausgeglichenes Leben zu führen. Freude, Glückseligkeit und Euphorie sind, genauso wie Zweifel, Herausforderungen und Ängste, Emotionen, die mit unseren Prioritäten verknüpft sind. Manchmal kann auch die Emotion selbst zur Priorität werden.
Während der Reise durch unser Leben ändern sich unsere Prioritäten und Sichtweisen zu so vielen Dingen. Je nach Umwelt und Lebensphase haben wir unterschiedliche Wertvorstellungen und Ideale. Entscheidend ist für mich zunächst die Erkenntnis selbst, dass diese sich ändern, also keine Konstante sind - auch dann nicht, wenn wir in der ein oder anderen Lebensphase noch so fest im Sattel zu sitzen glauben: Die Zeit relativiert alles. Junge Menschen sind resistenter gegen diesen Prozess als ältere. Wenn wir jung sind, machen wir uns kaum Gedanken über das Älterwerden – und wenn doch, sind diese meist mit zweifelhaften Annahmen verbunden. Für junge Menschen liegt das Alter in scheinbar weiter Ferne. Bei mir war es jedenfalls so.
Die Gründe für diese Änderungen in uns und um uns herum sind vielseitig. Äußere Rahmenbedingungen ändern sich ebenso wie die Fülle unserer Erfahrungen. Je älter wir werden, desto mehr sammeln wir - auch im Umgang mit uns selbst. Und aus Erfahrung lernen wir - auch über uns selbst.
Je nach äußeren Einflüssen, unserem Erfahrungsschatz und individuellen Erwartungen an die Zukunft sowie ein paar anderen Faktoren bilden wir dann unsere Meinungen, definieren unsere Werte und suchen unsere Ideale.
Bei manchen bleiben diese Meinungen, Werte und Ideale ein ganzes Leben lang unverändert – unreflektiert und starr. Bei den meisten von uns ist es anders: Was uns nämlich heute wichtig erscheint, kann morgen schon am Rande der Bedeutungslosigkeit sein – und umgekehrt.
Manchmal können wir solche Veränderungen in unserem Wertekonstrukt mit einschneidenden Erlebnissen verknüpfen, manchmal nicht. Dann ist es das Voranschreiten der Zeit beziehungsweise unsere körperliche und geistige Entwicklung, die in unserem Unterbewusstsein unaufhaltsam stattfindet. Sekunde für Sekunde und Tag für Tag. Und das nicht ohne Einfluss auf unseren Verstand. Und so wachen wir vielleicht eines Tages auf und sehen manches ganz anders als vorher. Vielleicht auch nur ein wenig anders. Was vorher schwarz war, muss nachher nicht unbedingt weiß sein. Es reicht schon, wenn aus Schwarz ein Braun wird. Und das ist gut so. Es ist unsere Entwicklung.
Entwicklung ist Stillstand jedenfalls vorzuziehen. Es sei denn, wir wären als Menschheit bereits perfekt – so es einen solchen Zustand überhaupt geben kann. Dass es ohnehin keinen Stillstand gibt, weil alles fließt, meinte schon der griechische Philosoph Heraklit, als er sagte, dass niemand zweimal in denselben Fluss steigen kann, weil eben alles fließt und nichts bleibt. Welchen Einfluss Erfahrungen und äußere Faktoren auf unsere Ansichten, Werte und Ideale haben und wie sie diese verändern, veranschaulicht folgende Geschichte:
Der Bleistift und ich
Ein Bleistift ist nur dann ein guter Stift, wenn er von Zeit zu Zeit geschärft wird. Hätte er Gefühle, so wäre das Spitzen der Mine für ihn äußerst schmerzvoll. Und doch braucht es genau diesen schmerzvollen Prozess, um den Bleistift zu einem guten und sinnvollen Instrument zu machen.
Im Leben ist das ähnlich. Wir alle machen schmerzvolle Erfahrungen. Doch letztlich sind es genau diese, die unsere Persönlichkeit formen und uns wachsen lassen. Fehler gehören dazu. Wir alle machen sie. Manche davon können wir wieder gutmachen - sozusagen mit dem Radiergummi am Kopf des Bleistifts. Andere nicht. Was aber viel wichtiger ist: Eigentlich gibt es keine Fehler, denn in dem Moment, wo wir etwas als Fehler bezeichnen, haben wir bereits daraus gelernt - gelernt, beim nächsten Mal etwas besser machen zu wollen. Der Fehler wird damit zur Lektion. Genau wie der Bleistift, hinterlassen wir überall unsere ganz persönlichen Spuren. Wir schreiben unsere eigene Geschichte. Und jedes Mal, wenn wir geschunden werden, wachsen wir. Genauso wie die Mine des Bleistifts jedes Mal geschärft wird, wenn sie einmal abstumpft - und das Wichtigste, egal ob Stift oder Mensch, kommt dabei immer von innen.
Im Inneren liegen unsere Meinungen, Werte und Ideale – und folglich unsere innere Überzeugung, etwas zu tun oder zu unterlassen. Sie ist unser stärkster Antrieb. Aus ihr leiten wir auch unsere Handlungen ab, was sie zu unserer wichtigsten Motivation für unser Verhalten macht.
Der britisch-amerikanische Unternehmensberater und Autor Simon Sinek trifft es mit seinem Bestseller „Frag immer erst: Warum“1 auf den Punkt, wenn er sagt, dass jedes Unternehmen zwar erklären kann, was es macht. Die meisten können auch gut darlegen, wie sie etwas tun. Doch nur die wenigsten wissen wirklich, warum. Und nein, das Erzielen von Profit ist keine zulässige Antwort. Profit sei nur die logische Konsequenz des intrinsischen Antriebs, des tatsächlichen Warum, wegen dem man in der Lage ist, etwas überdurchschnittlich gut machen zu können und man sich deshalb auch langfristig wahrscheinlich am Markt behaupten wird.
Ein Beispiel zur Veranschaulichung: Den meisten von uns wird das Essen in einem Restaurant dann positiv in Erinnerung bleiben, wenn der dort beschäftigte Koch aus der tiefsten Überzeugung heraus werkt, die besten Gerichte kreieren und zubereiten zu wollen, mit dem Ziel, seinen Gästen damit ein besonderes Erlebnis zu kredenzen. Gleich gegenüber ist ein weiteres Restaurant. Hier ist man nur auf das schnelle Geschäft aus. Der Koch arbeitet primär, um seine Rechnungen zahlen zu können, der Eigentümer nur, um möglichst rasch Profit zu machen. Nur logisch, dass er den billigsten Koch suchen wird, der wiederum mit geringstem Aufwand danach trachten wird, den Mindestanspruch der Restaurantgäste zu erfüllen. Wenn überhaupt. Ähnlich ist es, wenn das Restaurant gar nicht die Intention hat, gutes Essen zu servieren, sondern etwa Geldwäsche zu betreiben oder als Abschreibposten zu fungieren. Welches Restaurant sich mittelfristig behaupten wird, liegt auf der Hand. Rezensionen, Image und folglich die Buchungsauslastung im erstgenannten werden sich nachhaltig positiv entwickeln, während letzteres früher oder später etwas ändern wird müssen – oder eben zusperren wird.
Sinek meint darüber hinaus, dass Menschen heute vielerorts nicht mehr kaufen, was man tut, sondern warum man es tut – Menschen also bereit sind, für die innere Überzeugung und Motivation eines Dienstleisters oder Herstellers eines Produktes einen Preisaufschlag zu zahlen. Sie tun das mitunter, weil im Falle der Identifikation des Käufers mit der Geisteshalteng des Verkäufers ein größeres Vertrauen zum gemeinsamen Wertekonstrukt zustande kommt. Denken wir an einen Bio-Supermarkt. Hier sind die Produkte nicht zwangsläufig geschmacklich besser und optisch meist weniger ansprechend, jedenfalls aber teurer. Auch gibt es solche Märkte nicht an jeder Ecke, man muss also mehr Aufwand betreiben, um überhaupt hinzukommen. Trotzdem kaufen Menschen dort ein, weil das Warum des Bio-Supermarkts für sie das Überzeugende ist – nicht das Produkt selbst.
Entscheidend ist, dass Menschen wie Unternehmen dann ein deutlich stärkeres Durchhaltevermögen haben, wenn sie ihr Warum, ihre intrinsische Motivation dahinter, kennen. Dann werden sie sich leichter in der Gesellschaft durchsetzen und in ihr behaupten.
Würden wir beide Köche der genannten Restaurants kennen, aber bei keinem der beiden je gegessen haben, wohin würden wir wahrscheinlich zuerst gehen? Genau. Wer ein Warum im Leben hat, der erträgt fast jedes Wie, meinte schon Friedrich Nietzsche.
Die Frage nach meinem Warum hat meine Haltung zu so vielen Dingen grundlegend verändert – deshalb, weil Simon Sinek mich dazu inspiriert hatte, zu beginnen, über mein persönliches Warum zu so vielen meiner Haltungen im Leben nachzudenken.
Wie ich mich früher auch, sehnen sich viele Menschen nach einem Leben, das sie ganz offensichtlich nicht führen. Das wird etwa bei der scheinbar omnipräsenten Freude auf das Wochenende oder der weitverbreiteten Abneigung gegenüber Montagen deutlich. Dabei sind Montage gar nicht schlechter als andere Tage. Nicht sie geben uns das Gefühl, unsere Tage und Energie zu verschwenden. Es sind einzig unsere Lebensumstände und die Sicherheit der Gewohnheit, die wir nicht bereit sind aufzugeben. Anstatt nun aber unser Leben zu ändern, bevorzugen viele von uns die sichere Unzufriedenheit. Vertrautes ist schließlich auch dann Vertrautes, wenn es einen unzufrieden macht. Widerspricht unser aktuelles Leben unserer Idee vom Leben, etwa, weil wir im Job unglücklich sind, dann beginnen wir, Montage abzulehnen und Wochenenden zu bevorzugen. Die Konsequenz ist ein konsequenter Kompromiss. Wer nun fragt was übrig bliebe, wenn man die Sicherheit, die einen doch nur lähmt, verließe, dem sei gesagt: der Rest seines Lebens.
Wenn jeder von uns immer das eigene, das wahre Warum kennen würde, wäre unsere Welt nicht mehr dieselbe. Dem ist nicht so. Verantwortlich dafür sind aber nicht immer nur die von uns eingegangenen Kompromisse. Denken wir etwa an ein Dutzend Philosophie-Studenten im ersten Semester und konfrontieren wir sie mit der Frage, warum sie sich für ein Philosophiestudium entschieden haben, so werden wir unterschiedlichste Antworten darauf bekommen. Dieselben zwölf Menschen dreißig Jahre später noch einmal mit derselben Frage konfrontiert, wird wahrscheinlich ein anderes Ergebnis liefern. Es gibt also ein Delta zwischen den beiden Antworten auf die gleiche Frage beim identen Personenkreis. Verantwortlich dafür sind die dreißig Jahre Lebenserfahrung dazwischen. Ich selbst habe mich für eine wirtschaftliche Studienrichtung entschieden. Warum? Darauf antwortete ich vor fünfundzwanzig Jahren gänzlich anders, als ich es heute tue. Weil ich damals schlichtweg keinen Schimmer von meinem eigentlichen Warum für diese Studienrichtung hatte. Zwar gab es eines, das war allerdings brüchig, basierte mehr auf oberflächlichen Vorstellungen eines frischgebackenen und naiven Maturanten, denn auf ernstzunehmenden Überlegungen eines zielstrebigen Akademikers in spe. Heute gilt mein Interesse der Psychologie – doch nein: Ich habe keine psychologische Ausbildung.
Hätten wir die Gelegenheit, einzelne Kapitel in unserer Geschichte noch einmal beginnen zu können, so würden wahrscheinlich viele von uns manches anders machen - aus den unterschiedlichsten Gründen, mitunter, weil sich ihre Antwort auf das Warum zu gewissen Fragen im Laufe ihres Lebens - und basierend auf dem damit verbundenen Erfahrungsschatz - verändert hat. Selbst, wenn manche gleich alles noch einmal von vorne machen wollten, muss das noch nichts mit Reue zu tun haben. Nur weil man nichts bereut, heißt das nicht, dass man nicht gewisse Dinge anders machen würde, bekäme man die Gelegenheit dazu. Entscheidend ist nicht, dass man etwas anders machen würde und ob Reue dabei eine Rolle spielt, sondern, dass man es im Laufe seines Lebens erkennt und sich das auch eingestehen kann. Das ist keine Selbstverständlichkeit!
Ich selbst würde, abgesehen von meinem Studium, manches in meinem Leben anders machen, wenn ich die Möglichkeit hätte, in der Zeit zurückzureisen. Nicht, weil ich etwas bereue, sondern weil ich erkannt habe, dass meine Entwicklung hätte schneller erfolgen können. Es wären keine gravierenden Dinge, eher Entscheidungen, die mich später zur Erkenntnis geführt haben, dass mein Potenzial schon früher zur vollen Geltung hätte kommen können, wäre ich in einem anderen Umfeld gewesen. Doch das ist eben mein Weg. Wie bei den meisten von uns waren auch bei mir einzelne Phasen dieses bisherigen Weges für mich schwierig. Weil ich nicht genau erkennen konnte, warum, habe ich Hilfe in Anspruch genommen. Ausgehend von einer Familienaufstellung absolvierte ich unter anderem eine Gesprächstherapie und eine Energietherapie. Durch diese und andere Prozesse kam ich zu für mich schlüssigen Antworten:
1. Falle der Bequemlichkeit
Es heißt, das Leben beginne an dem Punkt, an dem man seine Komfortzone verlässt. Die Komfortzone wird damit zum Synonym für Bequemlichkeit. Denken wir an die bunte und artenreiche Tierwelt. Wahrscheinlich ist ausgerechnet der pelzige und gemütlich anmutende Koalabär für viele von uns das bequemste Tier auf Erden. Kaum fünf Stunden am Tag wach, verbringt er die meiste Zeit auf ein und demselben Baum, wo er letztlich nichts weiter tut als Fressen und Schlafen. Doch der Schein trügt, denn Koalas schränken ihre Beweglichkeit bewusst ein, um weniger Energie zu verbrauchen und ihren Kalorienbedarf zu drücken. Damit dient das eigene Faulsein dem Koala zum Überleben. Wir Menschen sind, ähnlich den Koalas, auf Bequemlichkeit programmiert. Im Gegensatz zu den Bären aus Australien gibt es für die Faulheit bei uns Menschen aber keinerlei Rechtfertigung. Trotzdem versuchen wir, unsere Ziele mit möglichst wenig Aufwand zu erreichen, ja manchmal sogar, diese nicht höher als nötig anzusetzen. Und nein, was ich meine, hat nichts mit Effizienz zu tun. Neues, uns bislang Unbekanntes, zu starten, ist für uns oft eine besondere Überwindung. Wir sind Gewohnheitstiere. Das veranschaulichen etwa die klassischen Neujahrsvorsätze: weniger Essen oder mehr Bewegung. Erst einmal zu etwas überwunden, versuchen wir, es in unsere tägliche Routine einzubauen. Wie wichtig das ist, veranschaulicht Folgendes: Wenn wir im Fitness-Studio mehrere Stunden trainieren, und uns anschließend vor den Spiegel stellen, werden wir von der wahrscheinlich erhofften Veränderung nichts sehen. Vielleicht fühlen wir uns kurzfristig besser, die angestrebte optische Veränderung wird jedoch ausbleiben - der Bauch wird immer noch da sein, die Muskeln immer noch nicht. Wenn wir das am nächsten Tag wiederholen, wird das am Ergebnis auch nichts ändern. Wir haben zwei Optionen: Entweder wir lassen es wieder, weil wir kein Ergebnis sehen und uns denken, das würde nichts bringen, oder wir machen weiter. Letzteres tun wir aber nur dann, wenn wir der inneren Überzeugung sind, dass diese Anstrengung sich für uns auszahlen wird. Dann betreiben wir sie konsistent weiter. In diesem Fall tut es nichts zur Sache, wenn wir einmal eine Torte essen oder zwei Tage keinen Sport machen. An einem Tag großen Aufwand zu betreiben, bringt uns nicht in Form. Jeden Tag eine viertel Stunde jedoch schon. Nicht die Intensität ist entscheidend, sondern die Routine. Wir streben dabei jedenfalls nach einer positiven Veränderung, die – wenn wir davon überzeugt sind, sie auch wirklich herbeiführen zu wollen, leicht gelingen wird – weil wir unser Warum kennen.
Der internationale Trainer, Coach und Autor Dieter Lange bezeichnet die Bequemlichkeit gar als härtesten Klebstoff der Welt, weil uns nichts so sehr bindet wie sie. Und dafür zahlen wir einen hohen Preis, denn Gewohnheit ist der Wartesaal des Lebens, das letztlich erst dort beginnt, wo man vorher noch nicht war. „Die Lust nach Bequemlichkeit“, so Lange, „mordet die Leidenschaft der Seele“. Laut ihm gibt es nur zwei Ereignisse, die uns blitzschnell aus diesem Muster katapultieren können: Liebe, die uns – als vorübergehender Tod des Egos – angstfrei macht, oder ein Schicksalsschlag, wobei Sal, von Los stammend, etwas Heiliges ist, man also, im übertragenen Sinn, zum Heil geschickt wird. Ein Gesunder hat viele Wünsche, ein Kranker nur einen. Und Lange fährt fort: „Zahme Vögel singen von der Freiheit, die wilden fliegen“. Auf der einen sind die „man könnte, wollte, sollte mal …“, auf der anderen die, die es tun. Auf der einen Unternehmer und Pioniere, auf der anderen Unterlasser und jene, die ständig fragen: „Wo kämen wir denn da hin?“. Die von Lange gestellte Gegenfrage schießt den Vogel ab, denn sie lautet: Wo kämen wir denn da wirklich hin, wenn alle nur Herumlamentieren und keiner wirklich gehen würde, um zu schauen, wohin wir da wirklich kämen? Die Welt gemacht haben jedenfalls die Macher, nicht die Unterlasser. Großartig, nicht?
Dumm nur, dass ich kein Macher war. Zwar hatte ich es mir eine Zeit lang eingeredet, doch letztlich fehlte mein klares Warum und meine innere Über-zeugung als wichtigster Antrieb. Die Gefahr der Bequemlichkeit ist allgegenwärtig – und ich ging ihr voll auf den Leim.
Haben wir sie erst einmal erkannt, gilt es, sie zu überwinden. Rezepte dafür gibt es unzählige. Die Tugend lautet, für sich selbst das Passende zu finden und es in seinen Lebensalltag zu implementieren.
In meinem Fall war der Schlüssel Inspiration zu intensiverer Reflexion. Ich musste gewisse Dinge ändern, weil ich anstand.
So habe ich begonnen zu lesen und mich mit Menschen und Themen zu beschäftigen, die mich vorher nicht interessierten.
Irgendwann kam dann von selbst das Verlangen, durch die dicke und fest verschlossene Türe am Rande meines sprichwörtlichen Tellers zu schauen. Entgegen all meiner, bis dahin scheinbar plausiblen, Erklärungen dafür, diese Türe möglichst nicht öffnen zu wollen, wollte ich es plötzlich doch. Und was ich zu sehen bekommen habe, hat weit mehr bewirkt, als ich jemals gedacht hätte. Mein anfänglich kurzer Blick durch diese Türe wurde für mich zum Aha-Erlebnis – und ich bekam Appetit auf mehr.
Bis dahin hatte ich die Grenzen meiner Komfortzone mit allen Mitteln verteidigt - und zwar von innen. Hoffnungslos verloren war ich deshalb aber nicht - muss mich also nicht den Rest meines Lebens als jemand abgestempelt fühlen, der mit minimalem Aufwand seine gegebene Zeit auf diesem Planeten verlebt - unmotiviert und bedeutungslos. Doch selbst wenn dem so wäre: Auch dieser Zugang hat seine Existenzberechtigung.
2. Suche nach Schuldigen
Durch mein Leben hat sich ein Gedankenmuster wie ein roter Faden gezogen. Viele kennen es, es ist weit verbreitet, bleibt meist lange unerkannt und wird in seiner Auswirkung häufig unterschätzt. Es ist das Gedankenmuster, das einem sagt, dass die Schuld für alles und jedes, also auch das eigene Scheitern, andere tragen. Als ich erkannte, dass ich stets versuchte, die Verantwortung für mein Leben an andere abzugeben, indem ich etwa hoffte, dass diese mein Potenzial erkennen und dann alles den von mir erhofften Verlauf nehmen würde, wurde mir klar, dass ich etwas ändern muss.
Mindestens zwei Geisteshaltungen waren bei mir für die Manifestation dieses Gedankenmusters verantwortlich. Zum einen bin ich davon ausgegangen, selbst immer alles richtig zu machen, zum zweiten habe ich immer und überall nach Anerkennung gesucht. Wer nun fragt, ob ich das bereue: Nein, denn schließlich habe ich es erkannt, für mich zur Lektion gemacht und meine Geisteshaltung adaptiert.
3. Die Krux mit der Angst
Lange habe ich mich gefragt, warum gerade ich der Bequemlichkeit so sehr auf den Leim gegangen war. Wie konnte es passieren, dass ausgerechnet ich, der es früher so gut verstand, mit Begriffen wie Fortschritt oder dem Puls der Zeit zu jonglieren, als Pseudokoala auf einem Baum verweilte, während sich das Leben am anderen Ende des Waldes abspielte - und dann, warum gerade ich die Schuld dafür, und alles andere auch, immer anderswo suchte, nur nie bei mir selbst.
Der Weg zur Antwort hat in meinem Fall gedauert – doch ich wurde fündig: Angst. Konkret die Angst vor der Verantwortung, etwas falsch zu machen und die Angst davor, nicht die Anerkennung zu bekommen, die ich mir für etwas erwarte. Hätte ich mein Problem der Bequemlichkeit erkannt und die Schuld daran bei mir gesehen, hätte ich handeln müssen – und das war damals außerhalb der mir ersichtlichen Bandbreite an Optionen.
Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Besonders dann, wenn gehandelt werden muss und Entscheidungen zu treffen sind. Dann wird sie nämlich zum Hinweis für ein wahrscheinliches Scheitern. Zwingt man Menschen, aus inneren Zwangslagen heraus Entscheidungen zu treffen und handeln zu müssen, droht irrationales Verhalten. Die Angst, und ihr Einfluss auf unsere Entwicklung, ist weitaus stärker, als wir glauben: Stellen wir uns vor, wir halten ein Glas mit unserem Lieblingsgetränk in einer Hand. Das hat kaum Gewicht, egal, was wir uns eingeschenkt haben. Im nächsten Schritt stellen wir uns vor, wir halten dieses Glas für die nächsten zwanzig Minuten in der ausgestreckten Hand waagrecht zum Boden. Plötzlich beginnt es in uns zu arbeiten. Erst gedanklich, dann körperlich. Wir müssen uns anstrengen. Irgendwann beginnt die Hand vielleicht zu zittern oder wir erleiden einen Krampf, je nachdem, wie gut wir in Form sind. Früher oder später werden wir müde, beginnen zu schwitzen. Unsere Schultern und unser Rücken werden bald weh tun. Je nach Alter und Verfassung scheitern wir vielleicht und senken die Hand schon vor Ablauf der zwanzig Minuten. Worum es geht, ist nicht, dass das Glas leicht ist, sondern, dass wir die Hand, in der wir es halten, nicht senken. Ähnlich ist es mit der Angst. Irrelevant, ob das, wovor wir Angst haben, eine große oder eine kleine Sache ist, ob es um viel geht oder wenig: Solange wir an der Angst festhalten, wird sie unser Leben beeinflussen.
In meinem Fall waren die Konsequenzen weitreichend. Auch, weil es tatsächlich nicht um Größe oder Gewicht des Glases geht, sondern um unsere Beharrlichkeit – meine Beharrlichkeit, es hochzuhalten. Und je länger wir das tun, desto mehr Angst müssen wir ertragen und desto mehr Aufwand betreiben.
Die Lösung des Problems mit der Angst ist, sie abzulegen. Klingt einfach, ist es aber nicht. Selbstreflexion, also unsere Analyse von Lebensumfeld und Lebensumständen, eignet sich als Präventivmaßnahme. Je eher wir sie in unseren Alltag implementieren, je eher werden wir die vorhandenen Ängste erkennen.
Trotz der Tatsache, dass ich in die Bequemlichkeitsfalle getappt, die Schuld immer bei anderen gesucht und ungeahnt weitreichende Ängste gehabt habe, hat es das Schicksal gut mit mir gemeint: Zum einen, weil es mich bislang vor besonders einschneidenden Erlebnissen verschont hatte. Zumindest vor solchen, die in kurzer Zeit weitreichende Veränderungen in meinem Wertekonstrukt beziehungsweise meiner Geisteshaltung verursachen würden. Auch ohne einschneidende Erfahrungen erlebt zu haben, kenne ich, wie wir alle, Berichte jener Menschen, die uns in Wissen, Erfahrung und Umgang mit derartigen Ereignissen voraus sind. Alle diese Berichte haben eines gemeinsam: Es ist die Kernaussage, dass unser Umgang damit das Entscheidende ist. Jedenfalls dann, wenn Aufgeben keine Option ist. Und wie wir damit umgehen, entscheiden allein wir selbst. Dass ich bislang von solchen Ereignissen verschont wurde, bedeutet aber nicht, dass ich mein Leben ausschließlich auf der Sonnenseite verbringe. In meinem Fall haben die Schattenseiten nur ein anderes Gesicht - ein weniger grässliches vielleicht. Schön ist es deshalb aber noch lange nicht. Ich denke etwa an Lebensabschnitte, in denen bei mir etwas aus dem Ruder gelaufen ist. Vielleicht aufgrund falscher Ideale, vielleicht wegen des Verlustes von Kontrolle, vielleicht auch nur, weil ich die Konfrontation mit der Realität scheute und mich lieber in eine Phantasiewelt flüchtete, ähnlich der kleinen Amélie Poulain in ihrer fabelhaften Welt2, die so fröhlich verspielt, geziert mit einem Duft aus träumerischer Leichtigkeit und einem nicht wegzudenkenden Hauch von Melancholie, dazu einlädt, sich in ihr zu verlieren.
Zum anderen, weil ich nicht länger als menschlicher Koalabär auf einem Baum sitzen muss und die mir gegebene Zeit verlebe, unmotiviert und bedeutungslos, während sich das Leben am anderen Ende des Waldes abspielt. Nein!
Mir hat das Schicksal auf unerwartete Weise gezeigt, wie unendlich weit das Leben über den eigenen, selbstgesetzten Tellerrand hinausgehen kann. Im Boxsport heißt es, der Schlag, der am meisten trifft, ist nicht der härteste, sondern der, der unerwartet kommt.
Schuld daran, dass manche Lebensabschnitte für mich weniger schön waren, wie sie es vielleicht hätten sein können, war allein ich selbst. Primär, weil ich unzufrieden war. Unzufrieden, weil das, was sich mir in der Realität darbot, nicht immer dem entsprach, was für mich, der ich damals hoffnungslos in Amelies träumerischen Welt verloren war, passte. Der Weg, bis ich schließlich erkannte, dass die Differenz zwischen meiner selbst zurechtgestrickten Realität und der tatsächlichen Realität auf mein eigenes Versagen, meine Bequemlichkeit, zurückzuführen ist, war kein leichter.
Heute bin ich unendlich dankbar dafür, diese Entwicklung, diese Transformation, bewusst wahrnehmen zu dürfen. Sie hat dazu beigetragen, dass ich nunmehr ein leichteres, weil authentischeres und folglich glücklicheres, Leben führen darf. Glück?
Seit der Antike beschäftigt uns diese Frage, die bis heute allgegenwärtig ist. Wir leben in einer Zeit, in der Narrative zu großen Themen wie Politik, Freiheit, Gerechtigkeit oder eben auch Glück keine geteilten Narrative mehr sind. Heute haben Menschen eine zunehmend individuelle Auffassung darüber, was Freiheit, Gerechtigkeit oder auch Glück für sie bedeutet.
Zu dieser Entwicklung stark beigetragen haben soziale Medien, die den Medien- und Informationskonsum eines jeden Einzelnen beeinflussen. Soziale Netzwerke, Weblogs, Microblogs, Wikis sowie Foto- und Videoplattformen zeigen uns, was uns interessiert. Aufwendige und von den Betreibern oft streng geheim gehaltene Algorithmen sorgen dafür, dass wir immer auf den Bildschirm bekommen, was unsere Aufmerksamkeit ebendort hält. Seit Web 2.0 – also dem Internet, das jeder mitgestalten kann, dienen soziale Medien auch der profilbasierten Vernetzung seiner Nutzer. Kurz gesagt: Gleichgesinnte werden zusammengebracht. Und so entstehen die absurdesten Gruppierungen. Bis vor wenigen Jahren war es noch eine bewiesene und allgemein gültige Aussage, dass die Erde die Form einer Kugel hat. Heute beherbergt das Internet ganze Strömungen an Menschen, die, aus welchen Gründen immer, meinen, dass das nicht so sei - gemäß dem Prinzip der selektiven Wahrnehmung, das uns immer nach Bestätigung für das von uns Geglaubte suchen lässt, bestärken wir uns dann gegenseitig in unserem Glauben.
Glück ist genauso subjektiv geworden und bedeutet längst für jeden etwas anderes. Laut Statista wird die Wellnessindustrie bis 2025 rund sieben Billionen US-Dollar, also 7.000 Milliarden US-Dollar, umfassen. Glück, und unser Streben danach, wird damit zu einem immer größeren Geschäft.
Ein Tag in einem Wellnesstempel muss aber nicht bei jedem von uns Glücksgefühle auslösen. Trotzdem ist das rasante Wachsen dieser Industrie ein klares Indiz dafür, dass wir zunehmend in unser Wohl und unsere Zufriedenheit, und damit einen Zustand innerer Ausgeglichenheit, investieren. Wenn wir uns zufrieden fühlen, sind wir mit den äußerlichen Gegebenheiten einverstanden, fühlen uns wohl und leben ein Leben, das uns erfüllt. Es ist ein unterschwelliges und wärmendes Gefühl, das sich dann durch unseren Alltag zieht. Und je weniger Energie wir zur Bewältigung unseres Alltags aufwenden müssen, umso mehr bleibt uns für unsere Entwicklung, unsere Ziele und unser Vorankommen.
Zahlreiche Glücksforscher wie Psychologen meinen, dass soziale Beziehungen, egal ob familiär, freundschaftlich oder zwischenmenschlich, einer der wichtigsten Faktoren für unser Glücksempfinden sind. Gute Beziehungen erfordern jedoch Pflege – und nein, sie haben de facto nichts mit sozialen Medien zu tun. Zudem wissen wir oft nicht, was uns eigentlich glücklich macht und welchen Stellenwert soziale Beziehungen haben. Als Konsequenz machen wir Dinge, die uns langfristig unglücklich machen, um uns kurzfristig zu schützen, beispielsweise nach vielen „Freundschaften“ auf sozialen Medien zu trachten.
Glück ist ohnehin etwas Kurzfristiges, das nur ein paar Momente andauert. Wichtiger ist das Wohlbefinden, ein kontinuierlicher Zustand, der unsere Lebenszufriedenheit entscheidend prägt. Und der ist bei mir durch meine Transformation nachhaltig gestiegen.
Die Glücksforschung sagt uns auch, dass man Glück kaufen kann, Geld damit zu einem wichtigen Faktor wird. Das belegt jedenfalls einmal mehr eine Studie3 der Forscher Daniel Kahnemann und Matthew Killingsworth. Zentral in dieser Studie steht ein Betrag, ein Jahreseinkommen über 75.000 US-Dollar. Es heißt darin weiter, dass ab diesem Einkommen die negativen Effekte von „zu wenig Geld“ wegfallen und wir damit ein auskömmliches Leben führen können - ohne Angst haben zu müssen, Not zu leiden oder Rechnungen des Alltags nicht zahlen zu können. Alles, was über dieses Jahreseinkommen hinausgeht, ermöglicht uns Luxus. Das zusätzliche Einkommen können wir dann für eine größere Wohnung, zusätzliches Reisen und teure Hobbys nutzen.
Noch vor ein paar Jahren war die vorherrschende Meinung, dass uns dieses zusätzliche Geld eben nicht glücklicher machen würde. Aktuelle Daten deuten jedoch darauf hin, dass ein zusätzliches Ferienhaus, ein Sportwagen oder zwei, und eine dicke Brieftasche unser Glücksempfinden sehr wohl steigern können.
Für mich spielte Geld immer eine große Rolle. Schon in meinen Zwanzigern wusste ich, was ich alles brauchte – und es war immer viel. Nein, ich hatte keinen Sportwagen. Ich hatte die meiste Zeit kein Auto. Darum dachte ich, dass es mich so glücklich machen würde, wenn ich es nur hätte. Es heißt, wer nichts weiß, muss alles glauben. Wie zutreffend. Ich lag jedenfalls völlig falsch mit meiner Annahme, dass Geld mich übermäßig glücklich machen würde.
Das kann ich deshalb sagen, weil meine Lebenssituation, genau wie meine Sicht auf materielle Dinge, heute eine andere ist. Heute kann ich erhobenen Hauptes und mit fester Stimme sagen, dass nicht die glücklichen Menschen dankbar sind, sondern die dankbaren Menschen glücklich. Materielles wird damit zur Nebensache. Für mich, wie ich zugeben muss, auch, weil ich zu jener Gruppe gehöre, die laut der obengenannten Studie ein „auskömmliches Leben“ führen kann.
Der Weg zu mir selbst war und ist eine lange Reise mit vielen Stationen. Schritt für Schritt, Erfahrung für Erfahrung und Erkenntnis für Erkenntnis wich auf dieser Reise meine von mir sauber zurechtgestrickte Pseudorealität den Fakten des knallharten Seins. Für mich war und ist das ein langwieriger Prozess, dessen Ziel es ist, dass ich mit mir selbst vollends im Reinen bin und damit mein bestes Selbst werden kann. Das bedeutet auch, dass ich meine Schwächen erkenne und sie akzeptiere, ohne Wert darauf zu legen, was andere über mich denken. Das erst macht Authentizität möglich.
Es sind also nicht Einflüsse von außen, die das Handeln eines authentischen Menschen bestimmen. Die Motivation muss aus ihm selbst kommen. In meinen jungen Jahren orientierte ich mich stark am Außen, legte größten Wert darauf, was andere von mir halten und wie andere mich sehen. Das spiegelten auch meine Ängste. Heute ist das anders. Heute bin ich so nahe bei mir selbst, wie ich es vorher noch nie war. Sollte es überhaupt möglich sein, bei sich selbst vollends ankommen zu können, dann fühle ich mich auf dem richtigen Weg. Und dieser Weg gleicht einer Achterbahn: Manchmal bin ich traurig, aber ich gebe nicht auf. Manchmal bin ich verunsichert, aber ich gebe nicht auf. Manchmal bin ich wütend, aber ich gebe nicht auf. Manchmal bin ich verletzt, aber ich gebe nicht auf. Und ich bin stolz darauf.
Soweit eine grobe Skizze der Reiseroute meiner Selbstfindung. Dieser Zusammenfassung, der Tatsache, dass ich diese Worte so zu Papier bringen kann, ging ein langer und holpriger Weg voraus. Und nein, ich bin kein Esoteriker. Auch wenn man das vielleicht glauben könnte.
Meine Umwelt
Meine Lebensbühne ist Wien, eine Stadt, die gleichermaßen für ihre Morbidität und den außergewöhnlichen Humor ihrer Bewohner bekannt ist. Hier gehört der Tod zum Leben, wie manche sarkastisch meinen. Die für hier typische Kulinarik wird dominiert von Kaiserschmarren und Wiener Schnitzel, die Architektur von einem Riesenrad, an dem alte Eisenbahnwagons hängen, dem Stephansdom – und natürlich Schönbrunn, der früheren Heimat von Sissi und Franz, die den Geist der hier lebenden Menschen bis heute entscheidend prägen. Edmund Sackbauer, aus der hierzulande berühmten Sozialstudie „Ein echter Wiener geht nicht unter“, ist ebenso ein, sicherlich für viele Wiener zutreffendes, Belegexemplar der hier vorherrschenden Lebensart, zu der Granteln jedenfalls dazugehört. Mehr noch: Mundi, oder Mundl, wie er in Wien genannt wird, ist zu Sissi und Franz in wohl jeder erdenklichen Hinsicht diametral. Und dennoch: Beide Seiten stehen für das, was Wien ausmacht. Ein echter Wiener, so sagt man, hat zudem tschechische Vorfahren.
Ein wenig Nasales von Kaiser Franz, gepaart mit einem durchaus vorhandenen Verständnis für das Weltbild von Mundl Sackbauer - und meine tschechischen Vorfahren machen mich wohl zu einem, mehr oder weniger, echten Wiener. Das aber viel Wichtigere: Ich hatte das Glück, in einer der lebenswertesten und wohlhabendsten Städte der Welt aufzuwachsen. Es fehlte mir an nichts – dachte ich jedenfalls.
Bevor nun ein falscher Eindruck entsteht: Meine lange, turbulente und nicht unwesentliche Beziehung zu Materiellem begleitet mich seit jeher auf meinem Weg. Mit dem goldenen Löffel aufgewachsen bin ich aber nicht, wobei das, wie so viele Dinge, immer eine Frage der Perspektive ist.
Meine Mutter war – nein, sie ist es noch, das, was man schlechthin unter einer aufopfernden und fürsorglichen Mutter versteht, die niemals etwas zwischen sich und ihr Kind kommen lassen würde. Was für Dummheiten ich auch immer zum Besten gab, sie steht immer hinter mir – und dass, obwohl ich sie regelmäßig in dieser Disziplin herausforderte. Mein Vater war früher in einer exponierten Managerposition, beruflich viel unterwegs und Berührungspunkte entsprechend selten. Beide Seiten waren gesellschaftlich bestens vernetzt und in dieser gerne gesehen. Das Haus war groß, der Kühlschrank voll und mein Kindermädchen ein Männertraum, mit dem ich viel Zeit verbracht habe, wohl den gesellschaftlichen Verpflichtungen meiner Eltern geschuldet.
Kindergarten, Volksschule, und schließlich eine strenge Privatschule. Die Zeit dort war prägend. Erste Ideale und Freunde fürs Leben. Dabei blieb es dann auch, denn ich musste das elitäre Etablissement noch in der Unterstufe verlassen - aufgrund „unüberbrückbarer Differenzen“, wie mir Mama später zu erklären versuchte. Über Umwege kam ich schließlich zu meiner Reifeprüfung. Während meiner Studienzeit durfte ich einige Monate im Ausland verbringen. Zunehmend erkannte ich, was mich nicht interessiert. Zahlen waren ohnehin nie meines und so startete ich eine Karriere in der Kommunikation – als Kommunikationsberater und PR-Manager. Ein Beruf, der in vielen Beliebtheitsrankings, sogar noch vor Politiker oder Journalist, unter den unbeliebtesten beziehungsweise unglaubwürdigsten, manchmal sogar unnötigsten, angeführt wird. Mir wars egal.
Damals und heute: Mitten im Leben





























