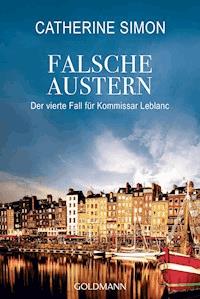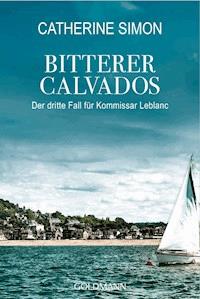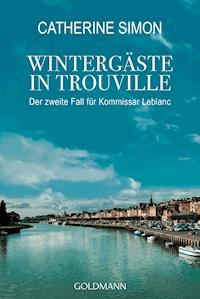
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Leblanc ermittelt
- Sprache: Deutsch
Der zweite Fall für den commissaire und Lebemann aus Deauville- Trouville.
Kommissar Leblanc hasst Schnee. Und der fällt in der Woche vor Weihnachten in dicken Flocken vom normannischen Himmel. Doch bald ist keine Zeit mehr für melancholische Verstimmung: Im renommierten „Hôtel des Roches Noires“ wird eine Tote gefunden – die Pariser Journalistin Bernadette Latour, Lebensgefährtin des so betagten wie begüterten Monsieur Adler. War Bernadette auf das Geld des alten Herrn aus und daher den Erben ein Dorn im Auge? Oder ist sie einem brisanten Skandal auf die Spur gekommen? Bei seinen Ermittlungen stößt der Kommissar auf familiäre Abgründe, eine Schönheitsklinik in der Nähe von Trouville und einen dubiosen Unbekannten, den etwas mit Leblancs früherer Geliebten Marie verbindet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Buch
Kommissar Leblanc hasst Schnee. Und der fällt in der Woche vor Weihnachten in dicken Flocken vom normannischen Himmel. Doch bald ist keine Zeit mehr für melancholische Verstimmung: Im renommierten Hôtel des Roches Noires wird eine Tote gefunden – die Pariser Journalistin Bernadette Latour, Lebensgefährtin des so betagten wie begüterten Monsieur Adler. War Bernadette auf das Geld des alten Herrn aus und daher den Erben ein Dorn im Auge? Oder ist sie einem brisanten Skandal auf die Spur gekommen? Bei seinen Ermittlungen stößt der Kommissar auf familiäre Abgründe, eine Schönheitsklinik in der Nähe von Trouville und einen dubiosen Unbekannten, den etwas mit Leblancs früherer Geliebten Marie verbindet.
Autorin
Catherine Simon ist das Pseudonym von Sabine Grimkowski. Seit 1999 ist sie als Redakteurin beim Südwestrundfunk in der Redaktion Literatur tätig. Sie hat Sachbücher geschrieben, unter anderem den Reisebegleiter »Normandie«, und Romane zu Fernsehserien. Regelmäßig fährt sie in die Normandie und verbringt in Trouville einen Teil des Jahres. Sie wohnt dort im legendären Hôtel des Roches Noires, wo schon Marcel Proust logierte und Marguerite Duras eine Wohnung besaß. Sabine Grimkowski lebt in Baden-Baden.
Mehr von Catherine Simon:
Kein Tag für Jakobsmuscheln. Der erste Fall für Kommissar Leblanc Bitterer Calvados. Der dritte Fall für Kommissar Leblanc.
CATHERINE SIMON
Wintergäste
in Trouville
Der zweite Fall
für Kommissar Leblanc
Eins
Dicke, nass-schwere Schneeflocken segelten vom grauen Dezemberhimmel vorbei an Jacques Leblancs Fenster. Der Kommissar stand an der Balkontür seiner Wohnung und sah missmutig den Kapriolen des normannischen Wetters zu. Wenn er eins nicht ausstehen konnte, war es Schnee. Gleich danach auf der Skala seiner Abneigungen kam Weihnachten, und das rückte unaufhaltsam näher. Immer früher begann dieses grauenhafte Weihnachtszubehör in den Läden zu erscheinen, Schokolade in Form von Glocken oder Tannenzapfen, blinkende Lichterketten, Sterne, Kugeln und Lametta. Er fragte sich, woher das Bedürfnis nach der überbordenden Weihnachtsdekoration kam und wann das angefangen hatte. Es musste sich langsam eingeschlichen haben, er konnte sich nicht erinnern. Vor Kurzem war ein Weihnachtsmann in rotem Mantel und mit weißem Kunstbart winkend in einer Kutsche durch Trouville gefahren und hatte vor der Touristenzentrale Süßigkeiten an Kinder verteilt. Es schienen aber eher die Mütter zu sein, die die Nähe des dickbäuchigen Père Noël suchten, um ihn mit ihren Händen zu berühren. Ob das Glück brachte? Ähnliches sagte man Schornsteinfegern nach. Sogar sein Stammrestaurant, das Central, hatte außen an der Fassade Girlanden aus Tannenzweigen angebracht und den Speiseraum mit Lichterketten geschmückt. Völlig überflüssig, fand Jacques Leblanc.
Außer ihm schienen alle diesem Fest entgegenzufiebern. Er hörte, wie seine Kollegen über Geschenke redeten und was es an den Weihnachtstagen zu essen geben sollte. Seine engste Mitarbeiterin Nadine war ganz aus dem Häuschen. Ihr Bruder aus New York wollte mit seiner Familie zu Besuch kommen, und seit Tagen überlegte sie laut, ob Austern oder Garnelen oder gar Hummer als Vorspeise angemessen wären. Sie hatte ihrem Bruder, der in einer Containerschiffsagentur arbeitete, einen prächtigen Bildband über die ersten Schiffspassagen nach New York gekauft und hoffte auf ein ebenso prächtiges amerikanisches Überraschungsgeschenk. Jacques Leblanc schenkte nichts und bekam nichts geschenkt. Er machte sich nichts aus diesen Dingen. Die Atmosphäre der Weihnachtszeit, in der alle Welt zu vergessen schien, dass es auch anderes gab, lähmte ihn. Dazu kam der Schnee, der sich wie Mehltau auf alles legte und die Mobilität einschränkte! Und noch etwas bedrückte ihn. Seit ein paar Tagen lag ein Brief auf dem Tisch, um den er herumschlich wie eine Katze um den leeren Fressnapf, ein Brief von Tante Amélie. Er brauchte ihn nicht mehr zu lesen, er kannte ihn auswendig. Die Worte hatten sich in seinen Kopf eingebrannt.
»Lieber Jacques, ich mache mir Sorgen um deine Mutter. Seit fünf Monaten wohnt sie jetzt bei mir in Versailles, und sie kann gewisse Gewohnheiten, die in Kamerun sicherlich angemessen waren, nicht ablegen. Das wäre aber nicht das Schlimmste. Sie treibt Handel mit irgendwelchen Substanzen, die sie aus Kamerun auf Wegen bekommt, von denen ich lieber nichts wissen möchte. Ständig tauchen hier Kameruner auf, die etwas bringen oder abholen. Ich habe sie darauf angesprochen, und sie sagt, das sei alles völlig in Ordnung, ich solle mich nicht aufregen. Jacques, du musst mit ihr reden. Wenn das so weitergeht, kann sie nicht mehr bei mir wohnen. Dann musst du dich um sie kümmern.
Tu etwas!
Deine Tante Amélie.«
Im Mai war sein Vater in Kamerun gestorben, und kurz danach war seine Mutter nach Frankreich zurückgekehrt, nach über vierzig Jahren. Tante Amélie, ihre Schwester, hatte sie in ihrem Haus in Versailles aufgenommen. Platz genug gab es in dem zweistöckigen Gebäude. Tante Amélie lebte allein, ihr Mann war vor langer Zeit gestorben. Am Anfang hatte sie sich sogar gefreut, im Alter wieder mit ihrer zwei Jahre jüngeren Schwester vereint zu sein. Leblanc hatte seine Mutter einmal in Versailles besucht und gesehen, dass es ihr gut ging und die beiden Frauen sich verstanden. Beruhigt, dass sich dieses Problem auf einfache Weise gelöst hatte, war er wieder nach Hause gefahren. Er hatte seine Eltern nicht häufig gesehen. Sein Vater hatte sich als Lehrer nach Kamerun versetzen lassen, und auch nach dessen Pensionierung waren die Eltern dort geblieben. Ihn hatten sie ins Pensionat gegeben, damit er die Schule in Frankreich absolvierte. Nur einmal, für kurze Zeit, hatten seine Eltern ihn zu sich geholt. Eigentlich war ihm seine Mutter fremd geblieben, und er hatte nicht das Bedürfnis, etwas nachzuholen. Aber jetzt gab es Probleme, und er musste sich darum kümmern. Seit Tagen versuchte er, den Brief zu ignorieren. Je länger er das tat, desto stärker schien der Brief zu leuchten, er blinkte geradezu wie diese aufdringliche Weihnachtsbeleuchtung.
Leblanc hatte sich den Nachmittag frei genommen, um nach Versailles zu fahren und mit seiner Mutter zu sprechen. Im Präsidium war es in den letzten Tagen relativ ruhig gewesen. Es schien, als ob das unwirtliche Wetter die Lust minderte, Verbrechen zu begehen. Man sollte eine Statistik erstellen, dachte Leblanc, wie Wetter und Straftaten zusammenhängen. Besonders Schnee, glaubte er, würde sich hemmend auf die kriminelle Energie auswirken. Wider Willen musste Leblanc lächeln, wie immer, wenn er auf Gedanken kam, die abwegig waren, ihm aber dennoch gefielen.
Er sollte jetzt losfahren. Es war eigentlich schon zu spät. Er hätte am Vormittag aufbrechen sollen, aber das hatte er nicht geschafft. Bei diesem Wetter! Vielleicht sollte er seinen Besuch in Versailles doch verschieben? Tante Amélie würde einsehen, dass es bei dem Schneetreiben kein Vergnügen war, mit dem Auto zu fahren. Er ertappte sich bei seinen Vermeidungsstrategien. Nein, er würde fahren. Aber erst einmal zum Mittagessen ins Central. Danach, danach würde er fahren. Ein letzter Blick aus dem Fenster, dann zog Jacques Leblanc seinen schweren, aber dennoch nicht wärmenden Wollmantel an, den er achtlos über den Stuhl geworfen hatte, und verließ seine Wohnung.
Während der Fahrstuhl leise ins Erdgeschoss glitt, zupfte Leblanc an dem schwarz-weißen Einstecktuch in der schmalen Tasche seines Mantels auf Brusthöhe. Für sein privates Auto, einen Peugeot, stand ihm ein nicht überdachter Stellplatz vor dem Gebäudekomplex am Jachthafen von Deauville zur Verfügung, in dem sich im fünften Stock seine Zweizimmerwohnung befand. Der Wagen war fast nicht zu erkennen, eine Schicht aus pappigem, feuchtem Schnee bedeckte ihn. Die musste Leblanc beseitigen, wenn er das Auto benutzen wollte. In Paris, wo er bis vor gut anderthalb Jahren gelebt hatte, hatte es selten geschneit. Und hier in Deauville, betonten alle Kollegen, würde es kaum Schnee geben. Dies sei eine Ausnahme. Ausgerechnet jetzt, wo er da war, musste sich diese Ausnahme ereignen. Der Kommissar sah sein Auto an wie ein fremdes Wesen. Er hatte kein Gerät zur Verfügung, um den Schnee zu beseitigen, keinen Besen, keinen Eiskratzer. Also nahm er seinen Arm und fuhr damit über die Windschutzscheibe. Das wiederholte er bei den anderen Fenstern. Als er erneut an der Vorderseite ankam, lagen schon wieder Schneeflocken auf der Scheibe, aber das würde der Scheibenwischer schaffen. Er merkte, dass sein Mantelärmel nass war. Die Nässe drang nach innen, befeuchtete sein Jackett und verwandelte sein Frösteln in ein Frieren. Angewidert verzog Leblanc das Gesicht. Aber gleich darauf entspannte er sich wieder, der Mantel würde im Central trocknen. Er war geradezu gezwungen, im Central zu essen. Mit einer ausladenden Geste fuhr er sich durch seine vollen grauen Haare, auf denen sich Schneeflocken niedergelassen hatten, die in kleinen Rinnsalen die Kopfhaut entlangliefen. Er stieg ins Auto und fuhr los, auf die andere Seite der Touques, die mit ihrem Wasserarm Deauville und Trouville trennte.
Im Central kehrte seine ihm eigene Zuversicht zurück. Es war warm, roch angenehm nach Gebratenem, und sein Lieblingstisch im hinteren Speiseraum war unbesetzt. Sorgfältig hängte er seinen Mantel über den Stuhl und achtete darauf, dass der nasse Ärmel frei hing und trocknen konnte. Leblanc pflegte, wann immer es möglich war, mittags im Central zu essen. Édouard, der Kellner, der ihn gut kannte, zog den Tisch ein wenig nach vorne, sodass der Kommissar bequem auf der mit rotem Kunstleder bezogenen, gepolsterten Sitzbank Platz nehmen konnte.
»Monsieur le commissaire, für Sie das Mittagsmenü?«
»Was gibt es denn? Ich habe nicht auf die Tafel gesehen.«
Im vorderen Raum hing für gewöhnlich eine Tafel, auf der mit Kreide das jeweilige Tagesessen geschrieben stand.
»Wir haben als Vorspeise Kalbskopfsülze mit Remoulade und als Hauptgericht Fasan mit glasierten Kartoffeln und Kürbismousse. Und als Dessert …«
»Lassen Sie mal, Édouard, das entscheiden wir später. Ich nehme das Menü und ein kleines Glas Rosé.«
In Anbetracht des in Aussicht stehenden Essens räkelte sich Leblanc wohlig auf der Sitzbank. Vom Nebentisch griff er sich eine Papierserviette und fuhr damit unter dem Tisch über seine schwarzen, glänzenden Schuhe, die vom Schnee feucht geworden waren. Er brachte sie regelmäßig zur Pflege zum letzten verbliebenen Schuhmacher in Trouville. Der behandelte sie mit einer Wachscreme, sodass sie immer wie neu aussahen. Der Schuhmacher war ein betagter Mann. Wenn er sein Geschäft schließen würde, müsste Leblanc nach einer Lösung für die Schuhpflege suchen.
Für einen Moment vergaß er, was ihm heute noch bevorstand, von der lästigen Autofahrt ganz zu schweigen. Diese Mittagessen im Central mochte er, es gab kaum einen Anlass, der ihn dazu bringen konnte, eins zu versäumen. Wenn er mitten in einem Fall war, hatte er beim Essen Zeit nachzudenken, Fäden zusammenzuknüpfen, Schlüsse zu ziehen oder auf neue Ideen zu kommen. Oft hatte er einen Kriminalroman dabei, in dem er las. Die von Georges Simenon mit dem Kommissar Maigret waren ihm die liebsten. Heute hatte er keinen in der Tasche. Er überlegte, was er seiner Mutter sagen sollte. Erst einmal musste er herausfinden, was sie da überhaupt trieb. Vielleicht war es nicht so schlimm, wie Tante Amélie meinte, und sie ließ sich aus Kamerun Kräuter schicken, aus denen sie heilende Tees braute. Über vierzig Jahre hatte sie in Kamerun gelebt, da war es natürlich, dass sie Gewohnheiten hatte, die hier in Frankreich nicht üblich waren. Sosehr sich Leblanc zu beruhigen versuchte, im Innern nagte doch der Zweifel. Seine Tante hätte ihm nicht geschrieben, wenn es nicht dringend wäre.
Édouard stellte einen Teller mit Kalbskopfsülze und ein Schälchen mit Remouladensauce vor den Kommissar auf den Tisch. Leblanc begann zu essen und pries das Central, das seine Speisekarte dem Wetter und den Jahreszeiten anpasste.
Über den Teller gebeugt, bestrich er die Sülze mit Remoulade und schob sich die Gabel in den Mund. Fast wäre ihm bei seinem hingebungsvollen Essen die Ankunft eines neuen Gastes entgangen, der den hinteren Raum des Central betrat, dort einen Moment verweilte und sich den Schnee vom Mantel und den kastanienbraunen Haaren schüttelte. Die Eintretende war ihm wohlbekannt. Mit Marie Bertaux hatte ihn eine enge Beziehung verbunden, als sie beide noch in Paris gelebt hatten. Zum ersten und einzigen Mal hatte sich damals mit Marie so etwas wie Beständigkeit in sein Leben geschlichen. Normalerweise mied er genau das bei seinen Liebschaften. Keine Ansprüche, keine Verpflichtungen, keine Probleme, das war seine Devise. Mit Marie war das anders gewesen, warum, konnte er nicht genau sagen. Auch nicht, warum sie sich letztlich doch getrennt hatten. Und nun waren sie unabhängig voneinander nach Trouville gezogen und begegneten sich hin und wieder, eine merkwürdige Laune des Schicksals. Leblanc war sich noch nicht im Klaren darüber, was das Schicksal damit bezweckte. Er ließ die mit der Sülze beladene Gabel sinken, erhob die Hand und winkte.
»Hallo, ché…«, setzte er an, die zweite Silbe blieb ihm in der Kehle stecken, denn hinter der nach einem geeigneten Platz Ausschau haltenden Marie betraten zwei Herren den Raum, die offenbar zu ihrem Gefolge gehörten. Leblanc ließ die Hand wieder sinken, konnte sich aber nun nicht mehr in gleicher Weise wie vorher auf seine Vorspeise konzentrieren.
Nun hatte Marie ihn entdeckt, lächelte ihm zu und begrüßte ihn mit »Bonjour, Jacques, lass es dir schmecken«. Dann war sie damit beschäftigt, zusammen mit dem Kellner einen Tisch auszusuchen und ihn mit den beiden Herren einzunehmen.
Marie saß auf der Sitzbank der gegenüberliegenden Seite, mit dem Gesicht zu Leblanc gewandt, die Herren hatten auf Stühlen Platz genommen und zeigten ihm ihre Rückenansicht. Sie trugen Anzüge, denen Leblanc insgeheim das Etikett »bieder« anheftete, dunkel, irgendwie gemustert, ohne jeden Schick. Dazu Hemd und Krawatte. Den Sätzen, die durch die Geräusche des Lokals an sein Ohr drangen, entnahm er, dass die Herren Französisch sprachen, aber keine Franzosen waren. Ein Akzent war deutlich hörbar, und sie drückten sich in äußerst gewählten Worten aus. Leblanc wandte sich wieder seiner Sülze zu. Kaum hatte er die Vorspeise beendet, als der Kellner schon den Fasan mit Kartoffeln und Kürbismousse servierte. Marie und ihre Begleiter berieten mit einem anderen Kellner die Auswahl der Speisen.
»Jacques, kannst du den Fasan empfehlen?«, wollte sie von Leblanc wissen.
»Unbedingt«, antwortete der Angesprochene, nachdem er einen Bissen gekostet und festgestellt hatte, dass sich unter der knusprigen Haut des Wildgeflügels herrlich zartes Fleisch verbarg.
Nachdem Marie die Bestellung aufgegeben hatte, flüsterte sie den Herren etwas zu, worauf beide sich nach Leblanc umdrehten und ihm zunickten. »Ich habe den Herren Professoren aus Deutschland gerade gesagt, dass ihnen gegenüber der berühmte Kommissar Leblanc speist, der Maigret der Kanalküste«, rief Marie gut gelaunt hinüber. Daraufhin hielten auch die anderen im Raum anwesenden Gäste inne, um neugierige Blicke auf Leblanc zu werfen. Der fühlte sich leicht unbehaglich, lächelte aber den deutschen Professoren zu, die ein so ausdrückliches Interesse an seiner Person bekundeten. Marie entschuldigte sich bei ihren Begleitern, ging zu Leblanc hinüber und setzte sich an seinen Tisch. »Wie geht es dir, Jacques?«
»Es geht. Du scheinst ja in blendender Verfassung zu sein. Gleich zwei Verehrer?«
Marie lachte. »Da kommt keine Langeweile auf, das solltest du doch am besten wissen.«
»Ist das ein neuer Service deines Gästehauses? Fremdenführung durch die Gastronomie Trouvilles?«, konterte Leblanc, und schon waren Jacques und Marie verstrickt in den ihnen eigenen, manchmal neckenden, manchmal von Untertönen begleiteten, oft spannungsgeladenen Wortwechsel. Der häufig mit einem »Ach, Jacques« seitens Marie endete.
Jetzt aber wollte sie von Leblanc wissen, was es mit den Überfällen auf sich habe, die sich in letzter Zeit häuften. »Vorletzte Woche ein Juwelierladen in Deauville, letzte Woche der Überfall auf das Casino. Muss man Angst haben? Treiben sich hier Banden herum?«
»Nein, keine Sorge. Die Juwelenräuber haben wir gefasst, zwei junge Männer, die dachten, sie hätten den genialsten Coup aller Zeiten vorbereitet und könnten sich mit der Beute nach Südamerika absetzen. Der Überfall auf das Casino war eine ganz andere Sache. Ein über Siebzigjähriger, der schon immer mal eine Bank ausrauben wollte, hat sich den Traum seines Lebens erfüllt und, als er das Geld erbeutet hatte, sich selbst erschossen. Er hatte alles genauestens geplant, sogar einen Abschiedsbrief fanden wir in seiner Hosentasche. Traurige Geschichte. Aber von irgendwelchen Räuberbanden kann keine Rede sein. Du kannst ganz ruhig schlafen. Na, im Moment stehst du ja unter männlichem Schutz, doppeltem sozusagen.«
Auf Leblancs Anspielung ging Marie nicht ein. Sie seufzte nur, ließ nun doch ein »Ach, Jacques« hören und fügte begütigend hinzu: »Gut, dass man keine Angst haben muss. Entschuldige, aber ich möchte mich wieder um meine Gäste kümmern.« Dann erhob sie sich und ging hinüber zu ihrem Tisch, wo die beiden Herren sie mit gefüllten Gläsern erwarteten, um mit ihr anzustoßen.
Leblanc schnappte noch eine Bemerkung auf über eine »gelungene Tagung«, dann ließ er das Horchen sein und machte sich über den Fasan her. Der letzte Bissen war in seinem Mund verschwunden, als sein Handy in der Jackentasche klingelte. Schlagartig fiel ihm ein, was zwischenzeitlich völlig aus seinem Bewusstsein entschwunden war, dass er nämlich nach Versailles fahren wollte. Er zögerte einen Moment, meldete sich dann aber doch, als er sah, dass der Anruf von seiner Kollegin Nadine kam.
»Ja, Nadine, was gibt es?«
»Chef, sind Sie schon auf der Autobahn?«
Leblanc hatte seiner Mitarbeiterin gesagt, er müsste in Familienangelegenheiten nach Versailles.
»N…nein, ich bin noch im Central, um mich für die Fahrt zu stärken.«
»Was ich Sie fragen wollte – ich kann das Protokoll vom Überfall auf das Casino nicht finden. Wissen Sie vielleicht, wo es geblieben ist?«
»Tja, also … das habe ich noch nicht geschrieben. Ich dachte, das hätte noch Zeit.«
»Ach so … ja, klar.« Nadines Stimme war zu entnehmen, wie unangenehm es ihr war, ihren Chef bei einem Versäumnis ertappt zu haben.
Leblanc witterte seine Chance, den Versailles-Besuch abzusagen, ohne sein Gewissen allzu sehr zu belasten. »Nein, du hast recht. Ich hätte es nicht so lange herauszögern sollen. Meine Fahrt kann ich verschieben, es wäre sowieso Wahnsinn, sich jetzt bei dem Schneetreiben auf die Autobahn zu wagen. Ich komme gleich ins Präsidium.«
»Aber Chef, das ist nicht nötig, fahren Sie ruhig zu Ihrer Familie. Das Protokoll hat wirklich noch Zeit«, versuchte Nadine Leblanc umzustimmen.
»Es ist entschieden, ich bin gleich im Büro.« Damit beendete Leblanc das Gespräch. Auf das Dessert verzichtete er, trank schnell noch einen Kaffee, winkte der ins Gespräch mit ihren Professoren vertieften Marie zu und verließ das Central.
Auf dem Weg ins Präsidium rief er Tante Amélie an und berichtete, er sei schon in Richtung Autobahn unterwegs gewesen – die Unwahrheit verzieh er sich sofort –, und nun habe ihn »eine dringende Sache« zurückgerufen. Was wieder der Wahrheit entsprach, jedenfalls halb. Tante Amélie zeigte sich verständnisvoll, äußerte sogar Bedenken gegenüber einer Autofahrt bei dem Schnee. Leblanc versprach, am folgenden Tag zu kommen, wenn das Wetter es zuließe.
Als Leblanc das Büro betrat, saß Nadine an ihrem Computer. Zerknirscht sah sie ihn an und verzog den Mund zu einer Grimasse. »Chef, das tut mir wirklich leid. Ich hätte Sie wegen des Protokolls nicht anrufen sollen. Manchmal geht der Ordnungssinn mit mir durch, sagt meine Mutter auch. Sie findet es fast unheimlich, dass ich alles sofort aufräume. Ein bisschen Chaos kann nicht schaden, meint sie.«
»Ist schon gut, muss dir nicht leidtun, meine Kleine.« Leblanc drückte seine Sympathie für die kluge und hübsche Kollegin, der er trotz einer mächtigen Zuneigung für das weibliche Geschlecht im Allgemeinen und für attraktive Frauen im Besonderen nie etwas anderes als kollegialen Respekt entgegenbrachte, durch diese zärtliche Wortwahl aus. Nadine ließ es sich gefallen, nicht ungern, schien ihm. »Im Grunde hast du mich gerettet«, fuhr er fort und fügte in Gedanken hinzu: für heute. Denn er wusste, dass er sich dem Problem Mutter würde stellen müssen.
»Vielleicht können Sie an den Weihnachtstagen zu Ihrer Familie fahren«, versuchte Nadine, ihren Chef zu trösten, denn sie glaubte, dass er des Trostes bedurfte.
»Ich warte lieber, bis Weihnachten vorbei ist. Festtage sind nicht so meine Sache.«
»Nein? Das verstehe ich nicht, Weihnachten ist so schön, die Lichter überall, die Musik, und wenn die Familie zusammen ist. Und dass es jetzt auch noch schneit, ist das Tollste. Haben wir hier ja selten an der Küste.«
»Hm, hab schon gehört, dass Schnee eine Ausnahme ist. Wie sind denn die Wetteraussichten für morgen?«
»Es soll auch in den nächsten Tagen noch schneien. Keine Änderung.«
»Aha.«
Leblanc verschob seinen Besuch in Versailles endgültig auf nach Weihnachten. Der Schnee verschaffte ihm einen triftigen Grund. Er würde Tante Amélie anrufen und erst mal am Telefon mit seiner Mutter sprechen. Vielleicht würde er das Problem so lösen können, ohne dass er persönlich dort auftauchen müsste. Das immerhin hatte er dem Schnee zu verdanken.
»Mögen Sie keinen Schnee, Chef?«
»Na ja, er ist in gewisser Weise hinderlich, nicht?«
»Sie dürfen das nicht nur praktisch sehen. Der Schnee verwandelt die Welt in eine Zauberlandschaft und bedeckt alles mit seinem schönen Weiß.«
Leblanc dachte an sein Auto. »Ja, da hast du recht.«
Dann widmete er sich dem längst fälligen Protokoll des Casino-Überfalls.
Zwei
Inzwischen war es dunkel geworden. Das Weiß der Schneeflocken setzte sich vor dem düsteren Himmel ab. Nadine war nach Hause gegangen. Leblanc nahm sein Handy und tippte die Nummer von Tante Amélie ein, die sich sofort meldete, als hätte sie in der Nähe des Telefons auf einen Anruf gewartet.
»Hier ist Jacques. Das Wetter wird nicht besser, und zudem stecke ich mitten in der Arbeit. Das wird nichts morgen mit dem Kommen. Aber gib mir mal Maman, ich rede mit ihr.«
»Ja, ich gebe sie dir, aber du musst ihr ins Gewissen reden. So geht das nicht weiter.«
Leblanc vernahm, wie seine Tante im Hintergrund nach ihrer Schwester rief. Er seufzte, dann hörte er die hohe und durchdringende Stimme seiner Mutter.
»Amélie sagt, du willst mit mir reden? Was ist los, mein Junge?«
»Maman, Amélie macht sich Sorgen um dich.«
»Hat sie dir das jetzt auch erzählt? Ständig liegt sie mir damit in den Ohren, ich weiß nicht, was das soll. Wieso macht sie sich Sorgen?«
»Sie ist nicht gerade froh darüber, dass bei dir ständig Leute aus Kamerun ein und aus gehen, die sie nicht kennt.«
»Aber warum denn? Das sind reizende Menschen. Ich verhelfe ihnen zu dem, was sie für ihre Religionsausübung brauchen.«
Leblanc schluckte. Ihm schossen Bilder von Voodoo-Priestern mit verdrehten Augen und von ekstatischen Tänzen durch den Kopf, und seine Mutter mitten im Geschehen, besudelt mit Hühnerblut. Sie war jetzt fünfundsiebzig, allerdings wendig und zäh wie eine sportive Vierzigjährige.
»Maman, was ist denn das, was du ihnen besorgst?«
»Eine Pflanze, eine Wurzel. Die ist wichtig für das Aufnahmeritual in unsere Religionsgemeinschaft.«
»Unsere? Bist du da Mitglied? Was ist das für eine Religion?«
Suzanne Leblanc lachte in einem meckernden Ton.
»Mitglied? Was hast du für Vorstellungen? In den Augen der Kameruner bin ich eine Zauberin, eine weiße Hexe.«
Jacques Leblanc verstummte. Das war zu viel. Einen Moment lang fühlte er sich verloren wie damals als Kind, als er in einer Erdhöhle in Kamerun verschüttet war. Seine Mutter redete unerbittlich weiter, als würde sie einem Reporter Auskunft geben.
»Ich besitze besondere Kenntnisse von Kräutern und kann ihre Heilkräfte nutzen und weitergeben. Außerdem rufe ich Geister um ihre Hilfe an. Du hast doch sicher schon von unserem Ahnenkult gehört.«
Nur mit Mühe gelang es Leblanc zu antworten.
»Nein, ich kenne mich mit afrikanischen Religionen nicht aus.«
»Ich erkläre es dir gern einmal ausführlich, wenn es dich interessiert. Die Missionare haben das Christentum nach Afrika gebracht, aber das Christentum konnte die Naturreligionen nicht ersetzen. Mit der Folge, dass sie sich vermischt haben, ganz einfach. Der Ahnenkult spielt dabei eine große Rolle. Die verstorbenen Ahnen erscheinen als Geister, meistens sind sie gutartig, aber manchmal auch jähzornig. Dann müssen wir sie besänftigen.«
Suzanne Leblanc lachte wieder meckernd. Ihr Sohn fühlte sich überfordert und hätte das Gespräch gern beendet.
»Maman, wie heißt denn diese Pflanze, die du aus Kamerun bekommst, und auf welche Weise gelangt sie in deine Hände?«
»Die Ibogawurzel wird mir mitgebracht von vertrauenswürdigen Personen, das kannst du mir glauben.«
»Gut, Maman, gib mir noch mal Amélie.«
Seine Tante schien das Gespräch in der Nähe mitgehört zu haben, sie war sofort am Apparat.
»Da, siehst du, habe ich es dir nicht gesagt!«
»Ich kümmere mich darum, Amélie. Ich finde heraus, ob das Treiben von Maman gesetzwidrig ist. Wenn nicht, kann sie ihre Religion ausüben, wo sie will, aber nicht bei dir im Haus. In Ordnung?«
»Ist gut, Jacques. Sie hat sich so verändert, ich kann kaum glauben, dass sie meine Schwester ist.«
»Sie hat fast ihr ganzes Leben in Afrika verbracht, das hinterlässt Spuren. Ich melde mich wieder.«
Leblanc legte sein Mobiltelefon auf den Bürotisch und stieß Luft aus, als hätte er eine schwere körperliche Anstrengung hinter sich gebracht. Das war schlimmer, als er sich hätte träumen lassen. Das war ein Alptraum. Seine Mutter eine Zauberin, eine Hexe! Allein die Wörter jagten ihm Schauer über den Rücken. Er startete seinen Computer neu, der sich von selbst ausgeschaltet hatte, gab das Wort »Ibogawurzel« in die Suchmaschine ein und las das, was da erschien, laut vor:
»Die Wurzel der Iboga, vor allem die innere Schicht der Wurzelrinde, enthält psychoaktive Stoffe, vor allem das Ibogain.Die Ibogawurzel wird oral konsumiert, schmeckt äußerst bitter und wird in kleingehacktem oder gemahlenem Zustand zerkaut und mit reichlich Wasser geschluckt. Kleinere Dosen wirken stimulierend und aphrodisierend, während größere Dosen Visionen auslösen, das heißt lebhafte Wachträume bei geschlossenen Augen. Zudem wird sich bei dem Verspeisen dieser Pflanze immer wieder übergeben. Die Ibogawurzel wird verwendet beim Aufnahmeritual der Bwiti-Religion.«
Dann erfuhr er noch, dass Iboga, so wie Cannabis und Marihuana, auf der Liste der verbotenen bewusstseinserweiternden Substanzen stand und im Sport als Dopingmittel galt. Seine Mutter handelte mit Drogen! Für den Moment war das mehr, als er verkraften konnte. Keinesfalls konnte er heute Abend allein sein. Er überlegte, Isabelle anzurufen, mit der er hin und wieder essen und danach ins Bett ging. Isabelle arbeitete in einem Immobilienbüro. Er verbrachte gern einen Abend mit ihr, sie war unkompliziert und bereit, sich zu amüsieren. Aber er entschied sich dafür, Annie aus der Bäckerei in Deauville zu fragen. Annie roch immer ein bisschen nach frischem Brot, bei ihr würde er Trost finden. Trost brauchte er dringend – und jemanden, der seinen Schlaf bewachte. Denn dass er allein würde schlafen können, das wusste er jetzt schon, daran war nicht zu denken. Sein altes Trauma aus der Kindheit, als er drei Tage in der Erdhöhle in Kamerun verschüttet war, würde ihn heimsuchen und ihm keine Ruhe lassen.
»Bonjour, Annie, chérie, hier ist Jacques. Du hast heute Abend noch nichts vor, oder? … Siehst du, dann können wir eine Kleinigkeit essen und im Zebra einen Drink nehmen … Nein, kein Problem, wir können auch bei dir etwas speisen … Gut, ich bin um acht Uhr da. Bis später.«
Wenigstens das hatte geklappt. Annie wollte zwar nicht ausgehen, aber sie hatte ihn zu sich nach Hause eingeladen.
Jacques Leblanc erwachte von der Stille. Es war kurz vor sechs und anders still als sonst. Neben ihm schlief Annie, ihre dicken braunen Haare lagen wie eine dunkle Wolke auf dem Kopfkissen. Bald würde sie aufstehen, denn um sieben Uhr fing ihre Arbeit in der Bäckerei an. Annie hatte gestern Abend eine passierte Gemüsesuppe gekocht, dazu hatte es frisches Baguette gegeben. Der Geruch hatte Leblanc besänftigt. Er ließ sich Geschichten aus der Bäckerei erzählen, und nach drei Gläsern eines guten Bordeaux war er tatsächlich neben der wohlriechenden Annie eingeschlafen. Aber sein Schlaf währte nicht lange. Einmal erwacht, gingen ihm die Sorgen um seine Mutter durch den Kopf. Seine Unruhe breitete sich im ganzen Körper aus, er wälzte sich hin und her. Viel später war er dann noch einmal kurz eingeschlafen. Leblanc stand auf und sah aus dem Fenster. Die Ursache der Stille war der Schnee, der die Geräusche schluckte. Man hörte nicht einmal den Müllwagen, der um diese Zeit die Tonnen leerte.
Jacques Leblanc zog sich an. Als Annie erwachte und ihn ansah, machte er ein Zeichen mit der Hand, dass er gehen würde. Sie kannte das. Meistens verließ Leblanc sie früh am Morgen, um, bevor er sich ins Präsidium begab, in seiner Wohnung vorbeizuschauen, die nur zehn Minuten zu Fuß von ihrer entfernt lag. Heute brauchte er länger. Seine Halbschuhe mit den Ledersohlen waren dem Schnee nicht gewachsen. Sie rutschten auf der nassen Oberfläche, und Leblanc fühlte sich wie auf einem schwankenden Schiff. Wenn er zu einer Hauswand oder einer Straßenlaterne griff, um Halt zu finden, dachte er, dass jeder, der ihn so sähe, denken müsste, er irrte volltrunken durch den frühen Morgen. Der Gedanke erheiterte ihn. Die Heiterkeit half aber nicht gegen das Frösteln. Er müsste sich ausstatten mit Stiefeln mit Profilsohle und einer Daunenjacke, mit einer Wollmütze und Handschuhen, so wie die anderen. Nein, das konnte er nicht. Das wäre nicht mehr er, Jacques Leblanc. Und Schnee gab es ja auch nur selten, wie die Einheimischen sagten.
Drei
Marie hatte anstrengende Tage hinter sich. Aber die Mühen hatten sich gelohnt. Zusammen mit dem Präsidenten der Gesellschaft der »Freunde Marcel Prousts«, Monsieur Richard, hatte sie in ihrer Funktion als seine Stellvertreterin eine Konferenz in Cabourg organisiert. Zwei Tage lang waren Vorträge gehalten worden über das Thema »Essen und Trinken bei Marcel Proust«. Marie liebte in Prousts Werk besonders die Stelle, an der nach dem Genuss einer in Tee getauchten Madeleine, dieses Gebäcks in Form einer Jakobsmuschel, bei dem Erzähler die Erinnerung einsetzt, an die Aufenthalte bei den Großeltern und der Tante. Dieses Phänomen hatte sie bei sich selbst auch schon häufiger beobachtet. Wenn ihr ein bestimmter Geruch in die Nase stieg oder ein Geschmack ihren Gaumen reizte, stellten sich Bilder aus ihrer Vergangenheit ein. Bei ihren Großeltern auf dem Land, die sie in den Schulferien immer besuchen durfte, gab es eine dunkle Ecke im Keller, in der Kartoffeln gelagert wurden. Der Keller war ihr unheimlich gewesen, und immer, wenn sie später diesen erdigen Kartoffelgeruch wahrnahm, sah sie im Geist das alte Haus ihrer Großeltern vor sich, das längst einem Neubau gewichen war, und erinnerte sich an das Gefühl, einer Mischung aus schaurigem Grusel und unwiderstehlicher Verlockung, das der Keller in ihr als Kind ausgelöst hatte.
Für die Konferenz hatte der Bürgermeister den Vortragsraum des Rathauses zur Verfügung gestellt, und natürlich hatten sie im Grand Hôtel die Mittag- und Abendessen eingenommen, der Speisesaal war eigens für diesen Zweck reserviert worden. Die Küche des Grand Hôtel hatte keine Mühen gescheut, auch ungewöhnliche Gerichte wie Kohlsuppe mit Speckwürfeln oder Rindfleisch mit Karotten in Aspik, wie sie in Prousts Werk erwähnt werden, nach alten Rezepten nachzukochen. Etwa vierzig Personen hatten an der Tagung teilgenommen, auch deutsche Proust-Forscher waren der Einladung gefolgt. Zwei von ihnen hatten in Maries Gästehaus in Trouville gewohnt und das Konferenzwochenende um einen Tag verlängert. Mit diesen zwei Professoren hatte sie gestern Mittag im Central gegessen – und dort Jacques angetroffen. Sie musste schon wieder lachen, wenn sie daran dachte. Jacques und seine Bemerkungen! Allerdings wusste man bei ihm nie, wann er es ernst meinte und wann er nur witzig sein wollte.
Nun brachte sie die zwei Professoren zum Bahnhof in Trouville, wo sie den Zug nach Paris nehmen und vom Flughafen Charles de Gaulle zurück nach Deutschland fliegen wollten. Sie zeigten sich begeistert über die in Cabourg verbrachte Zeit, besonders der Romanistikprofessor aus Köln, Herr Rösler, lobte die angenehme Atmosphäre.
»Madame Bertaux, es war uns ein besonderes Vergnügen, die Tage bei den ›Freunden Marcel Prousts‹ in Cabourg und in Ihrem Gästehaus in Trouville verbringen zu dürfen. Eine exzellente Organisation, erstklassige Vorträge und vorzügliches Essen. Vielen Dank für die Einladung. Wir werden uns mit einer Gegeneinladung revanchieren.«
»Danke sehr, die nehme ich gern an, Monsieur Rösler. Kommen Sie gut nach Hause. Ich hoffe, dass die Züge trotz des Schnees pünktlich sind.«
»Der Schnee, ein zusätzliches i-Tüpfelchen, durchaus erlebenswert. Man kennt die Normandie nur im Sommer, so wie auch Proust zu seiner Zeit. Der hätte natürlich bei derartigen Witterungsverhältnissen sofort Reißaus genommen, bei seiner angeschlagenen Gesundheit. Manchmal war es ihm sogar im August zu kühl. Ein sensibler Zeitgenosse. Immerhin haben wir dieser Sensibilität ein Meisterwerk zu verdanken, nicht wahr?«
Die Herren Professoren winkten ihr noch einmal zu, bevor sie die kleine Bahnhofshalle betraten.
Gestern hatte es zu schneien begonnen, zum Glück erst gestern, dachte Marie erleichtert, denn bei verschneiten Straßen wären die Autofahrten nach Cabourg am Wochenende beschwerlicher gewesen. Sie war froh, dass sie das Auto nun, da ihre Gäste abgereist waren, abstellen und sich ungetrübt über den Schnee freuen konnte. Fünf Tage bis Weihnachten, und sie hatte noch viel zu tun. Ihre beiden Kinder Charles und Elisabeth hatten sich angekündigt. Charles arbeitete in London in einer Bank und hatte es mit seinen dreiundzwanzig Jahren weit gebracht. Ganz genau wusste Marie nicht, welche Bankgeschäfte zu seinem Tätigkeitsbereich gehörten. Er verdiente jedenfalls eine Menge Geld. Einen größeren Gegensatz als den zwischen ihrem Sohn und ihrer Tochter konnte es kaum geben. Elisabeth studierte in Straßburg Agrarwissenschaft, engagierte sich für ökologische Landwirtschaft und hatte im Sommer ein Praktikum in Norddeutschland bei einem Betrieb für Kartoffelanbau absolviert, wo sie, wie sie stolz erzählte, alte Sorten erneut züchteten. In Deutschland, sagte sie, sei man viel konsequenter im Bio-Anbau als in Frankreich. Marie freute sich auf ihre beiden Kinder.
Sie fuhr vom Bahnhof zurück zu ihrem Gästehaus. Die beiden Professoren waren ihre letzten Gäste vor Weihnachten gewesen. Sie hielt die Zimmer für ihre Kinder frei, obwohl es Anfragen von Interessenten gegeben hatte. Merkwürdig, fand sie, dass Leute die Festtage nicht zu Hause verbringen wollten. Aber offenbar gab es immer mehr davon, denn Trouville bot für Weihnachtsflüchtlinge ein komplettes Programm an, von Tanzabenden mit Diner im Casino bis hin zu Kutschfahrten in die Umgebung. Die neueste Attraktion war eine Kunsteisbahn, die die Stadt am Ufer der Touques errichtet hatte und die jeden Nachmittag bis zum Abend mit ihrer Musik die Stadt beschallte. Die vorwiegend jungen Eisläufer bewegten sich zu den Rhythmen der Musik. Viele Anwohner teilten das Vergnügen nicht und hatten sich bereits beschwert. Aber was dem Tourismus diente, hatte Vorrang.
Marie stellte den Wagen in der Nähe ihres Hauses auf dem Parkplatz vor der Kirche Bonsecours ab, zog ihren Lammfellmantel an, setzte die Wollmütze auf und machte sich auf den Weg zu ihrer Freundin Dominique, die ihren Hund, einen Golden Retriever namens Arsène, für die drei Tage, während derer sie mit der Tagung beschäftigt war, bei sich aufgenommen hatte. Dominique betrieb mit ihrem Mann Paul ein kleines Restaurant, das Paradis sur Terre, in einer Nebenstraße. Sie kamen gerade so über die Runden, im Winter war es besonders schwierig. Nur die Tatsache, dass sie keine Miete zahlen mussten, hielt das Restaurant am Leben. Dominique hatte das Haus, das ihnen auch als Wohnung diente, von ihren Eltern geerbt. Jetzt, am Nachmittag, war das Restaurant geschlossen. Vor der Tür am hinteren Ende des Hauses zog Marie ihr Telefon aus der Tasche und rief Dominique an. Sie kannte zwar den Code der Eingangstür, wollte aber nicht ohne Ankündigung im Flur stehen.
»Hallo, Dominique, ich bin vor der Tür. Soll ich hochkommen, oder bringst du mir die Bestie runter?«
Dominique lachte laut.
»Marie, komm rauf. Die Bestie hat Sehnsucht nach dir.«
Marie war kaum die halbe Treppe nach oben gestiegen, als Arsène ihr freudig winselnd und schwanzwedelnd entgegenschoss.
»Arsène, nicht auf der Treppe. Geh wieder hoch!«
Sie schob den Hund die Stufen hinauf, aber er tanzte um ihre Beine herum. Dominique wartete im Türrahmen. Trotz der schwierigen finanziellen Situation des Restaurants ließ sie sich ihren Kummer nie anmerken. Immer war sie fröhlich, und ihre schwarzen Locken wippten, wenn sie sich bewegte.
»Na, da freut sich aber jemand.«
»War er anstrengend?«
»Nicht besonders, er ist ein freundlicher Hund. Klar, dass man regelmäßig mit ihm spazieren gehen muss.«
»Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll, Dominique. Du hast genug Arbeit, und dann noch einen Gast, der ausgeführt werden will.«
»Ist schon gut, Marie. Es hat auch Spaß gemacht mit ihm. Aber er hat dich vermisst.«
»Ich hätte ihn nicht mitnehmen können nach Cabourg. Drei Tage war ich von früh bis spät im Einsatz. Immerhin hat es sich gelohnt. Alle waren zufrieden, jedenfalls haben sie das gesagt. So, dann befreie ich dich mal von dem Tier.«
»Hier, seine Decke, Fress- und Trinknapf. Das Kissen kannst du mitnehmen. Es hat ihm so gut gefallen, dass er es fast aufgefressen hat.«
Marie seufzte.
»Tut mir leid, ich kann es ihm nicht abgewöhnen. Er zerfetzt Kissen. Du bekommst ein neues von mir. Bis bald, Dominique, und nochmals danke.«
Marie leinte den Hund an, der lammfromm an ihrer Seite nach Hause trottete. Als sie am Central vorbeiging, dachte sie erneut an Jacques, wie er gestern den Eifersüchtigen gespielt hatte. Seit Juni, als sie den Toten am Strand gefunden und ihn angerufen hatte, hatten sie sich kaum gesehen. Einmal hatte sie ihn zufällig getroffen, und er wollte sich sofort mit ihr verabreden. Sie war dann mit ihm bei Dominique im Restaurant gewesen, und er hatte sie nach Hause gebracht. Seinen bittenden Blick hatte sie ignoriert, ihre Gästezimmer waren belegt, und in ihre Wohnung wollte sie ihn nicht mitnehmen. Das musste im September gewesen sein, es war noch sommerlich warm gewesen, und sie erinnerte sich an einen klaren, hellen Sternenhimmel. Das mit Jacques war eine merkwürdige Sache. Sie mochte ihn immer noch, aber sie wusste auch, dass ihr eine Beziehung, wie sie sie mit ihm in Paris gehabt hatte, zu anstrengend wäre. Damals hatte sie gedacht, er würde ruhiger werden, seine Selbstinszenierungen würden mit der Zeit nachlassen. Aber nach drei Jahren hatte sie erkannt, dass er sich nicht ändern würde, dass er seine Umgebung als Bühne betrachtete, die er mit einem Feuerwerk aus Charme bespielte. Bezaubernder, witziger, unbeständiger Jacques! Die Erinnerung an ihn brachte ein Lächeln auf ihrem Gesicht hervor, als sie die Ziffern des Codes ihrer Haustür eingab.
Auf Arsènes Fell hatten sich Schneeflocken niedergelassen. Sie wischte sie notdürftig mit der Hand ab und schüttelte den Schnee von Mantel und Mütze. Es war erst drei, aber schon dämmrig. Arsène trottete auf seine Decke, die Marie neben den Kamin im Salon gelegt hatte. Sie ging die zwei Treppen hinauf in ihre Wohnung und hatte gerade die Heizung höher gedreht, als das Telefon klingelte. Es war Rachel, ihre Freundin aus Kinderzeiten.
»Hallo, Marie, sind deine Proustianer abgereist? Ist die Tagung gut gelaufen?«
»Ja, ich bin zufrieden, die anderen waren es auch, glaube ich.«
»Davon bin ich überzeugt. Wenn du etwas organisierst!«
»Danke für das Kompliment. Gerade habe ich Arsène von Dominique abgeholt, und jetzt fühle ich mich ein bisschen erschöpft.«
»Deswegen rufe ich an. Bleibt es bei unserer Verabredung um fünf? Oder bist du zu müde?«
»Nein, es bleibt dabei. Ich freue mich, dich zu sehen, und dieses Mal auch Masako, nach so langer Zeit. Schön, dass sie mitgekommen ist. Und sag ihr schon mal meinen Dank für die Einladung zur Teezeremonie. Ich bin sehr gespannt. So etwas habe ich noch nie mitgemacht.«
»Ich kann dir versprechen, dass du gestärkt und in buddhistischer Ruhe nach Hause gehst. Auf mich wirkt diese Teezeremonie immer wie eine Meditation, du wirst sehen. Dann bis später, Marie.«
»Kann ich Arsène mitbringen? Er musste mich so lange entbehren, ich würde ihn ungern alleinlassen.«
»Ja, klar, bring ihn mit.«
Rachel war Künstlerin und verkaufte ihre Bilder mit Erfolg auf internationalen Ausstellungen. Marie war mit ihr zur Schule gegangen, und seitdem verband die zwei eine enge Freundschaft. Während Marie ihre kleine Ferienwohnung im Hôtel des Roches Noires verkauft hatte, als sie von Paris ganz nach Trouville übersiedelte, besaß Rachel ihr Zweizimmerappartement nach wie vor und nutzte es als Rückzugsort, wenn sie sich von den Reisen und den anstrengenden Präsentationen in Paris erholen wollte. Normalerweise kam sie allein, ohne ihre Lebensgefährtin Masako, mit der sie in Paris eine Wohnung teilte. Aber nun hatten die beiden beschlossen, die Weihnachtstage und das Jahresende in Trouville zu verbringen. Masako war Japanerin und Schriftstellerin und, wie Marie kürzlich erst erfahren hatte, Teemeisterin. Was das genau bedeutete, konnte sie sich nicht vorstellen. Aber das würde sie heute erfahren, denn sie war von Masako zu einer Teezeremonie eingeladen. Marie legte sich aufs Sofa und begann, einen Artikel im Ouest-France zu lesen. Zehn Zeilen schafften ihre Augen, dann sank ihr die Zeitung auf die Brust. Sie war eingeschlafen.
Vier
A