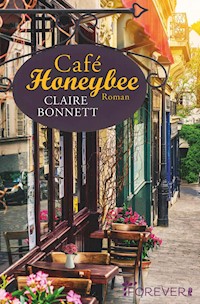4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
**Wenn dein Herz zu fliegen beginnt** Coco hat es geschafft: Als erfolgreiche Ballerina lebt sie ihren Traum und tanzt auf der Bühne der glanzvollen Pariser Oper. Doch seit einem folgenschweren Unfall hat die temperamentvolle Balletttänzerin das Vertrauen in ihren Partner verloren. Erst der charmante Farid, ein Trapez-Künstler des Pariser Winterzirkus, schenkt ihr neuen Mut. Der begnadete Artist und Herzensbrecher willigt ein, Coco beim Training zu helfen – und lässt sie dabei nicht nur Übungen unter dem Zirkusdach absolvieren, sondern auch ihr Herz in ganz neuem Rhythmus schlagen … Eine Liebeserklärung an die Stadt der Liebe und die Kunst des Tanzens Eine Ballerina, die das Vertrauen in ihr Können wiederfinden muss, und ein Artist, der ihr zeigt, was perfekte Harmonie bedeutet. Der ideale Winterroman für alle, die sich von einer einzigartigen Liebe in Paris verzaubern lassen wollen. //»Winterküsse in Paris. Spitzentanz und Zirkusliebe« ist ein in sich abgeschlossener Einzelband.//
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Impress
Die Macht der Gefühle
Impress ist ein Imprint des Carlsen Verlags und publiziert romantische und fantastische Romane für junge Erwachsene.
Wer nach Geschichten zum Mitverlieben in den beliebten Genres Romantasy, Coming-of-Age oder New Adult Romance sucht, ist bei uns genau richtig. Mit viel Gefühl, bittersüßer Stimmung und starken Heldinnen entführen wir unsere Leser*innen in die grenzenlosen Weiten fesselnder Buchwelten.
Tauch ab und lass die Realität weit hinter dir.
Jetzt anmelden!
Jetzt Fan werden!
Claire Bonnett
Winterküsse in Paris. Spitzentanz und Zirkusliebe
**Wenn dein Herz zu fliegen beginnt**Coco hat es geschafft: Als erfolgreiche Ballerina lebt sie ihren Traum und tanzt auf der Bühne der glanzvollen Pariser Oper. Doch seit einem folgenschweren Unfall hat die temperamentvolle Balletttänzerin das Vertrauen in ihren Partner verloren. Erst der charmante Farid, ein Trapez-Künstler des Pariser Winterzirkus, schenkt ihr neuen Mut. Der begnadete Artist und Herzensbrecher willigt ein, Coco beim Training zu helfen – und lässt sie dabei nicht nur Übungen unter dem Zirkusdach absolvieren, sondern auch ihr Herz in ganz neuem Rhythmus schlagen …
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
Danksagung
Das könnte dir auch gefallen
© privat
Claire Bonnett, geboren 1997, wuchs in einem lebhaften Haushalt voller Bücher auf und begann bereits als Kind eigene Geschichten zu schreiben. Kreative Unterstützung erhält sie dabei von einer Notizbuchsammlung und einem elektrischen Klavier. Die besten Zutaten für ihre Romane findet die Autorin allerdings im Alltag, der ihrer Meinung nach immer noch die verrücktesten Ideen bereithält. Man muss sie nur aufschreiben.
1
Spring. Spring einfach. Es wird alles so viel leichter machen. Spring jetzt, Coco. Spring!
Nichts. Nichts passierte. Ich wollte doch! Ich wollte so sehr!
Okay, Coco. Hol tief Luft, geh in die Knie!
Mein rasendes Herz drängte gegen meine Rippen, als wollte es vor mir den Absprung wagen.
Jetzt, Coco! Jetzt!
Ich nahm Anlauf, stand schon auf den Zehenspitzen.
Du wirst fliegen!
Die Hände umschlossen meine Hüften, fingen mich auf und hoben mich hoch in die Lüfte. Ein gelöstes Lächeln glitt über meine Lippen und ich streckte den Rücken durch.
Geschafft! Du hast es geschafft!
Doch dann, im selben Moment als ich glaubte, der Bann sei gebrochen, krampften meine Muskeln. Wie Fesseln schlangen sie sich um meinen Körper und schnürten mir die Luft zum Atmen ab. Die Spiegel rings um uns wurden dunkel. Ein helles, viel zu helles Licht leuchtete in mein Gesicht und die Hände, die mir eben noch Halt gegeben hatten, fühlten sich an wie Krallen, die mich gen Abgrund zogen. Ein Stechen wanderte mein Rückgrat hinab und die Panik schlug schwer über mir zusammen. Einige Sekunden versuchte ich noch mich zu beherrschen, kämpfte gegen den Schmerz, der meine Glieder zittern ließ und meine Gedanken vor Entsetzen lähmte.
»Aufhören!«, rief ich. »Lass mich runter, Dorian!« Kaum, dass ich die Worte ausgesprochen hatte, stand ich schon wieder auf dem Boden. Mein Herz pochte rasend im Takt zu den immer gleichen Vorwürfen.
Du kannst es nicht. Du kannst es einfach nicht …
»Coco? Alles okay?«
Nicht mehr …
»Okay?«, wiederholte ich und wischte über meine brennenden Augen. »Was glaubst du, Dorian? Ist alles okay, wenn man nicht mal mehr … Verdammt!«
Das Zittern in meinen Beinen war so stark geworden, dass ich unfreiwillig in die Knie ging.
»Hey! Fall mir nicht um!« Schon stand er neben mir und griff nach meinem Arm. Verärgert wich ich aus.
»Ich komme zurecht!«, sagte ich harscher als beabsichtigt. Ich stützte die Hände in die Seiten und nahm einige tiefe Atemzüge. Langsam ließ das Zittern in meinen Beinen nach und ich gewann wieder die Kontrolle über meinen Körper zurück. Ich spürte, wie die Anspannung Stück für Stück abebbte und meine Gedanken schließlich ruhiger wurden. Ich blickte hinüber zu Dorian, der mich mit sorgenumwölkter Stirn musterte.
»Tut mir leid«, sagte ich zerknirscht.
»Du musst dich nicht entschuldigen«, erwiderte er. »Du brauchst einfach nur … noch ein wenig mehr Zeit.«
»Genau! Ein wenig Zeit, Übung und Geduld. Mehr ist es nicht, ganz bestimmt«, antwortete ich und nickte mit dem Kopf, mehr für mich selbst als für meinen Tanzpartner.
»Es ist völlig normal, Angst zu haben«, sagte Dorian mitfühlend. »Jeder würde nach so einer …«
»Ich habe aber keine Angst!«, unterbrach ich ihn und das eiskalte Gefühl, das mich dabei durchzuckte, strafte meine Worte Lügen. »Es ist nur mein Rücken, okay! Mein Rücken und … und die Beine.«
»Coco, ich bitte dich!« Jetzt war es Dorian, der mich streng ansah. Ich kannte den Ausdruck in seinen dunklen Augen nur zu gut. Es war der gleiche, mit dem er mich früher um Mitternacht aus dem Trainingssaal geholt hatte. »Übertreib es nicht, Coco! Geh endlich schlafen, Coco. Morgen kannst du immer noch dein Grand Jeté perfektionieren.« Nur dieses Morgen hatte sich leider in Rauch aufgelöst. Große Sprünge waren inzwischen mein kleinstes Problem.
»Wir versuchen es noch einmal, ja?«, sagte ich mit zusammengebissenen Zähnen. »Nur noch einmal.«
»Ich glaube, du weißt ganz genau, dass nicht nur dein Körper verrücktspielt …«
»Was soll das jetzt heißen?«, fragte ich scharf. »Wenn du keine Lust mehr hast, mit mir zu trainieren, dann sag es einfach geradeheraus.«
Dorian sah mich finster an, dann wandte er sich einfach ab und ging mit seinen weiten, leichtfüßigen Tänzer-Schritten zu den Spiegeln an der Wand.
»Es ist wirklich genug für heute«, sagte er und hob die Trinkflasche auf, die dort stand. »Wir sollten nach Hause gehen und du solltest eine Nacht über das schlafen, was ich gerade gesagt habe. Etwas muss sich ändern, Coco, sonst war es das bald. Die Kompanie ist nicht der richtige Ort für deinen Starrsinn.« Dorian klemmte sich die Flasche unter den Arm und ging ohne ein weiteres Wort Richtung Tür.
»Hey, warte! Du kannst doch nicht einfach …«, rief ich meinem Tanzpartner hinterher, doch der warf bei seinem Abgang die Tür so schwungvoll hinter sich zu, dass die Spiegel an den Wänden kurz erzitterten. Wer von uns beiden war gerade starrsinnig?
»Jetzt hab dich nicht so, Dorian!«, rief ich und warf den Kopf in den Nacken. »Komm zurück! Bitte!«
Doch die Tür war zugefallen und ich stand allein im hell erleuchteten Ballettsaal. Allein, direkt in der Mitte und plötzlich schienen all die Spiegel ringsum immer näher zu rücken. Schonungslos reflektierten sie mich von allen Seiten, egal in welche Richtung ich mich drehte. Jeden Zentimeter meiner hübschen Ballett-Hülle leuchteten sie aus. Sie zeigten eine Tänzerin, die von ihrem Körper im Stich gelassen wurde … Nein, so schnell bekam man mich nicht klein! Ich hob die Arme, brachte sie in Position, streckte die Beine durch und stellte mich auf die Zehenspitzen. So viel Abstand zum Erdboden schien ich also gerade noch auszuhalten. Ich folgte keiner bestimmten Choreographie, als ich begann zu tanzen. Ich hatte nichts, keine Abfolge, keine Melodie. Nur meine Gefühle und meine Gedanken, die mich leiteten. Früher hatte ich mir die Seele aus dem Leib getanzt, wenn es erlaubt war zu improvisieren. Jetzt waren es langsame, kontrollierte Bewegungen, die die Figuren miteinander verbanden.
»Sieh dich nur an, Coco«, dachte ich verächtlich, als ich mich im Spiegel beobachtete. »Du tanzt mechanischer als eine Puppe.« Ich konnte den Blick einfach nicht abwenden, denn genau das brachte man uns Balletttänzern von klein auf bei. Hinsehen. Registrieren. Jeden noch so kleinen Fehler bemerken. Wer nach oben wollte, musste die Konkurrenz in den Details übertreffen. Doch das war wohl die zweite Sache, die meine Karriere als Tänzerin ruinieren würde. Ich hatte begonnen zu hassen, was ich im Spiegel sah. Eine junge Frau mit rabenschwarzen Haaren, die einmal hüftlang gewesen waren und jetzt noch knapp bis zu ihren Schultern reichten. Hochgewachsen war diese Frau, fast ein wenig zu sehr, um Ballerina zu sein. Ihre Augen saßen groß und dunkel in einem kleinen hellen Gesicht, aber – hatten die nicht mal Funken gesprüht? Hatten die nicht mal herausfordernd jeden Blick erwidert? Wie zum Beispiel an dem Tag, an dem sie sich das Ohrpiercing hatte stechen lassen? Den kleinen Goldring an ihrer Ohrmuschel, der bei Pirouetten durch das dunkle Haar blitzte? Sie hatte es sich leisten können. Wer hätte sie deswegen schon rausgeschmissen? Niemand. Sie war die Beste gewesen.
»Gewesen, das trifft es genau«, schoss es mir durch den Kopf. »Und statt deine Freunde um Hilfe zu bitten, jagst du sie lieber davon … Großartige Strategie, Coco.«
Ich senkte den Blick und betrachtete den matten Satin meiner Spitzenschuhe. Ich hätte Dorian nachlaufen, ihn um Verzeihung bitten sollen. Aber der herausfordernde Funke in mir war vor einiger Zeit einem kalten, trotzigen Starrsinn gewichen, den der Arme jedes Mal zu spüren bekam, wenn er versuchte mir zu helfen.
»Mademoiselle?«
Ich schreckte auf. Im Türeingang stand eine ältere Frau in einem dunkelblauen Kittel.
»Sind Sie hier fertig?«, fragte sie und zog eine Augenbraue hoch. »Ich bin zum Absperren da.«
»Ich? Ja, ich wollte gerade gehen«, erwiderte ich, auf seltsame Weise dankbar eine Ausrede zu haben, den Saal zu verlassen. Nur die traurige Gestalt mit den hängenden Schultern, die nicht mehr tanzte wie früher und Panikattacken bekam, wenn man sie in die Lüfte hob, die konnte ich leider nicht im Spiegel dalassen. Die musste ich mitnehmen. Und sie klebte an mir wie Pech.
***
In der Pariser Oper war es um diese Zeit ruhig in den Gängen. Natürlich blieben einige Tänzer abends oft noch, um zu trainieren, aber ich hatte darauf geachtet, dass Dorian und ich die letzten waren. Der Gedanke, die anderen Mitglieder der Kompanie könnten sehen, wie ich mich für Figuren abrackerte, die mir einmal so leichtgefallen waren, machte mich krank. Außerdem mochte ich die alten Übungssäle unter dem Dach, hier hatten schon seit Jahrzehnten Balletttänzer geprobt. Das Trippeln ihrer Spitzenschuhe über die alten Holzdielen hatte ihnen den Beinamen ›petits rats‹, kleine Ratten, eingebracht. Ähnlich wie eins der Nagetiere huschte ich jetzt den Gang hinunter und warf immer wieder einen flüchtigen Blick auf die riesigen Schwarzweiß-Fotos berühmter Ballerinas und deren Partner, die an den Wänden hingen. Früher war ich manchmal davor stehen geblieben und hatte mir ausgemalt, wie eines Tages ein überlebensgroßes Bild von Dorian und mir dort hängen würde. Ich, in einem Solopart von Schwanensee, am liebsten als Odile, dem schwarzen Schwan, denn ein braves Mädchen war ich noch nie gewesen. Und im Hintergrund dieses Bildes hatte ich mir immer meine Mutter im Publikum vorgestellt, anerkennend klatschend. Ausnahmsweise keinen guten Ratschlag auf den Lippen und unheimlich stolz auf das, was ich tat. Ich wandte wieder den Blick ab und schlich in die Damenumkleiden. Meine Mutter war so gut wie nie zu meinen Vorstellungen gekommen …
***
Als ich den Spind öffnete und meine Sachen herauszerrte, fiel mir beinahe mein Handy auf die Füße. Ich fing es gerade noch auf und sah auf den schwarzen Bildschirm hinab. Sollte ich Dorian anrufen? Ihm eine Nachricht schreiben? Meine Finger schwebten bereits über dem Display. Ich sehnte mich danach, seine beruhigende Stimme zu hören, die mir seit meinem ersten Tag an der Ballettakademie eine Stütze gewesen war. Immerzu war Dorian auf seine ruhige, fast schon stoische Art für mich da gewesen. Der verlässliche Gegenpol zu meinem aufbrausenden Charakter und der geduldige Vermittler, wenn ich mal wieder mit einer Lehrerin gestritten hatte. Ich schluckte, dann legte ich das Handy auf die Bank. Ich würde mit ihm reden, wenn wir uns wieder persönlich zum Training sahen. Kaum dass ich diese Entscheidung gefällt hatte, konnte ich fast schon wieder seine amüsierte Stimme hören. Für so eine aufbrausende junge Dame bist du manchmal ganz schön feige, Coco. Unangenehme Wahrheiten waren schon immer seine Spezialität gewesen. Aber waren beste Freunde nicht genau dafür da? Ja, Dorian und ich, unzertrennliche Freunde. Partner in Crime. Mit zwölf Jahren hatten wir gemeinsam die Aufnahme-Prüfung der renommierten Ballett-Akademie der Pariser Oper bestanden und die beste, aber auch schwierigste Ausbildung des Landes genossen. Eine Zeit wie diese schweißte zusammen, darum waren wir Profis, kein Liebespaar. Ein kleiner Seufzer entfuhr mir, als ich aus meinem Trainings-Trikot in meine Alltagsklamotten schlüpfte. Ich hatte in den letzten Wochen viel öfter als sonst an diese vergangenen Tage zurückgedacht. Was hatte ich sie wegen ihrer Härte verflucht – jetzt vermisste ich sie. Damals war ich mir noch so sicher gewesen am richtigen Ort zu sein … Ich ließ mich auf die Bank der Umkleide sinken, strich vorsichtig über meine Knie und dann mit dem Handrücken meine Wirbelsäule entlang. Der Schmerz war so schnell wieder abgeklungen, als hätte jemand einen Schalter umgelegt. Doch er konnte mich genauso plötzlich wieder aus einer finsteren Ecke heraus anspringen. Ich drückte probehalber etwas fester gegen meinen Rücken, fühlte die Wirbelknochen durch den dünnen Pullover – und nichts passierte. Was, wenn Dorian recht hatte und der Grund war wirklich … Schluss damit! Ich stand auf und griff nach meiner Tasche und meinem Mantel. Als ich die Umkleide verließ, verfingen sich fast meine Haare in den Stechpalmenzweigen, mit denen einige übereifrige Weihnachtsfans den Türrahmen dekoriert hatten. Ganz ehrlich, dass die Weihnachtszeit bevorstand, bekamen wir Balletttänzer ohne diese Gedächtnisstütze wirklich nicht mit. Es gab so viel Wichtigeres für uns als Weihnachten …
2
Paris im Winter. Manche fanden es ja romantisch. Die schmiedeeisernen Straßenlaternen, die in der Früh manchmal von Raureif bedeckt waren, die vielen kleinen Glühlämpchen, mit denen die Händler ihre Stände am Straßenrand schmückten oder das tintenschwarze Funkeln der Seine, das im Dezember so viel geheimnisvoller wirkte. Oder die heißen Maronen, die man jetzt plötzlich an jeder Straßenecke kaufen konnte, und die Künstler am Place du Tertre, die, nun mit dicken Handschuhen versehen, ihre Bilder zeichneten und sich hinter ihren Leinwänden gegen den kalten Wind zusammenkauerten. Auch die Pariser Oper machte in den Wintermonaten wirklich etwas her. Wobei sie natürlich zu jeder Jahreszeit ganz schön einschüchternd wirken konnte. Die Opéra war ein riesiger, kastenförmiger Bau aus dem neunzehnten Jahrhundert. Der unterste Teil wurde von beigen Steinbögen gesäumt. Im Stockwerk darüber wurden die hohen Fenster von Säulen eingebettet. Am imposantesten aber war das grüne, geschwungene Kuppeldach und die zwei goldenen Statuen an ihren Rändern. Sie stellten die Kunst und die Musik dar und blickten seit vielen, vielen Jahren auf all die Leute herunter, die das Palais betraten. Ganz egal, ob Künstler oder Zuschauer. Ich hatte früher geglaubt, die beiden wären so etwas wie gute Geister, die besonders auf das Bühnenvolk achtgaben, denn wir hauchten der Oper schließlich Leben ein. Mittlerweile war ich mir da nicht mehr so sicher. Ich zog meinen dicken Wollschal über die Nase und lief die Stufen zur Métro hinunter. Es wurde Zeit, dass ich nach Hause kam.
***
Es gab ja einige Klischees über Künstler. Künstler waren arm. Sie lebten in zugigen Dachwohnungen, hatten nichts zu essen, tranken zum Ausgleich umso mehr Rotwein, rauchten und schmissen ausgiebige Partys. Außerdem hatten sie zur Inspiration ständig hemmungslosen Sex. Die Wahrheit sah bei uns Tanz-Künstlern ein wenig anders aus. Einerseits, ja, reich waren wir wirklich nicht. Weil in Paris Wohnraum schon für Normalverdiener kaum bezahlbar war, stellte die Opéra Garnier eigene Wohnungen für die Mitglieder der Kompanie bereit. Nur befanden sich die am äußersten Rand von Paris. Ich lebte dort mit zwei anderen Tänzerinnen in einer WG zusammen. Wilde Partys und Alkohol-Exzesse konnten wir uns in unserem Job schlicht nicht leisten. Unser Körper war unser Kapital. Wir brachten ihn schon in unserem Berufsalltag ständig an seine Leistungsgrenzen, da konnten wir nicht regelmäßige Trink-Gelage obendrauf setzen. Tatsächlich erforderte unsere berufliche Profession einen ziemlich spießigen Lebenswandel. Gesunde Mahlzeiten, morgens Yoga und abends früh ins Bett so lautete das künstlerische Erfolgskonzept. Umso überraschter war ich deshalb, Roxane Leclerc mit einer riesigen Packung Cookie-Eis im Schoß und dem Laptop auf dem Couchtisch vorzufinden, als ich gegen halb zwölf unsere Wohnung betrat.
»Roxane?«, fragte ich verwundert und schmiss meine Jacke über einen der Stühle am Esstisch. Ich baute mich vor meiner Mitbewohnerin auf und stemmte die Hände in die Seiten.
»Also erstens bin ich froh, dass du endlich deine Dauer-Diät aufgibst und zweitens hoffe ich ganz stark, du hast was für mich übriggelassen«, sagte ich vorwurfsvoll.
Roxane sah mit einem schiefen Lächeln zu mir auf und drehte dann den Ton eines Disney-Films leiser.
»Chérie, ich habe diese Packung allein für dich vorgekostet«, sagte sie und schob sich zum Beweis einen weiteren riesigen Löffel voll in den Mund.
Ich fragte mich, wie so viel Eis überhaupt in jemanden wie sie hineinpassen sollte. Roxane war eine schmale Person von 1,65 Metern. Zart wie ein Vogelküken und quirlig wie ein Wirbelwind. Eine Eigenschaft, die Roxane bei uns den Spitznamen petit colibri – kleiner Kolibri – eingebracht hatte.
»Sag mal, fragst du dich nicht auch manchmal, ob wir nach unserer Ballett-Kariere als alte graue Jungfern enden«, sinnierte sie und machte mir auf dem Sofa Platz. »Glaubst du, die Verwaltung erlaubt uns hier wohnen zu bleiben und wir halten uns dann ein paar Kätzchen zur Gesellschaft? Oder wir werden eine von diesen mäkeligen Theaterkritikerinnen, die ständig in die Vorstellungen marschieren, um alles schlecht zu finden und an die guten alten Zeiten erinnern …«
»Meine Güte, Roxane!«, rief ich überrascht und vergaß einen Moment, dass ich mich eigentlich bei ihr wegen meines miserablen Nacht-Trainings ausheulen wollte.
»Ich möchte ja nicht theatralisch werden! Oder melancholisch!«, hob sie an und deutete mit einem eisverschmierten Löffel auf mich. »Aber ich befürchte, ich sterbe einmal alt und einsam.«
»Nun mach aber mal einen Punkt«, sagte ich verwirrt.
»Hast du heute Abend zufällig Pas de deux trainiert?«, fragte Roxane und hob ihre hauchfein gezupften Augenbrauen.
»Ja und es war einfach …«
»Und hieß dein Partner dabei zufällig Dorian Barratier?«
»Ja? Und?«, fragte ich ungeduldig.
»Da hast du es!«, rief Roxane. »Da kratze ich nach all der Zeit endlich – endlich! – den Mut zusammen, ihn zu fragen, ob er Lust hat, heute Abend mit mir auszugehen und dann behauptet der Kerl, er wäre zu müde, um etwas zu unternehmen. Weißt du, was noch schlimmer ist, als einen Korb zu bekommen? Wenn der Korb-Verteiler keine anständige Ausrede zustande bringt. Dann könnte ich mir jetzt nämlich einreden, dass er vielleicht wirklich nur müde war. Aber so weiß ich, dass er Null Interesse an mir hat und nicht die Courage, es auszuformulieren. Offensichtlich ist ihm eine Bromance mit dir wichtiger als eine Romance mit mir.«
»O nein«, seufzte ich. »Nicht das schon wieder.«
Seit ihrem ersten Tag in der Kompanie schmachtete Roxane Dorian an (so wie ungefähr – 90 Prozent? – der anderen Tänzerinnen). Und ich wusste nicht, wie oft ich schon dazu verdammt gewesen war, Vermittlerin zu spielen oder mich mit Eifersüchteleien herumzuschlagen, wenn ich Zeit mit Dorian verbrachte. Er war schon immer ein Frauenschwarm gewesen, nur hatte ihn bisher keine einzige erobert. Ich glaubte, den Grund dafür zu kennen. Nur stand es mir nicht zu, diese Vermutung mit Roxane zu diskutieren …
»Tut mir wirklich leid, dass es so gelaufen ist«, versuchte ich sie zu beschwichtigen. Ich wandelte jetzt auf einem schmalen Grat. Einerseits war ich ziemlich sicher, dass Dorian kein Interesse an ihr hatte, andererseits wusste ich auch, warum er heute zu einer Notlüge gegriffen hatte.
»Ich … ich habe Dorian gebeten niemandem zu sagen, dass wir noch zusammen trainieren würden.«
»Ach so?«, erwiderte Roxane erstaunt. »Warum das denn?«
»Weil … ich wollte nicht, dass uns jemand stört«, antwortete ich ausweichend. »Es lief wieder ziemlich beschissen, um ehrlich zu sein.«
»Dein Rücken?«, fragte Roxane mitfühlend.
Sie war eine der wenigen Tänzerinnen, bei denen ich das Gefühl hatte, dass ihre Anteilnahme echt war. Die anderen erkundigten sich nur nach meinem Zustand, um einschätzen zu können, wann ich meinen Job verlieren würde. Aber Roxane war anders. Sie versuchte Konkurrenz und Freundschaft so gut es ging auszubalancieren.
»Dorian meinte, wenn sich nicht bald etwas ändert, schmeißt mich Weissmann aus der Kompanie.«
»Ach, das würde er nicht tun«, sagte Roxane sofort. »Weissmann sieht doch Großes in dir. Er wird dich immer allen anderen vorziehen.«
»Hm«, gab ich wenig überzeugt zurück. »Aus Mitleid will ich jedenfalls nicht dabeibleiben. Da gehe ich lieber freiwillig.« Ich schlang die Arme um meine angezogenen Beine und legte nachdenklich mein Kinn auf die Knie.
»Aber, Coco, meinst du, wenn … wenn ich Dorian vielleicht ein anderes Mal frage, ob er mit mir ausgeht, dann sagt er Ja? Eigentlich könnten wir beide auch öfter zusammen trainieren. Immerhin bin ich die Zweitbesetzung der Hauptrolle im aktuellen Stück!« Roxane blieb hartnäckig.
Ich seufzte. Meine Mitbewohnerin und ich waren, was Romantik anging, grundverschiedene Menschen. Während Roxane nichts lieber tat, als die attraktivsten Tänzer der Kompanie anzuschmachten und abends Nicholas Sparks Liebesromane zu verschlingen, hatte ich irgendwann die pragmatische Einstellung entwickelt, die Karriere dem Knutschen vorzuziehen. Wenn in der Vergangenheit mal Schwärmereien bei mir aufgetreten waren, hatte ich sie mir wieder aus dem Kopf trainiert. Schließlich hatte ich oft genug mitbekommen, wie andere Tänzerinnen ihre Technik vernachlässigten, weil sie Liebeskummer hatten oder vor lauter Zuckerwatte im Kopf plötzlich die Trainings schwänzten. Dass ich an dieser Stelle niemals schwach werden würde, hatte ich mir darum schon früh geschworen. Mit der Opéra verheiratet zu sein reichte völlig.
»Was ist denn mit Frédéric?«, fragte ich, um Roxane abzulenken. »Der Kerl liegt dir doch zu Füßen. Warum geht ihr beide nicht einmal aus?«
»Frédéric«, schnaubte Roxane und pflückte mit dem Löffel ein Cookie aus ihrem Eis. »Frédéric ist natürlich sehr … nett. Aber er ist einfach nicht Dorian. Mit Frédéric würde ich Weihnachtsgeschenke für meine Mutter kaufen gehen. Aber mit ihm habe ich keine Fantasien, wie wir beide …«
»Schon gut, alles klar!«, winkte ich heftig ab. »Ich hab es kapiert. Er ist nicht dein Typ.«
»Leider gar nicht, Coco. Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, wieso du überhaupt mit Dorian trainierst. Immerhin ist er es, wegen dem du … du weißt schon.«
Immerhin war es Dorian, wegen dem ich nicht mehr tanzen konnte? Ja, verdammt richtig. Aber was hätte es schon genutzt, meine Wut an ihm auszulassen? Es war ein Unfall gewesen. Ein dummer Unfall …
»Tut mir leid, Coco. Ich wollte dich nicht nerven«, sagte Roxane, die meinen finsteren Blick natürlich bemerkt hatte.
»Du nervst mich nie, kleiner Kolibri«, erwiderte ich und versuchte mich an einem beruhigenden Lächeln. Mich beschäftigte sowieso gerade eine viel dringendere Frage. »Sag mal, Roxane, woher wusstest du überhaupt, dass Dorian und ich heute Abend zusammen waren?«
»Louise hat es mir erzählt. Sie ist ungefähr eine halbe Stunde vor dir heimgekommen. Sie war trainieren und hat anscheinend kurz durch den Türspalt gespäht. Wollte angeblich nur nachsehen, ob es dir – gut geht? Keine Ahnung, was sie damit meinte.«
»Ich auch nicht«, brummte ich missmutig.
»Ach, nimm es dir nicht zu Herzen. Du weißt doch, wie die neuen Tänzerinnen so sind, furchtbar neugierig und besessen vom Training. Die haben alle Angst, man könnte sie nach zwei Wochen wieder feuern.«
»Bei Weissmann? Gar nicht so abwegig.«
Dass Louise mir nachschlich, war trotzdem eine beunruhigende Neuigkeit. Je weniger Menschen von meiner Misere wussten desto besser. Unsere neue Mitbewohnerin hatte es vielleicht wirklich nicht böse gemeint, aber es gab genug Leute, die meine Schwäche sofort zu ihrem Vorteil nutzen würden.
»Sie hat gesagt, dass du … dass es nicht nur dein Rücken ist. Sie hat gesagt, du hast Panik.«
Allein Roxanes Worte reichten aus, um mich für einen kurzen Moment in den Ballettsaal zurückzuversetzen. Helles Licht, viel zu grelles Licht und dann wieder der Schmerz. Ich biss die Zähne zusammen.
»Louise hat keine Ahnung und sollte sich gefälligst aus meinen Angelegenheiten heraushalten«, sagte ich so bestimmt wie ich konnte.
»Bleib locker, Coco! Natürlich hast du Recht. Sie sollte weniger Unsinn daherreden, aber ganz ehrlich, es hätte schlimmer kommen können. Stell dir vor, die Verwaltung hätte uns Valentina ins Appartement gesteckt.«
»La cata«, seufzte ich. »Weißt du noch, wie sie Mariette davon überzeugt hat, dass sie nicht für die Zweitbesetzung der Zuckerfee vortanzen sollte, weil sie sich nur blamieren würde?«
»Wie könnte ich das vergessen, aber am Ende habe ich das Rennen um die Zuckerfee gemacht, darum habe ich es ihr fast verziehen«, antwortete Roxane zufrieden und schraubte den Deckel ihres Eisbechers wieder zu. »Mach dir jedenfalls keine Sorgen wegen Louise. Egal, was die anderen sagen, Weissmann ist unbestechlich und jetzt komm, lass uns schlafen gehen. Morgen ist unser freier Tag, dann hast du auch mal Zeit, den Kopf etwas freizubekommen. Hast du schon Pläne?«
»Nein, nichts Bestimmtes«, erwiderte ich. Ich stand von der Couch auf und massierte meine schmerzende Schulter.
»Du solltest ein wenig unter Leute kommen«, erwiderte Roxane lächelnd und wischte sich mit dem Ärmel Schokoladenreste vom Kinn. »Freunde, Familie, egal, Hauptsache du gehst nicht schon wieder in die Opéra! Wer in Form bleiben will, sollte wenigstens einmal die Woche etwas völlig anderes machen. Unsere Muskeln und unser Hirn brauchen Zeit, um sich zu regenerieren.«
»Weise Worte, Colibri.«
»Gute Nacht, Coco!«
***
Ich kannte viele Arten von Schlaf. Schlaf aus Erschöpfung, Schlaf aus Glück, Schlaf aus Trauer, Schlaf zum Vergessen. Was es auch war, der Schlaf hinterließ normalerweise nur Träume. Gute oder schlechte, die mit dem ersten Sonnenstrahl verflogen und Platz machten für die hellen Gedanken des Tages. Seit einiger Zeit jedoch führten mich diese Träume Nacht für Nacht zurück in die Vergangenheit auf die Bühne der letzten Aufführung des Nussknackers. Es lag jetzt ein Jahr zurück und noch immer hörte ich die Melodie der Zuckerfee, die ich tanzte, und die Streicher des Orchesters. Ich schmeckte wieder die klebrige Süße der Zuckerstangen, die Roxane vor der Aufführung als Glücksbringer verteilt hatte. Ich spürte wieder Dorians Hände, die mich erst durch die Luft trugen, plötzlich keinen Halt mehr gaben und dann … der dumpfe Schmerz, das Licht, die lauten Stimmen, die alle durcheinander riefen und noch viel schlimmer, dann kam der Moment, in dem da gar kein Schmerz mehr war, nur Leere. Kein Gefühl mehr. Der Moment, in dem ich auf der Bühne lag, in meinem engen Kostüm mit den kleinen rosa Glasperlen und den Spitzenrüschen an den Ärmeln, und keine Luft mehr bekam. Als ich verzweifelt um Atem rang, weil ich meine Beine nicht mehr spürte …
Mit einem entsetzten Keuchen fuhr ich hoch. Schon wieder. Schon wieder hatte ich davon geträumt. Mein Herz pochte so schmerzhaft rasend in meiner Brust, als wollte es mich daran erinnern, dass ich wieder wach war. Ich riss die Bettdecke beiseite und strich über meine Beine wie jedes Mal, wenn ich aus dem Horror erwachte. Und immer noch überkam mich jedes Mal eine Welle der Erleichterung, wenn ich feststellte, dass sie schmerzten vom harten Training oder ganz warm waren von den Daunen meiner Decke. Hauptsache, ich spürte sie … und Hauptsache, Roxane und Louise hatten nicht gehört, dass ich mal wieder laut aus dem Schlaf geschreckt war. Ich ließ mich erschöpft wieder zurück in mein nassgeschwitztes Kissen fallen und verschränkte die Arme hinter dem Kopf. Während ich dalag und dem Ticken des kleinen Weckers auf meinem Nachttisch lauschte, fasste ich einen Entschluss. Wie hatte Roxane vorhin noch gesagt? Ich sollte mal wieder unter Leute kommen. Ja, es wurde höchste Zeit dazu, denn so konnte es wirklich nicht weitergehen. Ich musste Dorian widerwillig recht geben, ich brauchte Hilfe und ich wusste auch, wo ich sie vielleicht bekommen konnte …
3
Am rechten Ufer der Seine lag das zehnte Arrondissement von Paris. Abgesehen vom berühmten Place de la République konnte man in diesem Viertel zwei der drei Bahnhöfe der Stadt bestaunen, den Gare de l’Est und den Gare du Nord. Jeden Tag spülten sie Tausende und Abertausende von Menschen in die übervolle Metropole und auch ich hatte an einem Januartag vor fast zehn Jahren von dort aus mein Großstadt-Abenteuer begonnen. Ich war damals zwölf Jahre alt gewesen und hatte zwei Stunden in einem vollen TGV verbracht. Meine Mutter war nicht bereit gewesen mit mir nach Paris zu fahren – denn Ballett war ihr immer ein Dorn im Auge gewesen. Lieber wäre ihr gewesen, ihre beiden Töchter hätten akademische Berufe ergriffen und wären erst mit achtzehn nach Paris gezogen, um an der Sorbonne zu studieren. Aus diesem Grund hatte mich meine ältere Schwester damals begleitet. Tagelang musste ich sie darum anbetteln und ausnahmsweise hatte sie daraufhin dann mal etwas getan, das unserer Mutter missfiel, als sie mit zum Bahnhof kam. Die beiden waren vermutlich der Hoffnung erlegen, mein Traum vom Tanzen würde mit der Aufnahmeprüfung platzen, ich geläutert nach Plussulien, meinem kleinen Heimatort, zurückkehren und endlich vernünftig werden.
Vernünftig, das war schon immer das Lieblingswort meiner Mutter gewesen. Alles, aber auch alles im Leben musste ihrer Meinung nach »vernünftig« sein. Ob etwas schön war, Freude bereitete oder Spaß machte, das kam erst an zweiter Stelle. Zuallererst hatten die Dinge vernünftig zu sein. Das fing schon bei so profanen Entscheidungen wie der Kleiderwahl an und endete schließlich bei der gesamten Lebensplanung, einschließlich der Partnerwahl. Es war wohl der einzige Punkt, in dem ich meine Mutter zufriedenstellte, dass ich mir das Verlieben frühestmöglich (vernünftigerweise!) für meine Karriere untersagt hatte.
Davon abgesehen hatte ich schon in jungen Jahren begonnen, Mamans Konzept der vernünftigen Lebensführung zu hinterfragen. Ich hatte nie »vernünftige« Schuhe angezogen, sondern lieber die mit drei Zentimeter dicken Sohlen und Nieten an den Fersen, oder mir mitten in der bretonischen Einöde gewünscht Ballettstunden zu nehmen. Meine Schwester hingegen war brav dem pragmatischen Pfad gefolgt, den unsere Mutter stets vorgab, und hatte ein sehr unaufgeregtes, vernünftiges Leben geführt. Zum Beispiel hatte sie einen anständigen Schulabschluss gemacht, ein Studium begonnen und einen Beruf ergriffen, mit dem sich gut bei den Nachbarn angeben ließ. Ihr Beruf war letztendlich auch der Grund, warum ich an diesem zweiten Dezembertag an der Métro-Station Goncourt ausstieg. Ich hatte mich nicht entschlossen, meinen freien Tag im zehnten Arrondissement zu verbringen, um die Statue der Marianne am Place de la République zu bewundern. Nein, mein Ziel lag in der Avenue Claude-Vellefaux und war ein Ort, an dem hoffentlich die wenigsten Touristen landeten.
Kaum, dass ich den Gedanken zu Ende gebracht hatte, musste ich mich auf eine Verkehrsinsel retten, um einem Krankenwagen auszuweichen, der mit heulenden Sirenen an mir vorbeirauschte. Das war knapp! Ich hastete über den Zebrastreifen und steuerte den großen steinernen Torbogen an, der den Eingang des Hôpital Saint-Louis markierte. Gleich drei wehende Frankreich-Fahnen waren dort angebracht. Zwei links und rechts des Bogens und eine oben auf dem spitzen Dach des altmodischen Baus. Das Krankenhaus stammte aus dem siebzehnten Jahrhundert und war damals wegen einer Pestplage errichtet worden – oder so ähnlich? So hatte es mir jedenfalls meine Schwester erzählt.
Nachdem ich den geschichtsträchtigen Eingang des Hospitals passiert hatte, befand ich mich auch schon im wesentlich moderneren Inneren. Ich fragte mich manchmal, warum in Krankenhäusern immer alles weiß sein musste. Weiße Wände, weiße Vorhänge, weißes Licht von weißen Lampen an weißen Decken. Warum nur strich man Krankenhäuser nicht in bunten, kräftigen Farben an? Weiß erinnerte mich an Kälte. Die Farbe hatte für mich etwas Anonymes, Distanziertes. Keine Umgebung, in der ich mich wohlfühlte, aber eine in die meine ältere Schwester gut passte …
»Nein, Monsieur! Sie können mit so einem Schnitt unmöglich nach Hause!«
»Entschuldigen Sie, Madame, Sie sind gleich dran …«
»Kann vielleicht jemand Docteur Garik rufen?«
Paris war eine Stadt voll großer und kleiner Gefahren und egal welcher von ihnen man sich stellte, egal ob männlich oder weiblich, jung oder alt, egal ob Hundebiss oder Sturz vom Eiffelturm, meistens landete man erst mal hier, in der Notaufnahme des Hôpital Saint-Louis und dort war zu jeder Tages- und Nachtzeit die Hölle los. Krankenschwestern und Krankenpfleger liefen durcheinander, auf Bänken saßen Menschen jeden Alters und die Luft roch aufdringlich nach Desinfektionsmittel. Jetzt zur Erkältungssaison ging man besonders großzügig damit um und einige Leute wirkten tatsächlich, als wären sie mit ihrem ersten Anflug von Wintergrippe hierher gewankt. Ich schob mich an zwei Chinesinnen mit Mundschutz vorbei und zupfte eine etwas weniger gestresst aussehende Krankenschwester am Ärmel.
»Entschuldigung, wissen Sie vielleicht, wo ich Docteur Laffon finden kann?«
»Docteur Laffon?«, erwiderte die ältere Frau und sah mich prüfend an. »Die ist auf Station, betreut Patienten. Sie müssen in den Gebäudeteil A, dritter Stock, schauen Sie bei den Zimmern 2100 bis 2140.«
»Danke!« Ich nickte der Frau noch einmal zu, dann machte ich mich davon und nahm den Aufzug.
Während der Fahrt betrachtete ich mich nervös im Spiegel. Meiner Schwester zu begegnen war für mich fast wie meiner Mutter gegenüberzutreten. Ich begann davor jedes Mal, mein Haar nervös nach hinten zu streichen und die Schultern anzuspannen. Im zweiten Stock hielt der Lift noch einmal, während ich damit beschäftigt war, meinem Spiegelbild Mut und Selbstbewusstsein zuzusprechen. Ich musste überzeugend sein. Wenn meine Schwester mir nicht helfen konnte, hatte ich wirklich ein …
»Charlotte?«
Ich zuckte zusammen, als hinter mir im Spiegel plötzlich eine zweite Person mit einem Kaffeebecher in der Hand auftauchte. Diese Person sah mir recht ähnlich. Sie war eine acht Jahre ältere Version meiner selbst, nur mit etwas helleren Haaren und einer Brille. Diese Version war außerdem etwas kleiner und stämmiger als ich – und dazu imstande, mich ausnahmslos mit vollem Vornamen anzusprechen.
»Lucile!«, rief ich und drehte mich rasch um. »Die Schwester meinte, du arbeitest heute im dritten Stock.«
»Das stimmt auch«, erwiderte meine Schwester und hob den Kaffeebecher hoch. »Ich wollte mir nur etwas zum Wachwerden holen.«
Zwei junge Männer folgten Lucile in den Aufzug und drückten verschiedene Knöpfe. Meine Schwester stellte sich mit ihrem Getränk neben mich und sagte nichts, bis wir schließlich im dritten Stock ausstiegen und den Gang hinunterliefen. Lucile legte dabei ein Tempo an den Tag, bei dem es selbst mir als Balletttänzerin schwerfiel, ihr zu folgen. Im Laufen noch leerte sie ihren Kaffee und warf den Becher in den Müll.
»Du brauchst etwas von mir?«, sagte sie, während wir um eine Ecke bogen. »Zu Besuch kommst du nie hierher.«
Das war typisch Lucile. Worte wählte sie ebenso sparsam wie präzise.
»Richtig«, erwiderte ich. »Es geht wieder um, du weißt schon …«
»Deine Verletzung?«
»Ja, ich … meinst du, du könntest mir vielleicht …« Ich stoppte und zu meiner Überraschung blieb auch meine Schwester stehen. Sie musterte mich von oben bis unten und steckte dann die Hände in die Taschen ihres Kittels. Weiß – warum nur war hier alles so makellos weiß?
»Du warst doch vor ein paar Wochen im MRT.« Meine Schwester runzelte die Stirn und ich meinte die ersten feinen Linien zu erkennen, die sich in ihrem Gesicht einnisteten. Spuren eines verantwortungsvollen Jobs.
»Ich weiß, aber …«
»Ich habe den Befund gesehen. Dein Rücken ist ausgeheilt. Die Bilder …«
»Nein, ist er nicht!«, schnitt ich Lucile das Wort ab. Ich ballte hinter eben diesem Rücken die Hände zu Fäusten. »Ich glaube, irgendwo haben die Ärzte etwas übersehen! Ich kann … ich kann immer noch nicht so tanzen wie früher. Jedes Mal, wenn ich es versuche, dann … dann ist da dieser Schmerz und ich kriege keine Luft und …« Ich merkte, dass meine Stimme mit jedem Wort dünner wurde. Ich zwang mich zu einem beruhigenden Atemzug und setzte von Neuem an. »Ist auch egal, was es ist, ich benötige jedenfalls dringend ein Attest von dir. Bitte, Lucile, schreib, dass meine Verletzungen noch ein wenig brauchen. Schreib in irgendeinem Ärzte-Fachjargon, dass ich mich noch schonen muss. Ich tanze momentan erbärmlich und wenn das so bleibt, bin ich ohne Attest geliefert. Ich brauche einen Zettel, auf dem steht, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis ich wieder in Form bin. Und das stimmt ja auch! Ich bräuchte nur ein klein wenig mehr Zeit! Bitte, Lucile! Ich verliere sonst meine Anstellung in der Kompanie!«
Denn niemand braucht eine Tänzerin, die Angst davor hat, hochgehoben zu werden …
Meine Schwester hatte sich meinen emotionalen Ausbruch schweigend angehört. Ihr Gesicht war dabei die aufmerksame, höfliche Maske einer Ärztin geblieben, die dem Leiden einer hysterischen Patientin lauschte, nicht der ihrer kleinen Schwester. Manchmal glaubte ich, Luciles Herz kannte so etwas wie Schmerz, Aufregung und Angst gar nicht. Stählerne Nerven, Neutralität, Vernunft. Das waren ihrer Ansicht nach die Eigenschaften einer echten Ärztin. Nur wer wollte sich schon von einer Maschine behandeln lassen?
»Ich erfinde kein Attest für dich, Charlotte«, sagte sie jetzt bestimmt. »Du bist physisch vollkommen gesund. Für mich sieht es eher so aus, dass du nervlich am Ende bist. Du hältst dem Druck nicht mehr stand.«
»So ein Schwachsinn!«, rief ich verärgert, obwohl ich innerlich hätte heulen können. Warum nur war ich überhaupt erst hergekommen? Es war doch klar gewesen, dass Lucile mir nicht helfen würde. Aber sie war mein letzter Strohhalm.
»Streite es noch eine Weile ab, wenn dir das hilft. Du kannst mich noch einmal besuchen, wenn du wieder zur Vernunft gekommen bist, und dann reden wir weiter«, sagte meine Schwester ungerührt. Sie ging zu einem der Pumpspender an den Wänden und begann sich die Hände zu desinfizieren. »Wenn du mich entschuldigen würdest? Ich muss nach einigen Patienten sehen«, sagte sie und schüttelte kurz ihre Hände zum Trocknen.
Ich war allerdings entschlossen den Kampf noch nicht aufzugeben. Allmählich war ich bereit, alles zu tun, um meine Situation zu verbessern. Ich zögerte kurz, dann trat ich näher an Lucile heran und senkte die Stimme.
»Kannst du mir dann nicht irgendwas für die Nerven verschreiben, wenn das deiner Meinung nach mein Problem ist? Es gibt doch bestimmt irgendeine Pille für Leute, die ›unter zu großem Druck stehen‹. Wenigstens das könntest du doch für mich tun?«
Lucile schüttelte unwillig den Kopf.
»Nein, kann ich nicht und jetzt lass mich wieder an die Arbeit. Meine Patienten warten.«
Damit war der Fall für sie erledigt. Meine ältere Schwester wandte sich ab und steuerte eines der Zimmer uns gegenüber an. Einen Augenblick lang fühlte ich mich wieder in meine Kindheit zurückversetzt. Wie oft war ich zu ihr gekommen, in der Hoffnung, sie würde mir helfen? Lucile, in Brest gibt es einen Wettbewerb für Nachwuchstänzerinnen. Lucile, würdest du noch einmal mit Maman reden? Lucile, bitte, dieses Vortanzen ist wirklich wichtig. Und in den allermeisten Fällen hatte es so geendet wie gerade eben. Meine Schwester hatte mich am langen Arm verdursten lassen und ich hatte mir geschworen so schnell wie möglich unabhängig von alldem zu werden. Davon, ob Maman mir das Geld für neue Spitzenschuhe gab oder ob Lucile mich zu Wettbewerben fuhr. Jetzt, mit einundzwanzig, hatte ich geglaubt, sie niemals wieder um etwas bitten zu müssen, mir niemals wieder den flehenden Tonfall in meiner Stimme anhören zu müssen, wenn ich ihr hinterherrief:
»Bitte, Lucile! Überleg es dir nochmal!«
Meine Schwester hatte bereits die Tür zum Patientenzimmer geöffnet. Ich folgte ihr auf dem Fuße.
»Lucile!«
»Docteur Laffon, na endlich!«
Ich blieb abrupt stehen. Im Krankenzimmer lag nicht, wie ich erwartete hatte, ein älterer Senior, sondern ein junger Mann. Er hatte dunkle Haut und pechschwarzes, lockiges Haar, das ihm zerzaust vom Kopf abstand. Es verdeckte einen Teil des Pflasters, das quer über seiner Stirn klebte. Zu meiner Überraschung schwang der Kranke direkt seine Beine aus dem Bett, als er uns beide im Türrahmen erblickte.
»Ich dachte schon, Ihr Hospital hat mich vergessen«, sagte er vorwurfsvoll.
»Entschuldigen Sie die Verspätung«, sagte meine Schwester und ging zum Fußende des Bettes. Mit routiniertem Schwung zog sie ein Klemmbrett aus einer Halterung am Gestell und begann in den Unterlagen zu blättern. Über den Rand ihrer Papiere warf sie mir einen strengen Blick zu, den ich sehr gute kannte. Er sagte so viel wie Gib endlich Ruhe, Charlotte!
Ich biss die Zähne zusammen, dann ging ich schnurstracks in eine Ecke des Krankenzimmers und ließ mich auf den Besucherstuhl fallen. Diesmal würde ich nicht so schnell Ruhe geben.
»Ich habe schon reingeschaut, Madame. Da steht, dass Sie mich heute immer noch nicht rauslassen«, sagte der junge Mann ungeduldig.
»Dann wird das seinen Grund haben, Monsieur Alfarsi«, erwiderte meine Schwester. »Mit Gehirnerschütterungen ist nicht zu spaßen.«
»Wissen Sie, mit wem noch nicht zu spaßen ist? Mit meiner Kollegin, wenn ich nicht bald wieder auf der Matte stehe.«
»Momentan bin ich als Ärztin Ihre oberste Kontrollinstanz und ich kann der Einschätzung meiner Kollegen nur recht geben. Ein letzter Scan zur Absicherung schadet nicht.«
»Mir geht es aber blendend!«, widersprach der renitente Patient. »Kommen Sie schon, fassen Sie sich ein Herz. Es ist doch Weihnachten!«
»Wir haben den zweiten Dezember«, antwortete Lucile nüchtern.
»Ist es nicht trotzdem die schönste Zeit im Jahr, um einem armen Kerl aus der Station zu entlassen, bevor er sich zu Tode langweilt?«
»Hören Sie, wir bemühen uns hier lediglich um Ihr Wohlergehen. Wenn Sie sich langweilen, schauen Sie fern.«
»Fernsehen«, schnaubte der junge Mann. »Ich muss raus an die frische Luft.«
Ich begann allmählich Mitleid mit ihm zu haben. Der arme Kerl verwandte auch gerade seine gesamte Energie darauf, sich an einer starrköpfigen Lucile abzuarbeiten.
»Lassen Sie ihn doch gehen, Docteuer«, sagte ich halb im Scherz. »Sonst springt er euch noch aus dem Fenster.«
Der junge Mann warf mir einen dankbaren Blick zu.
»Aus einem ähnlichen Grund ist er schon hierhergekommen«, antwortete Lucile und klang allmählich etwas angespannt.
»Habe ich eigentlich schon einmal erwähnt, wie süß Sie aussehen, wenn Sie genervt sind?«, versuchte es jetzt ihr Patient mit einer Charme-Offensive. Er schenkte ihr ein breites Lächeln, das eine Reihe schneeweißer Zähne offenbarte.
»Mit so etwas kommen Sie bei meiner Schwester nicht weit«, klärte ich ihn auf und fügte schnell und ohne nachzudenken hinzu: »Wenn jemand wirklich Hilfe braucht, wird sie zur Eiskönigin.«
Darauf herrschte zwei Sekunden Stille. Der junge Mann warf mir einen verwirrten Blick zu und zog die dunklen Brauen hoch. Ich jedoch sah hinüber zu Lucile. Sie blätterte immer noch in den Unterlagen, doch als sie den Kopf hob, bemerkte ich zu meiner Überraschung ein helles Blitzen in ihren Augen. Ein paar Momente lang sahen wir einander einfach nur an und ich meinte plötzlich nicht mehr der kühlen Ärztin gegenüberzustehen, sondern meiner großen Schwester, die nur genauso dickköpfig war wie ich.
»Wissen Sie was … verschwinden Sie«, sagte Lucile leise. Sie zog aus ihrem Kittel einen Kugelschreiber hervor, kritzelte etwas auf das Klemmbrett und steckte es so energisch zurück in die Halterung, dass die Metallstangen vibrierten. »Verschwindet um Himmels Willen beide!«
Und mit diesen Worten wandte sie sich ab und rauschte an mir vorbei aus dem Zimmer. Ich sprang von meinem Stuhl auf, doch mir war klar, dass ich es verpatzt hatte. Das schlechte Gewissen begann bereits in mir zu arbeiten. Heute Abend würde ich höchstwahrscheinlich meiner Mutter am Telefon Rede und Antwort stehen müssen. Ich hatte es gewagt, mit meiner großen Schwester zu streiten, so etwas Unvernünftiges.
»Ich glaube, ich bin gerade dem ersten Menschen auf der Welt begegnet, der es schafft, Docteur Laffon aus der Ruhe zu bringen.«
Meine bitteren Gedanken hatten mich einen Moment lang ganz vergessen lassen, dass ich nicht allein im Zimmer war. Der junge Mann war von der Bettkante aufgestanden und zog in aller Ruhe das weiße Pyjama Oberteil über den Kopf, das er getragen hatte.
»Ich, ähm, bin ihre kleine Schwester«, erwiderte ich und betrachtete mein Gegenüber perplex. Ich hatte als Ballerina so viel Zeit in Umkleiden und mit kaum bekleideten Tänzern auf der Bühne verbracht, dass mich ein nackter Männeroberkörper nicht mehr groß irritierte – trotzdem war ich nicht daran gewöhnt, dass Wildfremde in meiner Gegenwart begannen sich auszuziehen.
»Und? Was wollten Sie im Krankenhaus?«, fragte er, schmiss das Oberteil aufs Bett, ging durchs Zimmer und holte aus einem Schrank gegenüber ein T-Shirt. Auch nachdem er es angezogen hatte, zeichnete sich darunter sein durchtrainierter Körper ab. »Ah, viel besser«, sagte er und streckte sich. Er hatte eine geschmeidige, selbstsichere Art sich zu bewegen, die mir verriet, dass er wohl genauso wenig einen Bürojob ausübte wie ich.
»Tut mir leid, Monsieur, aber das fällt unter Patientengeheimnis«, antwortete ich und verschränkte die Arme. Falls er wirklich glaubte mich mit seinem beiläufigen Striptease aus der Fassung bringen zu können, hatte er sich leider getäuscht.
»Sehr schade, ich mag Geheimnisse«, antwortete meine seltsame neue Bekanntschaft (die jetzt übrigens nur noch in Boxershorts vor dem Schrank stand) und zog eine Jeans aus einer Schublade.
»Geheimnis ist eigentlich nur ein schöneres Wort für Ärger«, stellte ich ungerührt fest.
Der junge Mann trug jetzt wenigstens wieder eine Hose. Mit einem Lächeln kam er auf mich zu, während mir unwillkürlich ein paar Grad wärmer wurde.
»Mein Name ist übrigens Farid«, sagte er und hielt mir die Hand hin. »Und ich liebe Ärger.«