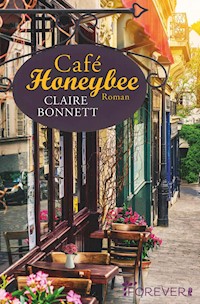6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die schönsten Romane für den Sommer und Urlaub
- Sprache: Deutsch
Er war ihre erste große Liebe - was hat sie zu verlieren?
Nachdem die Affäre ihres Freundes auffliegt, reist Luisa in die Bretagne - an den Ort, an dem sie als Teenager einen traumhaften Sommerurlaub verbrachte. Doch nicht nur die wunderschöne und raue Küstenlandschaft weckt Luisas Sehnsucht: Vor zwölf Jahren hat sie sich genau hier unsterblich in Maël verliebt. Die beiden waren den ganzen Sommer zusammen, nach dem Urlaub hat Luisa jedoch nie wieder etwas von dem charmanten Franzosen gehört.
Auch wenn es aussichtslos erscheint, beschließt sie, Maël zu suchen - aber zwölf Jahre sind eine lange Zeit und ein einzelner Vorname kein guter Startpunkt. Zum Glück trifft sie auf Yannic, der sich bereit erklärt, ihr bei der Suche zu helfen. Eine turbulente Reise durch die Bretagne beginnt, in der Luisa nicht nur das französische Essen und die französische Lebensweise zu schätzen lernt, sondern auch Yannics unverschämt leichtfüßige Art, die leise Gefühle in ihr weckt ...
Ein humorvoller, romantischer Sommerroman, der in die atmosphärische raue Landschaft der Bretagne entführt.
Alle Geschichten dieser Reihe zaubern dir den Sommer ins Herz und bringen dir den Urlaub nach Hause. Die Romane sind in sich abgeschlossen und können unabhängig voneinander gelesen werden.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 366
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Danksagung
Über die Autorin
Feedbackseite
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an: be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Dein beHEARTBEAT-Team
Über dieses Buch
Nachdem die Affäre ihres Freundes auffliegt, reist Luisa in die Bretagne – an den Ort, an dem sie als Teenager einen traumhaften Sommerurlaub verbrachte. Doch nicht nur die wunderschöne und raue Küstenlandschaft weckt Luisas Sehnsucht: Vor zwölf Jahren hat sie sich genau hier unsterblich in Maël verliebt. Die beiden waren den ganzen Sommer zusammen, nach dem Urlaub hat Luisa jedoch nie wieder etwas von dem charmanten Franzosen gehört. Auch wenn es aussichtslos erscheint, beschließt sie, Maël zu suchen – aber zwölf Jahre sind eine lange Zeit und ein einzelner Vorname kein guter Startpunkt. Zum Glück trifft sie auf Yannic, der sich bereit erklärt, ihr bei der Suche zu helfen. Eine turbulente Reise durch die Bretagne beginnt, in der Luisa nicht nur das französische Essen und die französische Lebensweise zu schätzen lernt, sondern auch Yannics unverschämt leichtfüßige Art, die leise Gefühle in ihr weckt …
CLAIRE BONNETT
Sommerglückin derBretagne
Kapitel 1
»Und was davon nehmen wir jetzt mit?« Meine Mutter hatte die Arme in die Seiten gestemmt und warf mir einen forschenden Blick zu.
»Keine Ahnung.« Ich ließ mich langsam auf die Knie sinken. Wir befanden uns in einem Meer aus braunen Pappkartons, und ich sollte plötzlich entscheiden, wie es mit ihnen weitergehen sollte.
»Es gibt da eine super Aufräummethode«, verkündete Mama jetzt. »Darüber hab ich letztens eine Doku gesehen. Da hat eine Frau Leute mit katastrophal chaotischen Haushalten besucht, und dann haben sie –«
Ich verdrehte innerlich die Augen, versuchte aber einen diplomatischen Tonfall beizubehalten, als ich sie unterbrach: »Mama, das interessiert mich jetzt leider gar nicht. Mir ist jede Methode recht, die dafür sorgt, dass ich hier fertig bin, bevor Michael zurück ist.«
»Natürlich, Schatz«, erwiderte meine Mutter auf diese betont verständnisvolle Weise, die seit Monaten jeder an den Tag legte, sobald Michas Name fiel.
Wie ich es satthatte! Mitleid fühlte sich in manchen Situationen schlimmer an als Ignoranz. Trotzdem … Meine arme Mutter hatte es nicht verdient, jetzt meinen aufgestauten Frust abzubekommen. Bei den meisten hörte Anteilnahme nämlich bei mitleidigen Kommentaren auf. Sie war wenigstens hier bei mir, um tatsächlich mit anzupacken.
»Im Großen und Ganzen haben wir ja schon besprochen, wem was gehört«, sagte ich daher ruhig. »Es geht jetzt nur darum, zu entscheiden, was ich als Erstes mitnehme. Kannst du vielleicht schon mal ins Schlafzimmer gehen und ein paar von den Kleiderkartons runterbringen? Ich habe sie mit roten Punkten markiert.«
»Kein Problem! Das wird ja wohl nicht besonders viel sein.« Meine Mutter machte sich sofort auf den Weg den Gang hinunter.
Ich blieb allein im Wohnzimmer zurück und konnte nicht anders, als einen langen Seufzer auszustoßen. Langsam sollte man ja meinen, dass ich mich an die Situation gewöhne. Ungeduldig schüttelte ich den Kopf.
Ich ließ mich auf das graue Sofa sinken, was ich im nächsten Moment bereute, denn dort stieg mir ein penetranter Geruch von Maiglöckchen und Vanille in die Nase. Ich verzog das Gesicht. Mit diesem Duft hatte es angefangen. Damit, ein paar flüchtigen Bemerkungen von Micha und viel zu viel Zeit am Handy.
Und ich? Ich hatte mich nur über Frauen lustig gemacht, die im Übermaß Parfum auftrugen und alles mit einem Schulterzucken abgetan. Warum auch nicht? Ich war felsenfest davon überzeugt gewesen, meinen Platz im Leben gefunden zu haben. Endlich auf einer schnurgeraden Straße zu sein, die in eine herausfordernde, aber in jedem Fall gemeinsame Zukunft führen würde.
»Ich versteh immer noch nicht, warum du ihm die Wohnung überlassen musst.«
Ich hob den Kopf und erblickte meine Mutter, die mit einem wackligen Kartonturm in den Armen wieder im Türeingang aufgetaucht war. Ich sprang vom Sofa auf und eilte zu ihr hinüber, um Schlimmeres zu verhindern.
»Ich habe es dir doch schon erklärt«, erwiderte ich, während wir hintereinander zur Wohnungstür marschierten. »Ich muss sie nicht überlassen, ich will sie nicht. Soll er sie haben und dort glücklich werden, mir egal.«
Daraufhin sagten wir beide eine Weile nichts, und während der Aufzug sich rumpelnd in den vierten Stock hievte, ahnte ich schon, was als Nächstes kommen würde. Also sprach ich es lieber gleich selbst an: »Sollen sie beide darin sehr glücklich werden.«
Und schließlich, als wir zusammengequetscht nebeneinander im Aufzug standen, brachte meine Mutter das Gespräch zu einem krönenden Abschluss: »Du hast München ohnehin nie gemocht.«
Den ganzen restlichen Nachmittag ging unser Karawanenzug weiter. Mama hatte einen kleinen Transporter gemietet, in dem wir die Kartons verstauten, die den Großteil meiner Habe beinhalteten. Es war ein merkwürdiges Gefühl, nach und nach die eigenen Spuren aus der Wohnung tilgen, die man einmal als Zuhause betrachtet hatte. Dabei warf ich immer wieder hektische Blicke auf mein Handy.
Micha hatte versprochen, dass er nicht aufkreuzen würde, wenn ich meinen Kram abholte. Ich hoffte inständig, dass er sich daran hielt, denn momentan funktionierten am besten die Gespräche zwischen uns, die nicht stattfanden. Man konnte sich noch so sehr um eine eskalationsfreie Kommunikation bemühen, wenn verletzte Gefühle im Spiel waren, glich jedes Aufeinandertreffen einer Barfußwanderung über Schotter.
Ich schnaubte und wischte mir den Schweiß von der Stirn, mir klebte mittlerweile das T-Shirt an der Haut. Das Juliwetter hatte beschlossen, den Tag meines Auszugs mit dreißig Grad Sonnenschein bei wolkenlosem Himmel zu feiern. Ständig Kisten zu schleppen, machte die Sache natürlich nicht besser. Wenigstens war es im Flur des Mietshauses ein wenig kühler. Und wenigstens war keiner der Nachbarn herausgekommen, um sich nach unserem Tun zu erkundigen.
Diese erleichternde Erkenntnis wurde vom kurzen Vibrieren meines Handys unterbrochen. Ich war gerade dabei, einen der letzten Kartons zum Auto zu tragen. Daher machte ich nicht extra Halt, um die Nachricht zu lesen, sondern schwankte einfach weiter den Flur hinunter, wo mir glücklicherweise die Tür aufgehalten wurde.
»Danke …«
»Kein Problem«, erwiderte eine helle Stimme. Ich nahm flüchtig ein schmales Gesicht und blonde Haare wahr – und den durchdringenden Duft von Vanille.
Es gab Dinge, von denen hatte ich immer fest geglaubt, sie passierten nur in Filmen und Serien. Eine Ex-Freundin, die im desolaten Zustand in die Neue ihres ehemaligen Partners hineinstolperte und erst mal alles fallen ließ, was sie gerade in den Armen hielt, gehörte definitiv dazu.
Mit einem dumpfen Schlag kam der Karton auf dem Türabsatz auf. Geistesgegenwärtig streckte ich die Hände aus, konnte allerdings nicht verhindern, dass die Pappkiste umkippte und ihr gesamter Inhalt die Treppenstufen hinunter auf den Bürgersteig kullerte.
»Verdammt!« Ich sprang hastig die Stufen hinab, denn ein löchriger Gullydeckel befand sich gefährlich nahe an meinen Habseligkeiten.
»Warte, ich helfe dir!« Zu meiner Überraschung – und meinem Widerwillen – lief Michaels Neue hinterher, um mich beim Einsammeln zu unterstützen.
»Ich schaff das schon.« Ich hechtete im nächsten Moment nach vorn, um zu verhindern, dass ein Füller auf Nimmerwiedersehen im Gully verschwand.
Erst jetzt erkannte ich, was überhaupt in dem Karton gewesen war. Ausgerechnet in der letzten Schachtel hatte ich etwas transportiert, das ich in Ermangelung eines besseren Wortes mal »Alte-Zeiten-Kram« genannt hatte. Eine wirre Sammlung von Erinnerungsstücken, die für einen Außenstehenden völlig nutzlos aussahen, aber für mich unschätzbaren Wert besaßen. Besonders dann, wenn ich mit einer Flasche Wein und alten Chart-Hits im Ohr in der Vergangenheit schwelgen wollte.
Und so befanden sich plötzlich auf einem Giesinger Bürgersteig in München die »Schöne Steine«-Sammlung meiner Kindheit, ein paar alte Kinokarten und halb verweste Festival-Armbänder. All das ausgerechnet durch die Hände »der Neuen« gehen zu sehen, war irgendwas zwischen peinlich und deprimierend.
»Was machen Sie denn hier?« Mir war egal, dass sie mich unbedingt duzen wollte.
»Ich hab mein Tablet in der Wohnung vergessen und brauche es dringend«, erklärte sie … Annabell. Ihr Name war Annabell. »Tut mir leid, Michael meinte, er gibt dir Bescheid …«
»Tja, es war nur abgemacht, dass er nicht vorbeikommt.« Ich versuchte so wenig resigniert wie möglich zu klingen. Rasch beugte ich mich wieder gen Boden, um etwas aufzusammeln, was nach meiner ersten eigenen Fotokamera aussah.
»Sisa-Schatz, ich glaube wir haben’s jetzt!«
Ich schnellte hoch und entdeckte meine Mutter im Hauseingang. Sie war damit beschäftigt, die letzten Kartons zum Transporter zu balancieren und hatte daher für mich und die blonde Frau neben mir keinen weiteren Blick übrig. Dass Mama mich ausgerechnet mit meinem Kosenamen gerufen hatte, war in einer ohnehin schon peinlichen Situation dem Schicksal wohl besonders ulkig erschienen. Als Kind konnte ich den Namen »Luisa« nicht aussprechen und hatte mich selbst »Sisa« genannt.
»Großartig.« Was sollte ich als Nächstes sagen? Keine Sorge, bald gehört die Wohnung ganz euch? Annabell schien zum Glück die Situation ebenfalls langsam unangenehm zu werden.
»Ich geh dann mal … hoch in die Wohnung.« Ihre ohnehin schon zarte Stimme wurde zu einem beinahe unverständlichen Nuscheln.
»Ja …«, erwiderte ich in Ermangelung einer anderen Reaktion, die weder weinerlich noch wütend geklungen hätte.
»Hier.« Zwei Sekunden später hatte ich plötzlich einen Stapel alter Fotos in der Hand, die vorhin noch auf dem Boden gelegen hatten. Annabell mit dem unerträglichen Vanille-Geruch machte zum Abschied eine unbeholfene Handbewegung, die einem Winken glich und drehte dann ab Richtung Wohnung.
Durch eine scharfe Kurve zum Hauseingang entging sie meiner Mutter, die gerade vom Transporter zurückkam. Ich sah Annabell mit einem merkwürdigen Gefühl im Bauch nach. Das war der Mensch, wegen dem mein Leben völlig aus den Fugen geraten war. Ich hatte sie bereits ein paarmal gesehen, aber es traf mich jedes Mal wieder aufs Neue: weniger die Trennung als vielmehr die Tatsache, wie … normal sie war.
Es wäre trotzdem einfach gewesen, meinen ganzen Frust, meine Wut und Hilflosigkeit auf sie zu projizieren, aber ich tat es nicht – ganz anders als meine Mutter. Sie durchbohrte Annabells Rücken mit langen misstrauischen Blicken, ehe sie sich wieder mir zuwandte.
»Das war doch gerade …«
Ich nickte. »Wir sollten jetzt besser gehen.«
»Da bin ich absolut einverstanden. Komm, ich nehme das.« Meine Mutter hob den letzten Karton mit dem »Alte-Zeiten-Kram« hoch, und gemeinsam gingen wir zurück zum Miet-Transporter.
Als ich auf der Fahrerseite einsteigen wollte, schaltete sich allerdings sofort wieder meine Mutter ein: »Nein, nein, ich fahre schon. Du solltest dich ausruhen!«
Das war typisch für Mama. Sie war Mitte sechzig, hatte den ganzen Weg von Stuttgart nach München zurückgelegt, um mir zu helfen, und trotzdem war ich für sie diejenige die Schonung brauchte. Ihre behütende Art war mir als Teenager unglaublich auf die Nerven gefallen. Aber man konnte auf ihre Hilfe zählen, wenn alles auseinanderbrach.
Ich stieg also brav auf der Beifahrerseite ein. Als meine Mutter den Motor anließ, spürte ich ein seltsames Gefühl der Erleichterung in mir aufsteigen.
Ich hatte gedacht, dass sich der Auszug für mich schlimmer anfühlen würde, Tränen unterdrücken zu müssen – oder den Drang zu verspüren, vor Frust etwas zu zerbrechen. Stattdessen war da nur eine gewisse Erleichterung, aber auch eine Leere, als hätte nicht ich, sondern jemand anderes den Vormittag damit verbracht, sein Leben kistenweise abzutransportieren.
Wir schlängelten uns jetzt durch den hektischen und unübersichtlichen Verkehr der Münchner Innenstadt. Während es draußen heiß war, war es hier drin auch noch stickig und roch unangenehm nach Zigarettenrauch. Wahrscheinlich einer der Gründe dafür, dass meine Mutter an einer Ampel frustriert schnaubte.
»Ich verstehe nicht, dass sie ausgerechnet heute aufkreuzen musste, und wenn das schon unbedingt sein musste, warum konnte sie dich dann nicht einfach in Ruhe lassen?«
»Sie wollte nur helfen«, antwortete ich, überrascht von mir selbst. Verteidigte ich Annabell gerade etwa?
»Wahrscheinlich liegt jetzt in irgendeiner Giesinger Hecke ein Ticket vom Green-Day-Open-Air-Konzert 2001.« Ich seufzte.
»Du warst als Teenager ständig auf irgendwelchen Festivals und Konzerten«, bemerkte meine Mutter. »Da sind bestimmt noch genügend Tickets deiner Sammlung übrig.«
Das stimmte wohl, und ich würde sie wahrscheinlich sowieso in nächster Zeit nicht in die Hand nehmen, denn bei einem dieser vielen Konzertbesuche hatte ich schließlich Michael kennengelernt. Geteilter Musikgeschmack und aquamarinblaue Augen waren mir wie ein verlässlicher Garant dafür erschienen, dass aus uns beiden etwas werden konnte. Und die Tatsache, dass ich zu diesem Zeitpunkt dringend jemand anderen vergessen wollte.
Ich blickte hinab in meinen Schoß und nahm zum ersten Mal den Stapel Fotos näher in Augenschein, den Annabell eingesammelt hatte.
»Und was ist das?«, fragte meine Mutter, die anscheinend gleichzeitig Auto fahren und mich im Auge behalten konnte.
»Nur ein paar alte Bilder.« Ich begann müde mit meinen verschwitzten Fingern die Fotos durchzusehen. Ein überraschtes Lächeln stahl sich dabei auf meine Lippen.
»Das sind Fotos von unserem Frankreich-Urlaub. Weißt du noch? In der Bretagne, zusammen mit Papa, als ich siebzehn war.«
»Ach ja …« Meine Mutter seufzte. »Dein Vater hatte da einen furchtbaren Fersensporn.«
Und Mama hatte ein besonderes Gedächtnis für unangenehme Details.
»Ich wollte erst überhaupt nicht mit.« Ich erinnerte mich mit einem kleinen Schmunzeln. »Ich wollte doch in dem Sommer lieber mit meinen Freundinnen einen Roadtrip nach Italien machen.«
»Sie haben sich dann auch ohne deine Hilfe in der Toskana verfahren.«
Ich überging den Kommentar und betrachtete weiterhin nostalgisch die Fotos. Aus Frust darüber, in Frankreich festzusitzen, hatte ich beschlossen, allen mit meiner neuen Kamera auf die Nerven zu gehen, mit der ich eigentlich meine Freundinnen unterwegs hatte ablichten wollen.
Während meiner Mutter neben mir damit beschäftigt war, ausschweifend zu erklären, warum es damals keine gute Idee gewesen wäre, zu einem abenteuerlichen Trip nach Italien aufzubrechen, betrachtete ich die zerknitterten Bilder von langen Sandstränden, Palmen und blühenden Hortensien. Immer wieder tauchte auch eine Grimassen schneidende Luisa auf, ein – wegen seines Fersensporns – missmutig dreinschauender Vater und meine Mutter, die unter einem riesigen Sonnenhut fast nicht zu erkennen war.
Als ich diese Bilder in den Händen hielt, schien ich fast wieder salzige Luft auf der Zunge zu spüren, und das Gelbgrün der umliegenden Wiesen und Felder verwandelte sich in ein wild glitzerndes Türkis. Anscheinend hatte ich schon so was wie Hitzefantasien.
Ich blätterte weiter. Was ich bis jetzt von mir geschoben hatte, war der Gedanke an ein ganz besonderes Foto, das sich irgendwo zwischen den normalen Familienaufnahmen verstecken musste. Ob es wirklich nur an der Hitze lag, dass sich ein Kribbeln in mir ausbreitete?
Als ich bei der letzten Aufnahme im Stapel angelangt war, zögerte ich kurz. Wollte ich es überhaupt sehen? Doch mein Herz ließ es mich einfach herauszupfen und in das helle Licht der Mittagssonne halten. Es wollte die zwei Gesichter erkennen. Dicht nebeneinander gedrängt, bewaffnet mit diesem Lächeln, das der ganzen Welt zeigte, wie unbesiegbar man mit siebzehn war. Zumindest wir waren es gewesen: Maël und ich.
Und kaum dass ich das Foto betrachtet hatte, saß ich endgültig nicht mehr in einem stickigen Miettransporter: Ich stand wieder barfuß am Meer. Ich trug wieder ein Bikini-Unterteil und ein altes Hard-Rock-Café-Shirt, während der Wind meine kurzen blonden Locken um mein Gesicht springen ließ.
Man sah wesentlich mehr von mir als von Maël, denn der hatte sich genau in dem Moment, als die Kamera auslöste, abgewandt, um mir einen Kuss auf die Wange zu drücken.
Maël hatte Fotos nicht besonders gemocht. Immer wenn ich mit freudig mit der Kamera gewedelt hatte, hatte er mit den Augen gerollt und mich dann auf die eine oder andere Art abgelenkt. Wieder fühlte ich dieses sehnsuchtsvolle Kribbeln in mir hochsteigen …
In diesem Moment holte mich eine wohlbekannte Stimme zurück ins Jetzt: »Ist das nicht dieser Junge vom Hotel?«
»Genau der«, antwortete ich in einem möglichst neutralen Tonfall. »Das Bild haben wir an unserem letzten Tag gemacht.«
»War ein komischer Kerl«, sagte meine Mutter in ihrer üblich knappen Art. »Nicht besonders redselig. Aber na ja, so viel Zeit habt ihr wahrscheinlich auch nicht damit verbracht, miteinander zu sprechen.«
»Mama!«, erwiderte ich empört. Rasch ließ ich das Foto von uns beiden wieder irgendwo zwischen anderen Bildern verschwinden.
»Was denn? Einem siebzehnjährigen Mädchen kann man seine erste Sommerromanze eben nicht verbieten – Papa war trotzdem nicht begeistert. Du willst nicht wissen, wie oft er mich gebeten hat, mit dir noch mal über Verhütung zu …«
»Um Himmels willen«, fuhr ich genervt dazwischen. »Zu viele Details, Mama.«
»Danach war er plötzlich dafür, dass du alleine wegfahren darfst.«
»Ja, dann spielt sich alles Besorgniserregende nicht direkt vor seiner Nase ab. Aber es hat sich sowieso nichts weiter daraus entwickelt.« Der Gedanke daran versetzte meinem Herzen einen kleinen Stich, und ich beschloss das Thema zu wechseln. »Ist Papa eigentlich zu Hause?«
»Hab ich dir doch schon geschrieben. Er ist gerade auf einer Konferenz in San Diego. Er hat sich tagelang vorher darüber aufgeregt, dass die Fluggesellschaft …«
Meine Mutter begann ausführlich zu erzählen, welches Problem es mit dem Flug gegeben hatte. Mir blieb dadurch genügend Zeit, den Ellenbogen ans heiße Fensterglas zu stützen und gedanklich noch einmal in einen Urlaub zurückzukehren, der ganze zwölf Jahre her war.
Maël. Nein, es war nicht die typische »Sommerromanze« gewesen, wie meine Mutter es genannt hatte. Maël war kein gut aussehender Surflehrer, der jeden Sommer reihenweise Herzen brach. Die meiste Zeit hatte er nicht auf einem Surfbrett, sondern in der dampfigen Hotelküche verbracht.
Er war mir auch nicht durch ein strahlendes Zahnpastalächeln zum ersten Mal aufgefallen, sondern durch seinen mürrischen Gesichtsausdruck, als er eines Morgens hinter dem Frühstücks-Buffet stand. Er hatte verschlafen ausgesehen, das dunkle Haar fast so zerzaust wie meins und mit Schatten unter den braunen Augen.
Von einem Knistern war erst mal nichts zu spüren gewesen, als er versehentlich Kaffee über meine Brötchen schüttete. Auch wenn er hinterher versicherte, er wäre nur von meinem Anblick so überwältigt gewesen. Ich musste schmunzeln.
»Es ist, soweit ich weiß, die einzige Konferenz in diesem Sommer, und er wollte unbedingt … Hörst du mir eigentlich noch zu?«
»Ja, natürlich!« Ich beschloss, fürs Erste die alten Urlaubserinnerungen beiseitezuschieben. Was dachte ich überhaupt an sie? Ich war frisch getrennt und musste alles Mögliche unter Dach und Fach bringen.
Also gab ich mir einen Ruck und wandte mich wieder meiner Mutter zu. »Was wollte er unbedingt?«
Gegen Abend kamen wir schließlich in Stuttgart an. Zum Glück hatte meine Mutter sich doch noch breitschlagen lassen, dass ich die letzte Etappe übernahm. Wir waren hungrig, verschwitzt und ausgelaugt.
»Wir verstauen morgen Vormittag die Kartons in deinem Zimmer«, sagte meine Mutter, nachdem der Wagen draußen vor dem Haus geparkt war.
»Da sage ich nicht Nein«, erwiderte ich erschöpft und zog den Gurt zurück, der immer unangenehmer in meine Haut geschnitten hatte.
Mit neunundzwanzig Jahren wieder in sein Kinderzimmer zu ziehen, fühlte sich nach wie vor deprimierend an. Natürlich war das nur übergangsweise. In München spontan nach einer bezahlbaren Wohnung zu suchen? Das glich einem kalkulierten Nervenzusammenbruch.
Nachdem ich erst als Texterin in der Werbung gearbeitet hatte, versuchte ich seit ein paar Monaten, mich als freie Redakteurin und Journalistin zu etablieren, weshalb ich von überall aus arbeiten konnte.
Ich hatte schon immer eine kreative Ader gehabt, und der Gedanke, eigene spannende Geschichten zu erzählen, mir eventuell sogar die Aufträge aussuchen zu können, hatte mich gereizt. Waren Trennungen nicht auch als der perfekte Zeitpunkt für Neuerungen bekannt? Jedoch waren die Aufträge bisher leider noch rar.
Wir gingen ins Haus. Meine Mutter stürmte als Erstes Richtung Küche, ich hingegen ging die Treppe hoch zu meinem Zimmer. Denn auch wenn mir die Vorstellung nicht behagte, dort zeitweise wieder zu wohnen, brauchte ich jetzt meine Ruhe.
Vorsichtig öffnete ich die Tür und spähte hinein. Das Bett war frisch bezogen, und ich erkannte sofort, dass jemand Staub gesaugt hatte. Ich riss das Fenster auf, dann ließ ich mich auf die nach Erdbeere riechende Bettwäsche sinken.
Tja, hier hatte ich vor vielen, vielen Jahren viel Zeit damit verbracht, die Bravo zu lesen und Nickelback zu hören. Ich legte den mittlerweile arg zerknitterten Stapel Bilder auf meinen Schoß. Ganz automatisch zogen meine Finger wieder das Bild von Maël und mir heraus und hielten es ins dämmrige Abendlicht, das durchs Fenster hereinfiel.
Maël war plötzlich mit einem Stapel Macarons beim Abendessen am Tisch erschienen, um Wiedergutmachung zu leisten. Von da an schien ich ihm ständig irgendwo zu begegnen: Auf dem Fischmarkt, abends an der Hotelbar. Und aus flüchtigen Begegnungen ergaben sich plötzlich holprige Gespräche. Aus Gesprächen wurden Spaziergänge und aus Spaziergängen … Na ja, wirklich viel geredet hatten wir ab da wirklich nicht mehr.
Es waren unbeschwerte zehn Tage gewesen, und selbst wenn es in diesen Tagen einmal geregnet haben sollte, in meiner Erinnerung waren sie sonnendurchflutet.
Wie unbekümmert wir auf dem Foto aussahen. Das war der letzte Tag vor meiner Heimreise gewesen. Wir hatten bis zum Schluss herausgezögert, darüber zu sprechen, wie oder ob es überhaupt mit uns weitergehen sollte. Ich hatte mir ein Herz gefasst, die Nummer meines Nokia-Handys aufgeschrieben und sie Maël am Ende unseres Spaziergangs in die Hand gedrückt.
Noch nie hatte ich seine Augen so strahlen sehen. Wahrscheinlich war er in dem Moment sehr glücklich gewesen und ließ deshalb ausnahmsweise ein Foto mit sich machen. Zumindest vermutete ich das.
Mit einem tiefen Seufzer legte ich das Foto neben mich auf die Bettdecke. All das musste ich mir nur eingebildet haben, denn als ich zu Hause ankam, blieb mein Handy stumm. Tage-, Wochen-, Monatelang … Und ich verstand die Welt nicht mehr. Das tragische Ende einer ach so süßen Sommerromanze.
Ein Klopfen ließ mich hochschrecken.
»Sisa-Schatz?« Meine Mutter schob die Tür einen Spaltbreit auf und steckte ihren Kopf herein. In den Händen trug sie ein Tablett, auf dem ein Glas und ein Krug mit Fruchtsaft standen. »Hast du vielleicht Durst?«
Sie bemühte sich wirklich Tag und Nacht um mich. Ich seufzte leise. »Ja, danke.«
Meine Mutter kam ins Zimmer und stellte das Tablett auf den Nachttisch. Als sie sich neben mich setzen wollte, griff sie schneller nach dem alten Foto als ich. »Schaust du immer noch die Urlaubsbilder an?«
»Hmh.« Ich nahm ihr das Bild aus der Hand und betrachtete es wehmütig. »Er hat sich nie wieder gemeldet …«
»Ich weiß.«
»Wochenlang hab ich mir wegen dem Mistkerl die Augen aus dem Kopf geheult.«
»Ach, Schatz.« Meine Mutter strich mir tröstend über den Arm. »Das sind sie doch alle nicht wert.«
»Anscheinend bin ich für sie alle einfach nicht gut genug!«, rief ich frustriert. »Offenbar bin ich dazubestimmt, verlassen und enttäuscht zu werden. Es fehlt mir wohl irgendwas. Irgendwas, wegen dem ich es nicht wert bin, geliebt zu werden!« Ich blinzelte heftig. Warum kamen nur ausgerechnet jetzt die Tränen?
»Luisa, bitte!«, sagte Mama erschrocken. »Sag so was doch nicht.«
»Aber es stimmt doch! Warum sonst werde ich wohl immer wieder weggeworfen wie ein alter Handschuh! Michael war ich plötzlich egal, Maël wollte nichts mehr von mir wissen, sobald ich …«
»So war es nicht.« Sie sagte es so leise, dass ich es fast nicht verstand.
»Ich war es Maël nicht mal wert, per SMS Schluss zu machen. Egaler kann dir eine andere Person dann wohl nicht sein …«
»Das warst du ihm nicht, Luisa«, wiederholte Mama mit einem merkwürdigen Gesichtsausdruck.
»Und woher willst du das wissen?«, fauchte ich. »Ihr habt beide kaum ein Wort mit ihm gesprochen. Das sagst du doch jetzt nur, um …«
»Ich hab ihm gesagt, du wärst schon mit einem anderen zusammen.«
Die Worte hallten wie ein Paukenschlag nach, und trotzdem sickerten sie nur langsam zu mir durch. Schemenhafte Erinnerungen tauchten blitzlichtartig vor meinem geistigen Auge auf. Mama, die ein letztes Mal zurück ins Hotel ging, um eine Rechnung zu bezahlen. Papa und ich, ungeduldig im vollgepackten Auto, während sich ihre Abwesenheit ungewöhnlich lange hinzog. Nun wusste ich, warum.
»Das hast du nicht …«, sagte ich leise.
»Du musst mich verstehen«, erwiderte meine Mutter, ihr Tonfall irgendwo zwischen entschuldigend und selbstgerecht. »Du warst so jung und impulsiv, du standst kurz vor dem Abitur. Ich wollte nicht, dass du dir wegen eines Urlaubsflirts die Zukunft kaputt machst. Und wenig später hast du ja auch Michael kennengelernt …«
Wut köchelte in mir hoch.
»Spinnst du eigentlich!«, rief ich. »Hast du nie verstanden, warum ich ihn überhaupt kennengelernt habe? Warum ich in dem Jahr bis zu meinem Abschluss zu nichts zu gebrauchen war? Weil ich beschissen heftigen Liebeskummer hatte und mich mit allen möglichen Mitteln versuchte habe, davon abzulenken! Darum war ich ständig in irgendwelchen Bars, Clubs und auf mittelmäßigen Konzerten. Du hättest meinen Abschluss wahrscheinlich eher gerettet, wenn du nicht diese miese Aktion unternommen hättest.«
»Es tut mir leid«, sagte meine Mutter leise. »Ich wusste ja nicht, dass er dir so viel bedeutet hat.«
»Warum erzählst du mir das alles überhaupt jetzt?« Ich schnaubte.
»Hätte es dafür jemals einen guten Zeitpunkt gegeben? Ich wollte nur nicht … nur nicht, dass du wirklich denkst, du wärst es nicht wert, geliebt zu werden.«
»Das ist ja wirklich toll, mir das jetzt zu sagen! Zwölf Jahre später!«
»Ich hätte nie gedacht, dass es noch einmal wichtig wird …«
»Lass mich bitte allein, okay?«, sagte ich mit bebender Stimme.
»Luisa …«
»Bitte lass mich jetzt allein«, wiederholte ich, diesmal fest und entschlossen.
Meine Mutter schien einen Moment etwas antworten zu wollen, dann besann sie sich eines Besseren. Sie stand auf und ging zur Zimmertür, doch anstatt mein Zimmer zu verlassen, wandte sie sich noch mal zu mir um.
»Maël war heiß und innig in dich verliebt«, sagte sie. »Ich wünschte nur, ich hätte nicht immer so viel Angst um dich gehabt.«
Dann ging sie und ließ mich allein mit einer Erkenntnis, die nach zwölf Jahren mein ganzes Leben auf den Kopf stellte.
Kapitel 2
An Schlaf war nicht zu denken. Schon seit Stunden lag ich in meinem etwas zu kleinen Bett und wälzte mich von der einen auf die andere Seite. Die Bettdecke befand sich zusammengeknautscht am Ende des Gestells. Bei der Hitze brauchte man sich nicht zuzudecken.
Ich hatte nicht mehr mit meiner Mutter gesprochen, nichts mehr gegessen, nur den traurigen Rest Saft ausgetrunken und dann erst die Wand mir gegenüber, später die Zimmerdecke angestarrt. Sorgfältig hatte ich beobachtet, wie das orangegoldene Sommerlicht langsam verblich und sich zurückzog, um mich in der Dunkelheit allein zu lassen. Allein mit meinen Gedanken.
In mir hatte sich eine erschöpfende Mischung aus Wut und Enttäuschung breitgemacht. Während sich ein Teil von mir beständig darüber aufregte, wie sehr sich meine Mutter damals – und auch noch irgendwie heute – in mein Leben einmischte, konnte ein anderer Teil aber nicht anders, als zu strahlen.
Das war der Teil, der immer wieder diesen einen magischen Satz vor sich hin flüsterte. Maël war heiß und innig in dich verliebt. Ich hatte mir seine Gefühle nicht eingebildet. Er hatte damals nicht einfach mit einem Schulterzucken das Interesse verloren, vielmehr … Na ja, vielmehr hielt er mich wohl bis heute für eine gemeine Herzensbrecherin.
Ich konnte es nicht fassen, dass jetzt nach all dieser Zeit mein Leben diesen seltsamen Haken schlug, weg von Michael und Annabell, wieder zurück zu dieser längst vergangenen Zeit …
Ich setzte mich auf und schaltete das Licht der Nachttischlampe an. Wohl zum hundertsten Mal fand meine Hand das zerknitterte Foto auf dem kleinen Beistelltisch neben meinem Bett. Vorsichtig strich ich mit dem Daumen darüber. Selten in meinem Leben hatte ich mir so sehr gewünscht, die Zeit zurückdrehen zu können. Wäre ich doch in der Lage, einfach in das Foto hineinschlüpfen und von diesem Augenblick an alles anders machen …
Aber ich konnte es nicht. Niemand konnte einfach zurückgehen. Zumindest nicht zurück in der Zeit. Ein Gedanke tauchte plötzlich in meinem Kopf auf. Er wollte mich dazu bringen, etwas wirklich und wahrhaftig Verrücktes zu tun.
Was brauchte man, wenn man abhauen wollte? Ich hätte nie gedacht, dass ich mir jemals diese Frage stellen würde. Als Michael damals beschlossen hatte, zu Annabell zu ziehen, war das für ihn Nötigste aus unserer Wohnung verschwunden: Zahnbürste, Kleidung, Laptop.
Daran konnte ich mich jetzt wenigstens orientieren, als ich im fahlen Dämmerlicht der frühen Morgenstunden zusätzliche Unterhosen in das Seitenfach eines Rucksacks stopfte. Klamotten, Waschzeug, Handy und Tablet, Geld, Ausweis, eine von Mamas Trinkflaschen aus recyceltem Stahl … Schon bald war der Rucksack bis zum Rand vollgestopft und ich zwar nicht der Überzeugung, jetzt bestens für ein Abenteuer vorbereitet zu sein, aber zumindest war es ein Startpunkt.
Ein kleiner Teil von mir war ohnehin nicht davon überzeugt, dass ich das wirklich durchziehen würde. Dafür war ich doch schon längst nicht mehr der Typ. Kurzschlusshandlungen, verrückte Einfälle, konnte man das noch mal neu lernen?
Zeit, es herauszufinden.
Diesen Satz wiederholte ich immer wieder in meinem Kopf, während ich mit geschultertem Rucksack leise die Treppe ins Erdgeschoss hinunterschlich. Zum Glück befand sich mein Auto bereits in Stuttgart. Sonst hätte ich entweder das meiner Mutter borgen oder mit dem Transporter abhauen müssen.
Wenn sich in Filmen Leute aus dem Staub machen, hinterlassen sie meistens einen Zettel auf dem Küchentisch. Entweder das, oder sie gehen ohne ein Wort zu sagen, um den dramatischen Effekt zu erhöhen. Ich konnte beiden Optionen etwas abgewinnen. Allerdings war mir absolut klar, dass bei einem wortlosen Abgang in kürzester Zeit die Hölle über mich hereinbrechen würde.
Meine Mutter würde es fertigbringen, innerhalb von achtundvierzig Stunden das FBI auf mein Verschwinden anzusetzen, und im Monat darauf käme die Geschichte bei Aktenzeichen XY. Mein Vater würde seine Konferenz in San Diego abbrechen – je nachdem, wann sein Vortrag vorbei war – und sich beschweren, dass er eine Ausrede für seinen frühen Abgang erfinden musste.
Für einen Geologen mit dem Schwerpunkt »Vorhersage von Naturkatastrophen« gab es irgendwann kaum noch Ereignisse, die man getrost als schwerwiegend deklarieren konnte. Vielleicht hatte er Mama geheiratet, um täglich daran erinnert zu werden, dass unser Alltag sehr wohl voll unvorhergesehener Gefahren war. Ja, das Verhältnis zu meinen Eltern, genauso wie das Verhältnis zwischen meinen Eltern, war nicht immer das einfachste gewesen.
Passte deshalb mein Abschiedsbrief auf ein winzig kleines Post-it? Ich blinzelte und blickte hinunter auf den kleinen pinken Zettel, den ich mittlerweile auf dem Küchentisch platziert hatte.
Nehme mir Urlaub, brauche Zeit für mich.Mach dir keine Sorgen, ich melde mich!Danke für alles,hab dich lieb, L.
Nehme mir Urlaub. Ich wusste selbst nicht mal genau, warum ich diesen Satz vorangestellt hatte. War das überhaupt ein Urlaub? Oder ein Selbstfindungstrip? Ein Abenteuer? Eine Grand Tour ins Ungewisse? Eine »ich bin dann mal meine Jugendliebe ausfindig machen und weiß selbst nicht mal so genau, warum«-Reise? Wahrscheinlich war es das. Aber das passte nicht mehr aufs Post-it.
Auf jeden Fall machte sich ein seltsam erleichtertes Gefühl in mir breit, als ich das Wohnzimmer und die Küche verließ und nach dem Rucksack im Flur griff.
»Luisa?«
Das Herz rutschte mir in die Hose. Ich drehte mich um. Die Stimme meiner Mutter kam aus dem Obergeschoss. Dann hörte ich ein vorsichtiges Klopfen.
»Luisa?«
Anscheinend hatte Mama in der Nacht genauso wenig geschlafen wie ich und suchte jetzt das Gespräch.
»Sisa-Schatz, darf ich reinkommen? Können wir nicht noch mal darüber reden?«
Mein Herz pochte so laut, ich war überzeugt, dass sie doch hören musste, dass ich direkt unter ihr im Flur stand.
»Hör mal, ich weiß, dass du sauer bist. Ich verstehe, dass du sauer bist.«
Ich hätte gehen sollen. Ich wusste, wenn ich verschwinden wollte, dann musste ich es jetzt tun, aber ich konnte es nicht. Ich stand einfach nur da wie versteinert, denn dass meine Mutter einen Fehler zugab, kam selten vor. Das traf mich völlig unvorbereitet. Meine Finger um den Griff des Rucksacks lockerten sich.
»Aber auch wenn du wütend auf mich bist, solltest du jetzt wirklich keine Dummheiten machen, ja? Versprichst du mir, dass du keine Dummheiten machst?«
Ein bitteres Gefühl breitete sich in mir aus und schnürte mir die Kehle zu. Nichts hatte sich geändert. Gar nichts. Da stand meine Mutter vor meinem leeren Zimmer, vollkommen überzeugt davon, genau zu wissen, wie ich mich fühlte, was das Beste für mich war und was genau ich jetzt tun sollte.
Ich konnte das nicht mehr. Ich wollte das nicht mehr. Meine Finger schlossen sich wieder fest um den Riemen des Rucksacks. Es war Zeit, zu gehen.
Manchmal stellte ich mir mein Leben wie das Laufen über eine Hängebrücke vor. Man bewegte sich über diese wacklige, unsichere Brücke und geriet dabei immer wieder gehörig ins Schwanken. Nervosität stieg in einem auf, also lief man schneller, um endlich auf die andere Seite zu kommen, aber gleichzeitig schwang die Brücke dadurch nur noch mehr hin und her. Man rannte also, während es unter einem nur so schlingerte und bockte, angetrieben von der irren Hoffnung, dadurch früher auf die sichere Seite zu gelangen.
In meinem Leben schlingerte und bockte es zurzeit ganz gewaltig. Also rannte ich, so schnell wie möglich, so weit wie möglich. Na ja, eigentlich fuhr ich so weit wie möglich, und der Meinung der Fahrer hinter mir zufolge, nicht mal ansatzweise schnell genug. Genervt rollte ich mit den Augen und reckte den Hals, um das nächste Schild nicht zu verpassen.
Der Autobahnring rund um Paris war – milde ausgedrückt – die reinste Hölle. Dass ich ausgerechnet hier beschlossen hatte, mich in metaphorischen Gedanken rund um das Leben an sich zu verlieren, rührte auf keinen Fall daher, dass man hier so gut zur Ruhe kam. Nein, es lag eher daran, dass ich mittlerweile hungrig, durstig und latent übermüdet in meinem blauen Mini Cooper saß.
Klar, ich hatte immer wieder kleine Pausen eingelegt, aber die sieben Stunden von Stuttgart bis hierher hatten mich ausgelaugt. Mit meinen Eltern war ich nicht an einem Stück in die Bretagne gefahren. Wir hatten die Nacht auf halber Strecke in irgendeinem kleinen Hotel verbracht. Genau dasselbe wollte ich nun auch tun, sobald ich irgendwie aus dieser Verkehrshölle entkommen war.
Gerade, als ich die richtige Ausfahrt nach Rennes entdeckt hatte, leuchtete mal wieder das Display meines Handys auf, das auf dem Beifahrersitz lag. Mir brach der Schweiß auf der Stirn aus. Mein Unterbewusstsein verknüpfte Anrufe immer mit negativen Neuigkeiten, denn wenn jemand keine Textnachricht schrieb, musste es dringend sein. Und wenn es dringend war, war es meistens nichts Gutes.
Seit einigen Stunden gingen jede Menge Anrufe auf meinem Smartphone von Leuten ein, die mir dringend etwas zu sagen hatten. Michael war darunter, meine Mutter und jemand mit einer mir unbekannten Nummer, aber ich hatte beschlossen, sie alle zu ignorieren. Zumindest so lange, bis ich so weit von Stuttgart und München entfernt war, dass eine spontane Kehrtwende keine Option mehr war. Ich pustete eine Haarsträhne aus meiner Stirn und drückte aufs Gaspedal.
Eine halbe Stunde später parkte ich auf einer großen grauen Betonfläche neben einigen Lastern mit fleckigen Abdeckungen. Vor mir ragte ein grauweißes Gebäude auf, an dem riesengroße grüne Plastikbuchstaben verkündeten, dass es sich um das Motel Leroy handelte. Hier würde ich also die erste Nacht meines »Urlaubs« verbringen.
Für eine Nacht würde es schon reichen. Die nächste Etappe würde noch mal gute sechs Stunden in Anspruch nehmen. Mein Hintern schmerzte von der langen Fahrt, Shorts und T-Shirt klebten an meiner Haut, und mein Nacken tat höllisch weh. So konnte ich heute nicht mehr weitermachen.
Kurzentschlossen stieg ich aus dem Wagen steuerte das Motel an und drückte die Glastür auf. Drinnen sah es genauso minimalistisch und lieblos aus wie draußen, aber es gab immerhin eine Klimaanlage. Hinter der Rezeption saß eine Teenagerin in froschgrünem Oberteil, die mit langen manikürten Fingernägeln auf ihrem Handy herumtippte, was ein klackendes Geräusch erzeugte.
»Salut«, sagte ich mit ausgetrockneter Kehle, um mich bemerkbar zu machen.
Die junge Rezeptionistin blickte auf und musterte mich, ohne ihr Handy wegzulegen. »Oui?«
Ich erklärte in sehr langsamem Französisch, dass ich ein Zimmer für eine Nacht buchen wollte.
Meine Gesprächspartnerin nickte, wandte sich dem Computer zu und begann etwas einzutippen. Währenddessen ergoss sich ein Wortschwall aus ihrem Mund, den wohl jeder Französischlehrer freudestrahlend für das nächste Hörverstehen einer Klausur aufgenommen hätte. Mir wurde in dieser Alltagssituation klar, dass mein Französisch mehr als eingerostet war.
Letztlich überwanden wir die Sprachbarriere, indem die Rezeptionistin mir einen Flyer überreichte, der alles, was sie gerade gesagt hatte, noch mal auf Tschechisch, Polnisch, Spanisch, Englisch und Deutsch auflistete. Ich bedanke mich artig – auf Französisch – und machte mich auf den Weg in mein Zimmer.
Dort angekommen ließ ich meinen Rucksack einfach auf den Boden plumpsen und mich selbst auf das schmale Bett an der Wand. Müde schloss ich die Augen und schlang die Arme um meinen Oberkörper. Ich befand mich in einem merkwürdigen Zustand zwischen aufgekratzt und erschöpft.
Ein paar Minuten lag ich einfach nur da und lauschte meinem eigenen Atem. Jedes Mal, wenn ich die Augen schloss, tauchte inzwischen schon ganz von selbst das Bild von Maël in meinen Gedanken auf. Ich seufzte.
Wie sollte ich ihn nur ausfindig machen? Ganz davon abgesehen, dass wir uns seit zwölf Jahren nicht mehr gesehen hatten, wusste ich … Tja, ich gab es nicht gern zu, aber ich wusste nicht mal mehr seinen Nachnamen.
Dieser peinliche Fakt hatte mich heute schon den ganzen Tag über gequält. Im Hotel hatten ihn alle einfach nur Maël gerufen – in einem mehr oder weniger strengen Tonfall. Ich wusste, dass er ihn mir einmal gesagt hatte, aber das war nun schon so lange her … Ich meinte, dass es ein ziemlich durchschnittlicher Name gewesen sei, einer den man in jedem Französischbuch für Einsteiger lesen konnte. Dupont? Durand? Laurent? Er fiel mir beim besten Willen nicht mehr ein.
Ich setzte mich auf und vergrub frustriert den Kopf in den Händen. Das konnte ja heiter werden. Ich tauchte im Hotel auf und erkundigte mich nach einem Küchenjungen, der seit wahrscheinlich zwölf Jahren nicht mehr dort arbeitete und von dem ich nur den Vornamen wusste.
Mein Grübeln wurde vom Vibrieren meines Handys durchbrochen, das ich in der Tasche meiner Shorts verstaut hatte. Müde zog ich es hervor. Schon wieder diese unbekannte Nummer. Ich wusste nicht, ob das etwas Gutes oder etwas Schlechtes war. Zumindest waren es weder meine Mutter noch Michael, also nahm ich ab, denn viel schwieriger konnte die aktuelle Situation eigentlich nicht werden.
»Hallo?«
»Spreche ich mit Frau Herzfeld?«, meldete sich eine unbekannte Frauenstimme.
Nervös setzte ich mich auf. Gut, dass beim Telefonieren niemand sehen konnte, in was für einem desolaten Zustand man sich befand.
»Ja, das bin ich«, antwortete ich vorsichtig. »Luisa Herzfeld.«
»Elena Stapf, stellvertretende Chefredakteurin vom Joyful Magazine. Ich bin für das Online-Ressort zuständig.«
»Oh! Oh, okay«, sagte ich und klang dabei wahrscheinlich wenig kompetent. Ich war völlig überrumpelt. Schließlich hatte ich Dutzende Arbeitsproben an so viele Magazine geschickt und niemals eine Antwort erhalten.
»Ihr Portfolio ist in meinem Mail-Fach gelandet. Mir gefällt Ihr Stil, und wir bauen gerade unseren Online-Auftritt um, dafür suchen wir nach neuen Stimmen und neuen Formaten.«
Joyful Magazine. Die Bewerbung musste schon mindestens einen Monat her sein. Dass die Dame ausgerechnet jetzt mit einem lukrativen Angebot um die Ecke kam, war wohl eine Art von Schicksalswink.
»Wow, das freut mich wirklich sehr!«, sagte ich und hoffte dabei weder panisch noch resigniert zu klingen.
»Hätten Sie denn vielleicht spontan ein paar Ideen? Ein Thema, über das Sie gerne bei uns berichten würden?«
»Na klar!«, behauptete ich und begann mich auf der Suche nach Inspiration in dem muffigen kleinen Motel-Zimmer umzusehen. »Wie wäre denn etwas mit …etwas mit … mit Reisen?«
»Reisen?«, hakte Frau Stapf nach und klang nicht wirklich überzeugt.
»Ja, genau, eine Reise …«, fabulierte ich fieberhaft, »eine, eine Reisekolumne!«
»Ich wusste gar nicht, dass Sie in Reisethemen drin sind«, erwiderte Frau Stapf verwundert.
»Tatsächlich ist es so, dass …« Ich massierte mit meiner freien Hand angestrengt meine Stirn. »Also, ich bin in den nächsten Wochen in Frankreich, in der Bretagne genauer gesagt, und darüber würde ich gerne schreiben.«
»Oh, okay.« Frau Stapf klang überrascht. »Na ja, man kann es ja mal ausprobieren. Sie finden sicher noch einen kleinen Twist, um das Ganze interessant zu machen.«
»Versprochen!«, antwortete ich sofort.
»Können Sie mir bis zum Ende der nächsten Woche den Entwurf Ihrer ersten Kolumne schicken? Dann können wir entscheiden, ob sich das für unsere Seite eignet.«
»Klar«, sagte ich. »Sehr gern.«
»Wunderbar, dann notiere ich mir das. Sie bekommen in den nächsten Tagen dann noch eine Mail mit allen wichtigen Infos zum Verlag, Konditionen, falls ein Vertrag zustande kommt et cetera. Bei Fragen können Sie sich gerne wieder bei mir melden«, sagte Frau Stapf.
»Das mache ich, danke!«
»Ich bin sehr gespannt darauf, was Sie sich einfallen lassen …«
Das war ich auch …
»Schönen Abend noch«, verabschiedete ich mich höflich.
»Wünsch ich Ihnen auch. Wiederhören!«
Nach diesem Anruf blieb ich eine Weile auf der harten Bettkante sitzen und versuchte meine Gedanken zu sortieren. In jeder anderen Lebenslage wäre ich wahrscheinlich freudestrahlend durchs Zimmer gehüpft und hätte anschließend eine Flasche Sekt geöffnet – hier gab es allerdings nicht mal eine Mini-Bar.
In meiner jetzigen Situation fühlte sich das Angebot vom Joyful Magazine leider eher wie eine zusätzliche Bürde an. Jetzt hatte ich wohl keine andere Wahl mehr. Ich musste in die Bretagne, ob ich nun Maël finden wollte oder nicht. Sollte ich daraus eine Geschichte machen, an der die ganze Welt teilhaben konnte?
Mir blieb nichts anderes übrig, denn Frau Stapf hatte es selbst gesagt: Ich war keine Reisejournalistin. Keine National-Geographic-Reporterin, die jeden Winkel ihres Zielortes kannte und exklusive Geheimtipps auf Lager hatte. Meine einzige Chance war daher, dieses offensichtliche Manko in meine größte Geheimwaffe zu verwandeln.
Ich musste die Leser an meiner ratlosen Suche nach Orientierung teilhaben lassen, denn wenn ich Frau Stapf am Ende der nächsten Woche einen halbseitigen Text schicken würde, in dem ich das Motel Leroy als lauschiges Liebesnest für Pärchen auf der Durchreise empfahl, würde der Vertrag in weite Ferne rücken. So viel stand fest.
Wow, ich hatte das Gefühl, dass die Hängebrücke mal wieder ganz gewaltig ins Wackeln geriet …
Kapitel 3
Als mich am nächsten Morgen der Wecker meines Handys aus meinen Träumen riss, verfiel ich für einen kurzen Augenblick leicht in Panik. Ich musste mich einen Moment sortieren und vor allem wieder daran erinnern, dass all die verrückten Dinge, von denen ich geträumt hatte, auf wahren Ereignissen beruhten.
Als sich diese Erkenntnis eingenistet hatte, kroch ich ein Stückchen tiefer unter meine Decke. Dort brauchte ich eine Weile, bis ich mich wieder daran erinnert hatte, dass ich eine verantwortungsbewusste junge Frau war, die sich von nichts und niemandem aufhalten ließ.
Nach dieser Selbstbeschwörung schälte ich mich langsam und immer noch ziemlich mürrisch aus der Bettdecke. Wie die meisten Menschen griff ich als Erstes nach meinem Handy, das auf dem Nachttisch lag. Meine Mutter hatte gestern Abend noch ein-, zweimal versucht, bei mir anzurufen.
Von meinen Bekannten hörte ich in letzter Zeit nicht mehr viel. Seit der Trennung hatte ich das Gefühl, dass der Großteil froh war, wenn ich mich nicht meldete. Sie schienen mit der Situation fast genauso überfordert zu sein wie ich. Müslischüsseln und Möbel konnte man ja noch untereinander aufteilen, aber Freunde?
Niemand wollte am Telefon Fragen stellen wie: Ist es okay für dich, wenn ich mit Annabell und Michael was unternehme? Manche wollten vielleicht auch einfach nur die Erkenntnis ausblenden, dass selbst beim augenscheinlich größten Traumpaar alles den Bach runtergehen konnte.
Ich verstand es, und mir kam die Funkstille auch ganz gelegen. Es gab wichtigere Dinge, auf die ich mich jetzt konzentrieren musste: Die letzte Etappe auf dem Weg in die Bretagne.
Nach einem kargen Frühstück im Motel, das aus billigem Müsli mit Milch und einem ziemlich dünnen Kaffee bestanden hatte, trat ich die letzten sechseinhalb Stunden Fahrt in die Gegend rund um Carnac an. Die Bretagne lag im äußeren linken Zipfel von Frankreich. Vorwitzig ragte er in den Atlantik hinein, als wollte er gleich ablegen und irgendwo im Ozean eine eigene Inselrepublik gründen.