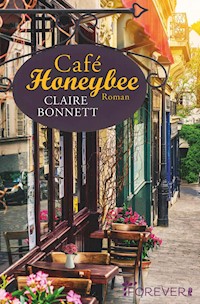4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ein Wohlfühlroman im Loiretal
- Sprache: Deutsch
Ein kleines französisches Dorf, liebenswerte Einwohner und ein Hauch von Hollywood!
Élodie kann es kaum glauben! Ausgerechnet im Schloss ihres verschlafenen kleinen Heimatdorfs Courléon soll ein Historienfilm gedreht werden. Alle Dorfbewohner sind furchtbar aufgeregt und wollen beim Dreh dabei sein. Als sich das Team vor Ort nach Komparsen umsieht, landet Élodie prompt als Hofdame am Filmset. Schon bald lernt sie den attraktiven Hauptdarsteller Paul kennen, der ihr ein wenig länger in die Augen sieht als allen anderen. Sehr zum Missfallen des jungen Schlosserben Nicolas, der seit Kindheitstagen eine heimliche Schwäche für Élodie hat. Ein trubeliger Sommer voller Gefühlschaos nimmt seinen Lauf ...
Der erste Band der romantischen Feel-Good-Reihe rund um ein kleines Schloss im idyllischen Loire-Tal.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 374
Veröffentlichungsjahr: 2023
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Über die Autorin
Weitere Titel der Autorin
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an: be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Dein beHEARTBEAT-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Élodie kann es kaum glauben! Ausgerechnet im Schloss ihres verschlafenen kleinen Heimatdorfs Courléon soll ein Historienfilm gedreht werden. Alle Dorfbewohner sind furchtbar aufgeregt und wollen beim Dreh dabei sein. Als sich das Team vor Ort nach Komparsen umsieht, landet Élodie prompt als Hofdame am Filmset. Schon bald lernt sie den attraktiven Hauptdarsteller Paul kennen, der ihr ein wenig länger in die Augen sieht als allen anderen. Sehr zum Missfallen des jungen Schlosserben Nicolas, der seit Kindheitstagen eine heimliche Schwäche für Élodie hat. Ein trubeliger Sommer voller Gefühlschaos nimmt seinen Lauf …
Kapitel 1
»Bitte schön, Madame, Ihr café au lait und ein pain au chocolat.«
Vorsichtig stellte ich den Teller mit dem Gebäck und die dampfende Tasse auf dem runden Holztisch ab. Das schaumige Herz auf dem Café schwappte dabei bedenklich nach rechts.
Die ältere Dame am Tisch sah mit irritierter Miene erst zu dem Getränk und dann zu mir. »Ich habe aber ein ganz normales Croissant und einen Kaffee ohne Milch bestellt«, teilte sie mir auf Englisch mit. »Ich vertrage keine Milch.«
»Mince!« Peinlich berührt kratzte ich mich am Hinterkopf. »Ja, gut, dann bringe ich Ihnen jetzt besser mal das Richtige, oder? Un instant s’il vous plaît!«
Ich schnappte mir so hastig die Tasse und das pain au chocolat, dass ein paar Spritzer des Heißgetränks doch noch auf der Tischplatte landeten.
»Entschuldigen Sie, ich bringe gleich Servietten!«, rief ich über meine Schulter und machte mich dann schnurstracks auf den Weg zurück zur Küche. An diesem Tag schien alles schiefzulaufen. Hatte die Dame wirklich ein Croissant bestellt? Vielleicht hatte mich ja das ewige Chanson-Gedudel aus den Lautsprechern aus dem Konzept gebracht.
Das kleine Bistro, in dem ich kellnerte, verkörperte bis ins letzte Detail, was Touristen sich unter »typisch französisch« vorstellten. Eilig schlüpfte ich unter einer Girlande aus rot-weiß-blauen Flaggen hindurch zurück in die Küche.
»Ähem, sie wollte doch ein Croissant«, verkündete ich dort. »Und Servietten bräuchte ich noch.«
»Na, so was.« Mein Vorgesetzter Monsieur Charlier bedachte mich mit einem strengen Blick. »Unsere Frau Anwältin scheint heute Konzentrationsschwierigkeiten zu haben.«
Im Bistro arbeiteten hauptsächlich Studenten, und mein Chef hatte die merkwürdige Angewohnheit, uns mit unserem Berufsziel anzusprechen. Das hieß, es gab einen Herrn Lehrer, eine Frau Biologin und natürlich mich, die Frau Anwältin. Nur leider wollte ich heute noch weniger als sonst an meine akademische Laufbahn erinnert werden.
»Das Leben als Anwältin ist nun mal hart«, erwiderte ich düster. »Besonders das einer angehenden Anwältin.«
»Einspruch abgelehnt.« Charlier packte ein Croissant mit ein wenig Butter und Marmelade auf einen kleinen Teller mit Goldrand. »Und jetzt sieh zu, dass du der Dame die richtige Bestellung servierst.«
»Oui, Monsieur!«
Ich schnappte mir den Teller mit dem Croissant und ein paar Servietten und eilte so schnell ich konnte zurück in den Gastraum. Es war an diesem Morgen gut besucht, besonders von Touristen, die sich bei typisch französischem Flair durch alle Köstlichkeiten des Landes probieren wollten. Das Stimmengewirr und die vielen gezückten Kameras und Smartphones, um ein paar Erinnerungsfotos zu schießen, machten mich nervös. Ganz abgesehen von den Kleinkindern, die in regelmäßigen Abständen gegen meine Beine prallten.
»So, aber jetzt, Madame«, sagte ich, als ich beim richtigen Tisch angekommen war. »Ein herrlich frisches, luftig leichtes Croissant für Sie.« Ich stellte den Teller vor ihr ab.
Mein Gast bedachte mich lediglich mit einem vernichtenden Blick. »Und was ist mit meinem Kaffee ohne Milch?«
»Merde.«
Ich bemerkte selbst, wie sich mehrere Gäste zu mir umdrehten. Zu Recht. So gründlich sah man wohl selten eine Kellnerin die Bestellung vermasseln. Mir wurde heiß.
»Es tut mir unendlich leid, Madame! Ihr café sans lait kommt natürlich auch sofort.«
»Wann haben Sie denn bitte hier angefangen?«, schimpfte nun die Dame. »Heute Morgen?«
»Ich bin normalerweise wirklich nicht so schusselig, aber heute … heute habe ich einfach einen schlechten Tag. Wissen Sie, ich studiere an der Sorbonne und –«
Ich wurde von der majestätisch erhobenen Hand der alten Dame unterbrochen. »Ich bin nicht hierhergekommen, um Ihren schlechten Tag auszusitzen, Mademoiselle. Machen Sie sich also nicht die Mühe, ich suche mir lieber ein anderes Bistro.«
Mir klappte erschrocken der Mund auf, als sie ihren Stuhl mit einem knarzenden Geräusch zurückzog und sich vom Tisch erhob. »Au revoir!«
Und ehe ich noch etwas sagen oder tun konnte – wobei ich wirklich nicht wusste, wie dieser Notfallplan ausgesehen hätte –, schlug die Tür des Bistros hinter ihr zu. Zut alors. Ich biss die Zähne zusammen und beugte mich nach vorn, um das unberührte Croissant wieder wegzutragen. Wer weiß … wenn ich es irgendwo versteckte und die Rechnung selbst beglich, würde Charlier vielleicht niemals davon …
»Das war ja eine traurige Vorstellung.«
Nur ein letzter Rest Geistesgegenwärtigkeit verhinderte, dass ein Croissant mitsamt Butter und Marmelade auf dem Bistroboden landete. Direkt hinter mir stand mein Chef. Charlier hatte die Augenbrauen hochgezogen und die Arme über seinem ausladenden Bauch verschränkt. Zwei Sekunden lang sahen wir uns an, während ich vor Peinlichkeit ein paar Zentimeter zusammenschrumpfte. Dann nickte er mit dem Kinn in Richtung Küche. Wie ein Häufchen Elend folgte ich ihm. Kaum dass wir die Frankreichgirlande passiert hatten, ging es auch schon los.
»Élodie Vinet! Man könnte meinen, du hättest heute Morgen deinen Kopf zu Hause gelassen! Wenn es nicht mal zum Kellnern reicht, bin ich nicht sicher, ob er überhaupt zu etwas taugt.«
»Es tut mir leid, Monsieur. Es ist nur … Sie wissen schon, der Stress. Ich bin heute ein wenig …«
»Das ist mir egal. Wir befinden uns hier nicht in deiner Universität, sondern in meinem Bistro. In Paris. In der Stadt der Liebe, compris? Meine Gäste wollen verzaubert werden und sich nicht mit den seelischen Nöten ihrer Bedienung befassen. Und überhaupt, mit Anfang zwanzig sollte man sich doch wohl etwas besser im Griff haben.«
»Mitte zwanzig«, korrigierte ich unwillkürlich.
»Ich gebe dir jedenfalls für den Rest des Nachmittags frei.« Monsieur Charlier wirkte sehr bestimmt. »Deine Leichenbittermiene ist in meinem Laden fehl am Platz.«
»Aber –«
»Der Herr Lehrer wird für dich einspringen, und jetzt Marsch nach Hause. Und komm ja nicht auf die Idee, noch mal so kopflos zur Arbeit zu erscheinen, sonst kannst du dir gleich eine neue Stelle suchen.«
Das Gesicht, das ich daraufhin machte, rechtfertigte meinen vorzeitigen Feierabend wahrscheinlich nur noch zusätzlich.
»Ja, Monsieur …«
Niedergeschlagen zog ich meine Schürze aus und verließ kurz darauf zur schwungvollen Melodie von »Les Champs Élysées« das Bistro. Dabei befand ich mich gar nicht auf der französischen Prachtstraße. Vielmehr schlurfte ich mit eingezogenem Kopf die verwinkelten Gassen von Montmartre entlang, vorbei an Patisserien in blassrosa Gebäuden, malerisch mit Efeu umrankt. Apropos malen: Hier konnte man an jeder Ecke ein Porträt von sich anfertigen lassen.
Vorfreudige Touristen saßen auf wackligen Holzstühlen, während sich die Künstler und Künstlerinnen hinter weißen Leinwänden verschanzten und in ihr Werk vertieften. Jetzt, da der Frühling in der Stadt angekommen war, stahlen sich sogar ein paar goldene Sonnenstrahlen durch die grauen Wolken. Jede Menge verschiedene Sprachen verflochten sich zu einem Klangteppich. Die Atmosphäre war entspannt und voller Leichtigkeit. Ich mit meiner »Leichenbittermiene« passte nicht in dieses Urlaubsparadies.
Mir entwischte ein tiefer Seufzer, als ich schließlich die vielen, vielen Stufen des Montmartre zurück zur Metro-Station hinuntertrabte. Dabei gab es eigentlich gar keinen richtigen Grund für ein finsteres Gesicht. Allerdings hatte ich mich seit heute Morgen immer noch nicht getraut, die Mail zu öffnen, die in meinem Postfach gelandet war. Die mit dem unheilvollen Betreff: Ihre Prüfungsergebnisse.
Als ich kurz darauf in der Metro saß, neben einem adretten Herrn im Anzug, verbrachte ich Fahrt an drei Stationen vorbei damit, nervös meine Hände zu kneten, nur um schließlich doch wieder mein Handy aus der Tasche zu ziehen. Es wurde Zeit, dass ich endlich diese Nachricht öffnete. Aber ich konnte es nicht. Ich starrte einfach nur wie hypnotisiert auf die Betreffzeile, während mein Finger unentschlossen über dem Display schwebte.
»Trauen Sie sich, Mademoiselle.«
Verdutzt wandte ich mich von meinem Handy ab und blickte in das Gesicht des älteren Herren, der neben mir saß. Er schenkte mir ein ermutigendes, wenngleich etwas mitleidiges Lächeln.
»Vom Herauszögern wird es auch nicht besser, glauben Sie mir.«
Wenn jetzt sogar schon die Leute in der U-Bahn Mitleid mit mir hatten, musste ich wirklich wie ein besonders armes Häufchen Elend aussehen.
»Ich weiß, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es durchstehe, wenn ich durch die Abschlussprüfung gerasselt bin.«
»Ach was!« Mein redseliger Sitznachbar machte eine wegwerfende Handbewegung. »Prüfungen kann man doch wiederholen.«
»Hmmh …« Ich wollte nicht zugeben, dass es sich schon um meinen dritten Anlauf handelte. Zum Glück las ich in diesem Moment auf der Anzeigentafel, dass ich ohnehin aussteigen musste. »Hoffentlich wird das nicht nötig sein.« Ich erhob mich rasch von meinem Sitz. Die Metro kam mit einem Ruck zum Stehen, woraufhin ich gegen eine metallene Haltestange prallte. »Au revoir,Monsieur!« Ich rieb meine schmerzende Schulter und verließ die Metro.
Das Viertel, das ich kurz darauf betrat, war nicht ganz so malerisch wie Montmartre. Aber wenn man Paris noch nicht allzu lange kannte, konnte man dort eigentlich alles irgendwie romantisch finden. Selbst den Müll in den Abflussrinnen, die Graffitis an den beigen Mauern oder die omnipräsenten Baugerüste über den Bürgersteigen.
Ich zumindest hatte das alles zutiefst abenteuerlich gefunden, als ich vor fast fünf Jahren hierhergezogen war. Raus aus der öden province, rein in die Hauptstadt! Ich hatte dabei ein sehr verklärtes Bild meiner selbst im Kopf gehabt. Von einer Élodie Vinet, die wie eine echte Bohemienne aufregende Partys besuchte, bis spät in die Nacht mit Studenten diskutierte und nebenbei noch den Lernstoff wuppte. Nun, streng genommen hatten sich einige Teile des Bohème-Lebens tatsächlich bewahrheitet.
Ich kam vor einem majestätischen alten Gebäude zum Stehen. Ein für Paris so typischer Haussmann-Bau mit hellen Mauern und einem runden, grau schimmernden Dach aus Zink. Ich tippte den Zahlencode an der Eingangstür ein und schob sie mit der Schulter auf. Routinemäßig warf ich einen Blick hinüber zum Aufzug. Er wurde immer noch repariert.
Fünf Minuten später erreichte ich also mit rotem Gesicht und Seitenstechen das Zentrum meines Lebens in der Hauptstadt. Eine winzige Kammer unter dem Dach. Im Winter bildeten sich dort manchmal beim Atmen kleine Wölkchen, und im Sommer verlor man vor Hitze fast den Verstand. Wenn das nicht bohèmien war, wusste ich es auch nicht. Als ich eintrat, fasste ich den vagen Plan, mich mit Kühlschrank-Resten zu stärken, bevor ich einen neuen Versuch unternahm, das Ergebnis meiner Prüfungsleistung zu erfahren.
»Manchmal kannst du schon ein furchtbarer Angsthase sein«, murmelte ich deprimiert, als ich meine Jacke und meine Tasche an den Haken an der Eingangstür hängte. Wer es merkwürdig fand, dass ich es nicht über mich brachte, Nachrichten zu öffnen, sollte mich erst mal erleben, wenn ich vor der Aufgabe stand, einen Zahnarzttermin auszumachen.
Das Herz rutschte mir in die Hose, als in diesem Moment mein Handy klingelte. Einen Moment lang befürchtete ich, es wäre Charlier, der beschlossen hatte, mich doch noch zu feuern. Aber es war nicht Charlier, stellte ich erleichtert fest.
»Coucou, Solène!«, rief ich ins Handy.
»Hallo, Élodie.« Im Gegensatz zu mir hatte meine beste Freundin einen strengen Ton angeschlagen. Ich ging schlagartig mögliche Verfehlungen durch, bis ich zum Schluss kam, dass Solène erst im Oktober Geburtstag hatte, ich ihr umwerfendes Minikleid wirklich nur geliehen und mit ihrem Ex-Freund niemals ein weiteres Wort gewechselt hatte.
»Also was ist jetzt?« Noch immer glich ihr Ton einem Verhör.
»Ist was …?«, hakte ich vorsichtig nach.
»Na, hat es diesmal geklappt, chérie?«
Ich hätte es wissen müssen. Meine beste Freundin war so gut organisiert, sie hatte sogar auf dem Schirm, an welchem Tag ich die Ergebnisse meiner Abschlussprüfungen erhalten sollte. Da sie selbst mit mir Jura studiert hatte, war sie mit den Abläufen bestens vertraut.
»Na jaaa …«
»Chérie, du setzt dich jetzt hin und machst endlich deine Mail auf.«
Um ehrlich zu sein, war ich ganz dankbar für Solènes Anruf. Er war der Tritt in den Hintern, den ich gerade dringend benötigte.
»Okay, okay«, erwiderte ich gespielt widerstrebend und ließ mich auf den einzigen Stuhl in meinem winzigen Zimmer fallen. Mein Herz pochte wie verrückt, als ich mein Smartphone auf die Tischplatte legte und Solène auf Lautsprecher stellte. Am liebsten hätte ich wieder gekniffen, doch schließlich tippte ich auf die Nachricht und öffnete die Mail.
Sehr geehrte Madame Vinet, stand dort, alles Weitere nahm ich kaum wahr. Fahrig huschte mein Blick über den Text, bis ich an der entscheidenden Stelle hängen blieb … Ein dumpfes Gefühl breitete sich in meiner Magengegend aus. Ich hatte es geahnt.
»Jetzt spann mich nicht auf die Folter, Élodie.« Für einen kurzen Moment hatte ich fast vergessen, dass ich gleichzeitig ein Telefonat führte.
»Ich befürchte, es ist an der Zeit, der Wahrheit ins Auge zu sehen: Aus mir wird in diesem Leben keine Anwältin mehr.«
»Mon œil! Du übertreibst mal wieder.«
»Aber das ist schon das dritte Mal, dass ich durch die Abschlussprüfung gerasselt bin.« Ich überflog erneut den kurzen Text. »Sogar mit noch weniger Punkten als beim letzten Mal!« Frustriert vergrub ich den Kopf in den Händen.
»Hast du denn das Gefühl, du hast wirklich alles in deiner Macht Stehende getan, um dich auf diese Prüfung vorzubereiten?« Man merkte wirklich, dass meine beste Freundin im Gegensatz zu mir die geborene Juristin war. Sie scheute sich nie, unangenehme Nachfragen zu stellen.
Ich hob wieder den Kopf. »Na ja …« Wenigstens konnte sie nicht sehen, wie ich nervös auf meinem Stuhl herumrutschte.
»Dachte ich es mir doch.« Solènes Stimme wurde jetzt ein wenig sanfter. »Du kannst das schaffen, Élodie. Du musst dich nur einmal wirklich auf die Prüfung konzentrieren.«
»Aber ich hab mich doch –« Das Schnauben meiner besten Freundin unterbrach mich.
»Und ich habe deine Instagram-Stories verfolgt, chérie. Du warst in der Vorbereitungsphase zehnmal öfter auf irgendwelchen Festivals, Konzerten und Theaterpremieren als in der Bibliothek.«
Mit einem Seufzen bekannte ich mich schuldig im Sinne der Anklage. Mich fesselte das kulturelle Leben in Paris schon immer wesentlich mehr als die Frage, unter welchen Umständen Nachbar Garnier sonntags die Hecke schneiden durfte.
»Sperr dich in deiner Wohnung ein, wenn es hilft«, sagte Solène streng. »Hauptsache, du lässt dich bei deinem vierten Anlauf nicht ablenken. Meine Mittagspause ist leider gleich zu Ende. Wir können später noch telefonieren, wenn du möchtest. Jetzt sieh erst mal zu, dass du den Schock verdaust. À bientôt, chérie.« Weg war sie.
Ich ließ mein Handy auf dem quadratischen Esstisch liegen, als ich aufstand und mich dem einzigen Ort zuwandte, wo ich heute noch ein wenig Trost finden konnte: meinem Vorratsschrank. Ich schnappte mir eine Flasche Rotwein – in der Voraussicht gekauft, um meinen bestandenen Abschluss zu feiern. Als ich kurz darauf mit meinem frisch eingegossenen Glas wieder am Tisch saß, fühlte ich mich allerdings nur noch schlechter. Was für ein mieser, mieser Tag das doch war. Müde blinzelnd blickte ich auf das schwarze Handy-Display hinab.
Bei Solène klang alles immer so einfach. Lass dich nicht ablenken, chérie. Wenn einen Rechtsfragen nicht die Bohne interessierten, wurde sogar der QR-Code auf einer Mineralwasserflasche plötzlich interessant. Und selbst wenn ich mich mal an den Schreibtisch meiner »Wohnung« zwang, wie Solènes das winzige Dachkämmerchen nannte, bekam ich schon nach wenigen Stunden Beklemmungsgefühle.
Obwohl man sich in meinem winzigen Zimmer kaum umdrehen konnte und die Klospülung regelmäßig kaputt ging, musste ich lange Stunden in Charliers Bistro kellnern, um die Miete bezahlen zu können. Wenn man auch noch beschloss, ein Privatleben haben zu wollen, kamen die Vorbereitungen für die juristische Abschlussprüfung durchaus mal zu kurz.
Nur leider halfen all diese Rechtfertigungen nicht über die Tatsache hinweg, dass meine beste Freundin recht hatte. Mit meiner bisherigen Herangehensweise würde ich auch beim nächsten Versuch nichts erreichen und eine ewige Studentin bleiben.
Der Gedanke war derart niederschmetternd, dass ich nun doch einen Schluck Wein nahm. Währenddessen konnte ich hören, wie einige Tauben auf dem Dach landeten. Ihre Flugmanöver äußerten sich regelmäßig in einem leisen »Klonk« über meinem Kopf. Die ersten paar Male hatte ich mich noch zu Tode erschrocken.
Mein Blick glitt über den Rest meines kleinen Zimmers. Die Poster von Konzerten, die ich aufgehängt hatte, die zahlreichen Bücher und Postkarten von Flohmärkten, für die eigentlich überhaupt kein Platz war und die sich in die kleinsten Winkel in den Regalen und Wandnischen drängten. Und dann natürlich das Bild vom Eiffelturm, das ich nach meinem Einzug auf das Rollo vor meinem einzigen Fenster geklebt hatte. Einfach damit ich so tun konnte, als hätte ich von meinem Zimmer die beste Aussicht der Welt.
Aber all diese Dinge, die Souvenirs von meinen Streifzügen durch Paris, sie erinnerten mich im Grunde nur daran, dass Solène gesagt hatte, ich schöbe etwas vor mir her. Und es stimmte. Ich zögerte halb absichtlich, halb unbewusst das nächste Kapitel meines Lebens hinaus.
Die meisten Kommilitonen meines Jahrgangs hatten ihr Studium schon längst beendet. Solène arbeitete seit fast einem Jahr für eine schicke Anwaltskanzlei im 4. Arrondissement. Nur ich dümpelte unentschlossen vor mich hin, schwankend zwischen dem Wunsch, ebenfalls die Abschlussprüfung zu bestehen, und der Angst vor dem, was danach kommen sollte. Denn eine Karriere im französischen Justizsystem, das konnte ich mit Sicherheit sagen, würde mich nicht glücklich machen.
Das war keine besonders neue Erkenntnis, aber um die vielen Jahre Studium einfach hinzuschmeißen, komplett neu anzufangen, hatte mir einfach der Mut gefehlt. Zum jetzigen Zeitpunkt ohne Abschluss etwas Neues auszuprobieren erschien selbst mir wahnwitzig.
Nachdenklich lehnte ich mich zurück und verschränkte die Hände hinter dem Kopf. Solène hatte recht. Ich brauchte einen Ort, so arm an Überraschung und Ablenkung, dass einem fast nichts anderes übrig blieb, als Gesetzesbücher zu wälzen. Und gleichzeitig würde mir diese Ruhe vielleicht dabei helfen, herauszufinden, was ich wirklich vom Leben wollte.
Mein Blick blieb nun an einem anderen Punkt in meinem Zimmer hängen. Es war ein Foto von einer weiten grünen Landschaft, aufgenommen von einer kleinen Anhöhe. Eine kleine Ansammlung von Natursteinhäusern drängte sich in der Ferne an eine einsame Landstraße. Man konnte auf den ersten Blick wirklich nicht sagen, ob jemand das Bild Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts oder letzten Monat aufgenommen hatte. Ich lächelte schief. Manchmal lagen die Lösungen doch viel näher, als man dachte.
Kapitel 2
In Paris hatte ich die Anschaffung eines Autos nicht mal in Erwägung gezogen. Also setzte ich mich am nächsten Morgen am Gare de l’Est in einen Zug nach Westfrankreich. In die Pays de la Loire. Am Steuer eines Autos hätte ich auch nicht so viel Gelegenheit dazu gehabt, aus dem Fenster zu schauen und mitzuverfolgen, wie die dicht gedrängten Häuserzeilen der Großstadt langsam ausdünnten.
Die dicken Scheiben des TGV spiegelten mein nachdenkliches Gesicht, als wir die Pariser Vororte verließen. Instinktiv hob ich die Hand, um mein langes glattes Haar zurückzustreichen. Meine unermüdlichen Sparversuche hatten in den letzten Jahren dafür gesorgt, dass es mir fast bis zur Hüfte reichte. Solène hatte einmal angeboten, mir mithilfe eines YouTube-Tutorials eine aufregendere Frisur zu zaubern, aber es gab Dummheiten, die selbst mir unheimlich waren. Außerdem war mein langes Haar eines der wenigen Attribute, die ich aufrichtig an mir mochte.
Maman hatte meine Gesichtszüge immer »individuell« genannt. Eine interessante Beschreibung für meinen schmalen Mund und den kleinen Höcker auf meiner Nase, den ich allerdings nicht ihr, sondern meinem Vater zu verdanken hatte. Es war nun nicht so, dass ich besondere Abneigung gegen mein Äußeres hegen würde, aber viel Zeit verbrachte ich in der Regel auch nicht damit, selig in den Spiegel zu lächeln.
Mein Blick fiel auf die kleine Sorgenfalte, die sich über meinem Nasenbein gebildet hatte. Vermutlich stammte sie von dem Gedankengang, was heute noch auf mich zukommen würde, denn ich hatte meine Eltern die letzten zwei Jahren nicht besucht. Streng genommen, seitdem ich damit angefangen hatte, regelmäßig durch alle Prüfungen zu fallen.
Die Vorstellung, dass Maman immer noch stolz unseren Nachbarn erzählte, dass ihr einziges Kind als Anwältin Karriere machte, versetzte meinem Herzen einen kleinen Stich. Sie hatte nie etwas dagegen gehabt, dass ich nach dem Bac erst mal dreihundert Kilometer von meiner Heimat weggezogen war. Der Rest von Courléon? Der hatte nur unwillig mit dem Kopf geschüttelt und missmutig ein paar Sätze über die Jugend gemurmelt, die das Landleben nicht mehr zu schätzen wisse. Die Wahrheit war allerdings: Wer in Courléon lebte, musste schon die absolute Ruhe lieben, um dort auf Dauer glücklich zu werden. Oder wie ich es als Teenagerin meist genannt hatte: die absolute Langeweile.
Nur sehr langsam vergingen die Stunden im Zug, und weil ich zu nervös war, um zu lesen, ja sogar, um sinnlos auf meinem Handy durch das Internet zu scrollen, sah ich weiter dabei zu, wie sich die Landschaft draußen wandelte. In Touristenbroschüren wurde die Pays de la Loire selten als »absolut langweilig« beschrieben. Und im Grunde war sie das auch nicht. Tatsächlich stellte ich zu meiner eigenen Überraschung fest, dass auch ich das nicht länger so wahrnahm.
Wenn ich früher angesichts weiter grüner Wiesen, uralter Wälder und verwunschener Schlösser – es gab ganze vierhundert davon – eher mit den Augen gerollt hatte, verspürte ich mittlerweile ein aufgeregtes Kribbeln im Bauch, als ich dorthin zurückkehrte. Und angesichts dieser Vorfreude wurde mir allmählich selbst bewusst, wie unglaublich angespannt ich in den letzten Monaten gewesen war. Eine Welle von Müdigkeit erfasste mich, und ich bemerkte, wie mir beim Betrachten der vertrauten Landschaft draußen immer wieder die Augen zufielen …
Zum Glück war der Bahnhof von Angers nicht nur mein Zielort, sondern auch die Endstation des Zuges. Sonst wäre ich womöglich noch viele, viele Stationen weitergefahren und in einem Kaff, noch weiter von Paris entfernt als mein Heimatdorf, gelandet. In meinem Abteil saßen nicht mehr viele Personen, und auch als ich durchs Fenster den Bahnhof betrachtete, bestätigte sich mein Eindruck, dass wie immer wenig los war. Schwungvoll hievte ich meinen Koffer von der Ablage unter der Decke und machte mich auf den Weg zum Bahnsteig. Ich hatte meinen Eltern heute Morgen meine ungefähre Ankunftszeit durchgegeben.
»Élodie! Je suis ici!« Ich erkannte Maman nicht nur daran, dass sie die Person war, die am heftigsten winkte, als ich ausstieg. Sie stach auch sonst aus jeder Menschenmenge heraus.
»Maman!« Lächelnd ging ich den Bahnsteig hinunter, während mein kleiner Rollkoffer hinter mir her schlingerte. Mit Küssen auf die Wange hielt sich meine Mutter nicht lange auf, sie fiel mir direkt um den Hals.
»Es ist so schön, dich mal wieder zu Gesicht zu bekommen!«, verkündete sie, kaum dass wir uns wieder voneinander gelöst hatten.
»Ich freue mich auch«, erwiderte ich. »Ist das Muster neu?«
»Gefällt es dir?« Liebevoll strich Maman über ihren orangen Strick-Cardigan. An den Ärmeln befanden sich lange grüne Fransen, wie sie ein Cowboy tragen würde. Nur eben nicht aus Leder, sondern aus Wolle. »Ich hatte noch ein paar Reste übrig, die unbedingt verarbeitet werden wollten. Papa behauptet aber, die Jacke sieht aus wie eine schimmelige Warnweste.«
Ich musste schmunzeln.
»Er hat ja keine Ahnung«, versicherte ich sofort. »Du weißt, ich liebe deine Kreationen.«
»Pah, den letzten Pullover, den ich dir gestrickt habe, hast du kein einziges Mal getragen«, antwortete Maman. »Aber nun komm, Papa kann es auch kaum erwarten, dich wiederzusehen. Er konnte leider nicht mitkommen, um dich abzuholen. Wir erwarten heute einen Haufen Gäste, musst du wissen.«
Meine Eltern leiteten einen kleinen Gasthof, die L’Auberge Vinet. Der perfekte Ort für Leute, die mal so richtig ausspannen wollten – oder Digital Detox ausprobieren. Das Netz in Courléon war katastrophal. Besonders überlaufen war die Unterkunft noch nie gewesen. Meistens hatte es gerade so gereicht, um über die Runden zu kommen, weshalb es mich umso mehr erstaunte, dass dort auf einmal riesiger Andrang herrschen sollte.
»Dann lass uns doch gleich fahren«, schlug ich also vor. »Und keine Sorge, ich nehm den schon.« Ich schnappte meiner Mutter den Koffer weg und zog ihn in Richtung Ausgang des Bahnhofs.
»Du musst mir alles erzählen!«, sagte Maman, die mich mit entschlossenen Schritten einholte. »In den letzten Monaten habe ich ja fast gar nichts mehr von dir gehört.«
»Ja, das … stimmt leider.« Ich schob die riesige Flügeltür auf, die den Ausgang markierte. »Ich war ziemlich beschäftigt.«
»Das verstehe ich natürlich«, erwiderte Maman, und angesichts ihres verständnisvollen Tons wollte ich am liebsten laut rufen: Aber nicht so wie du denkst. Ich habe jede Menge Zeit auf irgendwelchen Konzerten verplempert. Nur fiel es mir leider schon schwer genug, das für mich selbst im Stillen zuzugeben. Zum Glück ließ meine Mutter das Thema vorerst fallen, als wir den Parkplatz betraten, wo ich Ausschau nach unserem alten Van hielt.
»Wir haben mittlerweile ein neues Auto.« Maman zeigte auf einen grauen Wagen, einige Meter entfernt. »Der alte Van ist kaputt gegangen, gab einen kleinen Unfall.«
»Oh …« Ich wollte gerade fragen, warum sie mir nichts erzählt hatte, bis mir klar wurde, dass man nichts anderes erwarten konnte, wenn man durch Abwesenheit glänzte. Meine armen Eltern, die Neuanschaffung hatte wahrscheinlich ein ziemliches Loch in die Kasse gerissen. Ich verstaute mein Gepäck im Kofferraum des Autos und begab mich dann noch vorn zu meiner Mutter. Müde ließ ich mich auf den Beifahrersitz fallen. Obwohl ich im Zug nicht viel mehr getan hatte, als aus dem Fenster zu starren und dabei einzunicken, fühlte ich mich erschöpft.
»Hier!« Ehe ich blinzeln konnte, hielt mir Maman eine halb geöffnete Tüte hin, und mir stieg der verführerische Duft von Schokoladen-Éclairs in die Nase. Das wirkte besser als zwei Tassen Kaffee.
»Als Claudine gehört hat, dass du zu Besuch kommst, hat sie gleich einen ganzen Haufen davon gebacken«, bemerkte Maman, ließ die Tüte in meinen Schoß fallen und startete dann den Motor.
»Très gentil!«
Claudine war unsere Nachbarin und so etwas wie die Dorfbäckerin. Für eine echte Bäckerei war Courléon zu klein, aber da Claudine gefühlt den ganzen Tag damit verbrachte, Torten, köstliches Gebäck und Brot zu zaubern, fühlte man sich nie unterversorgt – und hütete sich selbstverständlich davor, es sich mit der rüstigen Rentnerin zu verscherzen.
»Wie geht es ihr?«, fragte ich, während wir Angers verließen und kurz darauf auf eine einspurige Landstraße gelangten. »Wie geht es Courléon?«
»Claudine geht es ganz gut. Bernouille hat ihr nun doch eine Bulldogge von seinem letzten Wurf aufgeschwatzt, und die hält sie ordentlich auf Trab. Hat letztens eine halbe Packung Mehl verspeist. Unsere Tinette ist auch nicht begeistert von ihrem neuen Nachbarn. Du weißt ja, jedes Mal wenn sie einen Hund sieht, stehen ihr alle Haare zu Berge.«
»Katzen wissen sich ja zum Glück gut zu wehren. Also geht ansonsten alles seinen gewohnten Gang in Courléon.« Ich nahm einen großen Bissen von Claudines Schokoladen-Éclaire.
Angers hatten wir schon lange hinter uns gelassen. Kuhweiden, kleine Wäldchen und Kornfelder säumten die Straße, die wir entlangfuhren. Courléon war so klein, dass die Schilder an den Rändern sich gar nicht erst bemüßigt fühlten, dessen Existenz zu erwähnen. Aber da ich die Strecke in- und auswendig kannte, wusste ich, dass wir fast eine Stunde zu fahren hatten.
»Weißt du noch, wie du als Jugendliche immer behauptet hast, bei uns würde nie etwas Spannendes passieren?«, fragte Maman. »Dabei waren wir sogar mal in den Nachrichten.«
»Maman, das war vor elf Jahren.« Ich rollte mit den Augen. Nach einem heftigen Unwetter war in Courléon zwei Tage lang der Strom ausgefallen. Reporter waren damals erschienen, um im Fernsehen das Dorf vorzustellen, das sich unfreiwillig im Mittelalter befand.
»Jedenfalls kannst du nicht länger behaupten, in Courléon wäre es langweilig. Aufregende Dinge sind im Gange.«
»Aufregende Dinge?« Langsam begann mein Hirn, die Hinweise zu verknüpfen. »Haben sie etwa mit der Heerschar von Gästen zu tun, die plötzlich in die Auberge ziehen?«
»O ja, das haben sie!« Selbst vom Beifahrersitz aus bemerkte ich, wie meine Mutter von einem Ohr zum anderen zu strahlen begann.
»Aha.« Aufregende Dinge waren in Courléon meistens, dass Monsieur Bernouille ein Schwein schlachtete. Aber dafür würden wohl keine zwanzig Leute anreisen. »Magst du mir verraten, was genau das für aufregende Dinge sind?«
»Nein, noch nicht. Ich spanne dich lieber noch ein bisschen auf die Folter. Erzähl du stattdessen etwas von dir. Solltest du nicht langsam mal fertig werden mit deiner Uni?«
Dieser Themenumschwung kam so überraschend, dass ich mich kurz an meinem Éclair verschluckte. »Ja, na ja«, erwiderte ich, nachdem ich ausführlich gehustet hatte. »Ja. Mir fehlt nur noch eine letzte Prüfung, aber die hat es … ganz schön in sich.«
»Verstehe.«
»Aber ich kriege das schon hin«, antwortete ich hastig. »Ich werde lernen bis zum Umfallen, und dann kriege ich das hin!«
»Natürlich wirst du das. Um dich mache ich mir gar keine Sorgen.« Maman nahm eine Hand vom Lenkrad, um beruhigend meinen Unterarm zu tätscheln.
Zu meiner Bestürzung spürte ich auf einmal einen dicken Kloß in meinem Hals. Am liebsten hätte ich meiner Mutter erzählt, wie oft ich schon durch die Prüfung gefallen war. Ich wusste selbst nicht so genau, was mich zurückhielt.
»Ich mache mir schon Sorgen«, sagte ich lediglich.
»Ach, zum Grübeln hast du später noch Zeit. Genieß lieber die Fahrt.« Also blickte ich wieder nach vorn durch die Windschutzscheibe und hörte in der darauffolgenden Stunde dem Radio zu oder meiner Mutter mit dem neustem Klatsch aus Courléon. Schließlich bogen wir von der Landstraße auf einen kleineren schlecht geteerten Weg ein, der in einem sandigen Feldweg endete. Dort befand sich Courléon. Eine Handvoll Häuser, Bauernhöfe, ein bereits vor vielen Jahren vernagelter Dorfladen und jede Menge Kuhställe. Die meisten Gebäude waren aus Naturstein, teilweise sogar noch mit Strohdächern gebaut.
Ich erspähte am Ende des Weges die Krone der dreihundertjährigen Eiche, unter der sich der Boule-Platz des Dorfes befand. Ein Ort, der fast ebenso häufig besucht wurde wie die kleine mittelalterliche Kapelle. Hier hatten meine Eltern geheiratet, und ich wurde dort getauft, doch ich wusste von beiden Ereignissen leider keine Details mehr.
Mir sprang allerdings etwas anderes ins Auge, als meine Mutter in Schritttempo durchs Dorf fuhr. In Courléon parkten jede Menge Autos. Und damit meinte ich nicht die üblichen alten Peugeot-Modelle und Traktoren, sondern schicke Autos, wie man sie eher in der Stadt zu sehen bekam. Und schwarze Kastenwagen mit getönten Scheiben, die den Eindruck erweckten, als gehörten sie einem Geheimdienst. Langsam dämmerte mir, dass Maman tatsächlich nicht übertrieben hatte. In Courléon passierte wohl wirklich etwas Außergewöhnliches.
Ich setzte mich aufrechter hin, um alles besser betrachten zu können. Wir waren nun fast bei dem Gasthof angekommen, den meine Eltern führten und in dem ich aufgewachsen war. Das drei Stockwerke hohe Gebäude war ein ehemaliger Bauernhof, und das nachträglich darauf gebaute dritte Stockwerk sah beinahe so aus wie eine dicke Sahneschicht auf einem hellbraunen Tortenboden.
Über der Eingangstür hing ein großes Schild aus Holz, auf dem in verschnörkelten Buchstaben L’auberge Vinet stand. An den breiten rechteckigen Fenstern hingen Blumenkästen mit hellrosa Blüten.
Als ich noch zur Schule ging, hatte mich mal eine Klassenkameradin gefragt, ob es sich nicht seltsam anfühlte, statt nach Hause zu kommen in ein Hotel einzuchecken. Aber erstens war diese Gebäude immer noch viel zu klein und rustikal, um den Titel Hotel zu verdienen, und zweitens kam es nicht auf die Bezeichnung an, sondern auf das Gefühl. Und in diesem Moment fühlte ich mich tatsächlich einfach nur angekommen.
Ein kleines Lächeln stahl sich auf mein Gesicht. Zwar hatte ich immer noch meine Probleme im Gepäck, aber hier, fernab von Paris, schienen sie plötzlich nicht mehr ganz so schwer zu wiegen. Maman parkte den Van in der Garage – der ehemalige Pferdestall –, und wir stiegen aus.
»Willst du mir immer noch nicht verraten, was seit Neuestem hier vor sich geht?«, fragte ich, während ich mein Gepäck aus dem Kofferraum hievte. »Man könnte fast meinen, hier würde ein EU-Gipfel stattfinden.«
Maman lachte.
»Die armen Politiker hätten hier ihre liebe Not. Wenigstens sind solche Leute frühes Aufstehen gewohnt. Du weißt ja, wie viele Gäste sich gleich am ersten Tag über Monsieur Bernouilles Hahn beschweren … Aber nein, hier sind nicht lauter Politiker eingefallen, etwas viel, viel Spannenderes ist im –«
»Madeleine!«
Mamans Enthüllung wurde im Keim erstickt, als die Tür zum Gasthof aufflog. Niemand anderes als Papa erschien im Eingang. Mit nervöser Miene eilte er auf uns beide zu.
»Ah, hallo, Élodie«, sagte er so schnell, dass es ungefähr so klang wie Halédie. »Madeleine, ich brauche hier unbedingt deine Hilfe. Du weißt doch, dass ich kein Englisch spreche und dieser Monsieur … Monsieur Domingo hat auch noch so einen unverständlichen spanischen Akzent! Seit mindestens zehn Minuten redet er schon auf mich ein. Ich bin völlig –«
»Calme-toi,Étienne.«
Maman stemmte mit fliegenden Fransen die Arme in die Seiten. »Ich komme sofort und helfe dir mit Monsieur Domingo. Aber lass uns doch vorher unsere Tochter ins Haus begleiten.«
»Oh, ja, natürlich.« Papa blickte wieder zu mir. Er schien erst jetzt wirklich zu begreifen, wer da neben seiner Frau stand. »Du warst wirklich ewig nicht mehr hier.« Sein Ton klang eher vorwurfsvoll als begeistert.
»Aber dafür konnte sie doch nichts, du weißt doch, sie muss sehr viel für ihre Uni arbeiten«, sagte Maman nachdrücklich. Ich fand es wirklich rührend, wie sie immer von »meiner Uni« sprach, als würden mir dort alle Professoren zu Füßen liegen.
Papa verzog skeptisch den Mund, gab sich aber vorerst geschlagen. »Jetzt lass mich den wenigstens nehmen«, brummelte er und nahm mir den Koffer ab. »Der ist doch viel zu schwer für dich, Kind.«
Nun zu dritt, gingen wir also zurück zum Gasthof. Seit Papa dazugekommen war, herrschte auf einmal eine seltsam unbeholfene Stille zwischen uns.
»Macht euch bereit«, sagte Papa schließlich, als wir vor der Eingangstür standen.
»Bereit wo–«
Doch da hatte mein Vater schon die Tür aufgeschoben und war ins Innere marschiert. Ich sah zu, dass ich hinterherkam.
»¿Por qué no hay Internet en el albergue? Where’s the internet? C’est où?!«
Verdutzt zuckte ich zurück, als ich plötzlich einem Mann mit sonnengebräuntem Teint und schwarzen Locken gegenüberstand. Er wedelte mit dem Smartphone in seiner Hand herum und brach dabei in einen wilden Wortschwall aus, in dem ich sowohl spanische, englische als auch französische Satzteile identifizieren konnte.
Papa warf Maman einen Blick zu, der so viel ausdrückte wie »Was habe ich dir gesagt?«. Zumindest konnte ich nun verstehen, warum mein Vater leicht panisch vor diesem mehrsprachigen Ausbruch geflohen war. Mamans große Stärke jedoch war, dass sie nicht einmal ein heftig gestikulierender Gast mit aufgeregt blitzenden Augen aus der Ruhe bringen konnte. Stattdessen lächelte sie mild und wartete geduldig, bis der Gast eine kurze Atempause einlegte.
»Sie können doch das WLAN benutzen«, sagte sie langsam auf Englisch. »In ihrem Zimmer liegt ein Zettel mit dem Passwort.«
»Ich habe nichts gefunden«, verkündete der Mann, von dem ich annahm, dass er Spanier war, nun ebenfalls auf Englisch. Doch auch das verdarb Maman nicht die Laune.
»Er muss dort sein, kommen Sie, wir sehen nach«, sagte sie freundlich mit einer Ruhe, die ich schon immer zutiefst bewundert hatte. Sie bedeutete ihrem Gesprächspartner, ihr zu folgen. Ich konnte den Spanier immer noch munter weiterreden hören, während sie die Treppe zum ersten Stock erklommen. Ein wenig fassungslos schüttelte ich den Kopf.
»Was ist denn hier los?«
»Hat Madeleine dir nichts gesagt?«, antwortete Papa.
Ich schüttelte den Kopf. »Sie wollte mich lieber noch ein wenig ›auf die Folter spannen‹, um es mit ihren Worten zu sagen. Aber jetzt ist sie mit eurem spanischen Gast abgehauen. Ich befürchte also, du wirst mich aufklären müssen.«
Papa machte ein unzufrieden klingendes Geräusch, dann deutete er mit dem Kinn nach rechts, wo es zur Küche ging. »Na, dann komm mal mit.« Meinen Koffer verstaute er vorläufig neben dem Treppenaufgang, dann folgte ich meinem Vater zur Küche. Dort roch es zu jeder Tageszeit nach Frittierfett, Suppengewürz und Zitronenspülmittel.
»Die sind aber auch wirklich alle so«, murmelte Papa verdrießlich, während er einen Sack Kartoffeln von einem Stuhl räumte, damit ich mich setzen konnte. »Alle total durchgeknallt.«
»Langsam reicht es mit den Andeutungen.« Ich ließ mich auf die frei gewordene Sitzgelegenheit fallen – nur wenig eleganter als ein Sack Kartoffeln. »Wer sind denn ›alle‹? Wo kommen sie her? Was macht dieser verrückte Spanier in unserem Gasthof? Wieso parken im ganzen Dorf auf einmal todschicke Autos? Das klingt langsam wie der Anfang von einem Mysteryfilm.« Und das kann ich für meine Lernpläne überhaupt nicht gebrauchen,fügte ich im Stillen hinzu.
»Mit deinem letzten Satz hast du es eigentlich schon fast erraten«, erwiderte Papa, der nun damit begann, verschmierte Teller in den riesigen Geschirrspüler zu räumen. Das war typisch für ihn. Sich einfach nur mit jemandem zu unterhalten, ohne gleichzeitig etwas »Sinnvolles« zu tun, erachtete er als Zeitverschwendung. Anders als Maman, die aus Angers kam und damit, wie alteingesessene Dörfler noch immer betonten, »aus der Großstadt«, war Papa in Courléon aufgewachsen. Dass er schon von Kindesbeinen an hart gearbeitet hatte, erkannte man an seiner drahtigen, aber kräftigen Gestalt.
Maman versicherte mir regelmäßig, dass es damals eine ganze Heerschar von Mädchen auf ihn abgesehen hatte, zu einer Zeit, als zu den hart erarbeiteten Muskeln auch noch eine blonde Haarmähne hinzugekommen war. Die kannte ich allerdings nur von den Hochzeitsfotos, die in der Gaststube über dem Kamin hingen.
»Es ist ja nicht so, dass ich mich nicht auch über die vielen Buchungen freuen würde.« Das Klirren von Weingläsern holte mich wieder zurück in die Gegenwart. Mit den Tellern war Papa bereits fertig. »Aber diese Filmleute sind teilweise exzentrisch.«
»Filmleute?«, wiederholte ich. »Du willst mir nicht wirklich erzählen, dass in Courléon –«
»Genauso ist es.«
Mein Kopf schnellte nach rechts, als ich Mamans Stimme erkannte. Mit zufriedener Miene stand sie im Eingang zur Küche. Anscheinend war es ihr gelungen, die Internet-Abstinenz unseres Gastes zu beenden.
»Sie drehen einen Film im Château«, sagte sie jetzt.
»Also nicht wirklich in Courléon«, bemerkte Papa.
»Aber, Papa, das Château gehört doch zu Courléon. Es heißt ja sogar Château Courléon. Und überhaupt … ein Film?« Ich setzte mich ein wenig aufrechter hin. »Wirklich? Wie konnte denn so etwas passieren?«
»Das Dorf und das Schloss gehören zwar zusammen, aber du weißt ja, wie die Montenaits sind, die haben sich nie groß um die Dorfbewohner geschert. Und jetzt stiften sie auch noch jede Menge Unruhe mit diesem Filmprojekt«, sagte Papa verdrießlich.
»Ach, Étienne, nun sei doch nicht so. Der alte de Montenait mag vielleicht ein eigenbrötlerischer Griesgram gewesen sein, aber seine Enkel sind ganz anders.«
»Guillaume und Nicolas waren seit Jahren nicht mehr hier. Genau wie sie.«
Es brauchte eine halbe Sekunde, bis zu mir durchsickerte, dass mit »sie« ich gemeint war. Nervös fuhr ich mir durchs Haar.
»Nun wirst du aber unfair. Élodie ist nun mal ehrgeizig, und das ist doch wunderbar. Sie arbeitet hart und hat es ganz alleine geschafft, sich in Paris zurechtzufinden. Wir konnten sie ja nicht mal mit der Miete unterstützen, weil ein Gasthof in diesem winzigen Nest so gut wie kein Geld abwirft.«
Papas Gesicht verfinsterte sich, und ein ungutes Gefühl breitete sich in mir aus.
»Ich habe meinen Eltern damals versprochen, den Hof fortzuführen«, sagte er steif. »Daraus stattdessen einen Gasthof zu machen war deine Idee. Das habe ich dir zuliebe getan.«
»Ähm, Entschuldigung?« Ich merkte selbst, wie dünn meine Stimme klang, und räusperte mich. Bahnte sich hier gerade etwa ein Streit an? Ich wollte mit meinem Besuch keine Grundsatzdiskussionen auslösen.
Zu meiner Überraschung verstummten meine Eltern tatsächlich daraufhin. Die unangenehme Stille, die stattdessen entstand, fühlte sich allerdings auch nicht viel besser an.
»Ich denke, ich sollte dann mal meinen Kram auspacken«, sagte ich betont locker. »Oder musstet ihr mein altes Kinderzimmer auch kurzfristig vermieten?«
»Das würden wir doch nie tun«, erwiderte Maman.
»Also ich war kurz davor«, sagte Papa.
Ich lächelte schief. »Dann beeile ich mich wohl lieber, was?«
Ich schob den Stuhl zurück und verließ die Küche. Als ich im Eingangsbereich wieder angekommen war, atmete ich tief aus. Meine Güte, den Besuch bei meinen Eltern hatte ich mir wirklich vollkommen anders ausgemalt. Ich hatte Maman und Papa bisher nur äußerst selten so angespannt erlebt. Ich schob es auf die Tatsache, dass in Courléon ein Film gedreht wurde und die beiden tatsächlich nicht so viele Gäste gewohnt waren.
Ich schnappte mir meinen Koffer und ging an der Treppe vorbei den Gang hinunter. Dort befand sich eine Tür mit einem laminierten Schild, auf dem in Großbuchstaben »Privé« stand. Aber wenn man einen Gasthof führte und in einem winzigen Kaff wohnte, war eigentlich nichts wirklich privat.
Ich schob die Tür auf und betrat die helle Wohnung, durchquerte die Stube, vorbei am Schlafzimmer meiner Eltern, dem winzigen Bad, bis ich beim Zimmer angekommen war, das ich bewohnte. Dass es für eine einzelne Person eigentlich ziemlich groß ausfiel, hatte ich erst begriffen, als ich nach Paris gezogen war. Dort drin gab es genügend Platz für zwei Bücherregale, ein altes Klavier und einen Ohrensessel. Alles war ein wenig verstaubt. Auch wenn ich wusste, dass es sich um mein Zimmer handelte, fühlte es sich etwas fremd an. Ich hatte schon ewig nicht mehr hier geschlafen.
Ich stellte meinen Koffer neben dem Schreibtisch ab. Es war ein wuchtiger Sekretär aus Walnussholz, der ursprünglich mal meinem Großvater gehört hatte. Viel zu groß für eine Élodie, die nur ein paar Mandalas ausmalen wollte, aber wahrscheinlich genau richtig für die, die sich in todlangweilige Gesetzestexte vertiefen musste. Da kamen einem die Mandalas im Vergleich schon wieder verlockend vor.
Der Sekretär befand sich unter dem Fenster meines Zimmers, durch das im Moment ein wenig Licht der tief stehenden Nachmittagssonne fiel. Ich ließ mich auf den schwarzen Bürostuhl sinken – den ich nicht von meinen Großeltern geerbt hatte.
Mein Zimmer lag auf der Rückseite des Hauses, und da der Gasthof am Rand des Dorfes stand, hatte ich von dort aus einen idyllischen Blick auf eine Reihe von Ulmen. Sie markierten den Anfang des kleinen Wäldchens, das zwischen dem Dorf Courléon und dem Château lag. Eine Weile sah ich einfach nur aus dem Fenster und betrachtete das hohe Gras am Waldrand. Sanft bog es sich in der Nachmittagssonne.
Als Kind hatte ich mir vorgestellt, dass es den Eingang zu einem mystischen Reich markierte. Zu einem gewissen Grad hatte das auch gestimmt, immerhin befand sich auf der anderen Seite des Waldes ein mehr oder weniger verwunschenes Schloss. Die Grashalme, die sich sanft wiegten, waren für mich ein Tor gewesen, das mich dazu einlud, diese Welt zu betreten.
Und ich erinnerte mich an die vielen Male, als Maman mir die strenge Anweisung erteilt hatte, mein Zimmer erst zu verlassen, wenn ich: alle Hausaufgaben erledigt hatte / mich wieder beruhigt hatte / mich bei Monsieur Bernouille dafür entschuldigte, seinen Zaun mit Straßenkreide bemalt zu haben. Doch meistens hatte ich mich dann nicht brav an meinen Schreibtisch gesetzt, um über meine Untaten nachzusinnen.
Ein kleines Lächeln stahl sich auf meine Lippen, als ich das Fenster entriegelte und es weit nach innen aufging. Ich setzte mich schwungvoll auf das Fensterbrett. Bist du nicht schon ein wenig zu alt für so etwas? Dieser erwachsene Einwand löste sich in dem Moment in Rauch auf, als ich die Beine aus dem Fenster schwang und mit einem kräftigen Satz draußen im Gras landete. Ich atmete tief den Geruch von Wildblumen und Tannennadeln ein. Warum sollte ich nicht mal wieder ein kleines Abenteuer erleben wie damals mit zehn Jahren?
Langsam lief ich durch das fast kniehohe Gras und näherte mich dem Waldrand. In den Geschichten, die ich mir ausgedacht hatte, war es meistens darum gegangen, dass ich eine Kriegerin, Prinzessin oder Spionin gewesen war, die sich allein durch das Gestrüpp schlagen musste. Ihr Ziel: Das kleine Château auf der anderen Seite des Finsterwaldes. Ich hatte ihn selbst Finsterwald genannt, da es sich um ein so kleines Wäldchen handelte, dass ihm die Dorfbewohner nie einen anständigen Namen gegeben hatten. Es waren wirklich wunderbare Geschichten gewesen, die ich mir ausgedacht hatte.
Ich war mittlerweile am Waldrand angekommen, und eine kühle Brise wehte mir entgegen. Ein paar Vögel zwitscherten, und ich konnte bereits den vertrauten Geruch von Moos und feuchter Erde wahrnehmen. Die magischen Tore öffneten sich. Mit einem großen Schritt betrat ich das Wäldchen.
Mir war bewusst, dass es eigentlich auch einen ganz normalen Weg gab, der auf direktem Weg zum Château führte – aber wo blieb da der Spaß? Außerdem hatte ich schon immer die Ruhe genossen, die sich in mir einstellte, wenn man durch die unberührte Natur lief.