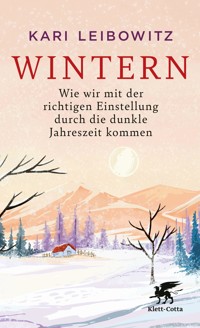
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Der Winter ist schön! Die Winterzeit hält viel Schönes bereit. Doch sie schlägt vielen aufs Gemüt: Warum ringen die einen mit sich, während die anderen den Winter ohne Weiteres genießen können? Alles eine Sache der persönlichen Einstellung, argumentiert die Psychologin und Wintermindset-Expertin Kari Leibowitz. Bahnbrechend erläutert sie, wie wir richtig wintern und die frostige Saison in eine Zeit der Freude und des Wohlbefindens verwandeln können. Alle Jahre wieder naht der Winter, Kälte und Dunkelheit fordern viele von uns heraus. Wir sind müder, launischer, ziehen uns eher zurück. Manche erleiden sogar eine saisonale Depression. Auch Kari Leibowitz kann den Winter nicht ausstehen, bis sie bei ihren Forschungen im arktischen Norwegen entdeckt, mit welcher Freude und Begeisterung die Menschen den langen und kalten Polarnächten begegnen: Ihre Einstellung, Rituale und Routinen lassen die Norweger diese Zeit genießen. Das persönliche Mindset und Verhalten können also die eigene Wintererfahrung verändern. Auch Leibowitz spürt schnell die positiven Auswirkungen. Ihre leicht verständlichen und wissenschaftlich fundierten Erläuterungen und praktischen Tipps lassen auch uns die Schönheit und Möglichkeiten der kalten Jahreszeit entdecken – und dem Winterblues Lebewohl sagen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 451
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Kari Leibowitz
Wintern
Wie wir mit der richtigen Einstellung durch die dunkle Jahreszeit kommen
Übersetzt aus dem amerikanischen Englisch von Nastasja S. Dresler
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe zum Zeitpunkt des Erwerbs.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH
Rotebühlstraße 77, 70178 Stuttgart
Fragen zur Produktsicherheit: [email protected]
Die Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel »How to Winter. Harness Your Mindset to Thrive on Cold, Dark, or Difficult Days« im Verlag Penguin Life, New York.
© 2024 by Kari Leibowitz
Für die deutsche Ausgabe
© 2025 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte sowie die Nutzung des Werkes für Text und Data Mining i. S. v. § 44 b UrhG vorbehalten
Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg
unter Verwendung einer Abbildung von © Freepik/Harryarts
Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck
Lektorat: Judith Mark, Freiburg
ISBN 978-3-608-96658-9
E-Book ISBN 978-3-608-12495-8
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Vorwort
Einleitung
Wie man überwintert
Erster Teil
Den Winter zu schätzen wissen
1.
Nun, was haben Sie denn erwartet?
Vom Schlimmsten ausgehen
Das Ende der Sommerzeit auskosten
Vorbereitung auf den Winter
2.
Sich zurücklehnen und ausruhen
Nur niedergeschlagen oder wirklich depressiv?
Zeit zum Ausruhen
Langsame Hobbys
Aufwärtsspirale
3.
Sie bekommen, was Sie sehen
Selektive Wahrnehmung
Eine andere Sichtweise auf den Winter
Die Natur wahrnehmen
Wetterbeobachtungen
Zielgerichtete Aufmerksamkeit
4.
Nutzen Sie Ihre Worte
Die Macht der Sprache
Drei Winter
Sagen heißt glauben
Falsche Narrative
Werden Sie Botschafter einer wintergerechten Einstellung
Zweiter Teil
Machen Sie den Winter zu etwas Besonderem
5.
In der richtigen Stimmung
Gelassenheit jetzt
Deckenlicht aus
Hygge um die ganze Welt
Ehrfürchtig sein
6.
Nächte, Lichter und Bräuche
Hello darkness, my old friend
Am Kaminfeuer
Was macht ein Ritual aus?
Feiertagsrituale
Dritter Teil
Gehen Sie raus
7.
Wir sind nicht aus Zucker
Schieben und ziehen
Vermeidungsverhalten abbauen
Einschränkende Überzeugung Nr. 1: Bei schlechtem Wetter kann man nicht nach draußen gehen
Einschränkende Überzeugung Nr. 2: Es ist unangenehm, im Winter nach draußen zu gehen
Einschränkende Überzeugung Nr. 3: Sich draußen in der Kälte aufzuhalten, macht krank
Sich langsam annähern
Strategie Nr. 1: Konzentrieren Sie sich auf kurzfristige Belohnungen
Strategie Nr. 2 Üben Sie kluges Selbstmitgefühl, um Muster zu erkennen
Strategie Nr. 3: Holen Sie sich soziale Unterstützung
Kluge Motivation
8.
Untergehen, schwitzen oder schwimmen
Die Vorteile des Badens
Schvitz happens
Aufwärmen durch Frieren
Tun Sie, was sich gut anfühlt
9.
Den Weg freimachen
Den Winter zelebrieren
Eine Winterstadt schaffen
Freie Straßen, volle Herzen
Verändern Sie die Kultur, verändern Sie Ihre Denkweise
Epilog
Den Winter schützen
Was ist Ihre Vorstellung von Ihrer Zukunft?
Dank
Zitatnachweis
Anmerkungen
Einleitung: Meine Reise in das Land des Winters
1. Nun, was haben Sie denn erwartet?
2. Sich zurücklehnen und ausruhen
3. Sie bekommen, was Sie sehen
4. Nutzen Sie Ihre Worte
5. In der richtigen Stimmung
6. Nächte, Lichter und Bräuche
7. Wir sind nicht aus Zucker
8. Untergehen, schwitzen oder schwimmen
9. Den Weg freimachen
Epilog: Den Winter schützen
Weiterführende Lektüre
Für Nanny und Rob
Man muss Winter im Sinn haben,
um auf den Frost und die mit Schnee
verkrusteten Äste der Kiefern zu achten,
und lange Zeit gefroren haben,
um den eisstarren Wacholder zu erfassen,
die Fichten, struppig im fernen Geglitzer
der Januarsonne; und nicht an ein Elend
zu denken im Geräusch des Windes,
im Geräusch einiger Blätter,
welches das Geräusch des Landes ist,
voll von demselben Wind,
der über denselben leeren Platz weht
für den Lauscher, der im Schnee lauscht
und, selbst nichts, nichts erfasst,
das nicht da ist, und das Nichts, das ist.
Der SchneemannWallace Stevens
Vorwort
Lange Zeit kam es mir so vor, als würde ich einen urkomischen Witz erzählen, wenn ich davon sprach, »wie man überwintert«. Mit meinem Umzug in die arktische Stadt Tromsø trotzte ich all meinen Vorbehalten, die ich mein ganzes bisheriges Leben lang gegen den Winter hatte. Ich bin an der Küste von Jersey aufgewachsen, eine Stunde südlich von New York. Den Winter konnte ich nicht ausstehen. Als älterer Jahrgang an der Highschool weigerte ich mich, meinen kleinen Bruder – der gerade in die erste Klasse gekommen war – zur Schule mitzunehmen, ehe er nicht jeden Morgen mein Auto auf eine angenehme Temperatur vorgeheizt hatte. Von 2014 bis 2015 ging ich dann jedoch als Forscherin und Fulbright-Stipendiatin an die Universität von Tromsø – die nördlichste Universität der Welt. Dort erlebte ich die Polarnacht, einen zweimonatigen Zeitraum, in dem die Sonne niemals aufgeht. Es zog mich in die Arktis, weil ich versuchen wollte zu verstehen, wie Menschen, die einen der dunkelsten Winter weltweit durchleben, mit dieser Jahreszeit zurechtkommen. Ich bin in eine Kultur eingetaucht, die die Möglichkeiten des Winters auskostet, und begann, all das, was ich um mich herum beobachten konnte, wissenschaftlich zu untersuchen. Aus meiner Studie ging hervor, wie die Menschen in Norwegen über den Winter denken: das, was ich die innere Einstellung zum Winter nenne. Dabei kam ich in Kontakt mit einer anderen Art und Weise, dieser Jahreszeit gegenüberzutreten, und fing selbst an, mich für den Winter zu begeistern.
Nach einem Jahr im Norden Norwegens machte ich mich auf den Weg zurück ins sonnige Kalifornien, um an der Stanford-Universität meinen Doktor in Psychologie abzuschließen – nicht unbedingt der beste Ort, um an meiner Winter-Kompetenz zu feilen. Um mit meiner Zeit in Skandinavien abzuschließen, schrieb ich einen Artikel über meine Erfahrungen und Forschungsergebnisse. Ich betrachtete dies als eine Vorarbeit zu dem, was mich im Stanford Mind & Body Lab erwartete, wo ich untersuchen würde, wie unsere Denkweise unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden beeinflusst. »The Norwegian Town Where the Sun Doesn’t Rise« (zu Dt.: »Die norwegische Stadt, in der die Sonne nicht aufgeht«) erschien im Juli 2015 in The Atlantic. Obwohl es sich um einen Aufsatz über unsere Einstellung zum Winter handelte, der im Sommer in den USA veröffentlicht wurde, war er der populärste Artikel des Tages und übertraf damit deutlich den beliebten Beitrag »I Made the Pea Guac« (zu Dt.: »Ich habe Erbsen-Guacamole gemacht«). Zufrieden mit meiner Leistung und dem Gefühl, meine Geschichte erzählt zu haben, war ich bereit, mich in meine neue Arbeit und mein neues Leben in Palo Alto zu stürzen.
Doch abgeschlossen war meine Zeit in Norwegen mit diesem Artikel keineswegs; in meiner Erfahrung taten sich weitverzweigte Risse auf. Sie zeugten von einer tiefen Sehnsucht, fast schon einer Verzweiflung, einen besseren Umgang mit dem Winter zu finden. Seitdem habe ich Hunderte von Anfragen von Journalisten erhalten, die gegen Ende der Sommerzeit und zum Wintereinbruch einen Rat von mir einholen wollten, wie die Menschen aus der dunklen Jahreszeit etwas anderes als Schwermut und Niedergeschlagenheit ziehen können. Meine Forschungsarbeit wurde in Ausgaben von National Geographic über The Guardian bis hin zum Forbes Magazine veröffentlicht. Ich bin in die norwegisch-schwedische Fernsehtalkshow Skavlan eingeladen worden, eine Woche, nachdem Adele dort zu Gast war. (Ich konnte allerdings nicht hingehen, da ich auf einer Tagung in San Diego war. Außerdem war mir nicht bewusst, was für eine große Sache das war.) Ein Artikel in Fast Company, »The Norwegian Secret to Enjoying a Long Winter« (zu Dt.: »Das norwegische Geheimnis eines langen Winters voller Vergnügen«), landete auf Platz eins der populärsten Leadership-Geschichten des Jahres und führte sogar dazu, dass die Autorin noch einen weiteren Artikel schrieb: »The Norwegian Secret to Getting an Article Shared 300 000 Times« (zu Dt.: »Das norwegische Geheimnis, wie ein Beitrag 300 000-mal geteilt wird«).
Menschen aus der ganzen Welt haben mir geschrieben und erzählt, was sie am Winter mögen und was sie an ihm nicht ausstehen können, welche glücklichen Kindheitserinnerungen sie an verschneite Tage haben und wie der Winter sie runterzieht. Anstatt das Thema Winter hinter mir zu lassen, verbrachte ich die nächsten zehn Jahre damit, an meine anfänglichen Nachforschungen durch weitere Studien darüber anzuknüpfen, wie unser Denken funktioniert und warum es so wichtig ist, sich die Strategien anderer Kulturen anzuschauen, um gut durch die dunkle Jahreszeit zu kommen. Ich wollte die Geschichten aus meiner Zeit in Tromsø und die Ergebnisse meiner Forschung mit einem internationalen Publikum teilen. Es kam mir so vor, als hätten die Menschen von Seattle bis New York, von Dublin bis Bukarest, von Sydney bis Tokio mit dem Winter zu kämpfen.
Gleichzeitig gibt es weltweit Orte – darunter auch Tromsø –, an denen der Winter freudig erwartet wird. Mein Aufenthalt in den arktischen Breiten hat mich gelehrt, dass der Winter nichts ist, was einem einfach passiert: Wir haben es selbst in der Hand, wie wir diese Jahreszeit erleben. Doch während es viele Forscher gab, die man dazu befragen konnte, wie man einen Umgang mit saisonal-affektiven Störungen (SAD) finden kann, oder mit denen man diskutieren konnte, wie die Sommerzeit unseren zirkadianen Rhythmus verändert, gab es erschreckend wenige Experten, die der Frage nachgingen, wie man dem Winter stattdessen etwas Positives abgewinnen konnte. Ich begann, mir zu überlegen: Wie kann man diese Jahreszeit annehmen und sich für sie begeistern? Wie können wir bei all der Dunkelheit, Kälte und Nässe Gelegenheiten dazu finden? Und was kann uns der Winter darüber lehren, wie unsere Gedanken die Wahrnehmung der Realität beeinflussen?
Ich hatte das Gefühl, besonders dafür geeignet zu sein, eine Antwort auf diese Fragen zu finden. Als jemand, der den Winter zuvor nicht ausstehen konnte und nun bekehrt war, konnte ich ganz gut beurteilen, was es hieß, die Einstellung zum Winter zu ändern. Mein Aufenthalt im Norden Norwegens, mein persönlicher Streifzug durch einen herausfordernden, aber bezaubernden Winter, öffnete mir die Augen und war eine Art Crashkurs, in dem ich gelernt hatte, die Jahreszeit aktiv anzunehmen.
Und meine akademische Ausbildung, die vor allem von den Erkenntnissen des Stanford Mind & Body Lab geprägt war, hat mir das wissenschaftliche Fachwissen vermittelt, um die über Jahrzehnte zusammengetragenen Forschungsergebnisse darüber zu analysieren, wie wir unsere Perspektiven, unser Verhalten und unsere Denkweisen bewusst verändern können. Meine Suche nach den Antworten auf diese Fragen führten zu dem Buch, das Sie nun in den Händen halten.
Im besten Fall zaubert der Winter Bilder von gemütlichen Schneetagen und heißer Schokolade mit Marshmallows herbei. Von Lesestunden vor dem Kamin mit dem Hund auf dem Schoß, Ski-Abfahrten von urigen Hütten, Schlittenfahrten mit Höchstgeschwindigkeit und Schneeballschlachten. Von Geschenken unter dem Weihnachtsbaum, wärmenden Eintöpfen und glitzernden Silvesterpartys.
Aber viele von uns leben während dieser Jahreszeit nur selten in diesem idealisierten Winterwunderland. Winter bedeutet auch, die Windschutzscheibe zu enteisen, bevor man zur Arbeit fährt; durch eisige Windkanäle zu laufen, um zur Schule oder zum Büro zu gelangen. Im Dunkeln zur Arbeit zu gehen und im Dunkeln nach Hause zu kommen. In einen in einer schier endlosen Reihe von grauen Tagen auf die Erde niederdrückenden Himmel zu blicken. Den im Nacken herunterlaufenden Schneeregen zu spüren und stundenlang zu frösteln. An den Autobahnen und Straßenrändern in der Stadt an dem sich auftürmenden Schnee vorbeizufahren, der sich hässlich braun verfärbt. Sich müde und lethargisch zu fühlen, verschnupft und melancholisch zu sein.
Der Winter stellt uns vor viele Herausforderungen. Je nachdem, wo wir leben, kann der Winter bittere Kälte und Berge von Schnee mit sich bringen. Oder die Tage sind voll von peitschendem Regen, Graupel und Hagel. Die Winterzeit kann ein endlos tristes, eintöniges Grau sein; mit kaltem, ständigem Nieselregen; einem Wind, der einem die Worte abschneidet und die Haare in einen unordentlichen Knoten verwirbelt. Wenn Sie nicht gerade in der Nähe des Äquators leben und der Winter weitestgehend an Ihnen vorübergeht, bringt er zweifelsohne Dunkelheit mit sich: mit frühen Sonnenuntergängen und langen Nächten. Diese klimatischen Bedingungen haben Auswirkungen auf uns; die Dunkelheit trägt dazu bei, dass wir uns träge und müde fühlen, und führt dazu, dass wir unkonzentriert sind. Kaltes, nasses Wetter hält uns davon ab, aktiv zu sein und uns im Freien zu bewegen, was unsere Antriebslosigkeit noch verstärkt. Wir sind vielleicht weniger gesellig, sind nicht annähernd die optimale Version von uns selbst. Und mit dem Klimawandel werden die Winter weniger vorhersehbar, bringen mehr Kälte in Gegenden, in denen man nicht an Minusgrade gewöhnt ist, und verwandeln vormals schneereiche Winter in regnerische, sodass wir unsere Einstellung zu dieser Jahreszeit an die neuen Bedingungen anpassen müssen. Oberflächlich betrachtet handelt es sich bei diesen Problemen um Fragen des Wetters und des Klimas. Aber sie spiegeln viel mehr wider: wie weit wir uns von dem alljährlichen Zyklus von Licht und Dunkelheit entfernt haben. Wie verzweifelt wir versuchen, die Natur unserem eigenen Zeitplan zu unterwerfen, anstatt unseren Rhythmus den Jahreszeiten anzupassen. Die Art und Weise, wie wir Erzählungen darüber verinnerlicht haben, was wir tun können und was nicht, wenn es dunkel, nass oder kalt ist.
Der Winter wird mit dem Tod assoziiert. In der Poesie, der Literatur und der Metaphorik wird der Winter als eine raue, brachliegende Zeit dargestellt. Das Gegenteil von Güte, Licht und Wachstum. Eine farblose Jahreszeit, der die Freude fehlt. In der psychologischen Forschung wird der Winter am häufigsten im Zusammenhang mit der saisonal-affektiven Störung bzw. Winterdepression untersucht. Für viele scheint es ganz selbstverständlich zu sein, dass der Winter eine Bedrohung für die mentale Gesundheit darstellt. Für manche erscheint der Winter vom ersten Tag an deprimierend. Ich fragte einmal eine Fünfjährige namens Alma, was ihre Lieblingsjahreszeit sei, und sie hat geantwortet: »Jetzt nicht lachen, es ist der Winter.« Selbst eine Fünfjährige weiß, dass es nicht cool ist, den Winter zu mögen.
Doch wenn wir resignieren und uns durch die Jahreszeit schleppen, bezahlen wir dafür einen Preis. Im besten Fall entgehen uns die Freuden und Vergnügungen in einer ganz speziellen Zeit, die einzigartige Möglichkeiten der inneren Einkehr, der Verbundenheit mit anderen und von Genüssen bietet. Schlimmstenfalls aber schlafwandeln wir durch ein Drittel des Jahres oder sogar noch mehr – das heißt, wir verzichten darauf, diese Monate unseres Lebens voll auszuschöpfen. Ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, unsere Denkweise beeinflusst, wie wir den Winter erfahren.
In Norwegen war ich von Menschen umgeben, die ein anderes Verhältnis zum Winter haben. Obwohl der Winter dort besonders lang und kalt ist, schöpfen die Menschen des Nordens Freude, Wohlbefinden und Enthusiasmus aus dieser Jahreszeit. Meine Forschungen in Norwegen haben ergeben, dass viele Menschen dort eine, wie ich es nenne »positive Einstellung zum Winter« haben. Diejenigen, die den Winter zu schätzen wissen, nehmen vor allem alles Zauberhafte dieser Jahreszeit in den Blick: gemütliche Zusammenkünfte am Feuer, frische Luft und klare Sternenhimmel, entschleunigte Rituale und die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen. Für Menschen mit einer solchen Einstellung ist der Winter keine Jahreszeit, die missfällt und mit Einschränkungen verbunden ist, sondern eine Zeit voller Möglichkeiten. In Norwegen lernte ich, dass wir nicht dazu verdammt sind, die Wintermonate zu vergeuden, indem man die Jahreszeit irgendwie durchsteht und den Frühling herbeisehnt. Wir können unsere Mentalität verändern und auf diese Weise unsere Erfahrungen mit dem Winter – und darüber hinaus auch unser Leben.
Die Haltung zum Winter zu ändern, ist keine Zauberei, und Sie müssen auch keine skandinavische Erziehung genossen haben, um sie zu übernehmen. Seit mehr als zehn Jahren habe ich untersucht, wie die Menschen ihre Einstellung ändern und den Winter mit offenen Armen begrüßen können. Um zu verstehen, wie man überwintert, habe ich mein psychologisches Fachwissen mit persönlichen Erfahrungen, kulturellen Beobachtungen und Gesprächen mit Menschen aus der ganzen Welt kombiniert. Ich habe in einigen der extremsten Wintergebiete der Welt gelebt und sie bereist. Ich habe wochenlang nicht die Sonne aufgehen sehen. Ich habe mich den Fragen von Journalisten in Dutzenden von Ländern gestellt. Und ich habe mit Tausenden von Leuten darüber gesprochen, wie eine andere Herangehensweise an den Winter auch im übrigen Jahr eine neue Art des Lebens ermöglichen kann. Auf Anfragen von Schulen, Unternehmen und Winterfestivals hin habe ich meinen Wintertime Mindset Workshop ins Leben gerufen – einen interaktiven Workshop, in dem konkrete Strategien vorgestellt werden, um die Einstellung zum Winter zu verändern. Ich habe diesen Workshop bei den Winter Cities Shake-Up-Konferenzen in Saskatoon und Edmonton, Kanada, und dem Great Northern Festival in Minneapolis in Minnesota abgehalten, bei Technologiekonzernen auf ihren Winter-Retreats, bei den Mitarbeitern großer Nachrichtenorganisationen, in Psychologiekursen und Fortbildungen, im Rahmen von Gesundheitsprogrammen an Universitäten, in Museen und Kunstzentren und gemeinnützigen Organisationen, und einmal sogar in einem Vogelschutzgebiet. Jahr für Jahr hörte ich von Menschen, die Hilfe in Anspruch nehmen wollten, um besser durch den Winter zu kommen, und die dann durch eine Änderung ihrer Einstellung dieser Jahreszeit mehr abgewinnen konnten. Ich habe aus erster Hand erfahren, dass eine Änderung der Denkweise über den Winter nicht nur möglich ist, sondern eine regelrechte Transformation darstellt.
Denn die Art und Weise, wie wir mit dem Winter umgehen, ist eine ziemlich gute Bewährungsprobe dafür, wie wir andere dunkle, schwierige Lebensabschnitte bewerkstelligen. Wie reagieren wir auf Situationen, über die wir keine Kontrolle haben? Wie reagieren wir auf Umstände, die wir uns so nicht ausgesucht haben? Schrumpfen und verkümmern wir, oder wenden wir uns bewusst unserem Inneren zu und kultivieren Momente der Freude? Fokussieren wir uns auf das Frustrierende oder suchen wir das Schöne und das Miteinander, um durchzukommen? Und was am wichtigsten ist: Welche Denkweisen motivieren uns bewusst oder unbewusst? Behindert uns unsere Denkweise oder bringt sie uns voran? Der Winter ist nicht nur eine Jahreszeit, die sich in der Natur abspielt. Winter – Zeiten der Herausforderung, in denen wir zu kämpfen haben, oder der Trauer – können auf unerwartete Weise und zu unerwarteten Zeitpunkten in die Mitte unserer Gesellschaften, in unsere Häuser und unser Leben einziehen. Die Strategien, die ich bei meinen Nachforschungen, wie Menschen auf der ganzen Welt dem Winter trotzen, beobachtet habe, können uns helfen, jeden Sturm, ganz gleich ob aus Schnee oder sonstiger Art, zu überstehen. Die gleichen Methoden, die uns dabei helfen, den Winter wohlwollend zu begrüßen und sogar zu genießen, können uns auch durch schwierige Lebensabschnitte helfen.
Ich fing an, die Änderung unserer Haltung zum Winter als einen Einstieg zu betrachten: einen Einstieg, um bewusst hilfreiche Denkweisen zu entwickeln, unsere Aufmerksamkeit und Sprache gezielt einzusetzen und uns auf das Wetter und die Dunkelheit, auf die wir keinen Einfluss haben, einzulassen. Ich erkannte, dass die Einstellung zur Winterzeit nicht nur die Erfahrungen der Menschen in dieser Jahreszeit, sondern das ganze Jahr über ihr Leben verändern kann. Ich habe dieses Buch geschrieben, um alles, was ich gelernt habe, weiterzugeben. Ich hoffe, es hilft Ihnen dabei, den Winter mit anderen Augen zu sehen. Wenn Sie bereits ein Fan des Winters sind, wird Sie dieses Buch hoffentlich dabei unterstützen, noch mehr Möglichkeiten zu finden, diese Jahreszeit auszukosten. Wenn Sie den Winter verabscheuen, wie ich es einst getan habe, hoffe ich, dass es Ihnen dabei hilft, Momente des Lichts inmitten der Dunkelheit zu finden und Ihnen eine Anleitung gibt, selbst solche Momente zu kreieren. Vor allem aber hoffe ich, dass dieses Buch Ihnen zeigt, auf welche unsichtbare Weise unsere inneren Einstellungen unser Erleben formen und wie sie eine mächtige, nicht ausreichend genutzte Ressource darstellen, um alle Herausforderungen zu meistern, die das Leben an uns stellt.
Einleitung
Meine Reise in das Land des Winters
Mehr als 300 Kilometer nördlich des Polarkreises gelegen, ist das norwegische Tromsø Schauplatz eines extremen und besonderen Winters, in dem die Welt in Tintenblau erscheint, der Schnee die Stadt in Stille hüllt und die Nordlichter am Himmel tanzen. Während der Polarnacht, die von Ende November bis Ende Januar dauert, geht die Sonne überhaupt nicht mehr auf. Zu dieser Zeit des Jahres bekommt Tromsø jeden Tag höchstens etwa sechs Stunden von einem diffusen Dämmerlicht ab, wenn die Sonne unterhalb des Horizonts entlangwandert. Am kürzesten Tag des Jahres hält die vollständige Dunkelheit fast 19 Stunden lang an: Um vier Uhr nachmittags wirkt das Licht nicht anders als um zwei Uhr morgens.1
Es war die Polarnacht, die mich überhaupt erst nach Tromsø geführt hat. Im Jahr 2013 hatte ich gerade mein Studium abgeschlossen und wollte noch weitere Forschungserfahrung sammeln, bevor ich mich bei einem Promotionsprogramm in Psychologie bewarb. Auf der Suche nach einer Möglichkeit, mein Interesse an Positiver Psychologie und psychischer Gesundheit zu vertiefen – und, um meiner Abenteuerlust nachzugehen –, stieß ich auf die Arbeiten von Joar Vittersø. Joar, Professor für Psychologie an der Universität von Tromsø, ist einer der weltweit führenden Experten für das menschliche Erleben von Glück. Er unterscheidet zwischen hedonistischem Wohlbefinden, also Dingen im Leben, die sich angenehm und lustvoll anfühlen, und eudämonistischem Wohlbefinden, denjenigen Dingen im Leben, in denen wir einen Sinn und Zweck finden. Joar hat Lebenszufriedenheit und persönliches Wachstum untersucht und erforscht, was es bedeutet, ein erfülltes Leben zu führen.
Ich war fasziniert von seiner Arbeit und hing Tagträumen von Abenteuern am Fjord nach, also kontaktierte ich Joar, um ihn zu fragen, ob er mit mir im Rahmen einer Studie zusammenarbeiten und mir als Mentor zur Seite stehen würde, wenn ich die finanziellen Mittel bewilligt bekäme. Joar war so nett, sich damit einverstanden zu erklären, und erwähnte beiläufig, dass seine Universität, auch bekannt als The Arctic University of Norway, die nördlichste der Welt sei. Tromsø liegt so weit im Norden, dass es noch viele weitere nördlichste Orte beherbergt: den nördlichsten botanischen Garten, das nördlichste Freibad, die nördlichste Moschee, die nördlichste Ampel, das nördlichste Aquarium und den nördlichsten Burger King und 7-Eleven-Supermarkt, um nur einige zu nennen. Ich lernte auch etwas über den extremen Winter in Tromsø und die Polarnacht. Mir fiel auf, dass Joar, einer der weltweit führenden Wissenschaftler zum Thema Wohlbefinden, an einem Ort lebt, an dem die Sonne zwei Monate im Jahr nicht aufgeht. Ich machte ihm den Vorschlag, das psychische Befinden in Abhängigkeit von jahreszeitlichen Schwankungen zu untersuchen, um zu verstehen, wie Tromsøs Winter sich auf die mentale Gesundheit auswirkt – negativ, wie ich annahm. Joar antwortete etwas in der Art von: »Das können Sie gern versuchen, aber in der Forschung hat man bislang keinen großen Unterschied feststellen können, was das Wohlbefinden in Abhängigkeit von den Jahreszeiten in Tromsø betrifft.«
❆
Als US-Amerikanerin nahm ich an, dass die langen, dunklen Winter in Tromsø der mentalen Gesundheit unzuträglich sind. Da ich an der Küste von Jersey aufgewachsen bin, war ich von einer Kultur geprägt, die davon überzeugt war – ja, die zweifelsohne wusste –, dass der Sommer eindeutig die beste Jahreszeit ist. So vieles von dem, was meine Heimatstadt so besonders macht – an den Strand gehen, an der Promenade Eis essen, Konzerte im Freien besuchen –, haben wir nur im Sommer gemacht. Der Winter war die Jahreszeit der Einschränkungen: die Zeit des Jahres, in der wir drinnen festsaßen; in der ich in meiner Jeans fröstelte; in der man, um zur Schule zu gehen, die Windschutzscheibe enteisen musste; und in der die belebtesten Treffpunkte bis zum Memorial Day (dem letzten Montag im Mai) völlig verlassen wirkten. Ein Grund dafür, dass ich in Atlanta, Georgia, studiert habe, war der, dass ich den Wintern im Nordosten der USA entkommen wollte.
Und tatsächlich bin ich davon ausgegangen, dass die Rate der saisonal-affektiven Störungen bzw. Winterdepressionen in Tromsø hoch sein würde. Die saisonal-affektive Störung ist eine Form der klinischen Depression, die saisonal auftritt, meistens im Winter. Weil die Lichttherapie eine wirksame Behandlungsmethode dieser Störung darstellt, haben Psychologen daraus eine Theorie abgeleitet: Ursächlich für eine Depression im Winter muss der Mangel an Tageslicht sein.[1] Die »Breitengradhypothese« der saisonal-affektiven Störung besagt, dass mit zunehmendem Breitengrad und entsprechendem Rückgang des Tageslichts während der Winterzeit die Rate der saisonal-affektiven Störungen ansteigen müsste.[2] Auf Grundlage dessen liegt die Annahme nahe, dass unter den Menschen, die die zweimonatige Polarnacht in Tromsø – und den sechs bis acht Monate langen Winter – durchleben, ein hoher Anteil an Winterdepressionen leiden muss.
Aber die Forschungsergebnisse, die ich gefunden habe, unterstützen Joars Behauptung und stellen die Breitengradhypothese zur saisonal-affektiven Störung infrage. Trotz des hohen Breitengrades und der winterlichen Dunkelheit hat die Forschung gezeigt, dass erstaunlich wenige Bewohner von Tromsø an saisonalen Depressionen leiden. Das bedeutet nicht, dass es in Tromsø überhaupt keine Winterdepression gibt; nur tritt sie nicht in dem Maß auf, wie wir es angesichts der extremen Winter erwarten würden. Eine Untersuchung von fast 9000 Einwohnern von Tromsø ergab, dass es keine bedeutenden jahreszeitlichen Unterschiede hinsichtlich psychischer Erkrankungen gab, das heißt, die Menschen in Tromsø scheinen im Winter nicht angespannter, deprimierter oder hoffnungsloser zu sein, verglichen mit dem Rest des Jahres.[3] Die Autoren dieser Studie kamen zu dem Schluss, dass die negativen Auswirkungen des Winters auf die psychische Gesundheit eher einem populären Mythos als einer wissenschaftlichen Tatsache entsprechen. Wir werden in Kapitel 2 noch ausführlicher auf die saisonal-affektive Störung zu sprechen kommen, aber die Forschungsergebnisse legen nahe, dass die Bewohner im Norden Norwegens nicht mehr unter der Winterzeit leiden als Menschen in anderen Gegenden – wärmere, hellere und weiter südlich gelegene Gegenden paradoxerweise miteingeschlossen. Nachdem ich mit Joar gesprochen und mir die Forschungsergebnisse angesehen hatte, wurde mir klar, dass ich in meiner Studie den Fokus nicht auf die Winterdepression legen sollte, sondern auf das Fehlen einer solchen. Ich wollte herausfinden: Wie schützen sich die Einwohner im nördlichen Norwegen vor dem Winterleiden? Warum sind sie in solch intensiven Wintern nicht eher deprimiert? Und lassen sich Strategien ausmachen, auf die die Menschen in Tromsø zurückgreifen, um mit dem Winter zurechtzukommen, die auch anderswo ihre Anwendung finden und dieselben positiven Ergebnisse herbeiführen könnten?
Im April 2014 wurde mir ein Stipendium im Rahmen des Fulbright-Programms zwischen den USA und Norwegen zugesprochen, um diesen Fragen in Tromsø auf den Grund zu gehen, und mein hypothetisches Abenteuer wurde plötzlich real. War ich wirklich gerade dabei, mein ganzes Leben einzupacken und in die Arktis zu ziehen?
Im August 2014 traf ich in Tromsø ein, etwas aufgeregt, aber in erster Linie ängstlich. Es machte mir Angst, in ein fremdes Land zu ziehen, in dem ich keine Menschenseele kannte. Es machte mir Angst, mich in einer neuen Kultur zurechtfinden zu müssen, in einer Sprache, die ich nicht verstand. Und, ja, natürlich hatte ich auch etwas Angst vor dem Winter und der Kälte. Um mich vorzubereiten, hatte ich alles gelesen, was ich über die kleine Stadt finden konnte. Die meisten Reiseführer schwärmten davon, wie schön es hier sei: die Fjorde, die Berge, die Nordlichter. Doch als ich mit der Buslinie Nummer 42 vom Langnes Flughafen zu meiner Unterkunft fuhr, war ich umgeben von Grau in Grau. Der Himmel war bedeckt, es war nebelverhangen und nieselte vor sich hin. Alles, was ich sehen konnte, waren graue Wolken, graues Wasser, graue Berge. Eine amerikanische Forschungskollegin, die im Süden Norwegens lebt, listete später einmal in ihrem Blog die norwegischen Grauschattierungen auf: downy-fill gray (das Grau von Daunenfüllungen), goodbye-daylight gray (ein Grau wie der Abschied vom Tageslicht), pavement-of-sadness gray (das traurige Grau des Straßenpflasters), heavy-frost gray (das Grau von starkem Frost), mid-November-noon-sky gray (das Grau des Mittagshimmels Mitte November). Die Gebäude entlang der Buslinie wirkten industriell und funktional. Wo waren die farbenprächtigen Holzhäuser, die mir versprochen worden waren? Wo war die rustikale norwegische Architektur?
Als ich in meinem neuen Zuhause, ein Zimmer in einer Wohnung, die ich mit drei Studentinnen teilte, ankam, musste ich als Erstes feststellen, dass es kein Internet gab. Daraufhin geriet ich in Panik, und mir kamen die Tränen – wie sollte ich meiner Familie Bescheid geben, dass ich gut angekommen war, geschweige denn überhaupt jemanden kontaktieren? Es war, als hätte ich ein Abenteuer um die halbe Welt angetreten und meinen Rucksack über einen Zaun geworfen, sodass ich mir nun überlegen musste, wie ich selbst ebenfalls rüberkomme. Als Drittes – mein erster Versuch, über den Zaun und in mein neues Leben in Tromsø zu steigen – richtete ich mein Schlafzimmer neu ein. Das Schönste an dem Zimmer waren seine Fenster: eines war klein und hoch – man konnte durch dieses Fenster nur Wolken sehen –, das andere groß und quadratisch. Von dem größeren Fenster aus konnte man auf das immerzu leuchtende blaue Schild des Ahlsell-Gebäudes auf der anderen Straßenseite blicken (dem führenden nordischen Händler von Installationsprodukten, Werkzeugen und Zubehör!), dann kam der Fjord, ein schmaler Streifen Wasser, und dahinter ragten die Berge des Festlands in den Himmel.
Das Zimmer war so eingerichtet, dass, wenn man im Bett lag, der Blick auf die Tür fiel. Nachdem ich meine anfänglichen Tränen unter Kontrolle gebracht hatte, drehte ich das Bett um 90 Grad, sodass ich mich hinlegen und nach draußen blicken konnte. Wenn ich an meine Zeit in Norwegen denke, denke ich daran, wie ich in diesem Bett saß und beobachtete, wie große Schiffe und kleine Boote aus dem Hafen und in den Hafen von Tromsø tuckerten: Schnellboote, mit denen die Norweger zu ihren Wochenendhäusern fahren, Fischerboote und das riesige norwegische Kreuzfahrtschiff Hurtigruten. Als das satte Grün des Spätsommers dem ersten Herbstfrost wich, sah ich, wie die Wolken nebeligen Nieselregen und heftige Regengüsse niedergehen ließen, leichtes Schneegestöber und rasende Whiteouts. Ich beobachtete, wie die Tage kürzer und die Nächte länger wurden – manchmal war der Himmel pechschwarz, ein anderes Mal erschien er in einem weichen, diffusen Blau, getönt vom reflektierenden Schnee und Wasser. Wenn ich das Fenster geöffnet und meinen Kopf hinausgestreckt habe, konnte ich manchmal sehen, wie sich die Nordlichter über den Himmel kräuselten. Einmal sah ich in einem Schneesturm einen Mann in Shorts joggen.
Tromsø ist eine kleine Insel, etwa so groß wie Manhattan, eingebettet zwischen dem norwegischen Festland im Osten und der erheblich größeren Kvaløya (»Walinsel«) im Westen. Wäre sie nicht auf der Karte eingezeichnet, hätte man Schwierigkeiten, sie zu finden: Sie ist kaum von den Hunderten anderer Inseln, die sich wie Tupfen an Norwegens Küste entlang erstrecken, zu unterscheiden. Mit etwa 80 000 Einwohnern ist Tromsø die drittgrößte Stadt nördlich des Polarkreises. Die Stadt hat eine belebte Innenstadt mit allem, was man braucht – ein Einkaufszentrum, drei Haupteinkaufsstraßen und ein paar Kinos. Und doch wirkte dieser Ort isoliert, und ich fühlte mich, als wäre ich in der Wildnis. Ich fragte mich, inwiefern meine Kenntnis über seine geografische Lage – der Umstand, Tromsø hoch oben auf dem Globus zu wissen – mein Gefühl verstärkte, am Rand der Welt zu leben.
Das Institut für Psychologie der Universität Tromsø hieß mich in der Arktis willkommen, was meine anfängliche Einsamkeit linderte. Als Joar und ich uns nach fast einjähriger Korrespondenz via E-Mail persönlich trafen, waren seine ersten Worte: »Es gibt dich also wirklich!« Joar stellte mich einer Kollegin vor, die zu einer meiner engsten norwegischen Freundinnen werden sollte und deren Wissen sich durch das ganze Buch zieht: Dr. Ida Solhaug. Ida war die erste von vielen Menschen, die ich in Tromsø traf und die das Vorurteil widerlegte, dass Skandinavier unterkühlt und spröde sind. Mit ihrer typischen Ida-Art lud sie mich sofort zu ihrer Geburtstagsfeier in ihr Haus ein.
Am nächsten Abend erschien ich nervös zu meinem ersten Aufeinandertreffen mit den Einheimischen. Als ich verlegen am Ende des Raumes herumstand, stellte sich mir ein Mann mit dickem schwarzen Brillengestell als Thor-Eirik vor (Namen, die ich zuvor nur in der Mythologie gehört habe, sind in Norwegen gang und gäbe), und ich stellte mich mit meinem New-Jersey-Akzent im Gegenzug als Kari vor.
»Wie ist dein Name?«
»Kari. Kah-Ri.«
»Kannst du das buchstabieren?«
»K-A-R-I.«
»Oh! CAR-I! Wusstest du, dass das ein sehr häufiger norwegischer Name ist?«
Mir fiel die Kinnlade herunter, als Thor-Eirik mir erklärte, dass der Name »Kari« – eine für amerikanische Verhältnisse ungewöhnliche Schreibweise von Carrie – hier nicht nur üblich, sondern auch typisch sei. So wie die Amerikaner »Jane« als einen typischen Mädchennamen anführen würden, würden die Norweger »Kari« benennen. Ich spürte, wie sich etwas in mir veränderte, es war wie ein Wegweiser in Richtung Dazugehören. Ich halte nicht viel von Dingen wie Schicksal oder Bestimmung, aber für jemanden, der keine norwegische Abstammung hat und dessen Familie noch nie zuvor in Norwegen war, hat mir diese Information auf die Sprünge geholfen. Plötzlich war ich also über den Zaun in mein neues Leben gesprungen: als die norwegische Kari.
Über mehrere Monate hinweg legten Joar und ich die Grundlagen für unsere Studie und knüpften an die Hintergrundrecherchen an, die ich vor meiner Ankunft in Tromsø angestellt hatte. Je mehr ich mich in der fremden Umgebung einlebte, desto mehr entdeckte ich einen weiteren Vorteil meiner Forschungsfrage: Jede Person, mit der ich sprach – bei lockeren Unterhaltungen, auf Partys, beim Mittagessen im Institut –, hatte eine Theorie, warum diese Stadt während der Polarnacht regelrecht aufblühte. Einige schworen auf Lebertran oder erzählten mir, dass sie Lampen benutzten, die das Sonnenlicht simulierten, indem sie jeden Morgen allmählich heller wurden. Andere führten ihr Wohlbefinden im Winter auf gemeinsame Aktivitäten zurück, auf Tromsøs vielfältige Kulturfestivals oder darauf, dass sie sich täglich die Skier anschnallten. Die meisten Einwohner sprachen jedoch einfach über die Polarnacht, als wäre sie kein großes Ereignis. Viele freuten sich sogar auf die bevorstehende Zeit und die einzigartigen Möglichkeiten, die diese mit sich brachte: zum Skifahren, für gemütliche Stunden zu Hause und zum Ausruhen.
Allerdings erkannte ich erst im Oktober, nachdem ich bereits mehrere Monate in mein Projekt involviert war, dass ich vielleicht die falsche Frage stellte, wenn ich mich auf das Fehlen von saisonalen Depressionssymptomen konzentrierte. Auf Idas Party hatte mich Thor-Eirik eingeladen, an seiner wöchentlichen Meditationsgruppe teilzunehmen. Unsere Treffen am Dienstagabend waren für mich eine der ersten Lektionen darin, wie die Menschen in Tromsø sich nicht vom Wetter abschrecken lassen: Bei Tageslicht wie bei Dunkelheit, bei Schnee und Regen wagten wir uns hinaus, um in Stille zusammenzusitzen. An einem dieser Dienstage stand ich mit meiner neuen Freundin Fern vor dem roten Gebäude am Hafen von Tromsø. Fern Wickson ist eine Australierin, die damals seit mehr als fünf Jahren in Tromsø lebte.
Wenn sie nicht gerade in ihrem Job in der ökologischen Biotech-Branche als wissenschaftliche Sekretärin für die North Atlantic Marine Mammal Commission tätig war, gab Fern Yogakurse in ihrem Heimstudio, dem Peaceful Wild, aus dessen Fenster man auf einen Fjord in Richtung Kvaløya blicken konnte, oder brauste mit ihrem Motorrad über die arktischen Inseln. An diesem Dienstagabend fragte Fern mich, wie lange ich plante, in Tromsø zu bleiben. Obwohl mein Stipendium im Mai auslief, sagte ich ihr, dass ich hoffte, so lange wie möglich den Sommer über noch hier sein zu können. »Es wäre doch eine Schande, den Winter zu überstehen und dann kurz vor Beginn der schönsten Jahreszeit wieder abzureisen«, meinte ich.
Ohne jedes Zögern antwortete Fern: »Ich würde nicht unbedingt sagen, dass der Sommer die schönste Jahreszeit ist.«
Für die Menschen in Tromsø käme Ferns Kommentar wahrscheinlich nicht sehr überraschend. Aber ich war verblüfft: Wollte Fern damit etwa andeuten, dass der Winter die beste Jahreszeit war?! In Tromsø gibt es nur zwei richtige Jahreszeiten: einen langen Winter und einen kurzen Sommer, der sehr plötzlich zwischen Ende Mai und Ende Juni kommt, wenn die Phase der Mitternachtssonne beginnt. Nicht nur das: Wann immer ich jemandem in den USA erzählte, dass ich für ein Jahr in die Arktis ziehen würde, um den Winter zu studieren, waren die häufigsten Antworten, die ich gehört habe: »Das könnte ich ja nie«, »Das würde mich so deprimieren«, »Ich hasse den Winter«, wobei mein persönlicher Favorit lautete: »Stell dir vor, du gehst nach Norwegen, um zu erforschen, warum sie dort nicht depressiv sind, und bekommst dann selbst eine Winterdepression!«
Doch aus Ferns Bemerkung kristallisierte sich ein Punkt heraus, den ich aus meinen Unterhaltungen zwar herausgehört, aber noch nicht richtig aufgenommen hatte: dass der Winter in Tromsø etwas ist, worauf sich die Menschen freuen. Plötzlich sah ich klarer, was die Ausarbeitung meines Forschungsansatzes betraf. Meine ursprüngliche These kam mir nun falsch vor. Ich hatte mich gefragt, warum die Menschen in Tromsø nicht niedergeschlagener waren, und dabei angenommen, dass der Winter grundsätzlich etwas Deprimierendes ist und man hier irgendwie immun dagegen war. Aber die Menschen in Tromsø schienen viel eher eine andere Sicht auf die Jahreszeit zu haben: dass der Winter etwas ist, woran man sich erfreuen kann, und nichts, was man ertragen muss. Wenn es nach meinen neuen Freundinnen ging, war der Winter in Tromsø voll von Schnee, Skifahrten, Nordlichtern und allem, was koselig, das norwegische Wort für »gemütlich«, ist. Als der Herbst in Sekundenschnelle vorüberzog, begann ich, den Winterzauber von Tromsø zu erahnen. Ab November schmückten Kerzen mit züngelnder Flamme jedes Café, jedes Restaurant und jedes Haus. Sogar im Aufenthaltsraum der Universität trafen wir uns zum Mittagessen bei Kerzenlicht. Ich schnallte mein erstes Paar Langlaufskier an und folgte der Lysløpa, einem gut beleuchteten Wander- und Skiweg, der entlang der Längsseite der Insel Tromsø verläuft, dahingleitend und oft abfallend, zwischen schneebedeckten Kiefern hindurch. Die Wale kehrten nach Tromsø zurück, ihre letzte Gelegenheit, um Nahrung zu sich zu nehmen, bevor sie ihre Reise in den Süden antraten, um zu gebären, und so wurde jeder Spaziergang an einem Fjord zu einem Spiel, bei dem es hieß: »Welle oder Wal?«, während wir nach aus dem Wasser auftauchenden Flossen Ausschau hielten. Ich hatte meine ersten Begegnungen mit den Polarlichtern und lernte ihre unterschiedlichen Erscheinungsformen kennen: in Schlieren und wellenförmig, wie ein gestreifter Vorhang oder diffus und dunstig, wie ein grüner Nebel am Himmel.
Als ich das Leben in Tromsø immer mehr zu genießen begann, konnte ich auch über das Grau hinwegsehen, das mich bei meiner ersten, heimwehgeplagten Busfahrt in die Stadt wie Eisenstangen umgeben hatte. Ich machte selbst die Erfahrung, dass die Polarnacht alles andere als eine Zeit absoluter Dunkelheit, sondern vielmehr eine Zeit wunderschöner Farben und eines weichen, indirekten Lichts ist. Fern erzählte mir, sie weigere sich, die Polarnacht bei ihrem typisch norwegischen Namen, mørketid, oder »dunkle Zeit«, zu nennen. Sie bevorzugte stattdessen den alternativen Namen blǻtid, was so viel bedeutete wie »blaue Zeit« und womit die Farbe betont wurde. Nachdem ich das gehört hatte, konnte ich nicht anders, als dem zarten, blauen Dunst, der sich über alles legte, mehr Aufmerksamkeit zu schenken, und ich versuchte ganz bewusst, dieses Licht als behaglich und nicht als düster zu empfinden. Als ich an Bushaltestellen wartete, eingepackt in wollene Unterwäsche, mein Atem wie Nebel mit jedem Atemzug rhythmisch vor mir herwabernd, bewunderte ich den Himmel, der dank der nie aufgehenden Sonne, die stundenlang unter dem Horizont stand, oft mit Streifen in Rosa, Violett, Blassgelb und allen möglichen Blauschattierungen durchsetzt war. Meine Freunde kamen zu Fuß oder auf Skiern zu unseren Treffen und waren bei ihrer Ankunft wach und erfrischt von der Bewegung im Freien. An einem Tag Mitte November fuhr ich mit einer Gruppe internationaler Studenten nach Kvaløya, um die Sonne zu sehen, wie sie ein letztes Mal auf die Gipfel der Berge schien und ihre Spitzen in Bronze, Kupfer und Gold leuchten ließ. Als ich nach Hause kam, habe ich an jedem verfügbaren Platz Kerzen aufgestellt und zum Ausgleich ihrer Wärme die Heizung heruntergedreht.
Die ursprüngliche Formulierung meiner Forschungsfrage war durch meine eigene, kulturell voreingenommene Sicht auf den Winter geprägt. Ich beschloss, einen Fragenkatalog in meine Studie mitaufzunehmen, mit dem sich die möglichen Vorzüge des Winters erfassen und die positiven Aspekte dieser Jahreszeit verdeutlichen ließen. Dabei stieß ich jedoch auf Schwierigkeiten. Abgesehen von den Bewertungsfragebögen, die benutzt werden, um saisonal-affektive Störungen festzustellen, existierten in der Psychologie keine standardisierten Fragebögen, die die innere Einstellung zum Winter ermitteln. (Wir werden in Kapitel 2 noch ausführlicher darauf zu sprechen kommen, aber frühere Studien, die zu saisonal abhängigen Störungen in Tromsø durchgeführt worden waren, stützten sich auf eine Mischung aus den standardmäßigen SAD-Bewertungsfragebögen und allgemeineren Erhebungen zur Messung psychischer Krankheitssymptome.) Es gab zwar durchaus Fragebögen, in denen nach saisonalen Depressionen, Stress und Schlafstörungen im Winter gefragt wurde, aber es gab keine Befragungen, in denen die potenziell positiven Aspekte dieser Jahreszeit berücksichtigt wurden.
Das war nicht nur ein Problem für meine Studie, sondern, was die Erforschung des Winters betraf, ein Hinweis auf Urteilsverzerrungen im größeren wissenschaftlichen Rahmen. Wir können nur untersuchen, was wir messen. Die Tatsache, dass es keine Instrumente zur Erfassung der Vorzüge des Winters gab, deutete darauf hin, dass es schlichtweg nicht unseren Denkgewohnheiten entspricht, auf die positiven Erfahrungen zu schauen, die die Menschen in dieser Jahreszeit machen, während Tausende von Forschungsartikeln das Thema Winterdepression behandeln.[4] Dadurch, dass Forscher an Universitäten und im Klinikalltag, angetrieben von dem Wunsch, den Menschen zu helfen, die unter dem Winter litten, möglicherweise versehentlich ihre Befragungen voreingenommen durchgeführt haben, entstand eine Verzerrung in der psychologischen Fachliteratur, durch die die Vorstellung aufrechterhalten wurde, dass wir alle darauf achtgeben müssen, die negativen Auswirkungen des Winters auf die psychische Gesundheit zu verhindern. Niemand schien über die Menschen auf der ganzen Welt zu sprechen, denen es im Winter gut geht.2
Ungefähr zu der Zeit, als ich nach Graduiertenprogrammen in Psychologie Ausschau hielt, flog ich zurück in die USA und besuchte die Universität von Stanford. Dort traf ich Alia Crum, eine Professorin für Psychologie, die später meine Doktorarbeit betreute. Alia oder Ali, wie wir sie nannten, leitet das Stanford Mind & Body Lab, wo sie bahnbrechende Forschungen dazu anstellt, wie unsere Denkweise unser Wohlbefinden, unsere Leistungsfähigkeit und unsere körperlichen Vorgänge beeinflusst. Ali definiert die innere Einstellung als »Grundannahme über die Beschaffenheit und Funktionsweise von Dingen in der Welt«: Wir können sie uns als Linse oder Rahmen unseres Geistes vorstellen, durch die wir Informationen aufnehmen und verarbeiten. Unsere Einstellung beeinflusst, was wir wahrnehmen und erwarten, und während wir uns unserer Denkweise nicht immer bewusst sind, zeigt die Forschung, dass sie einen tiefgreifenden Einfluss auf unser Verhalten, unsere Gesundheit und unser Glücklichsein haben kann. Als wir uns über ihre Forschung und meine eigene Arbeit in Norwegen unterhielten, meinte Ali, dass das Denken eine Rolle dabei spielen könnte, dass die Menschen in Tromsø im Winter regelrecht aufblühten, wie ich es beobachtet hatte. Ali tritt in die Fußstapfen der Psychologin Carol Dweck, die auch meine Mentorin in Stanford war und in ihrer Arbeit untersucht hat, wie die innere Haltung unsere Fähigkeit beeinflusst, sich in Bereichen, die Intelligenz und Sportlichkeit beinhalten, zu entwickeln und zu verbessern. In ihrer Forschung und in ihrem Buch Mindset: The New Psychology of Success (dt. Ausgabe: Selbstbild: Wie unser Denken Erfolge oder Niederlagen bewirkt) zeigt Carol detailliert auf, auf welche Weise ein »Wachstumsdenken« (growth mindset, die Überzeugung, dass Eigenschaften wie Intelligenz und Talente durch anhaltende Anstrengungen im Lauf der Zeit entwickelt werden können) zu einem größeren Erfolg führt als ein »starres Denken« (fixed mindset, die Überzeugung, dass individuelle Eigenschaften ein Leben lang festgelegt sind). Diejenigen, die über eine starre Denkweise verfügen, so ihre Forschungsergebnisse, betrachten ein Feedback oft nicht als Gelegenheit, sich weiterzuentwickeln, und verstehen Kritik schnell als persönlichen Angriff. Umgekehrt tendieren diejenigen, die eine wachstumsorientierte Einstellung haben, dazu, offener zu sein, um aus Fehlern zu lernen, Risiken einzugehen und das eigene Potenzial voll auszuschöpfen. So kann man davon ausgehen, dass beispielsweise Studenten mit einer wachstumsorientierten Denkweise, die motiviert sind, besser zu werden, aus einer Niederlage die Schlussfolgerung ziehen, dass sie sich mehr anstrengen oder eine andere Strategie verfolgen müssen, was dann tatsächlich dazu führt, dass sie sich mehr engagieren. Ein Student mit einer eher starren Denkweise hingegen hat vielleicht eher das Gefühl, dass dieses Versagen seine mangelnde Intelligenz bestätigt. Um sicherzugehen, dass andere seine Schwäche nicht bemerken, schreckt er vor Herausforderungen zurück und ist wenig motiviert. Studenten mit einer wachstumsorientierten Denkweise haben im Allgemeinen mehr Freude am Studium, eine größere Motivation, nach Erfolgen zu streben und nach Rückschlägen eine bessere Leistung zu erbringen, und einen besseren Notendurchschnitt. Carols einflussreiche Forschungen zeigen auch, dass sich unsere Denkweise ändern kann und dass eine Person eine starre Denkweise ablegen und sich eine wachstumsorientierte Denkweise zulegen kann.[5] Die Interventionsstudien von Carol und ihren Kollegen zeigen, dass es möglich ist, Studentinnen und Studenten dabei zu helfen, sich gezielt eine wachstumsorientierte Denkweise anzueignen, und dass sich dadurch die Studienleistungen oft verbessern. Schon allein die Menschen dazu zu bringen, ihre Denkweise bewusst wahrzunehmen, ist ein wirksames Instrument, um sie dabei zu unterstützen, hilfreichere Einstellungen zu entwickeln.
Alis Arbeit knüpft an diesen Ansatz an, indem sie untersucht, wie die Denkweise nicht nur Leistung und Erfolg, sondern auch die körperliche Gesundheit beeinflusst. Im Rahmen einer ihrer Studien wurden beispielsweise die Mitarbeiter eines großen Finanzinstituts versuchsweise an eine anpassungsfähige Einstellung zu Stress herangeführt, was sie dazu brachte, Stress nicht mehr als schädlich, sondern als förderlich zu betrachten. Die betreffenden Mitarbeiter zeigten später weniger Krankheitssymptome und erbrachten während der Finanzkrise und Rezession von 2008 eine bessere Arbeitsleistung.[6] Die Änderung ihrer Denkweise schien die Art und Weise zu verändern, wie diese Menschen auf Stress in ihrem Leben reagierten. In einem anderen Experiment wurde nach dem Zufallsprinzip Zimmerpersonal in einem Hotel ausgewählt. Man sagte den Mitarbeitern, dass ihr Job eine gute Möglichkeit sei, um an Körpergewicht zu verlieren und den Blutdruck zu senken. Die Vergleichsgruppe betrachtete ihren Job weiterhin einfach nur als Arbeit.[7] Alis Forschung macht deutlich, dass es nicht nur die starre und die wachstumsorientierte Denkweise über unsere Fähigkeiten sind, die uns beeinflussen: Jegliches Denken in Bezug auf Gesundheit, Leistung und Wohlbefinden kann sich als hilfreich oder nicht hilfreich, konstruktiv oder destruktiv erweisen.
Die Grundaussagen der in diesen Studien dargestellten Denkweisen treffen alle zu – Intelligenz kann trainiert werden, wenn man sich anstrengt; Stress kann sich positiv auf unsere Gesundheit und die Leistungsfähigkeit auswirken; wer mehrere Hotelzimmer am Tag reinigt, bewegt sich sogar mehr, als es die Empfehlungen für einen aktiven Lebensstil nahelegen. Allerdings sind auch sie ein Stück weit verzerrt: Es handelt sich hierbei um spezifische Aspekte einer komplexeren Wirklichkeit. Intelligenz hat zwei Komponenten: genetische Disposition und ihre Ausbildung durch Studium und Lernen. Stress kann sich negativ auf die Gesundheit auswirken, auch wenn er uns mental und physiologisch darauf vorbereitet, Herausforderungen zu meistern. Das Reinigen von Hotelzimmern ist gesunde Bewegung und zugleich harte, anstrengende Arbeit. Unsere Denkweise hilft dabei, diese Ambivalenzen einzuordnen: Was sagt ein Misserfolg in der Schule über meine Fähigkeiten aus? Wie wird sich Stress auf meine Leistungsfähigkeit auswirken? Sollte ich mir Sorgen machen, wenn ich nach einer Putzschicht Muskelkater habe? Die Realität ist vielschichtig, und viele Denkweisen bewegen sich auf einem Kontinuum. Indem man den Menschen dabei hilft, ihre Aufmerksamkeit und Energie selektiv auf einen besonders nützlichen Aspekt einer komplizierten Wirklichkeit zu richten, kann die Umgestaltung des Denkens Gesundheit, Leistungsvermögen und Wohlbefinden in einer Vielzahl von Situationen verbessern.
Der Winter ist, wie ich festgestellt habe, ähnlich vielschichtig und ambivalent: Es gibt Aspekte des Winters, die unangenehm sind, und solche, die reizvoll sind. Vielleicht sind die Menschen in Tromsø einfach besser darin, die schönen Seiten dieser Jahreszeit zu erkennen und sich ihnen zuzuwenden. Vielleicht ist ihr größeres Wohlbefinden im Winter zum Teil auf ihre Einstellung zurückzuführen.
Dies führte mich zu der Frage: Können wir positive oder negative Einstellungen dem Winter gegenüber messen? Könnte es einen Zusammenhang geben zwischen der inneren Einstellung zur Winterzeit und dem psychischen Wohlbefinden der Einwohner von Tromsø während der Polarnacht? Meine Hoffnung war es, eine positivere Dimension in die Diskussion über mentale Gesundheit im Winter einzubringen, die bislang übersehen worden war und in der Erforschung saisonal abhängiger Störungen fehlte. Anstatt mich darauf zu konzentrieren, warum die Menschen nicht niedergeschlagen waren, wollte ich nun mein Augenmerk darauf richten, zu verstehen, was es den Menschen in Tromsø ermöglichte, während der dunkelsten und kältesten Zeit des Jahres regelrecht aufzublühen.
Joar und ich entwickelten eine Skala zur inneren Einstellung zum Winter, anhand derer sich das Denken über die Winterzeit einschätzen ließ. Die Befragten sollten eine Bewertung abgeben, in welchem Umfang sie Aussagen wie »Es gibt viele Dinge, die man im Winter tun kann«, »Ich genieße es, viele Dinge zu tun, die ich nur im Winter tun kann« oder aber »Ich finde die Wintermonate dunkel und deprimierend« zustimmen oder nicht zustimmen. Unser Ziel war es, die Beziehung zwischen der sogenannten Einstellung zum Winter – ob die Befragten die Jahreszeit als eine Zeit voller Gelegenheiten und Vorzüge oder voller Einschränkungen und Bedrohungen sahen – und anderen Aspekten des psychischen Wohlbefindens, einschließlich Lebenszufriedenheit und positive Emotionen, zu verstehen.
Eine zufällige Auswahl von mehr als 200 norwegischen Erwachsenen hat an unserer Umfrage teilgenommen. Die Gruppe setzte sich aus Befragten, die fast gleichmäßig verteilt in Südnorwegen, Nordnorwegen und Svalbard, einer arktischen Insel auf halbem Weg zwischen Nordnorwegen und dem Nordpol, leben. Dank der warmen Strömung des Golfstroms gilt Tromsø trotz seiner nördlichen Lage als »subarktisch«: Die durchschnittlichen Wintertemperaturen schwanken zwischen minus 3,9 Grad Celsius und 1,1 Grad Celsius, was gemäßigter ist, als seine geografische Lage vermuten lässt. Svalbard kommt den Vorstellungen, die die meisten Menschen haben, wenn sie an die Arktis denken, wohl näher: Mit nur ungefähr 2500 Einwohnern verfügt die Hauptstadt der Insel, Longyearbyen, über nur einen Lebensmittelladen. Und wollen die Bewohner Longyearbyen verlassen, sind sie gesetzlich dazu verpflichtet, eine Waffe bei sich zu tragen, um für den Fall, dass sie einem hungrigen Eisbären begegnen, gerüstet zu sein. Im Winter nutzen viele Bewohner ein Schneemobil als Fortbewegungsmittel. Die Licht- und Temperaturbedingungen sind in Svalbard viel extremer als in Tromsø; die durchschnittlichen Temperaturen liegen im Januar zwischen minus 20 Grad Celsius und minus 13,3 Grad Celsius, und die Polarnacht fällt in Svalbard erheblich dunkler aus als in Tromsø, ohne indirektes Sonnenlicht, sodass es über Monate hinweg fast keinerlei Veränderung der Lichtverhältnisse gibt, anhand derer sich die Tageszeit festmachen lässt.
Unsere Umfrageergebnisse deuten darauf hin, dass die Einstellung zur Winterzeit zumindest teilweise für das Wohlbefinden der Norweger im Winter verantwortlich ist.[8] Aus unserer Studie ergab sich ein Zusammenhang zwischen einer positiven Einstellung zum Winter und dem von uns untersuchten Ausmaß des Wohlbefindens, wobei wir die Lebenszufriedenheitsskala (Satisfaction with Life Scale, ein weitverbreiteter Fragebogen, mit dem die allgemeine Lebenszufriedenheit gemessen wird bzw. das Gefühl, dass unser Leben so verläuft, wie wir es uns wünschen), allgemeine positive Emotionen (Freude, Zufriedenheit und Glück) und die Personal Growth Composite (eine Skala, die die Offenheit für neue Herausforderungen und persönliches Wachstum misst) miteinbezogen haben. Mit anderen Worten, die Menschen, die eine positivere Einstellung zur Winterzeit hatten, neigten dazu, mit ihrem Leben durchweg zufrieden zu sein, erlebten häufiger positive Emotionen und strebten nach persönlichem Wachstum.
Was wir auch herausfanden, war, dass es in Norwegen eine signifikante Korrelation zwischen der Einstellung zur Winterzeit und dem Breitengrad gab – diejenigen, die weiter nördlich leben, erleben den Winter tendenziell positiver und wissen, wie man sich an ihm erfreut. Mit seinem extremen Klima ist Svalbard ein Ort mit eigenem Selektionsmechanismus; viele Bewohner verbringen nur wenige Jahre auf der Insel. Wer den Winter nicht ausstehen kann, den zieht es dort wohl eher nicht hin. Aber auch dann, wenn man die Bewohner von Svalbard aus der Stichprobe ausschloss, wiesen die Bewohner Nordnorwegens immer noch eine positivere Einstellung zur Winterzeit auf als die Menschen, die in Südnorwegen leben. Es ist nicht so, dass die Menschen im Süden Norwegens keinen richtigen Winter erleben: Oslo liegt ungefähr auf demselben Breitengrad wie Anchorage in Alaska, und die Winter dort sind kalt, dunkel und lang, insbesondere für amerikanische Verhältnisse. Aber in Oslo gibt es im Winter wesentlich mehr Tageslicht als in Tromsø, auch zur Wintersonnenwende geht die Sonne auf. Doch trotz des helleren, freundlicheren Winters erleben die südlicheren Norweger die Jahreszeit nicht so positiv wie ihre Landsleute im Norden.
Als ich erkannte, dass die Menschen in Tromsø über diese positive Einstellung zum Winter verfügen, begann ich, sie plötzlich auch überall um mich herum wahrzunehmen. Die Umgebung und Kultur von Tromsø waren dieser wertschätzenden Haltung förderlich. Die Stadt verfügt über eine Infrastruktur, die die Straßen schneefrei und die Restaurants warmhält, auch wenn es draußen stürmisch ist. In jedem Restaurant und jedem Coffee Shop herrscht ein sanftes, warmes Licht und stehen echte Kerzen (etwas, das Menschen aus den USA nicht immer gewohnt sind – bei einem Besuch hat mein Vater versehentlich eine Speisekarte in Brand gesteckt, weil er sie unwissentlich zu nah an die Flamme gehalten hatte), und in den Cafés gibt es im Freien Wärmelampen und Decken an den Tischen, damit man das ganze Jahr über draußen Kaffee trinken kann. Die Menschen richten ihr Augenmerk bei der Kleidung auf praktische Aspekte: gepflegte und modische Mäntel, die warm und wasserdicht sind, Stiefel mit Wolleinlagen und dicken Sohlen und grob gestrickte Wollpullover. In Tromsø wird der Winter mit einer Fülle von Großveranstaltungen und Festivals zum Kulturevent: vom Internationalen Filmfest Tromsø über den PolarNight Marathon bis zum Northern Lights Music Festival und der Sami-Woche, in der die indigene samische Bevölkerung Nordnorwegens gefeiert wird.
Es dürfte leichter fallen, den Winter in Tromsø zu mögen, nachdem diese Jahreszeit im kulturellen Leben so viel Wertschätzung erfährt und als etwas Magisches gefeiert wird. Meine beste Freundin Becky, die den Sommer liebt und an der Küste Jerseys mit dem Surfen aufgewachsen ist, meinte, als sie mich in Norwegen besucht hat: »Wenn der Winter ein Ort wäre, wäre es Tromsø«. In Tromsø wird die Fantasiewelt aus Disneys Frozen (deutsch Die Eiskönigin) Realität: Ich habe mich nie daran gewöhnt, von der Bushaltestelle nach Hause zu laufen und die Nordlichter am Himmel tanzen zu sehen. Ich möchte natürlich vorsichtig sein, um die Bedeutung unserer Studie nicht überzubewerten. Nach unserem Kenntnisstand waren Joar und ich die Ersten, die die Denkweise über die Winterzeit untersucht haben. Da es sich um eine Korrelationsstudie handelt, können wir nicht mit vollkommener Sicherheit sagen, ob eine positive Einstellung zur Winterzeit zu einer höheren Lebenszufriedenheit führt oder es sich vielmehr umgekehrt verhält – nur, dass ein Zusammenhang zwischen diesen Phänomenen besteht. Aber die Forschung über die Bedeutung innerer Einstellungen – der Bewertung von Stress, der eigenen Intelligenz oder von Krankheiten – deuten darauf hin, dass Menschen, die sich förderliche Denkweisen aneignen, hieraus oft Vorteile für Gesundheit, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit ziehen.
Die Lektionen, die ich in Tromsø gelernt habe, haben mir gezeigt, dass die Wintermisere nicht unausweichlich ist. Auch wenn sich nicht alle Aspekte dieser Kultur übertragen lassen, so gibt es einfache, aber sinnvolle Schritte, die man unternehmen kann, um mehr Freude an dieser Jahreszeit zu haben. Unabhängig davon, wo man aufgewachsen ist – in einer Kultur, in der der Winter gefeiert wird oder in der der Winter geradezu verhasst ist –, kann man gezielt darauf hinarbeiten, dem Winter etwas Positives abzugewinnen. Das gilt nicht nur für Orte mit eisigen und schneereichen Wintern: Wenn Sie an einem grauen und nebelverhangenen Ort leben, an dem Sie im Winter mit ständigem Nieselregen konfrontiert sind, oder aber an einem gemäßigteren Ort, an dem die Wintertage dennoch kürzer und dunkler sind, können Sie Ihre Einstellung ändern und auf diese Weise lernen, sich besser an den Winter anzupassen und sich an den schönen Seiten dieser Jahreszeit zu erfreuen.
Wie man überwintert
Angeregt durch die Beobachtungen, die ich in Tromsø machen durfte, bin ich, während ich an diesem Buch geschrieben habe, zu einer Weltreise an verschiedene winterliche Orte aufgebrochen. Ich habe die Gemütlichkeit Kopenhagens genossen, bin in eisigen Flüssen in Finnland geschwommen und habe Reykjavíks frostige Luft eingeatmet. Ich habe den stechenden Wind auf der Isle of Lewis





























