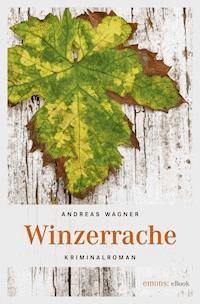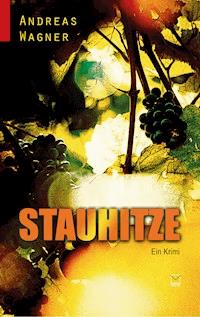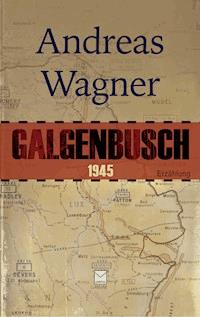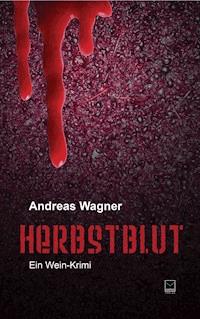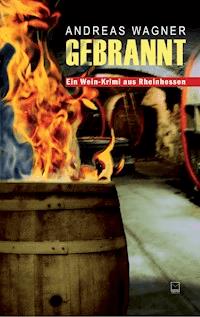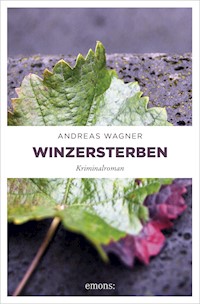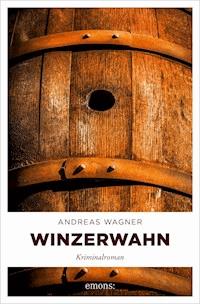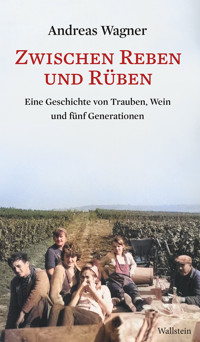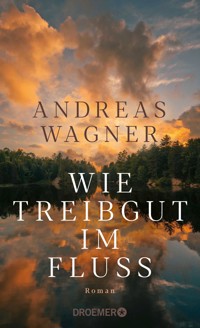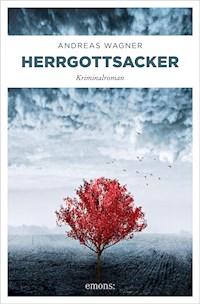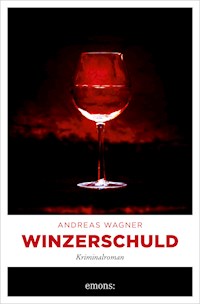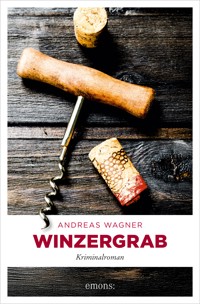
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kurt-Otto Hattemer
- Sprache: Deutsch
»Winzergrab« - ein kurzweiliger Winzerkrimi, nicht nur für Weinfans Bei einer Funzelfahrt durch die Weinberge in Rheinhessen wird die Tochter des bekanntesten Winzers im Dorf tot aufgefunden. Kurt-Otto Hattemer, selbst Winzer, kann's nicht lassen und stellt eigene Ermittlungen an. Dabei bekommt er es nicht nur mit seinen Kollegen, sondern auch mit gierigen Erben und einem undurchsichtigen Weinjournalisten zu tun. Und zu allem Überfluss hat ihn seine liebe Frau Renate auch noch beim alljährlichen Volkslauf angemeldet – ihn, die Unsportlichkeit in Person … Inmitten von Erbstreitigkeiten und familiären Spannungen auf dem Weingut Algesheimer versucht Kurt-Otto, Licht ins Dunkel zu bringen. Doch je tiefer er gräbt, desto mehr Geheimnisse kommen ans Tageslicht. Als dann auch noch der Patriarch Hans-Georg Algesheimer unter mysteriösen Umständen zu Tode kommt, spitzt sich die Lage zu. Zwischen Weinproben, Trainingseinheiten für den Weinbergscup und humorvollen Dialogen entfaltet sich ein spannender Kriminalfall vor der malerischen Kulisse Rheinhessens. »Winzergrab« ist ein unterhaltsamer Regionalkrimi mit viel lokalem Flair, der nicht nur Weinliebhaber begeistern wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andreas Wagner ist Winzer, Historiker und Autor. Nach dem Studium der Geschichte, Politikwissenschaft und Bohemistik in Leipzig und an der Karls-Universität in Prag hat er 2003 zusammen mit seinen beiden Brüdern das Familienweingut seiner Vorfahren in der Nähe von Mainz übernommen. Er ist verheiratet und hat vier Kinder.
www.wagner-wein.de/Krimi
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© Emons Verlag GmbH
Cäcilienstraße 48, 50667 Köln
www.emons-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: istockphoto.com/Olesia Shadrina
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept
von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Marit Obsen
E-Book-Erstellung: Geethik Technologies Pvt Ltd
ISBN 978-3-98707-307-6
Originalausgabe
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen
insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß
§ 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Für Nina, Phillip, Hanna, Fabian und Justus
Der liebste Platz, den ich auf Erden habDas ist die Rasenbank am Elterngrab.
Volkslied um 1900, unbekannter Verfasser
1
Die Bodenwelle hatte Erwin Döllinger nicht gesehen. Verdammte Scheiße! Er kannte den aus Betonplatten zusammengesetzten Weg durch die Weinberge im Teufelspfad eigentlich wie seine Westentasche. Nach drei Schoppen würde er sogar behaupten, dass er ihn auch mit verbundenen Augen mit dem Traktor abfahren könnte, ohne größeren Schaden an den Rebzeilen anzurichten. Nach dem vierten Schoppen würde er in jede ausgestreckte Hand einschlagen und die Wette samt gebotenem Einsatz annehmen. Da ließ er sich nicht lumpen. Jetzt half ihm das aber nicht weiter. Er war mit den Gedanken schlicht woanders gewesen. Bei dem Durcheinander und dem Streit daheim, bei den Sorgen, die so viele Winzer kurz vor der Weinlese umtrieben, und dem schlicht unlösbar erscheinenden Problem, wie er die morgige Tour auf die Reihe bekommen sollte.
Jetzt trat er zwar auf das ausgeleierte Pedal seines alten Fendt Schmalspurschleppers, aber das blieb nur Kosmetik. Zu fest durfte er nicht bremsen, sonst erging es seiner Ladung noch schlechter. Kreischend rieben sich die Bremsbacken des alten Gefährts an ihrer kaum lösbaren Aufgabe. Für einen Moment übertönte das durchdringende Geräusch sogar den unerträglichen Krach, der ihn begleitete: tiefe, wummernde Bässe und heulende Töne, die wie die schlecht gewarteten Sirenen auf der alten Feuerwache im Nachbardorf klangen. Im nach hinten offenen Führerhaus seines betagten Gefährts kam es ihm so vor, als wäre er auf der Flucht vor der lärmenden Schallwelle einer aufgebrachten Horde Wilder, die ihn verfolgte. Eine sinnlose Flucht auf einem mickrigen Traktor, der die Horde hinter sich herzog. Erwins Finger krallten sich fester um das Lenkrad.
Die wulstige Unebenheit, die zwei vor ihm liegende beschädigte Betonplatten wieder miteinander verbinden sollte, erreichte er in diesem Moment mit kaum reduzierter Geschwindigkeit. Zwei mäßig talentierte Mitarbeiter der Straßenbaufirma waren vor anderthalb Jahren mit einer Ladung Asphalt zur Ausbesserung angereist und hatten anscheinend den Auftrag gehabt, keinesfalls mit Restmaterial zurückzukehren. Die Lücke zwischen den Platten war nun zwar geschlossen. Sie mutete aber wie eine Barriere an, die der Werkstatt für Landmaschinen ein gut gefülltes Auftragsbuch in Form von Achsbrüchen sichern sollte.
Die Hinterräder des Fendts nahmen die Aufgabe sportlich. Ächzende Geräusche müden Materials drangen in seine Ohren. Wuchtig katapultierte es ihn aus dem Sitz in die Höhe. Seine Schädeldecke donnerte gegen die Schaumstoffauskleidung des Verdecks. Der darin eingelagerte Staub und Dreck dreier Jahrzehnte feierte die neu gewonnene Freiheit und folgte ihm mit etwas zeitlicher Verzögerung nach unten in den ausgesessenen Schalensitz. Für einen Augenblick sah er im Dämmerlicht dieses Tages bereits die funkelnden Sterne. Sie umkreisten ihn, irre Laufbahnen beschreibend. Gleich darauf erloschen sie so abrupt, wie sie aufgetaucht waren.
Das Schlimmste stand noch bevor. Die ersten beiden Räder des zweiachsigen Anhängers waren dran. Er hatte ihn vor mehr als fünfzehn Jahren im Winter mit einer Überdachung, Sitzbänken an beiden Seiten und einem Tisch, der sich in der Mitte über die gesamte Länge zog, ausgestattet. Eine stimmungsvolle Beleuchtung mit mehreren, separat ansteuerbaren bunten LED-Lichterketten war später hinzugekommen. Eng gedrängt passten fünfundzwanzig Personen auf die Ladefläche, auch wenn der TÜV nur zwölf genehmigt hatte. In zwei Kühlboxen unter den Bänken fanden knapp einhundert Flaschen Wein und etwas Wasser Platz. Noch keine Gruppe hatte es geschafft, diesen Vorrat bis auf den letzten Tropfen leerzubekommen. Der Männergesangverein aus dem Saarland, den er wahrscheinlich gleich in die Erdumlaufbahn katapultierte, schien nahe dran zu sein. Zu den mehrstimmigen, teils kämpferischen, teils traurigen Arbeiterliedern, die sie bei der Abfahrt angestimmt hatten, waren als Erstes die Rieslinge restlos vernichtet worden.
An die von ihm angedachte Probenreihenfolge hatten sie sich von Beginn an nicht gehalten. Jeder Wein sollte eigentlich dort ausgeschenkt werden, wo er gewachsen war. Die Stimmen der Sänger mussten jedoch stets geschmiert bleiben, vor allem, nachdem sie zum Singen von Schlagern von Helene Fischer, Costa Cordalis und Roland Kaiser übergegangen waren. »Sieben Fässer Wein können uns nicht gefährlich sein!« Die Harmonien hatten arg unter den Grauen und Weißen Burgundern gelitten, jeder der Herren war mit Theo auf einem anderen Weg nach Łódź unterwegs gewesen. Einige hingen noch im endlosen Refrain des Griechischen Weines fest. Mit den Rotweinen hatten sie wenig später den Gesang eingestellt und stattdessen die mächtige Box in der Größe eines Bierfasses in Betrieb genommen. Seither beschallten sie die reifenden Trauben mit Bässen und Sirenengeheul.
Erwin Döllinger spürte jetzt den Ruck, den der Anhänger auf seinen Schlepper übertrug, und vernahm die durchdringenden Schreie der aus dem Dämmerzustand brutal aufgeweckten Sangesbrüder. Zum Glück gab es recht stilvoll anmutende Weingläser aus robustem Kunststoff. Auf jeder Fahrt stürzten drei bis vier Personen mit dem gefüllten Glas in der Hand über die eigenen Füße oder verhedderten sich in dem zwischen den Rebzeilen rankenden Klee. Gehässiges Grünzeug, das entlang seiner bevorzugten Strecke wuchs und sich darauf spezialisiert zu haben schien, angetrunkene Funzelfahrer zur Strecke zu bringen. Ob sie dort hinten nach dem Abheben wieder rechtzeitig auf den harten Bänken landeten, ehe die zweite Achse des Anhängers sie erneut in die Höhe und unter die straff gespannte Plane katapultierte?
Erwin Döllinger litt körperlich mit den Opfern seiner Unachtsamkeit. Ganz besonders fühlte er mit denen, deren kahle Schädel nun, beim zweiten Ruck, ungebremst auf die massiven Stahlrohrstreben trafen, die der Dachkonstruktion die nötige Stabilität gaben. Auf die nur noch vereinzelten, gedämpften Schreie während des zweiten Parabelflugs folgte eine fast gespenstische Stille. Die Box hatte sich verabschiedet. Was die abendliche Funzelfahrt auf ihren Kern reduzierte: Sein knatternder Fendt und der quietschende Anhänger, den er auf zunächst weiten, dann immer enger werdenden Kreisen durch seine besten Weinlagen im Selztal zog, beschallten auf einmal ganz allein die Dämmerung. Leise, wie ein geflüstertes Gebet, murmelte er die Lagennamen vor sich hin: Teufelspfad, Blume, Sauermilch, Nonne, Nagelschmidt und Hieberg.
Er traute sich noch immer nicht, den Kopf zu drehen. Hoffentlich hatte sich keiner ernsthaft verletzt. Döllinger spürte einen wachsenden Groll auf sich selbst, seine Unachtsamkeit und die Sorgen, die sie ihm daheim bereiteten. Die ständigen Kämpfe mit seinem Sohn Michael, mit dem zusammen er den Betrieb führte, zermürbten ihn. Für die große Ausfahrt am morgigen Freitag musste er sich noch einen zweiten Fahrer suchen. Sein feiner Sohn wollte nicht. Er wischte den Gedanken beiseite und blickte sich nun doch noch hastig um.
Fünfundzwanzig rot glühende Gesichter strahlten ihn mit weit aufgerissenen Augen erwartungsvoll an. Er hatte die Saarländer Chorknaben unterschätzt. Sie jubelten ihm zu und forderten lautstark eine Zugabe: »Einer geht noch!«
Das waren keine Anfänger! Sie hatten sich alle rechtzeitig untergehakt oder schlicht zufällig im richtigen Moment geschunkelt. Ihr Vorsänger stimmte den passenden Refrain an: »Tanze Samba mit mir, Samba, Samba die ganze Nacht.«
Döllinger warf einen schnellen Blick auf seine Armbanduhr. Es war erst kurz vor zehn. Eine halbe Stunde musste er sie noch durch die Weinberge kutschieren. So war es verabredet, dafür bezahlten sie. Zwei der drei weiteren geplanten Zwischenstopps konnte er sich schenken. Den Wein dafür verteilten sie gerade großzügig in den wieder eingesammelten Plastikweingläsern. In manchen waren sogar noch erkleckliche Pfützen des Weißweines, der nun mit seinem Spätburgunder aufgegossen wurde.
Er konnte es mittlerweile ertragen. Es schmeckte ihnen, und darauf kam es schließlich an. Sie würden nachher bestimmt ordentlich in seiner Vinothek einkaufen. Darauf konnte er sich verlassen. Er musste nur dafür sorgen, dass sie zufrieden und reichlich beschwingt vom Anhänger stiegen. Die richtige Dosis brachte das gute Geschäft.
Er hatte sich über die Jahre zum Fachmann entwickelt. Mehrere Touren wöchentlich, auch in den Wintermonaten, hatten ihn geschult und bildeten eine stabile Basis für ihren Absatz. Völlig besoffen durften sie nicht sein, dann konnten sie keine Entscheidungen mehr treffen. Ihr Reisebus stand in seinem Hof. Den Gepäckraum würde er nachher bis in den letzten Winkel vollräumen. Das war sein erklärtes Ziel, und daran bemaß sich, ob es eine erfolgreiche Funzelfahrt gewesen war oder nicht. Vor diesem Hintergrund war ihm völlig egal, ob sie später noch wussten, in welcher Reihenfolge sie welche Weine getrunken hatten.
Michael verstand das nicht. Er verachtete diese Ausflugsgesellschaften und zeigte das so deutlich, dass er selbst meist froh war, wenn sein Sohn nicht mitkam. Der vergraulte ihm sonst die Kundschaft.
Döllinger reckte sich zufrieden in die Höhe, nahm seine Kappe mit dem aufgestickten Logo ihres Weinguts vom Kopf, einer grinsenden Traube mit dürren Armen und Beinen, und strich sich über den stoppeligen Haarkranz, der die große, glänzende Mitte säumte. So spät musste er nicht aufpassen, wo er anhielt. Um diese Uhrzeit war keiner der Kollegen mehr in seinem Weinberg unterwegs. Er steuerte seinen Traktor daher langsam etwas näher an die Rebzeilen heran und ließ ihn behutsam ein paar Meter ausrollen. Zuerst machte er den Motor aus, dann drehte er sich zu seinen Gästen um und gab freundlich lächelnd die nötigen Anweisungen: »Es geht bitte jeder in seine eigene Reihe. Nicht zu weit hinein, damit mir keiner verloren geht. Im Unterholz am Ende des Weinbergs wartet eine Rotte Wildschweine auf hilflose Opfer, der möchten Sie lieber nicht begegnen. In fünf Minuten fahren wir weiter. Das ist die letzte Chance. Einen weiteren Halt gibt es nicht.«
Kurz beobachtete er, ob es auch diesmal wieder funktionierte. Eigentlich brauchte er das nicht. Artig suchte sich jeder der wankenden Sangesbrüder seine eigene Gasse zwischen den Rebzeilen. Er lauschte ihrem Schnaufen. Der Weinberg des Kollegen Dörrhof stieg nach wenigen Metern steil an. Keiner würde freiwillig allzu weit hineinstapfen. Das erste Plätschern konnte er schon hören. Die übrigen Männer schienen auf das erlösende Geräusch nur gewartet zu haben. Ein gleichmäßiges Rauschen setzte ein und stimmte ihn zufrieden. Der Dörrhof hetzte bei der Gemeinde unablässig gegen seine Funzelfahrten, obwohl er sich an die meisten Regeln hielt. Wahrscheinlich war er es auch, der in unregelmäßigen Abständen Pflastersteine auf den abschüssigen Wegen so platzierte, dass man in hohem Tempo kaum noch bremsen oder ausweichen konnte. Alles Wege, auf denen er mit seinen Touren entlangfuhr, verstand sich. Neid und Missgunst trieben den alten Dörrhof an. Darum steuerte er die Weinberge des Kollegen gern für den einen oder anderen unbeobachteten Zwischenstopp an. Man brauchte sich ja nicht alles gefallen zu lassen.
Er selbst bog nach unten ab und betrachtete die sauber frei gestellten Trauben der Kollegin Winternheimer. Ihr Vater war vor drei Jahren vom eigenen Sohn umgebracht worden. Seither bewirtschafteten Mutter und Tochter das Weingut. Die Winternheimers waren davor schon maßlos abgehoben gewesen. Unter den beiden Frauen war das noch schlimmer geworden. Die hielten sich für die Krone der Weinschöpfung. Kurt-Otto Hattemer hatte ihn erst in der vergangenen Woche ganz beiläufig darauf hingewiesen, dass sie ihm ständig in den Ohren lagen. Sie gierten nach seinen Weinbergen und wussten scheinbar genau, wann welcher Pachtvertrag auslief. Er hatte auch zwei schöne Parzellen vom Hattemer, für die er nach der Weinlese einen neuen Vertrag brauchte, wenn er sie behalten wollte. Die Winternheimer bot das Doppelte. Das war eine Unverschämtheit sondergleichen. Man machte sich untereinander nicht in dieser Weise die Parzellen abspenstig. An derlei einfache Regeln hatte sich ihr Vater auch schon nicht gehalten. Sie eiferte ihm nach.
Schön sahen die Trauben aus. Auch im Dämmerlicht konnte man gut erkennen, dass sich die Grauen Burgunder bereits gleichmäßig verfärbt hatten. Sie schimmerten kupferfarben. Die Blätter vor den Trauben waren von Hand entfernt worden, damit die Früchte mehr Sonne abbekamen und besser durchreiften. Das hatte viel Zeit gekostet. Mutter und Tochter sah man fast jeden Tag draußen in ihren Parzellen. Fleißig waren sie, das musste er zugeben.
Alles war in diesem Jahr etwas später dran. In den Jahren zuvor hatten sie Anfang September schon voll in der Lese gestanden. Aber das musste kein Nachteil sein. Die Sonne hatte bereits an Kraft verloren. Die Gefahr, dass die Trauben an heißen Tagen verbrannten, bestand daher nicht mehr. Sie konnten langsamer reifen. In der Kühle der Nacht prägten sich ganz andere Aromen aus. Er freute sich auf das, was sie ernten würden, obwohl noch genug vom alten Jahrgang im Keller lag. Eine Woche noch, dann fingen sie mit den ersten Trauben für die Sektgrundweine an. Es durfte jetzt nur nicht zu viel Niederschläge geben, sonst konnte man den Trauben dabei zusehen, wie sie verfaulten.
Mit einem entspannten Seufzen öffnete Döllinger seine Hose. Den festen Strahl lenkte er gleich darauf über die dichte Front der Trauben vor sich. Eine wärmende Genugtuung breitete sich in seinem Innern aus. Die anderen Kollegen konnten ihm viel an den Hals wünschen. Einschüchtern ließ er sich dadurch nicht. Bei der letzten Runde würde er in voller Beleuchtung an allen vorbei durch das Dorf fahren. Sie sollten sehen, dass er wieder unterwegs war und dass es bei ihm lief. Es war alles gut, wie es war. Und er würde auch mit sechzig weiter dafür kämpfen, dass es so blieb.
2
Das Wetterleuchten erschreckte ihn nicht mehr. Das Gewitter zog weit entfernt vorbei. Ein zaghaftes Flackern erhellte auch jetzt wieder sein Sichtfeld. Er verharrte weiter in der angespannten und gebückten Haltung, auch wenn seine Knie zunehmend schmerzten. Er traute sich nicht, sich zu bewegen.
Das Insekt ließ sich von ihm nicht stören. Erst nach mehreren Lichtblitzen war es ihm im Grün des Reblaubs überhaupt aufgefallen. Es war eine Gottesanbeterin. Da bestand kein Zweifel. Die wärmeren Sommer ließen sie aus dem Süden bis hierher vordringen. Zunächst hatte er sie für einen Zweig gehalten und erst dann ihre charakteristischen Greifarme ausmachen können. Fasziniert behielt er die Stelle im Blick, seitdem der Lärm dieser Idioten ihn zum Innehalten gezwungen hatte. Er wartete auf ein erneutes Aufleuchten, um sie wieder sehen zu können. Sie war nicht allein, daher war sie ihm so groß vorgekommen. Die weiblichen Tiere betrieben sexuellen Kannibalismus. Sie fraßen ihre Geschlechtspartner nach der Paarung auf. Das Exemplar vor ihm hatte den Kopf des Männchens bereits verspeist, noch bevor er die Situation richtig erkannt hatte. Mit jedem Aufflackern konnte er ihren Fortschritt begutachten. Es war jetzt kaum noch etwas von dem übrig, was sie mit ihren dornigen Fangarmen festhielt. Der Verzehr des Partners versorgte das weibliche Insekt mit der notwendigen Energie für die Eiablage. Aus Fortpflanzungssicht musste dem Männchen also sogar daran gelegen sein, dass es von seiner Liebespartnerin aufgefressen wurde. Diese war dann in der Lage, mehr Eier zu legen. Der eigene Tod ermöglichte ein größeres Gelege und versprach zahlreicheren Nachwuchs. Eine verrückte Konstruktion der Natur.
Der Lärm des startenden Traktors ließ ihn zusammenzucken. Er klang nach den Minuten der Ruhe auf einmal viel näher. Reflexhaft duckte er sich noch etwas tiefer, obwohl er wusste, dass es keinen Unterschied machte. Er bildete sich das nur ein. Das Gefährt mit dem beleuchteten Anhänger, der wie ein blinkender Christbaum geschmückt war, befand sich in größerer Nähe zum Dorf als zu ihm. Sie waren vorhin kreischend ganz dicht an ihm vorbeigefahren. Zum Glück parkte sein Wagen zwischen den Bäumen. Dort war er nicht zu sehen.
Die dröhnende Musik und die dumpfen Bässe, die er in seinem Magen hatte spüren können, hatten ihn eine ganze Weile begleitet. Zunächst hatten sie sehr weit entfernt geklungen und sich dann langsam genähert. Es war ihm vorgekommen wie ein vorsichtiges Sichherantasten, bei dem sich die Klänge zwischendurch wieder entfernten. Er hatte erfolglos nach einem System gesucht, bevor es still geworden war. Die fuhren schlicht im Kreis auf allen einigermaßen befestigten Wegen der Gemarkung sinnlos umher. Jetzt sangen sie zur Abwechslung mal wieder. »Er gehört zu mir wie mein Name an der Tür.«
Schneller als zuvor ebbte der Lärm ab. Er war bald nur noch ein Rauschen, bei dem er nicht mehr zwischen dem Motor, ihrem Grölen und seinem in den Adern pulsierenden Blut unterscheiden konnte. An beiden Schläfen rannen ihm Schweißtropfen von der Stirn und suchten sich kitzelnd einen Weg durch die Stoppeln auf seinen Wangen. Einmal noch blickte er in Richtung der Gottesanbeterin, die er gleich darauf im fahlen Lichtblitz erkennen konnte. Zwei starre Hinterbeine waren alles, was vom Partner ihres grausigen Liebesspiels noch übrig war.
Er glaubte, einen sanften Druck unter seinen Schienbeinen zu spüren. Der Körper unter ihm regte sich kaum wahrnehmbar. Für mehr fehlte ihm die Kraft. An seiner Hand auf dem zugepressten Mund fühlte er ein gleichmäßiges, flaches Atmen. Er zögerte, obwohl er längst wusste, dass es keine andere Lösung gab. Zu viel war gesagt worden. Verletzende Worte, die ihn tief getroffen hatten. Die Angst war verweht. Er sah jetzt klar, ganz klar. Alles in ihm spannte sich von Neuem an. Seine Schienbeine drückten auf den Körper unter ihm, der sich benommen aufbäumen wollte. Nur kurz hatte er vorhin überlegt, einfach zu gehen. Eine irrsinnige Vorstellung. Nichts würde mehr so sein wie zuvor. Die Zeit ließ sich nicht zurückdrehen. Er wollte das auch gar nicht. Es war gut, dass er nun alles wusste.
Der Körper kämpfte jetzt fester gegen den Druck an. Er war immer noch keine Gefahr für ihn. Der erste Schlag hatte gesessen. Seine Faust schmerzte seitdem. Vielleicht war sie ein wenig aufgeschürft. Nichts Ernstes. Es musste enden, hier und jetzt. Vorsichtig tastete er mit der freien rechten Hand neben sich über den feuchten Boden. Säuerlich stieß ihm der Wein auf, den er vorhin zum Abendessen getrunken hatte. Das war noch vor alldem gewesen. Den Rest würde er später trinken, wenn es überstanden war. Ob er dann anders schmeckte?
Seine Hand stieß an etwas Hartes. Beim Widerschein eines der Blitze war ihm vorhin der grobe, handgroße Feldstein aufgefallen. Er fühlte sich gut an, jetzt in seiner Hand. Es war ein Klumpen versteinerter Muscheln aus dem Urmeer, das vor Millionen von Jahren alles hier geflutet hatte. Er würde ihm dabei helfen, alles auszulöschen. Nichts würde mehr übrig bleiben von dem, was gesagt worden war. Er tilgte es zur Gänze, so wie die Gottesanbeterin das Männchen restlos verzehrt hatte. Dann blieb nur noch eine Erinnerung. Sein Geheimnis, von dem niemand etwas erfahren würde.
3
Am Tag zuvor
Kurt-Otto Hattemer konnte es förmlich riechen. Vor seinem inneren Augen nahmen die Gegenstände Form und Farbe an. Er schmatzte gehetzt. Sein Herzschlag ging schnell, aber regelmäßig. Zwei dünne Scheiben Brot, dick mit Butter bestrichen, bildeten die Grundlage. Auch sie schienen in freudiger Erwartung zu sein und ihre tragende Rolle herbeizusehnen wie er das Endergebnis all seiner Bemühungen. Gar nicht mehr lange, bis er wieder in diesen Genuss kam. Er bemühte sich, die Bilder, die langsam zu verblassen drohten, weiter leuchtend zu erhalten.
Seine Hand führte er im Laufen nach vorne, als ob sie nach dem Dosenöffner langte. Der lag in der immer etwas unordentlichen Schublade, die sich rechts neben der für das Besteck befand. Dort richtete Renate Messer, Gabeln und Löffel in den ihnen zugedachten Fächern penibel aus. In der Schublade daneben herrschte kultiviertes Chaos. Manchmal musste er seinen Dosenöffner erst unter Suppenkellen, Käsereibe und Knoblauchpresse suchen. Das focht ihn nicht an. Er genoss es geradezu, weil es die Vorfreude noch ein wenig steigerte. Wie in dem Moment, wenn er bewusst kurz innehielt, bevor er das Rädchen in den Deckel drückte. Danach atmete er tief ein, um den ersten feinen Hauch des ersehnten Duftes zu erfassen, der aus der Öffnung entwich. Er konnte es jetzt wirklich riechen.
Die Phantasie war ein Wunderwerk des Gehirns. Erinnerungen genügten, um Bilder heraufzubeschwören, die selbst seine sonst so treffsichere und geschulte Winzernase täuschen konnten. Die guten Gedanken mobilisierten neue Kräfte. Er wusste aber, dass er es zu diesem Zeitpunkt noch nicht übertreiben durfte. Renates mahnende Worte hatte er augenblicklich im Ohr. Er verdrängte sie. Ihre Anwesenheit würde seine wohlschmeckenden Gedanken zerstören. Daher setzte er alles daran, umgehend wieder zu den Bildern von eben zurückzufinden. Es gelang ihm. Vorsichtig und konzentriert drehte er die beiden Kunststoffflügel kontinuierlich weiter. Ein schlürfendes Geräusch gesellte sich zum metallischen Schneiden. Das Rädchen durchtrennte den feinen Gallertring, der sich um die feste Bratwurstmasse im Inneren der Wurstdose schmiegte. Kurt-Otto schloss für einen Moment die Augen, um das alles noch deutlicher verfolgen zu können.
Schnell riss er sie aber wieder auf. Das war zu gefährlich, was er hier tat. Wie sollte er später glaubhaft darlegen, dass er auf ebener Strecke über die eigenen Füße gestolpert war? Das Schönste kam jetzt gleich. Das scharfe Rädchen näherte sich im großen Rund der Fünfhundert-Gramm-Dose seinem Ausgangspunkt. Es war ein magischer Moment, den er zelebrierte. Wie von Geisterhand hob sich ganz am Ende der Deckel langsam in die Höhe und gab den vollen Geruch der eingemachten Bratwurst frei. Es war die Würze in ihrer Gesamtheit, aber auch ihrer Einzelelemente, die sich nun offenbarte. Er wusste, womit sein Lieblingsmetzger aus dem Nachbardorf ihn verwöhnte. Die zarte Note von Majoran, die es in einer guten Dosenbratwurst brauchte, wurde von einem Hauch Muskat und ein wenig Pfeffer umspielt und sonst nichts. Kurt-Otto atmete durch den Mund. Er war da ganz Purist.
So, wie seine liebe Renate auf alles Mögliche achtete, was die ihrer Ansicht nach richtige Ernährung betraf, wollte er seine Dosenwurst für das Butterbrot ohne sonstige Zusätze, die nur den Geschmack verfälschten oder für ein überladenes Grundaroma sorgten. Beseelt kaute er vor sich hin, ohne dass auch nur eine winzige Aussicht auf eine umgehende Befriedigung seiner Sehnsüchte bestand. Er seufzte melancholisch in die Kühle dieses Morgens, der auf eine Nacht mit starken Gewittern und heftigen Niederschlägen gefolgt war.
Kurt-Otto Hattemer war Winzer im Ruhestand und siebenundsechzig Jahre alt. Seinem Körper sah man die gute Pflege mit zünftiger Hausmannskost an. Üppige Rundungen waren formvollendet ausgeführt. Auch wenn es nicht immer seine liebe Frau Renate war, die für die nötige Versorgung alles unternahm. Jahrzehnte ihres Ehelebens glichen für ihn im Rückblick einem Hase-und-Igel-Spiel. Zog er einen Strich darunter und bewertete einigermaßen objektiv, dann stand es bestenfalls unentschieden, mit leichtem Vorteil für seine Frau.
Wo hatte er nicht überall Depots und Basislager zur ausreichenden Versorgung in Notfällen angelegt? Renate überkamen in unregelmäßiger Abfolge wahnwitzige Launen, die alle darauf abzielten, seine Ernährungsgewohnheiten fürsorglich zu lenken oder direkt auf den Kopf zu stellen. Sie meinte es stets gut mit ihm, zumindest in den allermeisten Fällen. Eine gehörige Portion Fundamentalismus inklusive. Dabei entwickelte sie nicht selten ein Gespür für seine Geheimverstecke, das selbst einem Drogensuchhund des Zolls zu höchsten Meriten verholfen hätte. Ob stillgelegte Fässer in seinem Keller, die Weinpresse oder verschiedene Werkzeugkästen, Renate hatte mit ihrer schier grenzenlosen Beharrlichkeit noch jedes Versteck enttarnt.
Er schüttelte im Laufen ungläubig den Kopf. Die aktuelle Situation erschien ihm selbst nicht immer greifbar und real. Und dann musste er auch noch die Häme und den Spott der lieben Winzerkollegen ertragen. Wie gern sie sich doch über seine nur von kurzfristigen Erfolgen begleiteten Versuche der ausreichenden Bevorratung für Notsituationen ereiferten. Keiner von denen hatte eine Gattin, die einem in dieser Hinsicht so viel abverlangte. Sie konnten also gut lachen über ihn. Kurt-Otto schoss bei diesem Gedanken immer sofort die Zornesröte ins Gesicht. Aus blanker Angst vor dem Verhungern in der Fastenzeit und Renates dünnen Gemüsebrühen, die ihn bis Ostern in Form bringen sollten, hatte er vor zwei Jahren seinen im Rückblick schwersten Fehler begangen. Alle bisherigen Verstecke waren damals verbrannt gewesen. Die Monate waren vergangen, ohne dass sich neue Möglichkeiten auftaten. In seinem Werkzeugkasten stauten sich bereits die Vorräte, die er bei seinen Einkaufstouren mit dem Schlepper über die Nachbardörfer zusammengetragen hatte. Unverdächtige Kleinstmengen, die neugierige Landfrauen, die seine Gattin gut kannten, oder Kolleginnen von ihr aus dem Nieder-Olmer Gymnasium übersahen.
Die Erfahrung hatte ihn gelehrt, wie man im Lebensmittelhandel unauffällig und unterhalb des Radars einkaufen konnte. Die Landfrauen kannte er. Es waren die Gattinnen seiner Winzerkollegen. Er erkannte sie, woran auch immer. Ihnen konnte er in den meisten Fällen ausweichen. Beim Lehrerkollegium hatte er nie einen richtigen Überblick. Es waren schlicht zu viele, sie wechselten ständig, und alle schienen ihn zu kennen. In besonders dunklen Momenten seines Daseins, in denen er Hunger litt und Renate auch noch beteuerte, dass dieser Zustand gesund sei, glaubte er, dass im Lehrerzimmer ein großformatiges Foto von ihm hing: »Bitte melden Sie sich umgehend, wenn Sie diesem Mann bei Einkäufen in Metzgereien im Großraum Mainz begegnen. Merkmale: Haupthaar licht und mutig quer gelegt; zumeist in Latzhose anzutreffen, die über dem Bauch deutlich spannt; Traktor parkt direkt vor der Metzgerei.«
Damals an Fastnacht hatte er sich dazu hinreißen lassen, einen Großteil der Dosen bei einer Rundfahrt durch die Weinberge an besonders markanten Rebstöcken zu verscharren. Nur einen Teil davon hatte er aber in den Wochen danach wiedergefunden. Es war wie mit den Nüssen, die Eichhörnchen vergruben. Der Teil, den sie wiederfanden, reichte, um den Winter zu überstehen. So war es ihm auch ergangen. Er hatte bis Ostern überlebt. Für die kleinen Tiere war die Sache damit erledigt. Für ihn nicht. Im Unterschied zu den flinken Nagern hatte er Kollegen, die sich an seinem Leid weideten. Berthold Baumann stach besonders heraus. Er musste ihn damals bei der Auswahl und Bestückung der Lagerstätten beobachtet und detaillierte Notizen angefertigt haben. Anders war es nicht zu erklären, dass er ihn in den Sommermonaten jedes Mal, wenn sie sich im Weinberg begegneten, auf die eine oder andere Stelle hinwies, an der eventuell noch eine vergessene Dose zu heben sein könnte. Später präsentierte er ihm hin und wieder ein verbeultes oder aufgequollenes Exemplar. Erst kürzlich hatte er wieder von seinem Traktor herunter gegrüßt und ihm dabei kauend eine erdverschmierte Blechdose entgegengehalten.
All das wäre ihm erspart geblieben, wenn er und Renate sich schon früher auf einen gangbaren Mittelweg geeinigt hätten. Für ihren Kompromiss hatten sie fast vierzig Ehejahre gebraucht.
Das Wasser des letzten Regenschauers spritzte unter seinen Füßen zur Seite. Er erschrak dabei und starrte den schmalen Weg entlang. Renate war nicht mehr zu sehen. Das war besser so. Er durfte jetzt essen, so viel er wollte. Das war ihr Teil der Abmachung und ein riesiger Schritt des Entgegenkommens. Er testete die Grenzen regelmäßig und genüsslich aus, nachher beim Frühstück auch wieder. Die große Dose stand schon im Kühlschrank bereit. Er hatte einen Mordshunger. Sein Magen knurrte zustimmend. Renate hielt sich an ihre Absprache. Sie zog höchstens die linke Augenbraue etwas in die Höhe, wenn er auf den beiden Brotscheiben mehrere Lagen Dosenbratwurst auftürmte. Konzentriert rieb sie dann weiter einen Apfel in ihr Quellmüsli, dessen Hauptbestandteile sie abends in lauwarmem Wasser einweichte. Das Schüsselchen stellte sie vor dem Schlafengehen demonstrativ neben seine Wurstdose. Damit waren die Fronten seither geklärt und der Hausfrieden wiederhergestellt.
Kurt-Otto wusste, dass das nur die halbe Wahrheit war. Er konnte den Frauen der Winzerkollegen nun zwar freundlich und entspannt zuwinken, wenn er mit einem halben Dutzend Wurstdosen und einem Ring Mainzer Fleischwurst aus der Metzgerei kam. Ein Kompromiss bestand aber stets aus beidseitigen Zugeständnissen. Er hatte sich von Renate striktes Stillschweigen für seines ausbedungen. Das hatte sie vom ersten Tag an, seit sie zusammen liefen, respektiert. Das war Ende Januar gewesen. Seine Latzhose war am Bauch gerissen. Mit dem Hinweis auf Materialermüdung und schlechte Verarbeitung hatte er sie ihr zum Flicken hingelegt. Am nächsten Tag gab es Gemüsebratlinge, gedünsteten Brokkoli und einen Termin bei einem Mediator, bei dem Renate, über die Schule organisiert, seit einiger Zeit eine Fortbildung absolvierte. Den Besuch hatte er mit dem Zugeständnis von zusätzlicher Bewegung hinausschieben können. Nach einigem Hin und Her hatten sie selbstständig ihren Kompromiss gefunden, den er noch um ein paar für ihn lebenswichtige Details erweitern konnte. Sie liefen an drei Tagen in der Woche morgens zunächst fünf, später sieben und inzwischen fast zehn Kilometer. Dafür durfte er essen, was und so viel er wollte. Sie machte keine Witze mehr über seine geliebte Dosenwurst. Er zwängte sich in sportliche Fitnesskleidung, dafür gingen sie nie in der Nähe joggen. Die Weinberge im Selztal waren tabu, der Ober-Olmer Wald auch. Er wollte auf gar keinen Fall von den lieben Kollegen gesehen werden, zumindest nicht am Anfang und solange seine Bemühungen noch wie ein Kampf um jeden Meter aussahen. Wiederkehrende blöde Sprüche wie die von Baumann zu den vergrabenen Dosen brauchte er nicht. Dass sie seine Frau Renn-ate nannten, wusste er seit Langem. Er verspürte wenig Lust darauf, in Zukunft als Renn-Otto in den Dorf- und Kneipengesprächen Erwähnung zu finden.
Seiner Frau gegenüber beharrte er auch jetzt noch, Anfang September und mehr als ein halbes Jahr später, eisern darauf, dass ihm das Hinter-ihr-Herhecheln keinen Spaß mache. Er wollte ihr diesen Sieg nicht gönnen. Insgeheim gestand er sich jedoch ein, dass ihm etwas fehlte, wenn sie, was selten vorkam, einen ihrer frühmorgendlichen Läufe auslassen mussten. Selbst sein Körper schien sich daran gewöhnt zu haben. Das hätte er nie für möglich gehalten.
Eines jedoch würde sich nie ändern: Er trottete weiterhin mit großem Abstand hinter seiner Frau her. Damit war er im Mainzer Lennebergwald eine absolute Ausnahme. Meistens war es andersherum: Abgehetzte Frauen mit glühendem Schädel folgten in großem Abstand ihren enteilten Männern. Aber Renate lief ihr eigenes Tempo, das für ihn unerreichbar bleiben würde.
Kurt-Otto bedauerte, so weit von den angenehmen Gedanken an ein reichhaltiges Frühstück abgekommen zu sein. Er bemühte sich vergeblich, die Bilder wieder zum Leben zu erwecken. Die Tür dorthin blieb verschlossen. Weit war es sowieso nicht mehr. Er riss sich kurz die Kappe vom Kopf, die er gerne tief ins Gesicht gezogen trug. Diese Tarnung hatte ihn schon mehrmals gerettet. Er rieb sich den Schweiß aus den Augen und von der kahlen Stirn. Erst als er auf seinem Kopf wieder alles gerichtet hatte, fiel ihm das drahtige Männchen auf, das direkt auf ihn zusteuerte und ihm sehr bekannt vorkam. Es lagen nur noch wenige Meter zwischen ihnen. Rasch setzte er die Kappe wieder auf.
Der andere schien ihn noch nicht bemerkt zu haben. Kurt-Otto drehte seinen Kopf zur Seite. Sein Puls beschleunigte sich sprunghaft, am Tempo lag das jedoch nicht. Er war schon fast an ihm vorbei, als er die Blicke des Mannes auf sich spürte. Große Augen starrten ihn verdutzt an.
Auf das freundliche »Guten Morgen« seines Winzerkollegen Klaus Dörrhof reagierte er nicht. An dessen weißen Haaren, die einen leichten Stich ins Dottergelbe aufwiesen, hatte er ihn erkannt. Auch Dörrhof trug seine Kappe mit dem Emblem eines internationalen Pflanzenschutzherstellers bis fast über die Augen gezogen.
Kurt-Otto hatte das Gefühl, dass noch mehr kalter Schweiß seinen Nacken hinunterlief. Er konnte hören, wie Dörrhofs Schritte zuerst langsamer wurden, dann schien der Kollege stehen zu bleiben, um sich auf dem knirschenden Boden des Waldweges umzudrehen. Kurt-Otto sprang wie ein aufgescheuchter Feldhase vom Weg ins nahe Unterholz. Um nicht erkannt zu werden, drückte er sich kraft seiner Körpermasse durch die immer dichter werdenden Zweige und dürren Äste der Hecken und niedrigen Bäumchen. Dornen zerrten an seiner dünnen Laufjacke aus atmungsaktivem Spezialmaterial. Renate würde ihn zur Strafe bis nach Hause laufen lassen, wenn sie das hier sah. Trotzdem stürzte er weiter. Ein Zweig fuhr ihm durchs Gesicht. Seine Kappe bekam er gerade noch zu fassen und drückte sie zurück auf den dröhnenden Schädel. Jetzt erst traute er sich, einen gehetzten Blick zurückzuwerfen. Das war idiotisch. Selbst wenn Dörrhof ihn erkannt haben sollte, wovon Kurt-Otto nicht restlos überzeugt war, würde er kaum die Verfolgung aufnehmen. Er behielt trotzdem sein Tempo bei, preschte durch das Laub am Boden, das wild zur Seite stob, und im Slalom um die jetzt in lockerer Entfernung stehenden dicken Bäume. Der nächste Querweg war in Sicht. Kurt-Otto erklomm mit ein paar schnellen Schritten die flache Böschung und stellte fest, dass er sich kurz vor Schluss ein gutes Stück vor Renate wieder einreihen würde. Das trieb ihn zusätzlich an.
Es waren nur noch ein paar hundert Meter bis zu dem kleinen Parkplatz, den er gerne ansteuerte, weil dort kaum Autos standen. Er lag in der Nähe des schon seit Langem geschlossenen Ausflugslokals »Rotkäppchen«, das in den Achtzigern ein von der Mainzer guten Gesellschaft ausgiebig frequentiertes Bordell beherbergt hatte. Kurt-Otto schnaufte wie eine alte Dampflok. Die Sohlen seiner Schuhe schlugen klatschend auf den noch regennassen Schotter. Sein Herz hämmerte wie eine Weinpumpe kurz vor der Explosion. Hinter sich hörte er Renate. Ihre gleichmäßigen, schnell gesetzten Schritte. Ähnlich dem Rattern einer Nähmaschine. Er wusste, dass sie ihn auf den letzten Metern bis zum Auto noch einholen konnte. Es wär ein Leichtes für sie gewesen. Er war sich aber sicher, dass sie ihm aus pädagogischen Gründen den kleinen Sieg lassen würde. Sie wollte doch auch, dass er mit einem guten Gefühl in die Herausforderungen des kommenden Wochenendes ging.
4
Der Wasserhahn lief. Ein feiner Dunst waberte durch den Raum. Er lauschte dem Rauschen und sah zu, wie der Nebel dichter wurde. Ihm fehlte die Kraft, sich vom Rand der Badewanne zu erheben und die wenigen Schritte bis zum Doppelwaschbecken zu gehen. Der hellbraune Fliesenspiegel war jetzt nur noch zu erahnen. Hans-Georg Algesheimer rieb sich über die noch nachtmüden Augen. Solange das Wasser lief, ließen sie ihn in Ruhe. Ewig würde er diesen Zustand aber nicht in die Länge ziehen können. Irgendwann würde seine Tochter Kerstin vorsichtig an die Tür seines Badezimmers klopfen.
Der Gedanke an ihre Fürsorge wärmte ihn und drängte die Melancholie ein wenig beiseite. Sie meinten es ja alle gut mit ihm, und Kerstin ganz besonders. Er fuhr sich mit den knochigen Fingern, denen man das lange, arbeitsreiche Leben ansah, durch die noch immer sehr dichten schneeweißen Haare. Wie von ihr verlangt war er gestern zum Friseur gegangen. Er widersprach ihr in solchen Dingen nicht. Sie erinnerte ihn an seine Frau, wenn sie hartnäckig an derlei Ritualen festhielt. Karin, die ihn vor fünf Jahren viel zu früh verlassen hatte, war in dieser Hinsicht ebenso unnachgiebig gewesen. Er spürte, wie sich seine Augen mit Tränen füllten. Er konnte das nicht verhindern. Sie fehlte ihm. Ihr Tod hatte eine Lücke hinterlassen, die nichts und niemand zu füllen vermochte. Kitzelnd rannen die Tränen über sein von der Sonne gegerbtes, faltiges Gesicht.
Als Kerstin im Frühling ohne Vorankündigung mit ihrer sechzehnjährigen Tochter Lena, einem Koffer und verheulten Augen bei ihm auf dem Hof erschienen war, hatte er sie natürlich aufgenommen, sich zunächst aber vehement dagegen gesträubt, dass sich die beiden im Weingut häuslich einrichteten. Der Bruch mit Fred, ihrem Mann, kam einer Schmach gleich. Das hatte es bei ihnen in der Familie noch nie gegeben. Was würden die Leute im Dorf dazu sagen, dass sie ihn verlassen hatte? Die zerrissen sich das Maul über sie. Die Ehe war ein Bund fürs Leben, den man vor Gott und der Gemeinde einging und den man nicht aufkündigen durfte.
Er hatte Kerstin zurück zu ihm nach Mainz zwingen wollen. Die Drohungen und der Druck waren an ihr abgeperlt; ihren Trotz hatte das nur verstärkt. Sie war schon als Kind klar in ihren Entscheidungen gewesen und selten vom Gegenteil zu überzeugen. Kerstin wollte nicht erzählen, was vorgefallen war. Fred war alles in allem ein ganz sympathischer Schwiegersohn gewesen. Auch wenn er bis heute nicht verstand, warum man nach einem Studium seinen Lebensunterhalt als Tennislehrer bestreiten musste. Immerhin verdiente er mit seinen Privatstunden für die Söhne und Töchter der wohlhabenden Mainzer Schickeria so viel, dass sie sich ein schönes Haus auf den Gonsbachterrassen hatten kaufen können. Kerstin hatte ihm versichert, dass sie ihr Erbe dafür nicht hatte antasten müssen.
Mittlerweile war er froh darüber, sie hier zu haben. Auf dem Hof war genug Platz für alle, so viel sogar, dass man sich aus dem Weg gehen konnte, wenn man das wollte. Eigentlich war das Gehöft erst durch Kerstins Rückkehr wieder vollständig bewohnt. Davor hatte der rechte Flügel des prächtigen Haupthauses mit dem Walmdach aus dunklem Schiefer leer gestanden. Im linken wohnte sein jüngster Sohn Jörn mit seiner Frau Marie. Jörn war der Winzer auf dem Hof. Seine Frau arbeitete als Erzieherin im Mainzer Vorort Finthen. Ein Kind hatten sie noch nicht. Jörn war schon Anfang vierzig, Marie aber deutlich jünger. Es bestand also noch Hoffnung.
Das Gutshaus und die im Karree darum herum angeordneten Wirtschaftsgebäude, die all das beinhalteten, was man für einen stattlichen Weinbaubetrieb benötigte, waren zu Beginn des 18. Jahrhunderts errichtet worden. Eine Generation später hatte einer ihrer Vorfahren das Gehöft und die dazugehörigen Rebhänge gekauft. Man musste kein Ahnenforscher sein, um zu wissen, welchen Namen er getragen hatte. Bis seine Frau bei den eigenen Kindern eingeschritten war, hatten über fünfhundert Jahre und siebzehn Generationen hinweg alle erstgeborenen männlichen Nachkommen der Familie den immer gleichen Vornamen gehabt. Lediglich Spielarten schienen erlaubt gewesen zu sein, also Johann-Georg, Johannes-Georg oder eben Hans-Georg. Zur besseren Orientierung oder zusätzlichen Verwirrung hatte man die Träger identischer Vornamen durchnummeriert. Er war also genau genommen Hans-Georg IV. Aber damit war es vorbei, und er glaubte nicht einmal, dass seine drei Kinder noch von dieser Tradition wussten.
Der große Hof, in dem man bequem mit jedem Fuhrwerk und Anhängern im Kreis fahren konnte, sowie die mächtigen Scheunen, die ihn begrenzten und nun die Kelter- und Lagerräume sowie die gerade erst modernisierte Vinothek beherbergten, unterstrichen, dass ihre Familie über unzählige Generationen hinweg an der Spitze der dörflichen Oberschicht gestanden hatte. Wer im Hofgut St. Bertha im Ortsmittelpunkt das Sagen hatte, der bestimmte mit wenigen anderen im Dorf, wo es langging. Eine Position, die sich jede Generation aufs Neue erarbeiten und bewahren musste. Am Größten orientierten sich alle anderen, aber dieselben lauerten auch auf seine Fehler. Wie die Geier nutzten sie jede Schwäche und schlugen gnadenlos zu, wenn sich eine Generation nur so dahinschleppte. Die Schwachen überlebten nicht. Er konnte die Beispiele aus den letzten fünfzig Jahren im Halbschlaf benennen, und er hatte es immer vorausgesehen. Stattliche Güter waren es gewesen, über Generationen aufgebaut, die sich gegen Widrigkeiten und Schicksalsschläge behauptet hatten. Bei manchen hatte dann nur ein einziges Jahrzehnt der Schwäche ausgereicht. Müde geworden, bequem und von oben herab, waren sie zugrunde gegangen.
Auch einige ihrer eigenen Weinberge entstammten den hitzigen und gierigen Auseinandersetzungen, die aufbrandeten, wenn einer der anderen zerlegt wurde und wenig später nur noch eine trübe und schnell verblassende Erinnerung von ihm übrig blieb. Den letzten Rest tilgten zumeist die Bauträger aus Mainz oder Ingelheim. Sie rissen die jahrhundertealten Gebäude ab und verdichteten das Gelände nach. Ein brutaler Euphemismus, der nichts anderes besagte, als dass auf der freigeräumten, klaffenden Wunde im Dorf wuchtige Baukörper ohne Angesicht, aber mit Tiefgarage entstanden, die in Einzelteilen als Eigentumswohnungen wieder verschachert wurden. Nach Ablauf der Gewährleistung platzten die ersten Wasserleitungen. Die Fassade offenbarte meist schon davor, dass die Bauten nur für das Jetzt errichtet worden waren. Mit etwas Glück würde sich vielleicht noch die nächste Generation daran erfreuen können. Das glaubte er aber nicht.
Derlei Gedanken hatten ihn schon immer umgetrieben. Jetzt ließen sie ihn kaum noch los. Es lag also nicht nur am heutigen Tag. Seinen Vorfahren musste es genauso ergangen sein, als sie alt geworden waren. Die Sorge gehörte zu diesem letzten Lebensabschnitt zwangsläufig dazu, denn erfolgreich zu sein bedeutete auch, die Weichen für danach richtig gestellt zu haben. Der Druck lastete auf seinen Schultern. Er spürte ihn fast täglich. Heute schmerzte er ganz besonders. Sein ganzes Leben lang hatte er Entscheidungen von großer Tragweite getroffen, und nie war ihm das sonderlich schwergefallen. Er hatte nichts hinausgeschoben. Klug abzuwägen, um dann ein Urteil zu fällen, diese Fähigkeit schien ihm nun abhandengekommen zu sein. Er haderte mit allem und stellte selbst klare Voten wieder in Frage.
Er schüttelte den Kopf im Dampf des rauschenden heißen Wassers. Ob es seinem Vater und Großvater auch so gegangen war? Er fand keine Antwort auf diese Frage. Mühsam drückte er sich in die Höhe. Seine Beine schienen eingeschlafen zu sein. Unzählige spitze Nadeln stachen in seine Füße. Er schlurfte gebeugt durch den Dunst auf den Hahn zu. Von den braunen Fliesen rann in Strömen das Kondenswasser. Er stützte sich auf den Rand des Waschbeckens und suchte sein Gesicht im beschlagenen Spiegel. Noch einen Moment brauchte er, um sich ganz aufzurichten.
Die Männer in ihrer Familie waren alle groß gewachsen. Seine Frau Karin hatte ihm nicht mal bis zu den Schultern gereicht. Er hatte noch ihr Lachen in den Ohren. Das Lachen vor ihrem ersten Kuss nach dem Tanz auf der Kirchweih. Er hatte sie nach Hause gebracht, und sie standen zusammen, erhitzt, weil er durch ihren ständigen Aufenthalt auf der Tanzfläche verhindert hatte, dass einer der anderen auch nur einen einzigen Tanz mit ihr bekam. Sie hatte gelacht, weil sie sich auf die Zehenspitzen stellen und hochrecken musste, während er sich zu ihr hinabbeugte, damit ihre Lippen überhaupt zueinanderfinden konnten. Die kleine Karin mit den großen Weinbergen. So hatten sie sie damals genannt, und er hatte sie gewollt und bekommen. Jetzt lag sie schon seit fünf Jahren auf dem Kirchhof. Wenn sie ihn ließen, würde er sie nachher besuchen. Das gehörte auch zu diesem Tag.
»Vater? Ist bei dir alles in Ordnung? Sie warten schon auf dich.«
Er hörte den zarten Vorwurf in Kerstins Stimme. Die Müdigkeit war wieder da. Sie quälte ihn seit Monaten. War das normal? Er beantwortete sich seine Frage umgehend selbst. Der Großvater hatte bis weit in seine Neunziger mit angepackt. Als »zäh wie Juchte« hatte man ihn bezeichnet. Er hatte gemusst, weil der Sohn versehrt aus Russland zurückgekommen war. Hans-Georgs Vater waren vor Moskau zuerst die Füße und dann auch noch ein Teil der Finger abgefroren. Vor den Stümpfen der Füße hatte er sich als Kind geekelt. Der Vater brauchte damals die Hilfe. Der Großvater hielt daher so lange durch, bis sein Enkel groß und stark genug war, um das Zepter zu übernehmen. Ein Betrieb war nämlich nur so gut wie der, der vorneweg arbeitete.