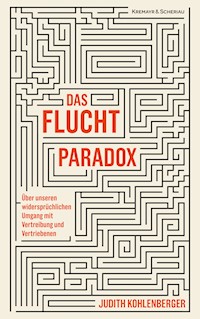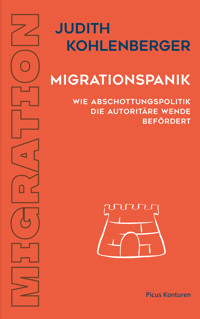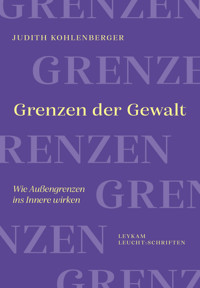Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Kremayr & Scheriau
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: übermorgen
- Sprache: Deutsch
Wir. Wie leicht uns dieses Wort über die Lippen kommt. Wir sind ein Paar, wir sind eine Familie, wir sind Freunde, wir sind eine Gemeinschaft, wir sind eine Nation. Wir sind nicht die Anderen. Oder? Judith Kohlenberger sieht genau hin: Wer ist das Wir in welchem Kontext? Welches Wir wählen wir selbst, welches wird uns zugeschrieben durch Herkunft, Beruf, Status? Wann wird das Wir zu einem Werkzeug der Ausgrenzung? Und wie beschreiten wir den Weg hin zu einem inklusiveren Wir? Dieser klarsichtige Essay räumt auf mit der Annahme, dass das von der Politik vielbeschworene und instrumentalisierte Wir selbstverständlich und festgeschrieben ist. Es ist vielmehr flüchtig, schwer fassbar, wandelbar – und ein ständiger Streit, den es auszuhalten gilt. Judith Kohlenberger plädiert in klaren Worten und mit Feingefühl für ein starkes, wagemutiges Wir, das Wachstumsschmerzen nicht scheut, das Unterschiede als Chance auf Weiterentwicklung und echte Teilhabe begreift.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 74
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wir
Judith Kohlenberger
Inhalt
Vorwort
Wer ist Wir?
Privilegien erkennen
Reject your privilege
Wachstumsschmerzen aushalten
Abgrenzen, aber nicht abwerten
Ausgrenzung schadet allen, nicht nur den Ausgegrenzten
Vorurteile reflektieren
Warum Wir?
Anmerkungen
füruns
We know what we are,but know not what we may be.
(William Shakespeare, Hamlet, 4. Akt, 5. Szene)
Die Anthropologin Margaret Mead wurde von einer Studierenden gefragt, was sie als erstes Zeichen für Zivilisation in einer Kultur betrachte.
Meads Antwort war, dass das erste Zeichen für Zivilisation ein gebrochenes und wieder zusammengeheiltes Femur (lat. für Oberschenkelknochen) sei. Sie erklärte, dass man im Tierreich stirbt, wenn man sich ein Bein bricht. Man kann weder vor Gefahren davonlaufen noch zum Fluss gehen, um etwas zu trinken, oder nach Nahrung suchen. Für herumstreifende Raubtiere ist man leichte Beute. Kein Tier überlebt lange genug, damit ein gebrochener Knochen heilen kann. Ein wieder verheiltes Femur sei ein Beweis dafür, dass sich jemand Zeit für den Verletzten genommen, seine Wunde verbunden, ihn in Sicherheit gebracht und bis zur Genesung gepflegt hat. Jemand anderem durch Schwierigkeiten zu helfen und beizustehen, ist der Beginn der Zivilisation. Wir sind am besten, wenn wir für andere da sind. Seid zivilisiert.
Ira Byock. The Best Care Possible: A Physician’s Quest to Transform Care Through the End of Life (2012). Eigene Übersetzung.
Vorwort
Dieses Buch wurde während des ersten Corona-Lock-downs im März und April 2020 verfasst. Selten wurde so oft ans „Wir“ appelliert wie in diesen außergewöhnlichen und herausfordernden Zeiten. In nahezu täglichen Pressekonferenzen, Liveschaltungen ins Bundeskanzleramt und Video-Sprechstunden riefen Bundeskanzler, Vizekanzler und die Minister*innenriege zu Einheit und Solidarität auf: „Jetzt müssen wir zusammenhalten!“, „Gemeinsam schaffen wir das!“, „Wir bleiben zuhause!“, „Wir lassen niemanden zurück!“ Die Liste an Stehsätzen zur Einschwörung der Bevölkerung auf den ultimativen Zusammenhalt ließe sich noch lange fortsetzen.
Die kontinuierliche An- und Ausrufung eines nationalen Schulterschlusses verdeutlichte bei näherer Betrachtung aber rasch, dass das inflationäre Wir nicht nur Einheit schaffen, sondern auch Spaltung erzeugen kann. Mitunter waren unter dem vermeintlich allumfassenden Wir nur ganz bestimmte Adressat*innen gemeint: Der Bundeskanzler wandte sich in seinen Ansprachen beharrlich an die „Österreicherinnen und Österreicher“ und klammerte so, bewusst oder unbewusst, die 1,4 Millionen in Österreich lebenden Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft aus. Die Ausgangsbeschränkungen schienen mit dem Bild einer sehr eng definierten Bevölkerungsgruppe im Hinterkopf verfasst worden zu sein, wie auch ihre Kommunikation in einer breit angelegten Infokampagne zeigte. Zu sehen war die klassische, gutbürgerliche Kernfamilie – Vater, Mutter, maximal zwei Kinder – in großzügigen Wohnlandschaften in sanften Weiß- und Beigetönen. Die Teenagertochter vorm eigenen Laptop, der kleine Sohn hilft der Mama artig beim Backen, Papa liest ein gutes Buch. Das hier dargestellte Wir war häuslich, wertkonservativ, weiß und sauber, mittelständisch, in jedem Sinne aufgeräumt und geordnet. Die Lebenssituation von Einpersonenhaushalten, Patchworkfamilien, alternativen Lebensund Familienformen und prekären Wohnsituationen wurde aus diesem scharf begrenzten Wir geflissentlich ausgeklammert.
Die Krise verengte also den Blick, führte aber gleichzeitig vor Augen, wer schon lange vor COVID-19 systematisch vom Wir ausgeschlossen blieb: Geflüchtete, Menschen mit nichtösterreichischer Staatsbürgerschaft, undokumentierte Migrant*innen, persons of color – in Österreich sind das oft Menschen, die eben nicht der bürgerlichen Mittelschicht angehören. 47 Prozent der Ausländer*innen und 43 Prozent der Menschen mit Migrationshintergrund sind als Arbeiter*innen tätig, das sind in etwa doppelt so viele wie Menschen ohne Migrationshintergrund.1 Herkunft und sozioökonomischer Stand sind somit oft eng miteinander verschränkt. Von der Corona-Krise waren diese Menschen als Systemerhalter*innen disproportional stark betroffen, gleichzeitig aber auch anhaltender Diskriminierung aufgesetzt und häufig von medizinischer Behandlung ausgeschlossen. Nicht nur in Zeiten einer Pandemie entscheidet die Zugehörigkeit zum Wir über Leben oder Tod.
Die Absicht dieses Buches ist, seinen Leser*innen die Bestärkung zu geben, dass ein anderes Wir möglich ist. Ein Wir, das niemanden zurücklässt. Ein Wir, das nicht auf Ausgrenzung oder Abwertung beruht, sondern auf Miteinander und Füreinander, das aber die vielen Diskussionen, Debatten bis hin zu offen ausgetragenen Konflikten, die eben jede Form der menschlichen Beziehung mit sich bringt, nicht ausklammert, negiert oder als Beweis für das Scheitern dieses Miteinanders versteht. Ein Wir, das sich im ständigen Zusammenwachsen und Zusammenraufen befindet und die damit verbundenen Schmerzen wahr- und ernst nimmt. Denn dem Wir, das dieses Buch imaginieren will, soll es nicht ums vielzitierte und noch öfter kritisierte „Gleichmachen“ gehen, ganz im Gegenteil: Die Abgrenzung vom und zum anderen ist ein psychologisches wie soziales Grundbedürfnis, mitunter sogar ein epidemiologisches. Es ist ein Wir, in dem auch das Du und das Ich Platz haben.
Um an solch einem neuen Wir zu arbeiten, braucht es eine gemeinsame Vision, wie dieses aussehen soll. Diese Vision kann nur gemeinsam erdacht, erarbeitet und erstritten werden. Eine erste Inspiration dafür mögen vielleicht die folgenden Seiten geben.
Wer ist Wir?
Lassen Sie mich gleich vorweg mit dem Paradoxen beginnen: Das Wir gibt es nicht. Es existiert schlichtweg nicht. Klar, jede und jeder von uns existiert, aber eben als Individuum, nicht in der Summe. Egal wie viel man mit anderen gemeinsam hat, wie viel uns verbindet, welche Merkmale man teilt – es gibt immer etwas, was uns vom anderen unterscheidet. Politiker*innen können noch so oft ans Wir appellieren, keiner wird dadurch mit einem anderen verschmelzen. Das Du und das Ich lassen sich benennen, aufrufen, auf der Straße ansprechen, durch Namen appellieren, in der materiellen Welt anschauen und angreifen. Das Wir dagegen bleibt flüchtig, schwer fassbar, wandel- und undefinierbar.
Gleichzeitig gibt es ganz viele ungreifbare Wirs. Das kleinste Wir sind zwei Menschen, die sich als Einheit begreifen, etwa in einer Paarbeziehung oder einer Freundschaft, aber auch als Team im beruflichen Kontext. Ein Wir erlebt man tagtäglich als Teil einer Gemeinschaft, sei es als Familie, als Verwandtschaft oder Sippschaft, als Clique oder Sportteam, als Abteilung oder Organisation, als Verein oder Versammlung, als WhatsApp-Gruppe oder Freundesrudel, als Dorfgemeinschaft, Bezirks- und Landesangehörige*r und nicht zuletzt als Bürger*in in einem Staatswesen, in dem man natürlich nicht jedes andere Mitglied des Wir persönlich kennen oder gar mögen muss, um sich dennoch als Teil eines Gemeinsamen zu fühlen.
Der Politikwissenschaftler Benedict Anderson bezeichnete diese letztere Version des Wir als „imagined community“.2 Eine Nation sei das Paradebeispiel einer solchen sozial konstruierten Gemeinschaft, an die all jene, die sich dieser Nation zugehörig fühlen, glauben, auch wenn sie sich ihr ganzes Leben lang nie persönlich treffen, austauschen oder etwas tatsächlich Gemeinsames schaffen können. Um das Wir als diese Art der „imaginierten Gemeinschaft“ zu begreifen, brauchen wir eine minimale Vereinheitlichung, eine Art kleinsten gemeinsamen Nenner, etwas, was uns vereint. Im Falle der Nation ist das rein formal unser Reisepass, also die Staatsbürgerschaft, aber auf der wesentlich wichtigeren emotionalen Ebene sind es vor allem vermeintlich geteilte Werte, Ansichten, Interessen, Einstellungen, Mentalitäten, Eigenschaften und Erfahrungen.
Genau das verdeutlicht bereits einen der Fallstricke in der landläufigen Wahrnehmung des Wir. Das Wir ist nie homogen, auch wenn manche dieser Wirs gerne den Anschein erwecken, sie wären es. Das Idyll einer absoluten Gleichheit ist so verführerisch wie trügerisch. Nun gibt es natürlich bestimmte Merkmale, die jedes Mitglied eines Wir teilt (zum Beispiel den gleichen Nachnamen, das Interesse an Tischtennis oder den gleichen Reisepass), aber auch viele andere, die sich unterscheiden (zum Beispiel der Vorname, das Alter oder die Hautfarbe). Das führt zu der Frage, welche der Merkmale erfüllt sein müssen, um Teil eines Wir werden zu dürfen, und welche optional sind. Nicht selten sind diese Merkmale bei näherer Betrachtung wesentlich weniger absolut und universell, als sie den Anschein erwecken, sondern kontextgebunden und variabel in ihrer tatsächlichen Bedeutsamkeit.
Das offenbart den zweiten Fallstrick, nämlich die Tatsache, dass wir alle Teil vieler verschiedener Wirs sind. Je nach Lebenssituation und Kontext werden wir diese Wirs aktivieren oder negieren, verstärken oder abschwächen, verstecken oder betonen. Das begründet sich in unserer persönlichen Identität und unseren unterschiedlichen sozialen Rollen, die wir tagtäglich einnehmen, aber auch aus dem politischen und rechtlichen Gefüge, in das wir eingebettet sind. Laut einer Umfrage des Market-Instituts aus dem Jahr 2018 verbinden 69 Prozent der Befragten mit „Wir“ ihr Heimatland Österreich, ähnlich viele ihre Familie und ihren Bekannten- und Freundeskreis. Mit anderen Zugehörigkeiten scheint man sich hierzulande schwerer zu tun. Während in Deutschland knapp 70 Prozent der Befragten Europa als „Wir“ definieren, sind es in Österreich nur 29 Prozent.3 Ein Zusammenspiel aus individuellen und strukturellen Gründen ist also dafür verantwortlich, dass uns die Zugehörigkeit zu einem ganz bestimmten Wir wichtig erscheint, dass es uns stolz macht und wir es vor uns hertragen, während wir ein anderes Wir lieber loswerden oder uns davon abgrenzen wollen. Das allerdings ist mitunter gar nicht so einfach.
Denn: Die Zugehörigkeit zu manchen dieser Wirs können wir uns aussuchen (Tischtennisverein), viele andere sind aber zumindest teilweise vorgegeben (Familie, Nation). Zu Letzteren gehören vor allen Dingen die großen, bestimmenden Wirs unseres Daseins, darunter Geschlecht, soziale Klasse, Ethnizität und Nationalität. Auch manche dieser großen Wirs kann man ändern, aber oft nur unter Aufwendung erheblicher persönlicher wie materieller Ressourcen. Das Wir ist deshalb nicht beliebig, sondern determiniert vielfach unseren Lebensweg, unsere Chancen und Privilegien (siehe Kapitel