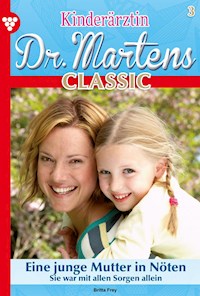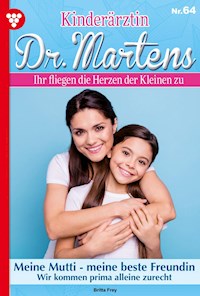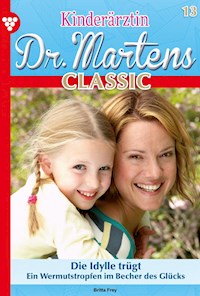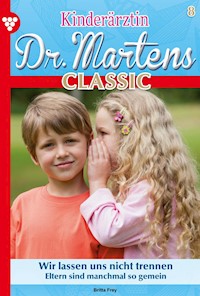
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kinderärztin Dr. Martens Classic
- Sprache: Deutsch
Die Kinderärztin Dr. Martens ist eine großartige Ärztin aus Berufung, sie hat ein Herz für ihre kleinen Patienten, und mit ihrem besonderen psychologischen Feingefühl geht sie auf deren Sorgen und Wünsche ein. Die Kinderklinik, die sie leitet, hat sie zu einem ausgezeichneten Ansehen verholfen. Kinderärztin Dr. Martens ist eine weibliche Identifikationsfigur von Format. Sie ist ein einzigartiger, ein unbestechlicher Charakter – und sie verfügt über einen liebenswerten Charme. Alle Leserinnen von Arztromanen und Familienromanen sind begeistert! Kathinka Leipert stand am Fenster der winzigen Küche, in der es so schwierig war, Ordnung zu halten und starrte in das verlöschende Tageslicht. In ihren blauen Augen war ein grenzenlos trauriger Ausdruck, der so gar nicht zu ihrer gepflegten damenhaften Erscheinung passen wollte. Bei einer jungen Frau wie ihr, bildhübsch, tadellos gewachsen und geschmackvoll gekleidet, wäre da nicht eine gewisse Sorglosigkeit angebracht gewesen, jene jugendliche Leichtigkeit, die einem im Verlauf des Lebens unweigerlich und bedauerlicherweise irgendwann einmal abhanden kam? Doch Kathinka Leipert hatte Sorgen, sie hatte sogar das seltsame Gefühl, seit einiger Zeit auf einer Schaukel zu sitzen. Früher war sie sich ihres Glücks so sicher gewesen, hatte sich für eine vollkommen zufriedene Frau gehalten, die mit ihrem Mann das Große Los gezogen hatte. Seit einigen Wochen jedoch hatte ihr makelloses Familienglück unschöne Risse bekommen, begann der vermeintlich unverzehrbare Goldglanz ihrer ehelichen Harmonie matter zu werden. Kathinka machte unvermittelt die bestürzende Feststellung, seit gut zehn Jahren in einem Wolkenschloß aus lauter regenbogenbunten Illusionen gelebt zu haben. Auf einmal wünschte sie sich, über Dinge zu sprechen, an die sie seit Jahren nicht mehr gedacht hatte oder über die sie niemals mit einer Menschenseele hatte sprechen wollen. Aber Peter ist ja nicht da, stellte sie gereizt fest, war auf einmal nervös und unruhig und hatte das Gefühl, daß irgendein Unglück auf sie wartete. Ein Unglück, das sich im Hintergrund, von Peter und ihr unbemerkt oder verdrängt, so genau ließ sich das nicht mehr feststellen, aus Ereignissen und Einflüssen zusammengebraut hatte und nun jeden Moment mit seiner ganzen furchtbaren, seit langem aufgestauten Gewalt über sie hereinbrechen konnte. Kathinka war so in ihre deprimierenden Gedanken vertieft, daß sie nicht hörte, wie sich die Küchentür leise öffnete. »Mami?« Kathinka drehte sich um. Ihr Sohn Daniel streckte den dunklen Kopf zur Tür herein. Vom Toben gerötete Wangen, seidenweiche zerzauste Haarsträhnen, die sich wegen der vielen Wirbel niemals ordentlich glätten ließen, große braune Augen, die sie bittend anschauten. Und natürlich wieder barfuß. »Kommst du heute nicht mehr, Mami?« fragte der Achtjährige, der mit einer Hand die rutschende Hose seines blauen Pyjamas festhielt, mit der anderen die Türklinke umfaßte. Der rosige Kinderbauch leuchtete zwischen Hose und hochgerutschtem Oberteil des Pyjamas, das arg mit Fingerfarben gestreift war. Wie immer, wenn Kathinka ihren Sohn anschaute, durchflutete sie Stolz und Freude.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 147
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kinderärztin Dr. Martens Classic – 8 –
Wir lassen uns nicht trennen
Eltern sind manchmal so gemein
Britta Frey
Kathinka Leipert stand am Fenster der winzigen Küche, in der es so schwierig war, Ordnung zu halten und starrte in das verlöschende Tageslicht. In ihren blauen Augen war ein grenzenlos trauriger Ausdruck, der so gar nicht zu ihrer gepflegten damenhaften Erscheinung passen wollte.
Bei einer jungen Frau wie ihr, bildhübsch, tadellos gewachsen und geschmackvoll gekleidet, wäre da nicht eine gewisse Sorglosigkeit angebracht gewesen, jene jugendliche Leichtigkeit, die einem im Verlauf des Lebens unweigerlich und bedauerlicherweise irgendwann einmal abhanden kam?
Doch Kathinka Leipert hatte Sorgen, sie hatte sogar das seltsame Gefühl, seit einiger Zeit auf einer Schaukel zu sitzen. Früher war sie sich ihres Glücks so sicher gewesen, hatte sich für eine vollkommen zufriedene Frau gehalten, die mit ihrem Mann das Große Los gezogen hatte.
Seit einigen Wochen jedoch hatte ihr makelloses Familienglück unschöne Risse bekommen, begann der vermeintlich unverzehrbare Goldglanz ihrer ehelichen Harmonie matter zu werden.
Kathinka machte unvermittelt die bestürzende Feststellung, seit gut zehn Jahren in einem Wolkenschloß aus lauter regenbogenbunten Illusionen gelebt zu haben.
Auf einmal wünschte sie sich, über Dinge zu sprechen, an die sie seit Jahren nicht mehr gedacht hatte oder über die sie niemals mit einer Menschenseele hatte sprechen wollen.
Aber Peter ist ja nicht da, stellte sie gereizt fest, war auf einmal nervös und unruhig und hatte das Gefühl, daß irgendein Unglück auf sie wartete. Ein Unglück, das sich im Hintergrund, von Peter und ihr unbemerkt oder verdrängt, so genau ließ sich das nicht mehr feststellen, aus Ereignissen und Einflüssen zusammengebraut hatte und nun jeden Moment mit seiner ganzen furchtbaren, seit langem aufgestauten Gewalt über sie hereinbrechen konnte.
Ich hätte Peter nicht heiraten dürfen, sagte sich Kathinka und verspürte wieder diesen ziehenden Schmerz in der Brust, der immer dort war, dachte sie an ihren Mann…
Kathinka war so in ihre deprimierenden Gedanken vertieft, daß sie nicht hörte, wie sich die Küchentür leise öffnete.
»Mami?«
Kathinka drehte sich um. Ihr Sohn Daniel streckte den dunklen Kopf zur Tür herein. Vom Toben gerötete Wangen, seidenweiche zerzauste Haarsträhnen, die sich wegen der vielen Wirbel niemals ordentlich glätten ließen, große braune Augen, die sie bittend anschauten. Und natürlich wieder barfuß.
»Kommst du heute nicht mehr, Mami?« fragte der Achtjährige, der mit einer Hand die rutschende Hose seines blauen Pyjamas festhielt, mit der anderen die Türklinke umfaßte. Der rosige Kinderbauch leuchtete zwischen Hose und hochgerutschtem Oberteil des Pyjamas, das arg mit Fingerfarben gestreift war.
Wie immer, wenn Kathinka ihren Sohn anschaute, durchflutete sie Stolz und Freude. Ein auffallend hübscher kleiner Junge war er, ihr Danny, der in jeder Beziehung ganz nach seinem Vater Peter schlug. Ihre Melancholie verflog im Handumdrehen, jetzt erfüllte Bewunderung ihr Herz, aber auch ein Hauch von Dankbarkeit, daß ihr dieses vollkommene kleine Geschöpf gehörte.
»Natürlich komme ich«, erwiderte Kathinka zärtlich und verließ ihren Platz am Küchenfenster, kam mit ausgebreiteten Armen auf Danny zu, blickte lächelnd zu ihm herab.
»Die Fränzi und ich, Mami, wir warten schon so lange auf dich. Ist der Papi denn noch nicht da?«
Ihr Herz tat einen seltsamen Sprung. Auf einmal war sie wieder da, diese scharfe gallige Bitterkeit, die ihr das Herz kalt und schwer machte.
»Nein«, hörte sie sich mit heller kühler Stimme antworten und wunderte sich, wie sie es fertigbrachte, diese Unbefangenheit aufzubringen, »der Papi macht Überstunden, kleiner Hosenmatz, er kommt später.«
»Schade«, sagte Danny achselzuckend, aber nicht sonderlich erschüttert, denn er war ja daran gewöhnt, den Vater nicht sehr häufig zu sehen. »Erzählst du uns eine Gutenachtgeschichte?«
»Mal sehen, wie das Kinderzimmer ausschaut, Danny.«
»Prima«, sagte er wie aus der Pistole geschossen und grinste frech. Sein unwiderstehliches sommersprossiges Zahnlücken-Lachen.
»Du Schlingel!« sagte sie schmunzelnd und fuhr ihm durch das zerzauste Haar, das störrisch war wie das seines Vaters.
Das Kinderzimmer, das sich die zehnjährige Franziska und ihr Bruder Danny teilten, sah wie üblich chaotisch aus. Offenbar hatte vor dem Zubettgehen eine stürmische Kissenschlacht stattgefunden, denn nicht nur sämtliche Stofftiere, Autos und Puppen waren vom Regal zu Boden gefegt worden, auch alle Bilder an den Wänden hingen schief, das Kasperltheater war umgekracht.
»Großer Gott«, murmelte Kathinka, die sich flüchtig an ihr eigenes Kinderzimmer in der eleganten elterlichen Elbvilla erinnerte, ein riesiger sonnendurchfluteter Raum mit eigenem Badezimmer und Balkon, einheitlich in kühlen Blautönen gehalten und natürlich allzeit wohlaufgeräumt und gepflegt…
»Ist gar nicht so schlimm, Mami, die Fränzi und ich räumen das morgen alles wieder auf«, tröstete Danny unbekümmert seine erschrockene Mama, die das Kinderzimmer so behutsam und fast schüchtern betrat, als handle es sich um vermintes Feindesland.
Das Kinderzimmer war, wie sich Kathinka erinnerte, an sich reizend. Es gab sogar eine kleine Sitzecke, damit die Kinder ihre kleinen Freunde dort bewirten konnten, ohne sich beobachtet zu fühlen. Kathinka hatte sich bei der Einrichtung und Ausstattung des Kinderzimmers wirklich große Mühe gegeben.
So weit, so gut. Kathinka hatte das eigene kleine Reich ihrer beiden Kinder also wie eine entzückende Puppenstube eingerichtet. Doch sie hatte leider die Rechnung ohne ihre beiden Sprößlinge gemacht. Buchstäblich seit ihrem allerersten Schrei taten Fränzi und Danny Leipert nämlich genau das, was sie wollten. Und was sie wollten, tja, das wußten die beiden Herzchen ganz genau.
Bisweilen war Kathinka ob so viel Temperament und Selbstbewußtsein am Ende ihrer Kräfte. Mit diesem Ausbund an Lebhaftigkeit hatte sie dermaleinst wahrlich nicht gerechnet.
Danny stürmte das Kinderzimmer. Kein Mensch hatte ihn jemals langsam gehen gesehen. Der Achtjährige war ständig in Bewegung und Eile. Danny Leipert besaß die unermüdliche Schwungkraft eines Perpetuum Mobiles und den Einfallsreichtum eines Zauberers.
Er warf sich in sein Bett, zog sich die Steppdecke bis unters Kinn und schaute seine Mami erwartungsvoll an.
Kathinka beugte sich zunächst über Fränzis Bett, um nach ihrer Tochter zu sehen. Wie üblich mußte sie zweimal hinschauen, um die Fränzi zwischen ihren Püppchen und Stofftieren zu entdecken.
Springlebendig wie ein übermütiges kleines Fohlen, das den Ernst des Lebens noch nicht erfahren hatte, war ihre Tochter, die zehnjährige Fränzi, die ihre blonden Haare und ihre blauen Augen geerbt hatte. Aber während die Frau Mama sehr zurückhaltend wirkte, vornehm distanziert, erinnerte die Fränzi mit ihrem spontanen, äußerst natürlichen Wesen und dem Hang zu kessen Sprüchen durchaus an den Herrn Papa, den chronisch abwesenden.
Fränzi schlief schon, hatte ihr gerötetes Gesicht tief ins Kissen gedrückt, auf dessen Bezug sich unzählige Mickymäuschen tummelten. Kathinka seufzte und schob die heiße feuchte kleine Kinderhand beiseite, so daß sie die Steppdecke hochziehen konnte.
»Schlaf schön, mein Kleines«, flüsterte Kathinka, beugte sich über das Bett und küßte Fränzi auf die glühende Wange. Dabei atmete sie den Duft nach frischer Seife und sauberer Haut ein.
»Sie pennt schon, die alte Schlafmütze?« fragte Danny neugierig und ein bißchen gekränkt. »Dabei hat sie mir fest versprochen wachzubleiben, bis ich dich geholt habe, Mami.«
»Schscht, Dannyspatz«, wisperte Kathinka und legte warnend den Zeigefinger vor die gespitzten Lippen, kam auf Zehenspitzen zum Bett ihres wartenden Sohnemanns, der sich unbändig darauf freute, die Mama endlich einmal ganz für sich zu haben.
»Mit der Gutenachtgeschichte ist jetzt wohl Essig, wie?«
»Essig?« Kathinka schmunzelte. »Aber Danny, was ist denn das für eine krause Ausdrucksweise!« Sie hockte sich auf die Bettkante und strich ihm das wirre Haar aus der Stirn. »Ich singe dir ein Gutenachtlied vor, einverstanden?«
»Klar, Mami.« Danny streckte sich genüßlich unter der raschelnden Steppdecke aus und meinte schlaftrunken: »Unser Lied, ja?«
»Natürlich, Spatz, unser Lied.« Kathinkas Lippen öffneten sich zu dem glücklichen unbeschwerten Lächeln, das in den letzten Wochen nur noch sehr selten auf ihrem Gesicht erblühte.
Impulsiv streckte sie die Hand aus und hielt Dannys Kinderhand fest, fühlte gerührt all die Kratzer und Hornhautpickel, die von den unzähligen Scharmützeln und Gefechten auf Spiel-, Bolz- und Fußballplätzen herrührten und von enormer Einsatzfreude zeugten.
»Wer hat die schönsten Schäfchen?« sang Kathinka mit gedämpfter Stimme, um die schlafende Fränzi nicht zu stören. »… die hat der goldene Mond, der hinter unserem Hause, am Himmel droben wohnt. Dort weidet er die Schäfchen, auf seiner blauen Flur…«
»Mami«, unterbrach Danny mit ergriffener Stimme den mütterlichen Gesang, »du siehst unheimlich schön aus, wenn du singst und dabei lächelst, weißt du das eigentlich?«
»Danke schön, mein kleiner Kavalier«, sagte Kathinka entzückt ob soviel sommersprossiger Liebenswürdigkeit, die direkt aus dem Bubenherzen zu kommen schien. Und sie drückte seine Hand und sang die nächste Strophe des Schlaflieds, das Danny am liebsten hörte.
Dannys Augen schlossen sich langsam, fielen sacht zu. Sein Atem wurde ruhiger und gleichmäßig. Doch als Kathinka nach der dritten Strophe mit dem Singen aufhörte, flüsterte Danny: »Ich bin noch hellwach, Mami, noch nicht weggehen, ja?«
»Nein«, flüsterte sie zurück und sang auch die vierte Strophe.
Ihr begütigendes Lächeln erlosch freilich, als sie Peters Wagen kommen hörte. Er parkte ihn wie immer vor dem Haus. Die Fahrertür wurde schwungvoll zugeknallt, dann hallten seine Schritte auf den Steinplatten, die zur Haustür führten.
Kathinka erstarrte. Ihr Blick fiel auf das schlafende Kind. Dannys Mund stand halb offen, die dunklen Wimpern warfen halbmondförmige Schatten auf die erhitzten Wangen: er schlief fest.
Mit einer raschen ärgerlichen Bewegung erhob sie sich und verließ das Kinderzimmer, knipste das Deckenlicht aus. Ihre entspannte Stimmung machte aufkommendem Ärger Platz. Ärger über sich selbst, über Peter und über alles um sie herum.
Sie zwang sich, im Wohnzimmer auf dem Sofa Platz zu nehmen, nahm sogar ihren Roman in die Hand, um einen möglichst normalen Eindruck zu machen. Peter sollte nur nicht auf die Idee kommen, sie habe die Minuten bis zu seiner Rückkehr gezählt.
Als sie hörte, wie er die Wohnungstür aufschloß, begann ihr Herz wild zu pochen.
*
»Hallihallo, Schatz!« rief er durch die offenstehende Tür ins Wohnzimmer und warf seinen Trenchcoat auf die Truhe im Flur.
Schon dieses unbekümmerte Hallihallo brachte Kathinka in Weißglut. Und dann ärgerte sie sich maßlos über seine Vergeßlichkeit. Hatte sie ihm nicht schon hundertmal gesagt, daß er seinen Mantel an den dafür vorgesehenen Haken an der Garderobe hängen solle?
»So ernst heute abend, Schatzilein?« Peter wirbelte ins Wohnzimmer, biß gleichzeitig in ein Brötchen, trank einen Schluck Bier und brachte es noch fertig, sie anzustrahlen.
Kathinka wappnete sich innerlich gegen dieses Lächeln, das sie vor kurzem noch glatt umgeworfen hätte. Und sie bog den Kopf zur Seite und wich seinen Lippen aus, die sie küssen wollten.
»Laß das«, rief sie ungehalten, »du stinkst nach Bier und kaltem Zigarettenrauch. Ich kann das nicht ausstehen… Widerlich!«
Peters hübsches Gesicht mit den ebenmäßigen Zügen nahm den Ausdruck der Gespanntheit, der alarmierten Wachsamkeit an.
»Schlechte Laune, mein Engel?« fragte er lächelnd, während seine Augen sie forschend musterten.
Sie wandte sich mit einem verächtlichen Seufzer ab, schlug das Buch an einer x-beliebigen Stelle auf und gab vor zu lesen.
»Gab’s irgend etwas Besonderes heute?« fragte Peter freundlich, schlenderte durch das Wohnzimmer, wobei er sie nicht aus den Augen ließ. Er spürte, daß irgend etwas gegen ihn vorlag: »Eigentlich nicht, nur das Übliche«, sagte sie scharf. Ihre blauen Augen wirkten kalt und feindselig, während ihr Herz fast schmerzhaft gegen ihre Rippen hämmerte. Sie ärgerte sich entsetzlich über ihn und seine saloppe Art, Probleme zu verdrängen, doch gleichzeitig sehnte sie sich mit einer Heftigkeit nach ihm, die sie erschreckte.
»Was ist los, Kathinka?« fragte er sie plötzlich rundheraus. »Du weißt, ich hasse dieses Katz-und-Maus-Spiel.« Er stellte das Bierglas so ungeschickt auf den Couchtisch, daß es umkippte. Zum Glück war es bis auf einen winzigen Rest Bier leergewesen. Die wenigen Tropfen versickerten in der Brokatdecke.
Doch Kathinka brach in Tränen aus, schrie wütend: »Das ist mal wieder typisch. Du kümmerst dich um nichts, läßt mich den ganzen Tag mit den Kindern allein und kommst am späten Abend nach Haus und tust so, als sei das ganz normal. Verdammt, ich habe es satt, immer nur hinter dir und den Kindern herzuräumen, ich bin es leid, die brave kleine Hausfrau zu spielen und zu sparen, nie genug Geld zu haben, um mir etwas leisten zu können…«
Als ihr die Puste ausging, warf er mit leiser, fast unbeteiligter Stimme ein: »Worum geht’s eigentlich? Um die paar Tropfen Bier? Menschenskind, Kathinka, wieso mußt du das wieder so eng sehen? Ist doch gar nicht so wichtig, oder? Komm, nun beruhige dich, sei lieb und verträglich, ich…«
»Lieb und verträglich«, wetterte sie, »das könnte dir so passen, mein Lieber. Ich war schon viel zu lange lieb und verträglich. Dämlich war ich, blind und taub dazu.« Sie hob den Kopf und sah ihn herausfordernd an. »Darf ich dich mal fragen, wer Nicki ist? Eine gewisse süße kleine Maus namens Nicki?«
Er sah, wie die Bitterkeit ihre klassisch-edlen Züge verhärtete. Sie hatte, wie ihm jetzt erst auffiel, an Gewicht verloren, ihre Wangenknochen traten viel stärker hervor als früher. Ihre mädchenhafte Ausstrahlung, die er so sehr liebte und bewunderte, schien während der letzten Jahre abhanden gekommen zu sein. Irgendwie, stellte er erschrocken fest, ähnelt Kathinka jetzt ihrer Mutter, dieser vornehm unnahbaren Lady, diesem Muster an damenhafter Vollkommenheit, vor deren Kälte mich schon immer gruselte…
Kathinka fixierte ihn mit frostigem unbeteiligtem Blick. Ruhig wirkte sie, merkwürdig ruhig. Doch hinter ihrer unbewegten Fassade, er ahnte es, brodelte es, und ihm wurde klar, daß die unvermeidliche Krise dicht bevorstand.
»Nicki? Wieso?« fragte er, um Zeit zu gewinnen.
Sie lächelte herablassend, ihr Elbchaussee-Lächeln, und langte hinter sich auf den kleinen Lampentisch, griff sich das Foto, das sie dort offensichtlich in der Absicht deponierte, es später als Beweismittel gegen ihn zu verwenden, und präsentierte es ihm.
»Von dieser Dame ist die Rede«, sagte sie höhnisch und mit aschfahlem Gesicht, »oder solltest du sie gar nicht kennen? Nein? Dann darf ich dir mal die zärtliche Widmung auf der Rückseite vorlesen, um deine Erinnerungen aufzufrischen…«
»Nein!« rief er kategorisch und riß ihr das Foto aus der Hand, zerfetzte es mit raschen Bewegungen. »Kathinka«, sagte er dann sehr viel weicher, »es tut mir leid, ich…«
»Es tut dir immer leid, Peter. Aber das hindert dich nie daran, nach kurzer Zeit eine neue Affäre anzufangen und mich zu betrügen.« Sie sah ihn gekränkt an. »Ich bin es so leid, dieses ewige Theater mit deinen kleinen Freundinnen, all den Suses, Annes und Daggis… Diesmal ist es Nicki, morgen wird es eine andere sein. Und ich werde wieder ein Foto in deiner Jackentasche finden oder ein vergessenes Taschentuch, Lippenstiftspuren…«
»Kathinka«, rief er flehentlich, »du irrst dich. Nicki und ich sind nur… gute Freunde. Es ist nichts zwischen uns, glaube mir.«
»Ich soll dir glauben? Du verlangst viel von mir, Peter«, erwiderte sie dumpf. »Während du den strahlenden Sonnyboy spielst, von einer Affäre zur anderen schlidderst, dir ein flottes Leben machst und auf meine Gefühle nicht für fünf Cent Rücksicht nimmst, rackere ich mich in dieser engen, unpraktischen Wohnung ab, muß mich mit den Kindern und den Nachbarn herumärgern…«
»Moment mal, du wolltest zwei Kinder, Kathinka!« warf er ein.
Sie holte tief Luft und sagte kopfschüttelnd: »Ich habe genug von diesem, Leben, Peter, genug von Haushaltskatastrophen, Kinderkrankheiten, unserem ewigen Streit ums Haushaltsgeld, deinen Seitensprüngen. Mir reicht’s, verstehst du?«
»Ich bin ja nicht schwerhörig, ich habe verstanden. Und was hast du nun vor?« fragte er und verschränkte die Arme vor der Brust.
»Ich verlasse dich. Ich hätte es schon vor Jahren tun sollen. Mutter hat mich ja von Anfang an vor dir gewarnt, sie…«
»Natürlich, deine Mutter!« Er lachte auf und schlug sich mit der flachen Hand an die Stirn. »Die so überaus wichtige Meinung deiner Mutter mußtest du mir ja unter die Nase reiben, die darf bei unserem Streit ja nicht fehlen. Ich habe schon richtig darauf gewartet, daß deine Mutter wieder zitiert wird. Ihre wundervollen scharfsinnigen Lebkuchensprüche fehlten mir direkt.«
»Du brauchst gar nicht ironisch zu werden, Peter.« Sie warf ihm einen, wie sie hoffte, vernichtenden Blick zu. »Meine Mutter ist eine gescheite Frau mit viel Lebenserfahrung. Und wenn ich auf sie gehört und dich damals nicht geheiratet hätte, dann wäre mir diese Ehe-Katastrophe erspart geblieben.«
»Offen gestanden, Kathinka, hörst du dich jetzt an wie deine Mutter. Das amüsiert mich kein bißchen mehr.«
»Nein«, sagte sie gelassen. »Das glaube ich dir. Du konntest meine Mutter noch nie leiden, nicht wahr? Aber sie dich auch nicht. Und wäre damals nicht Fränzi unterwegs gewesen, so hätte ich dich auch nie geheiratet, das steht fest, mein Lieber. Ich hätte ganz andere Männer heiraten können. Erfolgreiche Männer.«
Er starrte sie an, seine aphroditenschöne Kathinka, und spürte eine zunehmende Trauer. Als sie sich von ihm abwandte, überkam ihn das Gefühl unendlicher Trostlosigkeit.
»Hör mal, Kathinka«, sagte er leise und mit rauher Stimme und hielt sie an der Schulter fest, »laß uns in Ruhe über alles reden, morgen oder übermorgen, wenn wir uns beruhigt haben, jetzt…«
»Ich bin völlig ruhig, Peter.« Ihr Gesicht war nun schneeweiß, verhärmt, die Augen riesig und glanzlos. Sie befreite sich ungnädig und fauchte ihn an: »Es ist aus, Peter, aus und vorbei. Du hast es endgültig geschafft. Ich empfinde nichts mehr für dich, nicht einmal mehr Haß. Meinetwegen kannst du zum Teufel gehen, es interessiert mich nicht länger…«
»Ah, ich höre förmlich die guten Ratschläge deiner Mutter!«
»Jawohl, ich habe mit Mutter gesprochen«, bestätigte sie kühl. »Und Mutter ist damit einverstanden, daß ich dich verlasse und in mein Elternhaus zurückkehre.«
Nach dieser Ankündigung entstand ein langes schweres Schweigen zwischen ihnen. Peter stand vor ihr, totenbleich, und starrte ihr ins Gesicht, bis er begriff, daß sie es ernst meinte. Er schluckte und sah blind an ihr vorbei, murmelte mit belegter Stimme: »Und was soll aus den Kindern werden, hat deine Mutter auch diesbezüglich schon eine Entscheidung getroffen?«