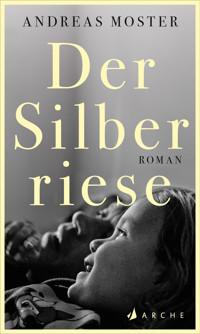11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arche Literatur Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine atemberaubende Fabel über die Gewalt der Väter, vor allem aber über die Widerstandskraft der Töchter Gewinner des Hamburger Literaturpreises 2021, Teilnehmer am 46. Bachmann-Wettbewerb – Andreas Moster gehört zu den sprachmächtigsten Autor:innen seiner Generation. Sein Roman ›Wir leben hier, seit wir geboren sind‹ erzählt in traumwandlerischen und doch messerscharfen Bildern von Stillstand und Aufbruch, von den Fesseln der Tradition und der Sehnsucht nach einer anderen Zukunft. In einem abgelegenen Bergdorf taucht ein Fremder auf und dreht alle Steine um. Fünf Freundinnen, die keine Kinder mehr sind, aber auch noch keine Frauen, sitzen auf dem Dorfplatz und beobachten ihn dabei. Der Mann, Georg Musiel, soll feststellen, dass dem Kalksteinbruch, ohne den das Dorf nicht überleben kann, nichts mehr abzutrotzen ist. Als es während seiner Besichtigung des Bruchs zu einem schweren Unfall kommt und Musiel verjagt wird, halten die Mädchen als Einzige zu ihm. Doch dann verschwindet eine von ihnen, und die strenge Ordnung der archaischen Gemeinschaft gerät aus den Fugen. Die Freundinnen ahnen, dass es einen anderen Ort für sie gibt, dass Freiheit möglich ist. Um sie zu erlangen, müssen sie sich gegen ihre Väter erheben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 237
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Andreas Moster
Wir leben hier, seid wir geboren sind
Roman
Die Originalausgabe erschien 2017 im Eichborn Verlag.
Ungekürzte Taschenbuchausgabe
© 2023 Arche Literatur Verlag,
ein Imprint der Atrium Verlag AG, Zürich
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Designbüro Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Coverabbildung: Thanapol Tontinikorn/Getty Images
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
ISBN978-3-03790-036-9
www.arche-verlag.com
www.facebook.com/ArcheVerlag
www.instagram.com/arche_verlag
Für Petra
1
Ein Mann kommt in unser Dorf und dreht die Steine um und die Köpfe der Mädchen. Die Steine liegen auf einer weißen Mauer, die das Dorf vor dem Hang schützt. Die Mädchen sitzen auf dem Dorfplatz und beobachten, wie der Mann die Steine umdreht. Der Mann schlendert an der Mauer entlang, hebt die Steine mit der rechten Hand hoch und legt sie verkehrt herum wieder zurück. Die Köpfe der Mädchen folgen den langsamen Bewegungen des Mannes, der an der Mauer entlanggeht. Er trägt einen Koffer in der linken Hand, seine schmale, hochgewachsene Gestalt ist leicht nach links geneigt, wegen der Schwere des Koffers. Die Mädchen haben gesehen, wie der Mann den Koffer aus dem Zug gehoben hat. Sie haben nichts zu tun, ihre Langeweile liegt in der schweren Luft wie ein Gewitter, ihre Hände liegen zwischen den Beinen, während sie den Mann beobachten, der an der weißen Mauer entlanggeht und die Steine umdreht. Als der Mann das Ende der Mauer erreicht, halten die Mädchen den Atem an. Der Mann dreht den letzten Stein um und stellt den Koffer ab. Es kann nun alles passieren: Der Himmel kann aufgehen, der Berg kann ins Tal stürzen, der Mann kann zu Boden gehen. Die Mädchen können ihn ausweiden, bei lebendigem Leib. Aber wir tun nichts. Sitzen nur da, die Hände zwischen unsere Beine gelegt, beobachten, wie der Mann den Koffer hochhebt und den Dorfplatz überquert, eine schmale, hochgewachsene Gestalt, die von außen in unser Dorf gekommen ist.
Noch in der Nacht träume ich von dem Mann. Das Gewitter ist zwischen den Bergen hängen geblieben und kann nicht fort. Immer wieder rollt es mit gesenktem Kopf gegen den Hang, donnert gegen die Felsen und taumelt wutentbrannt ins Dorf zurück, schleudert uns seine Blitze vor die Füße und spuckt uns ins Gesicht, bis es müde wird. Das sanfte Grollen treibt mich in den Schlaf. In meinem Traum öffnet der Mann seinen Koffer und nimmt eine Welt heraus, ein Messer, ein Geschwür im Unterleib, ein Kind. Der Mann legt die Dinge vor mir auf den Tisch: die Welt, das Messer, das Kind. Mit dem Messer schneidet er die Welt in zwei Hälften, ich soll mir eine aussuchen, aber die Hälften sind gleich, und ich kann mich nicht entscheiden. Das Geschwür im Unterleib brennt wie ein schwarzer, zu einer Nuss verdichteter Stern. Ich will den Mann bitten, es mit dem Messer herauszuschneiden, doch meine Stimme ist leer und hohl, und meine Bitte haucht tonlos gegen seine Wange.
»Sprich lauter, Kind.«
Ich bin kein Kind mehr. Ich kann nicht sprechen. Der Mann steckt seinen Finger in meinen Mund und prüft die Stimmbänder, indem er daran entlangfährt wie an einer Bogensaite. Ich mache ein Geräusch, und der Mann fährt mit dem Finger über meine Zunge und aus meinem Mund heraus.
»Du kannst sprechen, Kind.«
Ich bin kein Kind mehr. Ich versuche zu sprechen.
»Nimm die Nuss heraus.«
Meine Stimme ist das Krächzen eines am Boden liegenden Vogels. Der Mann hebt mich auf und nimmt mich in seine Hände. Als er mich mit dem Finger aufmacht, schreie ich und werde wach von dem Schrei.
Das Gewitter liegt geschlagen am Hang. Es hat die Gestalt eines Bocks, die Hufe ragen steif in die Straße hinein, der Kopf ruht in einer Mulde, die sich langsam mit Tränen und Speichel füllt. Die Hörner zerwehen im Mondlicht. Vom Fenster aus beobachte ich die Auflösung des Bocks. Die Wolkenfetzen ziehen nach Norden ab, tiefer in die Berge hinein, zur Ruhestatt der Böcke. Am Morgen wird die Luft klar sein, von allem Schmutz gereinigt. In diesem Frühjahr sind die Gewitter zahlreich gewesen. Der Mann kommt in ein sauberes Dorf, der Schmutz klebt an den Bäuchen der Böcke, mit denen sie über das Pflaster schleifen, Nacht für Nacht.
Der Traum folgt mir in den Tag hinein. Beim Frühstück schneide ich das Brot in zwei Hälften, mein Vater kann sich nicht entscheiden und schaut mich misstrauisch an, vielleicht ahnt er, was der Mann in der Nacht mit mir getan hat. Er nimmt eine Brothälfte und drückt meine Hand zusammen, die das Messer hält.
»Täusch mich nicht, mein Kind.«
Ich bin kein Kind mehr. Ich versuche zu sprechen.
»Lass meine Hand los.«
Der Blick meines Vaters geht durch mich hindurch, vor seinen Augen ziehen Schleier auf und verhüllen das leuchtende Blau, in dem meine Mutter vor langer Zeit ertrunken ist. Seine Hand drückt so fest, dass ich aufschreie und nicht wach werde davon. Das Messer klirrt auf den Tisch. Mein Vater blinzelt, atmet ein, legt den Kopf schief. Die Schleier vor seinen Augen zerwehen wie die Hörner des Bocks. Er lässt meine Hand los und steht vom Tisch auf, steckt sich das Brot in den Mund und kaut es zu Brei, täusch mich nie mehr, mein Kind, es ist mein Brot, das du da isst. Als er die Küche verlässt, weicht meine Mutter vor ihm zurück wie eine Gerte, die sich im Wind biegt. Sie lauscht den Schritten meines Vaters im Flur, dann setzt sie sich zu mir und untersucht meine Hand.
»Beweg deine Finger.«
»Ich kann nicht.«
»Versuch es.«
Ich schüttele den Kopf, meine Finger sind steif und rot vom Griff meines Vaters. Meine Mutter geht mit mir zum Spülbecken und lässt Wasser ein. Das Wasser tut meiner Hand gut. Vorsichtig bewege ich die Finger. Das Spülbecken ist aus dem gleichen weißen Stein wie die Mauer, an der der Mann entlanggegangen ist und die Steine umgedreht hat. In meinen Gedanken beobachte ich, wie er den Dorfplatz überquert, seine hagere Gestalt ist ein wenig nach links geneigt, wegen der Schwere des Koffers. Wir haben nicht gesehen, wohin er gegangen ist, ob er geblieben ist oder uns, nachdem er die Steine umgedreht hat, wieder verlassen hat. Ein stechender, sehnsüchtiger Schmerz fährt in meine Hand. Ich reiße sie aus dem Spülbecken, und die Wassertropfen fliegen in einem glitzernden Bogen durch die Küche, der sich vom Spülbecken über den Tisch bis zur Tür spannt und sekundenlang in der Luft stehen bleibt, ehe die Tropfen alle zugleich herabfallen und die Küche mit einer dünnen Wasserlinie in zwei Hälften teilen. Meine Mutter sitzt auf einem Stuhl am Tisch. Auf ihrem Scheitel glitzert die Wasserlinie, auch sie wird auseinanderbrechen und zu beiden Seiten des Stuhls herabfallen. Wortlos sitzt sie da und wundert sich. Mit den Fingern fährt sie an ihrem Scheitel entlang, führt die Finger an die Nase und riecht daran, wischt die Finger an ihrem Rock ab. Die beiden Hälften meiner Mutter sind gleich, ich kann mich nicht entscheiden. Sie hebt den Kopf und schaut nach oben, aber an der Decke ist kein Wölkchen.
Ein schöner Tag liegt vor uns.
Die Straßen sind sauber.
Meine rechte Hand pocht wie ein Krebs, der in der Sonne liegen geblieben ist und nicht ins Wasser zurückfindet. Ich versuche, die Bücher zu halten, aber es geht nicht. Sie fallen einzeln herunter und bleiben aufgeschlagen liegen, Lineare Funktionen und Gleichungen, Sprachbetrachtung, Zur Entstehung der afrikanischen Arten. Mit der linken Hand hebe ich die Bücher auf, es ist ungewohnt, meine rechte Hand hängt beschäftigungslos herab. Auf dem Weg zur Schule lässt das Pochen nach. Erst als ich ankomme, ist es verschwunden.
In der Schule machen wir eine Zeichnung von dem Mann, bevor wir zur Mauer gehen. Ada zeichnet die Beine und gibt das Blatt weiter, Cass zeichnet den Rumpf und gibt das Blatt weiter, Lilianne zeichnet den Schwanz und gibt das Blatt weiter, Séraphine zeichnet die Arme und gibt das Blatt weiter, ich zeichne den Kopf und gebe das Blatt an Ada zurück. Ada spuckt auf den Schwanz des Mannes und gibt das Blatt weiter, Cass verreibt die Spucke auf dem Schwanz des Mannes und gibt das Blatt weiter, Lilianne küsst den Schwanz des Mannes und gibt das Blatt weiter, Séraphine gibt das Blatt weiter, und ich zeichne dem Mann Hörner an den Kopf und die Augen des Bocks. Der Mann ist mager. Sein Brustkorb ist eingefallen, die Rippen zeichnen sich deutlich ab. Seine Arme sind lang und schlank und gerade, ebenso seine Beine und sein Schwanz, aus dem Adas Spucke läuft. Adas Spucke ist dick und warm. Der Hals des Mannes ist dünn und lang und hebt seinen Kopf hoch über den Körper. Der Kopf eines afrikanischen Steppentiers.
Ein afrikanischer Bock.
Die Hörner schrauben sich in schwarzen Windungen gegen den Himmel, der Kopf ist in den Nacken gelegt, die Lippen sind zu einem blutlosen Strich zusammengepresst. In den Äuglein glimmt ein tiefes, kerzenflackerndes Licht. Der Körper des Mannes ist vollkommen weiß. Ich traue mich nicht, ihn anzufassen. Seine Schönheit ist makellos wie die eines wilden Tiers, mit dem Finger fahre ich an den Konturen entlang, den Beinen, den Armen, umrunde den Körper einmal ganz, bis er in einer unsichtbaren Hülle gefangen ist und wahnsinnig wird davon. Die Beine treten nach hinten aus, die Arme schlagen nach allen Seiten, die Hörner bohren sich in die Hülle und reißen sie in Stücke. Die Sehnen im Hals des Bocks sind zum Zerreißen gespannt, die gehetzten Augen nehmen mich in den Blick. Die Hilflosigkeit des Tiers rührt mich an, und ich erlöse es, indem ich das Blatt zusammenfalte und zwischen die Seiten eines Buchs schiebe. Ada sieht mich an, Cass, Lilianne. Séraphine streicht sich die Haare aus der Stirn, wie sie es immer tut, mit beiden Händen vom Scheitel hinab zum Kinn. Die Schulglocke läutet, und wir rennen nach draußen, vor allen anderen. In den Schatten der Straßen ist es noch kühl, erst als wir auf den Dorfplatz kommen, schlägt uns die Hitze entgegen, und wir bleiben kurz stehen, geblendet vom Sonnenlicht auf dem weißen Pflaster.
Es ist unser Dorf, wir haben kein anderes.
Und so treten wir nacheinander an die Mauer heran und drehen in einer feierlichen Zeremonie die Steine wieder zurück, die der Bock durcheinandergebracht hat.
Die Mauer erstreckt sich über eine Länge von fünfzig Metern entlang der Ostseite des Dorfplatzes. Sie ist vor vielen Jahren von den Männern des Dorfes gebaut worden, die sich früh am Morgen auf dem Dorfplatz versammelt haben, ihre Gesichter noch grau von der Nacht, graue Gesichter in der grauen Dämmerung. Die Männer stehen wortlos rauchend beisammen. Dünne Rauchfäden steigen vor ihren Gesichtern auf, sie kneifen die Augen zusammen und warten auf den Aufbruch, der irgendwann von selbst geschieht, weil einer sich reckt und ein Geräusch macht und vorangeht, ein zweiter, ein dritter, eine dünne Fadenkette, ein Rauchfaden, der sich ins Gebirge hineinschlängelt. Es sind keine Frauen dabei. Die Arbeit wird hart werden, die Steine sind schwer, die Frauen haben Brot und Käse und Wurst in Tücher eingeschlagen, Ziegenmilch in einer Kanne, der Schnaps in einer Flasche aus dickem Glas. Die Männer gehen nach Norden. Sie kennen den Weg. Nichts fällt ihnen ins Auge, kein Geräusch beunruhigt sie. Die Vertrautheit des Weges verschließt ihre Sinne, sie riechen die Kräuter nicht, spüren nicht, dass die Sonne neben ihnen aufgeht, der Geschmack in ihrem Mund ist der Geschmack ihres Mundes, wie er an jedem Morgen schmeckt, schal nach dem Aufstehen, wie der Mund eines Hundes. Der Weg ist schmal, keine zwei Mann breit. Die Abdrücke der Böcke auf dem Weg. Nach rechts fällt der Berg steil ab, eine Geröllhalde zum Wasser hin, aber die Männer hören das Rauschen des Flusses nicht, in den die Böcke stürzen, wenn sie den Tritt verlieren und die Halde hinabrutschen. Der Fluss reißt die Böcke ins Tal, in einer Bucht werden die Kadaver angespült wie wollene, gehörnte Wale. Die Männer hören das Rauschen nicht, spüren die Hitze nicht, die in ihrem Rücken aufzieht. Noch gehen sie einzeln hintereinander, noch denken sie ihre eigenen Gedanken, an die Ernte und die Herde, an die Frau des Vordermanns, aber es schleicht sich schon etwas ein, die Mentalität des Arbeitertrupps: Wir werden eine Mauer bauen. Wir sind ein Körper mit fünfzig Händen. Die Mauer muss gebaut sein, bevor der Regen im Herbst die Erde vom Hang wäscht. Ein Körper mit fünfzig Händen, mit fünfzig Beinen, die sich in den Boden stemmen. Die Männer spüren nicht, dass der Weg nun steiler ansteigt. Der Schweiß färbt ihre Hemden, dunkle Dreiecke wie auf dem Rücken getragene Schilde. Die Maultiere am Ende des Zuges haben die Mäuler weit geöffnet. Mit unerschütterlichem Gleichmut setzen sie die Hufe auf den endlosen Weg, der sich Kehre um Kehre den Berg hinaufwindet, kurz vor dem Gipfel jedoch stark abfällt und in einer torkelnden Linie zwischen ineinander verkeilten Granitplatten nach unten führt. Am Scheitelpunkt des Weges halten die Männer kurz inne. Unter ihnen liegt der Kalksteinbruch, eine klaffende weiße Wunde im Fels der gegenüberliegenden Wand. Sie haben ihr Ziel nun beinahe erreicht. Gemächlich schreiten sie voran, atmen noch einmal durch vor der Aufgabe, die groß genug ist für sie, vor der Mauer, die sie bauen werden, mit fünfzig Armen, fünfzig Händen. Diese drei binden die Maultiere fest. Ihr beiden geht die Bruchkante ab. Du verteilst die Hämmer und Meißel. Die Männer gehen auf die Knie und schlagen die Steine. Es gibt nichts zu reden. Die Hammerschläge hallen durch den Bruch, die Maultiere stehen mit den Köpfen beisammen und atmen mit geblähten Nüstern die brennende, mit Kalkstaub versetzte Luft, die Ohren zucken im Rhythmus der Hammerschläge, sonst regt sich nichts, die Sonne steht senkrecht über dem Bruch und sengt wie zur Strafe.
Im Rhythmus der Hammerschläge.
Die Männer stapeln die Steine hinter sich, diese zehn bilden eine Kette und geben die Steine weiter, diese beladen die Säcke, diese führen die Maultiere ins Dorf zurück. Das Dorf ist arm, es hat nur fünf Tiere. Der Weg muss mehrfach gemacht werden, zweimal noch an diesem Tag. Die Zurückgebliebenen setzen sich in den Schatten der Bruchkante und trinken die Milch, essen das Brot, den Käse, die Wurst, trinken den Schnaps, geben die Flasche wortlos weiter, einen Rest lassen sie übrig für die Maultierführer. Die Gesichter der Männer sind staubbedeckt, ihre Münder sind staubbedeckt, bis die Milch über ihre Lippen fließt, der Schnaps. Im Schatten kehren die Gedanken zurück: die Ernte, die Herde, die Frau des Vordermanns. Das kühle Laken auf der nackten Haut. Sie sind schon müde, schon nach der ersten Runde, ihr da, nehmt die Hämmer und Meißel und schlagt die Steine heraus. Langsam wandert die Sonne über den Bruch. Die Maultiere kehren zurück, die Maultierführer trinken den Schnaps aus, essen das Brot, den Käse, die Wurst. Die Hammerschläge werden schwächer. Die Maultiere ziehen ab, kehren zurück. Vor Einbruch der Dämmerung muss alles getan sein. Die Sonne ruht wie ein glühender Ball auf der Spitze des Berges. Die Männer packen Hämmer und Meißel ein und beladen die Maultiere ein letztes Mal. Sie kennen den Weg, nichts fällt ihnen ins Auge, kein Geräusch beunruhigt sie. Die Müdigkeit verschließt ihre Sinne, und die Männer lösen sich voneinander, steigen auf in einzelnen, schimmernden Blasen, die vom aufkommenden Wind in alle Himmelsrichtungen zerstreut werden, über die rot leuchtenden Hänge und die gezackten Schatten der Gipfel, Traumblasen, in denen die Männer schwerelos und mit weit geöffneten Augen gegen die eigene Achse rotieren, Abendembryonen im warmen Licht der untergehenden Sonne. Sie sind ein wenig zu langsam, ein wenig zu spät. In dem düsteren Licht verliert ein Maultier den Tritt und stürzt über die Kante der Halde, kein Laut dringt aus dem Maul des Tieres, ein stummer, überraschter Schrecken, die Beine zappeln hilflos im Geröll, während der mit Steinen beschwerte Körper langsam die Halde hinunterrutscht, staunende, zum Abschied geöffnete Augen. Wie im Traum gleitet das Tier ins Wasser. Das Gewicht der Steine zieht es sofort nach unten, die aufgewühlte Oberfläche beruhigt sich bereits, da reißt das Tier in einer letzten, verzweifelten Anstrengung noch einmal den Kopf hoch und schreit, schreit nun doch, ein schriller, zum Himmel gerichteter Schrei, der die feine Haut der Blasen mit Leichtigkeit durchdringt und platzen lässt, sodass die Männer krachend herabstürzen, zum Rand der Halde stürzen, suchend ins dunkle Wasser hinabspähen. Das Maultier ist verschwunden. Wortlos setzen die Männer ihren Weg fort. Hinter der nächsten Biegung warten die Lichter des Dorfes, warten die Frauen, die Kinder, die zu den Männern hinaufsehen. Ein Rauchfaden, eine dünne, um ein Glied verkürzte Fadenkette, die aus dem Gebirge zurückkehrt. Noch bevor die Männer das Dorf erreichen, gehen die Frauen in die Häuser zurück. Es genügt zu wissen, dass sie heimkehren, das Essen kann jetzt auf den Tisch, das Brot, der Schnaps. Draußen rennen die Kinder ihren Vätern entgegen, ein Mädchen zählt die Maultiere: eines weniger. Vier Tiere hat das Dorf noch. Das Mädchen legt eine Hand auf die Nüstern der Tiere, die vor Anstrengung zittern, flüstert ihnen etwas zu, ein Wort des Trostes oder eine kleine Grausamkeit: Ihr seid nur noch vier. Die Männer schnallen die Säcke von den Rücken der Maultiere und legen die Steine am Fuß des Hangs ab. Es ist ihre letzte Arbeit des Tages. Am frühen Morgen werden sie aufstehen und die Steine sortieren, werden einen spatenblatttiefen Graben ausheben und zu einem Drittel mit Sand auffüllen, werden die Schnur parallel zum Hang spannen und die größten Steine mit einer leichten Neigung zum Hang auslegen, werden lehmigen Sand in die Zwischenräume füllen und die nächste Reihe mit versetzten Fugen setzen, werden die Steine mit dem Hammer festklopfen und nach jeder Reihe mit Sand hinterfüllen, werden jeden zehnten Stein quer zur Mauerrichtung setzen, um die Mauer mit dem Hang zu verzahnen. Die Männer werden eine Mauer bauen. Die Mauer hat ein Leben und zwei Tage Arbeit gekostet, und sie wird das Dorf vor dem Hang schützen, wenn der Regen kommt.
Der Regen kommt, und wir springen von der Mauer, auf der wir gesessen haben, und rennen zu der großen Kastanie in der Mitte des Dorfplatzes. Um den Stamm der Kastanie verläuft eine hölzerne Bank, wir setzen uns so, dass wir in alle Richtungen sehen können, setzen uns auf die Lehne und lehnen uns an den Stamm. Ada sieht auf die Mauer und auf den Hang, der sich dahinter erstreckt. Cass sieht auf die weißen, schief stehenden Häuser und auf die Straße, die sich in die Berge hinaufwindet. Lilianne sieht auf das Bahnhofsgebäude und auf die große Uhr mit den römischen Ziffern. Séraphine sieht auf die Gleise, die ins Tal führen, und streicht sich die Haare aus dem Gesicht. Ich sehe die abfallenden Wiesen, die vielfarbigen Blumen, rot und blau und gelb, die Ziegen, die die Blumen und das Gras fressen. Viel mehr ist es nicht. Der Hang. Die Straße. Die Uhr. Die Gleise. Wir leben hier, seit wir geboren sind. Im Winter liegt der Hang unter einer geschlossenen Schneedecke, im Frühling fließt der Schlamm durch die Straße, im Sommer glänzen die Gleise wie zwei goldene Bänder, und die Uhr schlägt zum Herbst, am Morgen des Erntefests. Wir pflücken Blumen von der Wiese und flechten Blumenketten. Wir bauen Schlitten aus Stroh und Holz und fahren den Hang hinunter. Wir balancieren auf den Gleisen, bis unsere Füße brennen und das Dorf hinter uns verschwindet. Die Uhr schlägt zu jeder vollen Stunde, seit wir geboren sind. Auf der Straße ist kein Mensch. Der Regen trommelt auf die Blätter der Kastanie, hoch über unseren Köpfen, weit weg. Wir aber bleiben trocken wie in einem Haus. Ich schließe die Augen und stelle mir vor, wie sich die Bank zu drehen beginnt, langsam und ruckelnd zunächst, wie ein rostiges Kinderkarussell, die Jahrmarktsmusik ein blechernes, überdrehtes Scheppern, dann immer schneller, ich reiße die Augen auf, die Farben verwischen, der dunkle Hang schmiert durch die weißen Häuser, feine gelbrotblaue Blütenstriche, in die Länge gezogene Ziegen, gleislange Ziegen, die goldenen Bänder ein Planetenring. Ada geht als Erste. Sie küsst uns auf die Wangen, ihre Lippen sind weich wie Kissen, ihr Vater arbeitet im Steinbruch wie alle hier, ihre Mutter ist nach vier Kindern ausgetrocknet. Mit ihren drei Geschwistern schläft Ada in einem großen Zimmer, dessen Fußboden immer mit Kalkstaub bedeckt ist, den ihr Vater mit nach Hause bringt. Ihre Mutter ist mit Kalkstaub bedeckt. Eine kreideweiße Frau mit trockenen Lippen, sie hat keine Liebe mehr für Ada übrig, braucht alles selbst, das letzte Wasser, um nicht zu verdursten. Ada geht aufrecht durch den Regen, beinahe stolz. Sie ist die Stärkste von uns, stößt die Böcke um wie keine andere. Wo wir zwei Hände brauchen, um die Steine umzudrehen, nimmt Ada zwei Finger. Sie liebt es, mit diesen Fingern durch Liliannes Haare zu fahren. Liliannes lange, schwarz glänzende Haare, die sie uns immer wieder anbietet, aber nur Ada hat Interesse daran, streichelt sie, küsst sie, fährt mit ihren großen Fingern hindurch, die wie Zangen die Steine packen und hochheben. Lilianne springt von der Bank herunter und rennt Ada hinterher. Sie wird Ärger mit ihrem Vater bekommen, weil sie sich die Schulbücher mit einer Hand über den Kopf hält, um ihre Haare zu schützen, und die Bücher nass werden. Sie wird die Bücher vor ihrem Vater verstecken, und ihr Vater wird sie fragen, wo die Bücher sind. Lilianne wird irgendeine Geschichte erfinden, um die Schuld von sich zu nehmen, aber ihr Vater wird ihr nicht glauben. Sie werden in den Keller gehen. Lilianne wird mit dem Gesicht zur Wand sitzen, und ihr Vater wird hinter ihr stehen. Beide werden sich für Stunden nicht bewegen. Dann wird ihr Vater noch einmal fragen, wo die Bücher sind, und Lilianne wird es ihm sagen. Die Seiten der Bücher werden wellig sein und voller Wasserflecken. Ihr Vater wird mit Bedauern über die Bücher streichen und Lilianne im Keller sitzen lassen bis tief in die Nacht. Lilianne wird Ada davon erzählen, während Ada mit ihren langen Fingern Liliannes Haare kämmt. Händchen haltend gehen sie durch den Regen, nur um Cass ein wenig zu ärgern. Die Eifersucht von Cass: Sie versucht sie zu unterdrücken, aber sie frisst sich durch ihr Gesicht. Nachts mahlen ihre Zähne aufeinander, am Morgen spuckt sie kalkigen Schlamm ins Waschbecken wie ihr Vater, wenn er aus dem Steinbruch kommt. Ihre Zähne werden stumpf davon, und sie kann nicht mehr richtig kauen. Deshalb schneidet Cass ihr Essen in winzige Stücke, die sie im Mund zu Brei verarbeitet und herunterschlingt. Sie ist auf alles und jeden eifersüchtig, vielleicht weil sie selbst nichts hat. An manchen Tagen behält sie den Brei länger im Mund, bis zum Abend, schiebt ihn mit der Zunge unter Ober- und Unterlippe, füllt die Wangen damit, bis sie aussieht wie ein Hamster. Dann legt sie sich ins Bett und lässt den Brei genüsslich mit geschlossenen Augen auf der Zunge schmelzen, obwohl er schon längst nach nichts mehr schmeckt, schläft ein darüber und träumt Schlaraffenlandträume, in denen ihr das Essen in den Mund fliegt. Der Brei trocknet in ihren Mundwinkeln, am Morgen hat sie wieder nichts. Cass springt von der Bank herunter und rennt Ada und Lilianne hinterher. Der Regen hat nachgelassen, das Trommeln wird leiser und verklingt schließlich ganz. Séraphine sieht auf die Gleise und streicht sich die Haare aus dem Gesicht. Arme, kleine, dumme Séraphine. Sie hat den Kopf schief gelegt, und ich versuche zu glauben, dass sie über die Gleise nachdenkt, ob sie ans Meer führen oder in eine große, glitzernde Stadt oder unendlich weiter, durch alle Tage und Nächte hindurch, bis ans Ende der Welt. Séraphines Augen sind zwei flache, von einem leichten Dunst überzogene Teiche aus wässrigem Blau. Der Schlaf kommt schnell über diese Augen. Séraphine blinzelt und klettert von der Bank herunter, macht drei Schritte in Richtung der Gleise, bevor sie sich umdreht und ohne Eile Ada, Lilianne und Cass hinterhergeht, die hinter der Biegung am Ende der Straße verschwunden sind.
Ich bin allein.
Ich will nicht nach Hause gehen, wo mein Vater ist. Über dem Hang bricht die Sonne durch die Wolken, die nasse Straße explodiert in dem plötzlichen Licht, die Uhr schlägt zur vollen Stunde. Der Hang. Die Straße. Die Uhr. Die Gleise führen bis ans Ende der Welt. Ich schließe die Augen, und das Karussell beginnt sich zu drehen, die Gesichter verwischen, die Körper der Ziegen ziehen sich in die Länge, endlose, schwarzgraue Flanken zwischen den goldenen Bändern der Gleise. Ich reiße die Augen auf, und die Welt steht still. Vor mir tritt der Bock aus dem Gasthaus neben dem Bahnhof. Er überquert den Dorfplatz, seine Gestalt ist leicht nach links geneigt, obwohl er den Koffer nicht bei sich hat. Er sieht sich um, und ich sinke zusammen, verharre auf der Bank wie ein im Halbdunkel lauernder Vogel, bis der Bock sich abwendet und nach einem kurzen Zögern in der Straße verschwindet, die hinauf in die Berge führt.
2
Natürlich bemerkte Georg Musiel, dass das Mädchen ihm folgte. Er ging schneller, und das Mädchen ging schneller, er wurde langsamer, und auch das Mädchen verlangsamte den Schritt, er sah es mit einem kurzen Blick über die Schulter, das Mädchen war zehn Meter hinter ihm. Vielleicht würde sie in einem der letzten Häuser verschwinden, aber dann war er aus dem Dorf heraus, und das Mädchen war immer noch da. Er tat so, als störe es ihn nicht, und blickte voraus in die Berge, auf das gute Stück Weg, das vor ihm lag. Um ihn herum sickerte, tröpfelte, rauschte das abfließende Wasser, Geräusche eines Nachgeschehens, nachträgliche Anmerkungen zum eigentlichen Regen, den er am Fenster seines Zimmers im Gasthaus verbracht hatte, an dem kleinen Tisch, der dort stand, die Unterlagen, die ihm Generaldirektor P. zur Ansicht mitgegeben hatte, aufgeschlagen vor sich. Er hatte seinen Kopf in die Hände gestützt, der Regen ein grauer Vorhang, der die Welt vor ihm verbarg. In dem Zimmer war es warm gewesen, sodass er die mitgebrachte Decke nicht gebraucht hatte, die er sonst oft um die Beine schlug, wenn er in seinem Büro am Schreibtisch sitzend fror. Er blätterte in den Unterlagen bis zu der Karte des Dorfes und der umliegenden Gebiete. Aus der Küche stieg der Geruch von gebratenen Zwiebeln. Vor ihm auf dem Tisch lagen wohlgeordnet die Salben, die er aus seinem Koffer genommen hatte. Er streckte die Beine aus und studierte den Weg, den er, sobald der Regen nachgelassen hatte, gehen wollte, um Gelenke und Muskeln zu lockern. Die Zugfahrt steckte ihm noch in den Knochen. Auf der topografischen Karte war die Bahnstrecke als schwarze Linie verzeichnet, das Dorf ein gelber Fleck, die Straßen darin weiß, der Bahnhof, an dem er angekommen war, ein roter Balken am Rande des Dorfes. Mit dem Finger fuhr er über die blaue Linie, die den Fluss markierte, in Richtung Norden. Dort würde er entlang müssen. Mühelos durchschnitt sein Finger die eng zusammenstehenden Höhenlinien, folgte ihnen für eine Weile, weil der Fluss eine Biegung machte, verharrte an einer Geländekante, wo die Böschung steil abfiel. Der Steinbruch war ein grau unterlegtes, weiß gepunktetes Quadrat in der Flanke des Berges. Nirgendwo stand ein Name, wie er es von anderen Karten kannte. Er suchte im Vertrag und in den Anhängen, aber auch dort fand er die Bezeichnung nicht. Ein Ratschlag des Generaldirektors P. kam ihm in den Sinn:
»Nehmen Sie die Dinge, wie sie sind, Herr Musiel.«
Er nickte und hob den Blick zum Fenster.
Der Dorfplatz war leer, obwohl es aufgehört hatte zu regnen.
Sie gingen nun schon eine ganze Weile zusammen.
Das Mädchen folgte ihm im immer gleichen Abstand, kam nie ganz nahe heran und blieb nie weit zurück, als hielte sie ihn, seit er aus dem Gasthaus getreten war, an einem elastischen Band im Zaum. Sie war schlank, mittelgroß, trug ein graues, einfaches Kleid, das viel besser für die Berge geeignet war als sein Anzug, den er nach seiner Ankunft noch nicht gewechselt hatte. Ihre dunklen Haare waren zu einem Pferdeschwanz gebunden. Als er sich umdrehte und sie direkt ansah, stockte sie kurz, und ihr Blick floh über ihn hinweg in die schwarzen Wolkenformationen, die immer weiter aufbrachen und gleißendes Sonnenlicht über die Gipfel strömen ließen.
Georg nahm es, wie es war.
Die Hitze unter seinen Armen.
Den steiler ansteigenden Weg.
Das Mädchen, das ihn verfolgte.