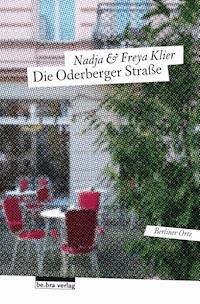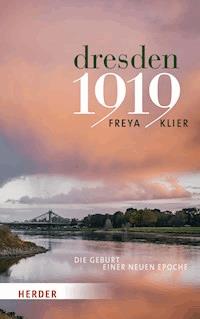Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Sieben Kinder – sieben Schicksale. In ihrem bewegenden und aufwühlenden Buch zeichnet Frey Klier Flucht und Vertreibung von sieben Kindern aus Ostpreußen nach. Nach siebzig Jahren des Schweigens erhalten diese sieben Menschen endlich die Gelegenheit, ihre Stimme zu erheben und die eigene Geschichte zu erzählen, beginnend mit dem Sommer 1944 bis hinein in unsere Gegenwart. Aus der Komposition der Stimmen erwächst ein so noch nie zu lesendes Panorama der letzten Kriegsmonate. Ein ergreifendes Zeugnis und Buch für eine ganze Generation – und deren Nachkommen!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 515
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Freya Klier
Wir letzten KinderOstpreußens
Zeugen einer vergessenen Generation
Titel der Originalausgabe
Wir letzten Kinder Ostpreußens
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2014
ISBN 978-3-451-30704-1
Um ein Nachwort erweiterte Taschenbuchausgabe
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2017
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Designbüro Gestaltungssaal
Umschlagmotiv: © dpa Picture-Alliance
ISBN (Buch) 978-3-451-06843-0
ISBN (E-Book) 978-3-451-80206-5
Inhalt
Die Störche ziehenSommer 1944
Der FeuersturmHerbst 1944
Die große Winterschlacht1945
Sie sind da1945
Frau, komm!1945
Kriegsende. Aber nicht für Ostpreußen1945
Stilles Sterben1946
Spezialisten müssen noch bleiben!1947
Die letzten Kinder Ostpreußens1948
In einer anderen Welt1949
Aufbruchsfieber in der OstzoneDie 1950er-Jahre
Hippies gegen Faltenrock-Ordnung1960er-Jahre
Königsberg von sehr weit oben1970/80er-Jahre
Sehnsuchtstouristen1990er-Jahre
Hoffen auf Immanuel Kant21. Jahrhundert
Dank
Literatur
Nachweise
Nachwort
Die Störche ziehen
Sommer 1944
„Noch einmal, ehe die Kriegswalze darüber hinwegging, entfaltete sich meine ostpreußische Heimat in ihrer ganzen rätselvollen Pracht. Wer die letzten Monate mit offenen Sinnen erlebte, dem schien es, als sei noch nie vorher das Licht so stark, der Himmel so hoch, die Ferne so mächtig gewesen. Und all das Ungreifbare, das aus der Landschaft heraus die Seele zum Schwingen bringt, nahm in einer Weise Gestalt an, wie es nur in der Abschiedsstunde Ereignis zu werden vermag …“
Mit diesen berührenden Worten erinnert der Arzt Hans Graf von Lehndorff in seinem Ostpreußischen Tagebuch an jene Wochen im Sommer 1944, die der Katastrophe unmittelbar vorausgehen. Er beschreibt die Unruhe der Bewohner im östlichsten Teil der Provinz.
Bis vor kurzem noch galten die Gebiete jenseits von Oder und Neiße als die sichersten in Deutschland: Sie waren Aufmarsch- und Durchzugsgebiet der Wehrmacht – die Schlachten fanden woanders statt. Nach Ostpreußen kamen die Evakuierten, wenn im Ruhrgebiet, in Hamburg oder Berlin die Bomben fielen …
Über die Gebiete Europas, die jenseits der Grenze von Ostpreußen liegen, ist die Katastrophe längst schon hereingebrochen. Sie kam zunächst über Polen, das im September 1939 mit Hitlers Vorgabe „Härte gegen alle Erwägungen des Mitleids“ überfallen wurde. Polen ist inzwischen zerschlagen, die polnische Intelligenz durch Himmlers Truppen weitgehend „ausgerottet“. Und wurde die Beute zunächst mit Stalin, dem bolschewistischen Erzfeind, geteilt, so ist die Sowjetunion seit 1941 nun selbst Aufmarschgebiet von drei Millionen Soldaten der Wehrmacht, von Polizeieinheiten und Verbänden der Waffen-SS.
Was sich im Osten neben den Jubelmeldungen im Volksempfänger tatsächlich abspielt, wissen allein die Soldaten der Wehrmacht, Himmlers SS- und Polizeieinheiten, wissen die im Generalgouvernement und später in Weißrussland eingesetzten deutschen Zivilinstanzen, die Akteure in den Vernichtungslagern, Eisenbahner, die Fahrpläne Richtung Osten zusammenstellten …
Längst sind das Baltikum, Weißrussland und die Ukraine durchkämmt – sind Juden, „Zigeuner“ und eine Vielzahl „slawischer Untermenschen“ zwischen Ostsee und Karpaten vernichtet. Oft fanden die Mordorgien mit Hilfe von Freiwilligenverbänden aus den besetzten Gebieten statt.
Haben die Zivilisten Ostpreußens, auf die nun die Rote Armee zuwalzt, eine Ahnung davon, was die Menschen im Osten seit Jahren erleiden müssen? Haben sie eine Vorstellung davon, in welchem Tempo beispielsweise im September 1941 in der Schlucht von Babi Jar 34000 Juden aus Kiew ermordet wurden?
Den Massenerschießungen im Baltikum, in Weißrussland und Teilen der Ukraine, an denen sich auch Einheiten der Wehrmacht beteiligten, fielen in den ersten Monaten nach dem Überfall rund eine halbe Million Menschen zum Opfer …
Was wissen die Bewohner Ostpreußens von Leningrad, der zweitgrößten Stadt Russlands, die erst im Januar dieses Jahres endgültig befreit werden konnte?
Die Überlebenden von Leningrad sind schwer traumatisiert.
Im ersten, eisigen Winter 1941/42 ließ die Heeresgruppe Nord der Deutschen Wehrmacht, welche die Großstadt umzingelt hatte, zweieinhalb Millionen Menschen – darunter etwa 400000 Kinder – ohne Nahrung, ohne Wasser, ohne Licht, ohne Strom, ohne Heizung und ohne Kanalisation. Leningrad lag über Monate dunkel und kalt wie die Tundra. Das häufigste Geräusch in dieser Zeit waren die Kufen von Kinderschlitten, auf denen steif gefrorene Tote auf die Zufahrten zu den Friedhöfen gebracht wurden. An die Friedhöfe selbst kam man schon bald nicht mehr heran, weil Leichenberge die Wege versperrten …
Bereits im ersten Jahr der Blockade starben in Leningrad, dem früheren St. Petersburg, schätzungsweise 470000 Frauen, Kinder und Männer. Sie starben durch Hunger und Kälte, durch Bombardements und Artilleriebeschuss. Bis Ende des Jahres 1941 warf die deutsche Luftwaffe fast 70000 Brand- und Sprengbomben über der Stadt an der Newa ab, wobei gezielt Kindergärten, Schulen, Betriebe und Straßenbahnhaltestellen bombardiert wurden, um die Bevölkerung zu demoralisieren. Als Leningrad im Januar 1944 durch die Rote Armee befreit wurde, hatte Hitlers Luftwaffe mehr als 100000 Brandbomben über der Stadt ausgeklinkt …
Keine Grausamkeit lässt sich durch eine vorher begangene rechtfertigen. Doch weisen die Grausamkeiten von Eroberern auch im 20. Jahrhundert noch beträchtliche Ähnlichkeiten auf. So hat das bevorstehende Aushungern der ostpreußischen Bevölkerung durch die Sowjets seinen Vorlauf unter anderem in Leningrad – als nationalsozialistische Strategie im „Generalplan Ost“, in der das Verhungern von etwa dreißig Millionen „Untermenschen“ von vornherein eingeplant war.
Nicht nur Menschen, auch unwiederbringliches Kulturgut wurde vernichtet: So löschte ein Bombenangriff auf die Eremitage im Jahr 1942 die gesamte jüdische Stammesgeschichte der über die Welt verbreiteten Schapiro-Sippe aus, die sich zurückverfolgen ließ bis zu Kalam, dem Goldschmied des Königs Salomon. Hunderte von Dokumenten auf Pergament und Papier, von Zeugnissen und Notizen, Tagebüchern, Urkunden, Urteilen, Gnadengesuchen und Eigentumsbescheinigungen, Enteignungsbefehlen, Freibriefen, Geburts- und Einbürgerungsurkunden, Schenkungs- und Ehrenurkunden, Ehe- und Pachtverträgen, Sterbeurkunden, Begräbnisbescheinigungen, kleinen Gegenständen, Familienbildern, Zeichnungen und Porträts aus vielen Ländern und allen Zeiten wurden in einer einzigen Nacht zerstört.
Mögen die Schätze der meisten Überlebenden wesentlich bescheidener gewesen sein – ihr Verlust schmerzt nicht weniger.
Nichts von all diesem Grauen ahnen Bauer Possienke und seine Frau – sie haben keinen Sohn, der auf Heimaturlaub hätte einiges andeuten können, der gefallen oder vermisst ist oder sich jetzt im Zug ausgemergelter Gestalten in russische Gefangenschaft schleppt. Bauer Possienke und seine Frau haben drei kleine Mädchen – vier, sechs und acht Jahre alt. Sie bewirtschaften einen größeren Bauernhof – mit etwa vierzig Kühen, mit Pferden, Schweinen und Gänsen, die zwischen den Kindern über den Hof schnattern.
Der Bauernhof der Familie liegt in Schuditten, einem sehr kleinen Dorf, in dem es weder eine Schule noch eine Kirche gibt. Schuditten ist ein altes Dorf, noch aus der Pruzenzeit stammend. Und dass Familie Possienke sich von der Roten Armee nicht sonderlich bedroht fühlt, liegt daran, dass die russisch-litauische Grenze hier scheinbar weit weg ist: Schuditten befindet sich dreißig Kilometer westlich von Königsberg. Ebenfalls nur dreißig Kilometer sind es bis Pillau; die Küste ist also nicht weit, die Samland-Bahn passiert direkt das Dorf.
Brigittes Vater ist nicht nur Landwirt, sondern auch Bürgermeister der etwa 400 Seelen, die Schuditten bewohnen. Er fühlt deutsch-national wie fast alle Bauern des Dorfes, doch für Politik fehlen ihm aufgrund seines großen Hofes Zeit und Interesse – um dieses Thema kümmert sich der Ortsbauernführer.
Die vierjährige Brigitte, das jüngste der drei Mädchen, wird sich später dunkel daran erinnern, hier 1944 – noch fernab allen Kriegsgeschehens – eine glückliche Zeit erlebt zu haben: Gerade waren Onkel und Tanten zu Besuch. Und wie immer gab es unter den Kindern die üblichen Geschwister-Reibereien, wollten doch die beiden größeren Mädchen mal wieder nicht mit ihr spielen, weil sie noch nicht richtig mithalten konnte …
Es geht im Sommer 1944 auf dem Hof von Possienkes zu wie in vielen anderen Familien auch – Familien, die keinen Sohn im Krieg haben, um den sie bangen müssen, oder die aus rassischen bzw. politischen Gründen verfolgt werden.
Seit dem 22. Juni 1944 befindet sich die Rote Armee in einer Großoffensive, die bereits dramatisch die Situation verändert hat: Die zahlenmäßig weit überlegenen sowjetischen Truppen – seit 1943 verstärkt durch polnische Divisionen – fügen der Wehrmacht immer empfindlichere Verluste zu und rücken bis an den östlichen Saum Deutschlands vor. Verlief die Frontlinie zunächst quer durch Polen und dicht an der Grenze zu Ostpreußen entlang, so erreicht die 5. Sowjetische Armee zwei Monate später, am 17. August 1944, die ostpreußische Grenze.
Der Krieg wird damit für die Zivilbevölkerung Ostpreußens zur bitteren Realität. Seit Juli werden die Bewohner des Memellandes evakuiert. Die Straßen östlich von Königsberg füllen sich außerdem mit Flüchtlingen aus Litauen. Durch die erntereifen Felder streift immer mehr herrenloses Vieh …
Die Unruhe unter denen, die sich noch nicht auf den Weg gemacht haben, nimmt von Tag zu Tag zu: Bleiben oder Gehen? Niemand darf es wagen, seine Befürchtungen offen zu äußern. So starren die Menschen zum Himmel, an dem die Störche bereits ihre Kreise ziehen, und fragen sich: „Ihr zieht jetzt fort – und wir? Was soll aus unserem Land werden?“
Der elfjährige Günter Kropp, 1933 in Stallupönen geboren, kann die Bedrohung noch nicht so recht nachvollziehen. Er wächst auf einem Bauernhof in der Nähe von Rauschendorf auf, im tiefen ostpreußischen Land. Stallupönen liegt an der Bahnstrecke Königsberg-Insterburg-Gumbinnen-Eydkau und somit ziemlich dicht an der nur siebzehn Kilometer entfernten litauischen Grenze, hinter der sich derzeit die Truppen der Roten Armee massiv zusammenziehen. Seine Eltern und Großeltern sind beunruhigt – auch sie bewegt die schwerwiegende Frage des „Bleiben oder Gehen“ … Intensiv denken sie über eine mögliche Flucht nach, doch wie soll das gehen? Kropps haben sechs Milchkühe, Günters Vater hat sich auf Milchlieferung spezialisiert. Da sind pro Tag etwa sieben 20 -Liter-Kannen zu melken. Auch in diesem Sommer 1944 wird die Milch täglich von den verschiedenen Dörfern abgeholt …
Günter ist ein hoch aufgeschossener Junge, der sehr langsam spricht und ausgesprochen gutmütig ist. Sein kleiner Bruder ist drei Jahre alt. „Es soll ein großer Aufmarsch feindlicher Soldaten hinter der siebzehn Kilometer entfernten Grenze stattfinden“, versucht er, dem kleinen Bruder zu erklären, aber es stellt sich dabei kein Gefühl von Angst ein – Günter kennt keine Bedrohung. Der Hof liegt einen Kilometer vom nächsten Dorf entfernt und ist komplett umrundet von den eigenen Feldern.
Auf dem Hof wohnen drei Generationen friedlich zusammen. Das Leben hier verlief bisher konfliktarm. Es kam öfter mal Besuch auf den abgelegenen Hof, was immer eine gute Abwechslung war. Und als einmal eine Cousine der Mutter aus dem Ruhrgebiet eintraf, war das ein ganz besonderes Ereignis.
Im Winter wiederum musste Familie Kropp immer zusehen, den Kontakt zum Dorf nicht zu verlieren:
„Der Schnee war ja manchmal einen dreiviertel Meter hoch, das musste man sich auf dem abgelegenen Bauernhof freischaufeln. Manchmal waren die Schneewehen noch höher.
Wir hatten Pferde, auch Hühner, Schweine und Kühe und natürlich Hunde und Katzen. Im Kuhstall gab es eine Pumpe. Und Vater hat im Kuhstall eine Tränke bauen lassen, wodurch die Kühe auch im Winter so viel saufen konnten, wie sie wollten. Die Pferde wurden getränkt, die Schweine bekamen Gerstenschrot, Haferschrot und Kleie.“
Gut kamen Kropps bisher mit dem anstrengenden Alltag auf dem Land zurecht, mit dem harten, trockenen Winter und dem meist heißen Sommer:
„Nur einen Steinwurf von uns entfernt waren die Trakehner, die berühmte Pferdezucht. Die Tiere blieben kräftig und leistungsfähig bei diesem ostpreußischen Klima. So waren wir Menschen auch.“
Die Bauernfamilie baut seit Generationen an, was sie für sich selbst und die Tiere braucht. Hinzugekauft werden müssen lediglich Zucker, Salz und Textilien. Ansonsten sind Kropps komplette Selbstversorger und so eine Art Vorläufer der Bio-Bauern:
„Wir hatten Roggen, Weizen, Hafer, Gerste, Erbsen, Rüben. Kartoffeln bauten wir an, das war unsere Hauptnahrung. Nudeln haben wir selbst gemacht, mit Weizenmehl, Eiern und Milch. Da habe ich als Kind mitgeholfen: Der Teig wurde ausgerollt und dann in Streifen geschnitten, quer und längs – das waren die Nudeln.
Was wir sonst gegessen haben? Morgens gab es Brot und Marmelade, manchmal auch Honig. Wenn geschlachtet wurde, gab es frische Leberwurst, ansonsten eingeweckte. Blutwurst gab es, Lungenwurst, Dauerwurst – die hielt bis zum nächsten Schlachten vor Weihnachten.
In der Woche gab es mittags Graupensuppe, Mehlsuppe oder Kohlsuppe – Süßkohl und auch Sauerkohl. Warme Knacker manchmal dazu. Auf jeden Fall kamen wir gut übers Jahr …
Ich erinnere mich noch ganz genau: Am Sonntag gab es den Sonntagsbraten und davor Nudelsuppe. Danach Kartoffeln, Sahnesoße und manchmal Hähnchenfleisch. Nein, gehungert hat bei uns auf dem Hof wirklich niemand.
Geschlachtet haben wir ein Schwein jeweils kurz vor Weihnachten. In der Erntezeit wurde auch mal ein Kalb geschlachtet – das war ja die Zeit, in der wir Leute zur Unterstützung brauchten. Bei der Kartoffelernte zum Beispiel. Danach auch zum Rübenhacken …
Es gab ja damals noch keine Tiefkühltruhen, so wurde alles eingeweckt. Oder geräuchert – Bauchspeck und Wurst. Wir hatten eine Räucherkammer, die hatte Vater gebaut. Und die war groß, darin lagerten wir im Sommer auch die Schinken in Leinensäcken.
Vater verkaufte auf dem Markt in Stallupönen zusätzlich Äpfel, Kartoffeln, Butter und Eier …“
Kropps sind evangelisch, so ging es sonntags bisher immer in die Kirche. Die liegt in Stallupönen zwischen zwei Märkten – dem Ferkelmarkt und dem Adolf-Hitler-Markt. Letzterer ist der Platz, auf dem die großen Aufmärsche stattfinden. Und ein Jahrmarkt mit Karussell, Losbuden und dem jährlichen Auftritt der Hochseil-Artisten mit ihren langen Querstangen. Es sind die „Trabers“, die Günter Jahre später in Berlin-Spandau wieder erleben wird:
„Das war beeindruckend, nicht nur für Kinder. Die Artisten suchten auf dem Jahrmarkt immer Freiwillige, die sich hinübertragen ließen. Keine Ahnung, ob die bestellt waren oder wirklich freiwillig. Es gab aber sicher auch Mutige, die gesehen hatten, dass die Getragenen auf der anderen Seite unversehrt angekommen waren, und die nun eben ihren Mut beweisen wollten, vielleicht vor ihrer Freundin …“
Soweit die ostpreußische Idylle aus der Rückschau eines damals Elfjährigen. Irritierend für Familie Kropp war bisher lediglich das Jahr 1938, als plötzlich etliche Ortsnamen ausgetauscht werden mussten:
„Wir wohnten ja nur siebzehn Kilometer von der litauischen Grenze entfernt. Und da wurden plötzlich 1938 unsere litauisch und polnisch klingenden Namen eingedeutscht. Das war völlig blöde. Pillkallen zum Beispiel wurde in Schloßberg umbenannt …“
Doch dieser Sommer 1944 ist noch irritierender für Günter. Er sollte eigentlich noch in die „Pimpfe“ aufgenommen werden:
„Ich bekam aber keine Einladung mehr, solche Aufnahmen fanden nun wahrscheinlich gar nicht mehr statt. Im Frühjahr 44 waren in unserem Gehöft noch Kinder aus Berlin einquartiert worden – die hatte man verschickt wegen der Bombenangriffe auf Berlin. Inzwischen waren die aber schon wieder zurück, und Schule fand nur noch ganz unregelmäßig statt.
Die Berliner Kinder waren übrigens anders drauf als wir ostpreußischen Landeier: Sie kamen immer in Uniform in die Schule, die Jungs, die Mädchen hatten auch ihre BDM-Schlipse um und solche Trachtenjacken …“
Hat Familie Kropp Angst vor den Russen? Irgendwie schon, doch Günters Großvater erinnert sich auch an Positives. Er ist Mitte fünfzig und arbeitete im letzten Jahr vorübergehend im Torfbruch. Dort hatte er Feindkontakt, wie sich Günter erinnert:
„Das war so eine spezielle Aktion in unserer Gegend, die ging vom Mai bis Juni. Der Torfbruch hieß Sonnenmoor, aber wir Kinder haben dazu immer Teufelsmoor gesagt. Dort wurde der Torf gestochen, und jeder Hof hatte so eine Parzelle, für die man etwas bezahlen musste. Denn das war gutes Heizmaterial.
Es gab dort zwei Pressen und zwei Motoren. Einen Motor bediente ein junges Mädchen, und Großvater bediente den anderen. Und mitarbeiten beim Torfstechen mussten auch etwa acht Russen.
Das waren russische Kriegsgefangene, noch in Uniform. Und die wurden sehr schlecht ernährt. Die hatten immer Hunger. In Schach gehalten wurden sie von einem Wachmann mit Gewehr.
Doch sie mussten ja auch mal austreten, so wie alle Menschen. Dann gingen sie in die Büsche, um ihre Notdurft zu verrichten. Das war ein bisschen abseits. Großvater hat das beobachtet.
Wir hatten zuhause Landbrot, das war vierzig Zentimeter breit. Ich weiß nicht, wie viele Stullen mein Großvater normalerweise mit in den Torfbruch genommen hat. Aber als er das wahrgenommen hat, was die Kriegsgefangenen für einen Hunger hatten – die haben Gras gegessen, Sauerampfer sowieso, alles, was sie für essbar hielten –, dann hat er von nun an zuhause ein paar Stullen mehr in den Rucksack gepackt.
Vater kam einmal dazu, als er so eine große Ladung Brot einpackte, und sagte zu seinem Schwiegervater: ‚Fritz, was ist denn los – bleibst du vierzehn Tage weg oder was?‘
‚Nee‘, sagte mein Großvater. ‚Die armen russischen Jungs haben so einen Hunger …‘
‚Dann sei mal vorsichtig, dass sie dich nicht erwischen‘, warnte Vater ihn. Denn da war ja nicht nur der jeweilige Aufseher – auch der Landrat kam manchmal raus in den Torfbruch oder irgendwelche anderen Leute.
Mein Großvater meinte daraufhin: ‚Wenn die mal austreten gehen, schicke ich jemanden hin zu ihnen, der ihnen dann schnell heimlich zwei halbe Stullen Brot gibt. Ich habe ja im Weltkrieg gegen die Russen gekämpft, ich versteh sie schon ein bisschen und sie mich auch.‘
Das Ganze kam aber dann doch raus. Und von da an hatten sie meinen Großvater auf dem Kieker … Es war eine Zeit der Denunziation, man konnte jederzeit an die Front abkommandiert werden. Oder Schlimmeres …
In Trakehnen war mein Großvater zunächst Pferdepfleger gewesen. Dann hatte er sich selbständig gemacht mit einem kleinen Hof an der litauischen Grenze: Da lief eine ganze Menge mit Schmuggel und so, da war mein Großvater nun mitten drin: Er fuhr zum Beispiel mit einem Pferd im Gespann rüber nach Litauen und kam mit zweien wieder zurück. Das eine hat er dann privat verkauft, und so wurde der Zoll umgangen …
Das Ganze wurde ihm dann aber zu heiß und er verkaufte das Grenzgehöft wieder – und kaufte stattdessen den Hof, auf dem ich nun aufwuchs.
Also, bis 1944 war ich dort glücklich …“
Etwa fünfzig Kilometer Luftlinie entfernt von Stallupönen liegt Mallenuppen – ein ebenfalls ziemlich litauisch klingendes Dorf. Hier erblickte der inzwischen zehnjährige Siegfried Matthus das Licht der Welt:
„Ich bin an einem Freitag, dem 13. April 1934 geboren. In Mallenuppen, einem Dorf in der Nähe der Kreisstadt Darkehmen. Mein Vater hat meine Geburt dokumentiert: An diesem Tag goss er gerade einen Betonpfeiler für die Auffahrt zu unserem Haus. Und in diesen Pfeiler ritzte er ein: 13.4.1934.
Ich war das erste Kind meiner Eltern, und den Pfeiler betrachtete ich später voller Stolz – heute gibt’s den natürlich nicht mehr …
Ich bekam später noch drei Geschwister: Meine Schwester ist 1937 geboren, ein Bruder kam 1939 auf die Welt und der Jüngste 1942.
Meine Mutter war dreizehn Jahre jünger als mein Vater, die beiden hatten sich auf einem Tanzvergnügen kennengelernt. Mein Vater hatte da Musik gemacht und sich in das hübsche Mädchen verliebt. Pünktlich neun Monate nach ihrer Hochzeit kam ich auf die Welt.
Wir hatten eine kleine Landwirtschaft mit Kühen, Pferden, Schweinen, und als Junge habe ich mitgeholfen, Pferdeställe auszumisten, Futter zu holen, Schweine zu füttern – das habe ich selbstverständlich alles mitgemacht …
Das Wichtigste in meiner Kindheit aber war die Musik. Sie hatte großen Einfluss auf mein späteres Leben, auch beruflich. Meine Mutter hat wunderbar gesungen – sie kannte viele Volkslieder, und damit bin ich aufgewachsen. Wir wohnten in einem kleinen Dorf, in dem die Gehöfte inmitten der Felder lagen. Die Frauen, daran erinnere ich mich, haben am Abend oft zusammen gesungen.
Mein Vater wiederum war ein sehr begabter Laienmusiker. Mein Großvater, den ich nicht mehr kennengelernt habe, der war Schneider; er hatte neben dem Bauernhof eine kleine Schneiderei, kombiniert mit einer kleinen Gastwirtschaft. Großvater hatte eine Reihe von Gesellen, die in der Landwirtschaft und in der Schneiderei mithalfen. Und die mussten auch alle ein Instrument spielen! Sodass sie dann – wie mir mein Vater erzählte – noch auf Hochzeiten oder bei Kindstaufen oder Tanzvergnügen spielen konnten.
Die Musik der damaligen Zeit in Ostpreußen bestand aus Polka und Volkslied – und das war meine musikalische Welt, in der ich aufgewachsen bin. Es war Volksmusik – ich glaube, von Bach, Beethoven oder Mozart habe ich in meiner Kindheit noch nichts gehört, jedenfalls nicht wissentlich. Ich war in dieser Mischung aus Volksmusik und den traditionellen Tanzmusiken musikalisch zuhause.“
Wie schon Günter Kropp hat auch Siegfried Matthus 1938 die Umbenennung seines Dorfes erlebt:
„Ich bin noch in Mallenuppen geboren, so steht das auch in meiner Geburtsurkunde. 1938 aber ließ Adolf Hitler – dem das natürlich nicht Deutsch genug klang – die Kreisstadt und unser Dorf umtaufen: Aus Darkehmen wurde Angerapp, nach dem Fluss, der durch die Stadt floss. Und statt Mallenuppen – das kommt eindeutig aus dem Litauischen – hieß unser Ort nun Gembern. Dadurch sind meine jüngeren Geschwister in Gembern geboren, ich aber als Ältester in Mallenuppen.
Wir wohnten etwa drei Kilometer von Darkehmen bzw. Angerapp entfernt, dort bin ich dann später zur Schule gegangen. Und dort wohnten zwei Onkel von mir: Der eine hatte eine Sattlerwerkstatt, dadurch hatten wir als Kinder schöne Ledertornister. Der andere besaß ein Fahrradgeschäft und eine Auto-Reparaturwerkstatt.
Er verkaufte auch Autos … und ist verantwortlich für meine noch immer anhaltende Faszination für Autos.
Was habe ich noch gemacht in meiner Freizeit? Ich bin oft schwimmen gegangen. Später habe ich sogar mein Freischwimmer-Zeugnis gemacht. In einem tümpelartigen Dorfanger habe ich schwimmen gelernt. Da tranken die Kühe nicht nur draus, da machten sie auch rein. Und irgendwelche Leute hatten da alte Töpfe reingeschmissen. Ich habe hier unter dem Knie noch eine Narbe, wo ich mir in dem Tümpel als Kind das Bein aufgerissen habe.
Am schönsten war der Fluss Angerapp – der aber weit an unserem Dorf vorbeiging. Abends, im Sommer, so erinnere ich mich, ist da unsere Mutter mit uns Kindern manchmal baden gefahren. Da muss ich so sechs, sieben Jahre alt gewesen sein. Auch andere Mütter mit ihren Kindern kamen da zum Baden an die Angerapp.
Nur etwa zehn Kilometer von meinem Geburtsort entfernt lag der Ort Nemmersdorf. Nemmersdorf hat dann schon bald eine furchtbare Geschichte gehabt. Im Sommer 1944 war aber von der Tragödie noch nichts zu spüren …“
Auch ein anderer ostpreußischer Junge ist mit Musik aufgewachsen – Michael Wieck aus Königsberg, der in diesem Sommer 1944 sechzehn Jahre alt ist.
Bach und Beethoven wurden ihm in die Wiege gelegt – Michael entstammt einer berühmten Musikerfamilie.
Da sind zunächst seine Eltern: Vor 1933, vor dem Machtantritt der Nationalsozialisten, spielten sie im bekannten „Königsberger Streichquartett“ – die Mutter Bratsche, der Vater die zweite Geige:
„Das Quartett gab Beethoven-Zyklen und konzertierte unter anderem in Berlin. Es führte Hindemiths und Schönbergs Quartette zum ersten Mal auf. Mein Vater“, so erinnert sich Michael, „organisierte alles, er plante die Proben und Konzertauftritte. Sogar einen Bund für neue Tonkunst gründete das ‚Königsberger Streichquartett‘ …“
Beide Eltern unterrichteten nebenbei noch Schüler; zu denen der Mutter gehörte die junge Hannah Arendt, die sich im Sommer 1944 jedoch bereits im amerikanischen Exil befindet.
Michaels Mutter hat ihr großes musikalisches Talent wohl von ihrer Mutter geerbt – die brachte auch dem Enkel das Klavierspielen bei, und Michael erinnert sich, dass die Großmutter über ein absolutes Gehör verfügte. Die großen Namen aber kommen aus der Familie väterlicherseits:
„Mein Vater stammte aus Berlin. Und oft sprach er von seinem Elternhaus, in dem Brahms und Clara Wieck-Schumann – eine entfernte Verwandte – zu Besuch waren. Nicht weit vom geräumigen Haus seiner Eltern stand die Villa der Familie Mendelssohn …“
Namen wehen da aus dem fernen Berlin nach Königsberg, die noch in den 1920er-Jahren ein reiches Kulturleben erahnen ließen: Max Liebermann, Adolph von Menzel, Joseph Joachim mit seinem berühmten Streichquartett …
Doch das ist längst vorbei. Die glückliche und erfüllte Zeit der Familie Wieck liegt etliche Jahre zurück; kaum kann sich der Sechzehnjährige daran erinnern, wann er das letzte Mal uneingeschränkt glücklich war. Der Grund: Familie Wieck gehört zu den Ausgestoßenen, Mutter und Sohn sind permanent gefährdet. Denn Michaels Mutter hat ein jüdisches Elternhaus, und so gehört auch ihr Sohn zu den rassisch Verfolgten. Dass er und seine Mutter 1944 überhaupt noch am Leben sind, verdanken sie dem Umstand, dass der Vater als „arisch“ gilt. Michael ist damit in der Welt der Rassenideologie ein „Mischling ersten Grades“.
Der sechzehnjährige Junge mit dem Judenstern, der selbst schon ziemlich gut Geige spielt, ähnelt mit seiner „arischen“ Erscheinung der Mutter:
Michael Wieck mit seinen Eltern Hedwig und Kurt und seiner Schwester Miriam im September 1929
„Meine Mutter war blond und blauäugig, von kleiner Statur. Doch ihre Bewegungen und auch der Gang wirkten immer großräumig. Obwohl mit gutem Verstand begabt, waren ihr die Gefühle wichtiger. Gefühlvoll sprach, musizierte und handelte sie. Sie war idealistisch, bescheiden und unpraktisch; ganz Musikerin, kaum Hausfrau …“
Der Großvater mütterlicherseits, ein Ingenieur und in Preußen bekannter Regierungsbaumeister, entstammte einer lange zurückzuverfolgenden Rabbinerdynastie. Er starb früh und musste so den nationalsozialistischen Rassenwahn nicht mehr erleben.
Michael und seine Mutter müssen diesen Rassenwahn aushalten, seit mehr als einem Jahrzehnt schon. Deutlich erinnert er sich an den November 1938, als die Synagoge brannte. Er war damals zehn Jahre alt, und die Eltern wachten, dass ihre beiden Kinder Miriam und Michael nicht Augenzeugen des Pogroms wurden:
„Als ich aber wieder auf die Straße gehen durfte, führte mein Weg sofort zur Synagoge. Erschüttert stand ich davor und sah überhaupt zum ersten Mal ein zerstörtes und verbranntes Bauwerk. Dann hörte ich, man habe die Thorarollen auf der Straße verhöhnt und zerrissen. Die Kinder des Waisenhauses wurden in Nachthemd und Schlafanzug auf die Straße gejagt …
Es herrschte eine tiefe Bedrückung. Fast jede jüdische Familie bemühte sich nun um Auswanderung, doch eben in vielen Fällen erfolglos …“
Für Michaels dreizehnjährige Schwester Miriam bot sich im Jahr darauf eine Chance, aus Deutschland herauszukommen: Britische Quäker offerierten Freiplätze, um dreizehnjährige jüdische Kinder in Boardingschools unterzubringen. Die Kosten dafür übernahmen oft anonyme Spender. Michaels Schwester wurde also plötzlich ein Platz in einer schottischen Schule angeboten – die Eltern griffen sofort zu. 1939, als Familie Wieck Miriam mit Gepäck und Geige zum Königsberger Bahnhof brachte, ahnte sie nicht, dass es zehn Jahre dauern würde, ehe sie einander wiedersehen …
Nach der Abreise seiner Schwester vertiefte sich der elfjährige Michael intensiver als bisher in die jüdische Religion. Er verliebte sich, was ihn tief verwirrte. Doch auch vieles andere verwirrte den sensiblen Jungen: So nahmen ihn Bekannte einmal mit in den Königsberger Dom, das war 1941. Bachs Matthäus-Passion wurde aufgeführt. Michael erinnert sich an den überfüllten Dom und an ein überwältigendes musikalisches Erlebnis. Doch da lauerte auch ein belastender Text: Von Judas, der Jesus verriet, sang der Evangelist …, und immer, wenn so eine Passage kam, war er zusammengezuckt.
Michael und seine Mutter sind seit Jahren zwangsverpflichtet in einen Chemie-Betrieb. Sie hoffen, wie auch der Vater, auf eine baldige Befreiung durch die Rote Armee.
Siegfried, Günter und Michael, die drei ostpreußischen Jungen, sind bereits stark durch die NS-Zeit geprägt, wenn auch auf sehr unterschiedliche Weise. Nachhaltig sind die Erinnerungen an ihre glühend nationalsozialistischen Lehrer. Die wenigsten Probleme damit hat noch der zehnjährige Siegfried aus Mallenuppen:
„Von der zweiten Klasse an kam ich in die Stadtschule. Die hatte nun diesen ‚herrlichen‘ Namen Horst-Wessel-Schule. Das war ja mitten in der Nazi-Zeit. Und in dieser Horst-Wessel-Schule wurde viel gesungen, vor allem viele Heimatlieder. Ich kann in Gedanken innerlich wunderbar singen, doch äußerlich ist meine Stimme nicht so besonders. Und so habe ich immer meine 3 oder 4 als Zensur bekommen. Und als unsere Lehrerin eines Tages Geburtstag hatte, bin ich dort mit meinem Akkordeon aufgekreuzt und habe gespielt: Seitdem habe ich von ihr immer eine 1 bekommen …
Das sind so die kleinen Episoden aus der Schulzeit, an die ich mich erinnere. Ich war da so etwa neun, zehn Jahre alt.
Natürlich wurden auch Nazi-Lieder gesungen. Ich war aber in einem Alter, Gott sei Dank, muss ich sagen, in dem ich für den späteren Volkssturm noch nicht in Frage kam. Aber ich habe das alles miterlebt. Das ging ja schon in der Schule los – und zwar sowohl in der Dorfschule als auch in der Stadtschule in Angerapp –, dass wir früh zu Unterrichtsbeginn für Adolf Hitler gebetet haben. So nach dem Motto, der liebe Gott möge unseren Führer beschützen. Des Führers Geburtstag war ein ganz besonderer Feiertag.
Ich erinnere mich gut, was für eine Atmosphäre, ganz auf die nazistische Propaganda ausgerichtet, damals herrschte. Meine Tante hatte zwei Söhne, also meine Cousins, die damals so achtzehn und zwanzig Jahre alt waren.
Die waren zu Beginn der Vierzigerjahre Soldaten. Und ich erinnere mich, wenn sie auf Urlaub kamen, mit welcher Begeisterung – das grenzte schon fast an Fanatismus – sie von ihrem Soldat-Sein und dem Krieg redeten.
Die ganze Atmosphäre um mich herum – also dieses Nazi-Reich – war wie eine Offenbarung. So, als sei der Sohn Gottes wieder auf Erden niedergekommen. Das habe ich als Kind völlig unkritisch aufgenommen, da war eine tiefe, ansteckende Hitler-Gläubigkeit.
Meine beiden Cousins sind dann nicht wiedergekommen … gefallen für Führer, Volk und Vaterland. Das war ein schwerer Schlag für meine Tante und meinen Onkel, trotz ihrer Führergläubigkeit …“
Die Schule, die Günter Kropp aus Rauschendorf besucht, liegt gleich im Nachbardorf:
„Das Dorf lag nur einen Kilometer von unserem Hof entfernt. Dort kamen die Schüler aus vier umliegenden Dörfern zusammen. 34 Schüler waren wir insgesamt, und alle lernten zusammen in einem Klassenraum: Die Kleinen saßen vorne beim Lehrer – und hinten saßen diejenigen, die schon das letzte Schuljahr absolvierten, die waren so dreizehn bis vierzehn Jahre alt. Manche von denen gingen dann aufs Gymnasium, andere lernten einen Beruf, begannen zu arbeiten. Für die Mädchen kam seit 1938 das Pflichtjahr hinzu.
Wir hatten in der Dorfschule nur einen Lehrer, der musste alle Fächer unterrichten. Seine Frau gab den Mädchen lediglich Handarbeit. Für den großen Rest war der Lehrer verantwortlich. Er unterrichtete Deutsch, Rechnen, Erdkunde, Religion, Geschichte und Musik, er spielte sogar Geige. Und dann natürlich Turnen: Der Lehrer wusste, wie es geht, hat aber nicht mitgeturnt.
Unser Lehrer war Mitglied der NSDAP. Und der Lehrer im Dorf daneben war auch Mitglied der NSDAP. Der war besonders stramm: Er trat plötzlich aus der Kirche aus! Das wurde ihm von höheren Funktionären nahegelegt, denn er war auch Mitglied der SA. Und Parteigenossen und SA-Mitglieder sollten ja Vorbild sein. Das war im Jahr 1941 …“
Kurz danach gibt es im abgelegenen Gehöft der Kropps noch eine bezeichnende Episode:
„Mein Vater spielte mit dem Bürgermeister von Rauschendorf, dem Ortsbauernführer und dem besagten Lehrer manchmal Skat. Und eines Abends kam eine Radiomeldung, wie weit die deutschen Truppen bereits auf russischem Gebiet vorgerückt sind. Das war noch vor Stalingrad. Und der scharfe Lehrer, der hieß mit Vornamen Konrad, rühmte bei dieser Nachricht den Vormarsch. Und da sagte mein Vater zu ihm: ‚Conni, wart’s ab – wenn unsere Truppen rückwärts gehen, werden sie noch schneller sein …‘
Daraufhin stand der Lehrer auf, schmiss die Spielkarten hin und zischte: ‚Das lass ich mir nicht gefallen! Das muss ich melden!‘ Daraufhin sagten die beiden anderen: ‚Conni, wenn du das machst, dann ist es aus mit dem Skatspielen, dann spielen wir nie wieder zusammen, dann nicht mehr mit dir!‘
Der Lehrer setzte sich wieder hin, sie tranken alle vier einen zur Verdauung und dann haben sich alle beruhigt …“
Auch 1944 besucht der elfjährige Bauernsohn Günter Kropp aus dem Kreis Stallupönen noch die Einklassen-Schule im nachbarlichen Rauschendorf. Die Stimmung hat sich verschärft, inzwischen ist auch der Fanatismus des eigenen Lehrers gewachsen. Eines Tages wird Günter von seinen Eltern zum Bürgermeister geschickt, um für die Familie einen Schlachtschein zu beantragen:
„Ich bin ins Dorf gegangen, nichts Böses ahnend. Und plötzlich lief mir unser Lehrer über den Weg. Ich bin ausgewichen und habe ‚Guten Morgen, Herr Lehrer!‘ gesagt. Der hat auch ‚Guten Morgen!‘ gesagt. Ich habe mir gar nichts weiter gedacht und bin weitergegangen.
Später dann – ich glaube, es war in politischer Weltkunde – klingelte es zum Stundenbeginn, und ich ging vom Pausenhof in den Klassenraum. Und als die Stunde losging, rief mich der Lehrer beim Namen, ich musste aufstehen: ‚Sag mal, Günter, wer hat dir denn verboten, mit ‚Heil Hitler!‘ zu grüßen?‘, fragte er.
Jetzt habe ich überlegt: ‚Halt, Vorsicht!‘ Mir ist nämlich gleich eingefallen, dass ich ihn getroffen und ‚Guten Morgen!‘ gesagt hatte. Was sollte ich denn nun antworten?
Und der Lehrer bohrte nach: ‚Sag mir doch, wer dir das verboten hat!‘
Ich antwortete: ‚Das hat mir keiner verboten. Aber wenn ich früh aufstehe und auf meine Großeltern treffe oder meinen kleinen Bruder oder meine Eltern, dann sage ich auch immer ‚Guten Morgen!‘ – und die sagen das auch. Und wenn ich aus der Schule komme, sage ich ‚Guten Tag!‘ … Und wenn ich schlafen gehe, sage ich ‚Gute Nacht!‘
Er guckte dann ein bisschen blöd. Wenn ich aber pfiffig gewesen wäre, hätte ich ihn daran erinnert, dass er ja heute Morgen auch ‚Guten Morgen!‘ gesagt hat. Ehrlich gesagt, mir ist das eingefallen, aber ich habe mich nicht getraut, es zu sagen …“
Michael, der Sohn des Musiker-Ehepaares Wieck, musste den Hitler-Gruß-Fanatismus besonders schwer büßen, als er 1935 eingeschult wurde:
„Unglücklicherweise bekam ich eine junge, begeisterte Nationalsozialistin als Klassenlehrerin. Ihr Name war Frau Koske. Sie begrüßte die Klasse mit forschem ‚Heil Hitler!‘, welches wir stehend zu erwidern hatten. Da sie schon bei der Aufnahme der Personalien sofort feststellte, dass in ihrer Klasse ein Junge mit ‚mosaischer‘ Religionszugehörigkeit war, versäumte sie keine Gelegenheit, verächtlich, sogar mit Abscheu, über jüdische Menschen zu sprechen …“
Beim Sprechen bleibt es nicht, der Siebenjährige wird schikaniert, bis er die Demütigungen nicht mehr aushält:
„Einmal stand sie am Ende einer langen Treppe im Innenhaus der Schule. Es war kurz vor Unterrichtsbeginn, und wir mussten alle diese Treppe heraufkommen. Oben angekommen, grüßten wir sie freundlich, wobei einige ‚Guten Morgen‘, andere ‚Heil Hitler!‘ sagten. Als ich ‚Guten Morgen‘ sagte, fuhr sie mich wütend an: ‚Marsch, die Treppe herunter, und dann wollen wir doch einmal sehen, ob du nicht weißt, wie man im Neuen Deutschland seine Klassenlehrerin grüßt.‘
Ich wusste, was sie meinte, und vor meinen neugierigen Klassenkameraden und vielen anderen Jungen kam ich nun die lange Treppe ein zweites Mal herauf; einmal mehr zutiefst verletzt, aber gehorsam, sagte ich oben angekommen: ‚Heil Hitler, Frau Koske.‘
Aber auch das genügte ihr keineswegs. Ihre Macht und das Schauspiel genießend, befahl sie mir, noch einmal die Treppe heraufzukommen und dann gefälligst den rechten Arm zum Gruß zu erheben, ‚wie sich das für einen anständigen Jungen gehört‘. Ich tat auch dies – was blieb mir denn anderes übrig. Meine Mitschüler, in dieser Weise aufgehetzt, fingen an, mich immer mehr zu schikanieren, und wurden nun zunehmend handgreiflich …“
Michaels Mutter meldet den tief verstörten Jungen ab der 2. Klasse in der jüdischen Schule in Königsberg an, und Michael hat nun das Gefühl, in eine andere Welt einzutauchen:
„Hier war alles sehr persönlich und freundlich. Herr Kaelter, der Schulleiter, gebärdete sich nicht wie ein Kompaniechef – das war ich bisher gewohnt –, und mit meinem Eintritt in die jüdische Schule begann eine ganz neue, wichtige Zeit für mich. Wie sehr erfüllte mich der Religionsunterricht, das Hebräisch-Lernen, die jüdischen Feste und die an jedem Freitag abgehaltenen ‚Schabbatstunden‘. Die Klassen waren klein, und Mädchen und Jungen lernten zusammen. Das war damals noch ungewöhnlich. Jetzt gab es keine bevorzugten oder benachteiligten Kinder, nur mehr oder weniger sympathische, wie überall …“
Obwohl allein bis 1939 mehr als 250 antijüdische Maßnahmen erlassen wurden, ist es für den Königsberger Jungen noch ein paar Jahre aushaltbar: Er übt auf der Geige Bach und Mozart, in seiner Schule werden Theaterstücke mit verteilten Rollen einstudiert; es gibt Turn- und Tanzstunden, er besucht die Synagoge … Und mit der Nachbarsfamilie haben die Wiecks ohnehin Glück: Sie lässt sich auch 1944, da es für die deutschen Truppen rückwärts geht, nicht vom Hass anstecken. Der Nachbarssohn kam stets zum Spielen herüber, mitunter in der braunen Uniform des Hitlerjungen.
Es stimmt: Oft verloren die jüdischen Schüler ihren Frohsinn: Mitunter lauerte ihnen das „Jungvolk“ nach der Schule auf, um sie zu verdreschen; dann musste nicht selten jener Lehrer, der zugleich ein trainierter Boxer war, die Schüler befreien. Doch hinterließen solche kleinen Erlebnisse keine bleibenden seelischen Wunden. Noch nicht:
„Später, als wir alle den gelben Stern trugen, musste auch ich mehrmals feige und brutale Überfälle erdulden. Ein wuchtiger Schlag auf meinen ahnungslosen Kopf, ausgeführt von jemandem, der darauf sofort weglief, ist mir als besonders böser Vorfall in Erinnerung geblieben …“
Der Feuersturm
Herbst 1944
Seit Beginn des Krieges gegen die Sowjetunion musste sich Königsberg an Fliegeralarm gewöhnen. Ihm folgte dann meist ein Luftangriff der Sowjets. Die Fernbomber der sowjetischen Luftwaffe verursachten jeweils zahlreiche Gebäudeschäden, und sie forderten fast immer Opfer unter den Bewohnern der Stadt. Doch besaß einer dieser Angriffe ein wirklich existenzielles Bedrohungspotential für Königsberg?
Die siebenjährige Doris Meyer fand Fliegeralarm bisher sogar ein bisschen spannend – im Unterschied zu ihrer Mutter, welche die kranke Oma jedes Mal unter größter Anstrengung vom zweiten Stock in den Keller schleppen muss, in der Sackheimer Straße Nr. 91, im Osten der Stadt:
„Wir saßen oft über Stunden im Keller und redeten über alles, was wir so erlebt hatten. Über die herrlichen Sommer zum Beispiel!
Meine Mutter fuhr nämlich jeden Sommer mit mir und unserer Oma für acht Wochen an die See, in eines dieser mondänen Ostseebäder. Wir mieteten dort ein Zimmer und blieben praktisch den ganzen Sommer über dort. Meine Mutter fuhr ab und zu rein nach Königsberg, um zu gucken, ob Post da ist und ob auch sonst alles in Ordnung ist.
Was ich damals als kleines Kind gar nicht so mitgekriegt habe, denn ich war ja meistens am Strand oder spielte mit Freunden: Meine Mutter war nicht auf Urlaub, sie arbeitete den ganzen Tag. Sie nähte jeweils für die Leute, die uns das Zimmer vermieteten. Mein Vater war im Krieg, und sonst war er Kaufmann, wir waren also nicht reich. Wir hätten uns einen so langen Aufenthalt in einem Ostseebad gar nicht leisten können. Aber weil meine Mutter für die Vermieter den Sommer über nähte, durften wir uns über acht Wochen in diesem Zimmer aufhalten …
Crantz, Rauschen, Georgenswalde – das waren beliebte Urlaubsziele. Einmal genossen wir auch die Sommerfrische in einem Fischerdorf auf der Nehrung: Beeindruckt war ich dort von den Leinen, die von Haus zu Haus gespannt wurden und auf denen die Flundern zum Trocknen hingen …
Außerhalb der Sommer mochte ich besonders die Sonntage. Da Omchen nicht mehr zur Kirche gehen konnte, veranstaltete meine Mutter eine kleine Andacht zuhause. Sie spielte wunderbar Harmonium und las jeweils einen Abschnitt aus der Bibel vor …“
Die Siebenjährige ist ein rundum geliebtes Kind. Sobald sich in der Erwachsenenwelt Misstöne breitmachen, versucht Doris, die Harmonie wieder herzustellen:
„Im Grunde bin ich noch nach preußischem Muster erzogen worden, das kann man sich heute nur noch schwer vorstellen. Diese Werte hatte ich als Kind bereits völlig verinnerlicht – Bescheidenheit, Demut, Dienstbereitschaft, Disziplin, Gemeinsinn … Was noch? Genauigkeit, Kameradschaft, Opferbereitschaft, Ordnung, Pflichtbewusstsein, Sparsamkeit, Toleranz und Gottesfurcht …“
Doris Meyer 1942 mit Großmutter und Mutter in Rauschen
Doch auch Doris hat eine schulische Leidenszeit hinter sich:
„Ich bin nur ein Jahr in die Schule gegangen – dann war Schluss wegen des zunehmenden Fliegeralarms. Die erste Schulstunde war ein Horror. Wir waren etwa vierzig Schüler in der Klasse; so viele Kinder hatte ich noch nie in einem Raum versammelt gesehen, ich war starr vor Verwunderung. Die Lehrerin – eine alte, vertrocknete Person mit einem Haarknoten im Nacken – las in der ersten Stunde uns Kindern das Märchen vom Rotkäppchen vor. Ich kannte alle Märchen, denn mein geliebtes Omchen hatte sie mir öfter vorgelesen – meistens vor dem Einschlafen.
Nun verlangte die Lehrerin, dass ein Kind aus der Klasse dieses Märchen nacherzählen sollte. Da sich kein Kind am ersten Schultag dazu in der Lage sah, rief sie einfach aus ihrem Buch einen Namen auf …, und das war ausgerechnet mein Name: Doris Meyer!
Ich erstarrte und brachte kein Wort heraus. Da forderte sie mich auf, an ihr Pult zu treten, und schlug mir mit dem Rohrstock, der damals noch zum Handwerkszeug eines Lehrers gehörte, mehrmals auf die von ihr verlangten vorgestreckten Hände. Der Schreck und der Schmerz wirkten auf meine Kinderseele so gewaltig, dass ich noch stundenlang in mich hineinschluchzte. Weil ich mich einfach nicht beruhigen konnte – zuhause hatte ich noch nie mit einem Stock Schläge bekommen – sagte sie dann zu mir: ‚Na, Meyerchen, nun ist ja alles wieder gut.‘
Bei mir war aber gar nichts gut. Schon ab diesem ersten Tag ging ich nicht mehr gerne zur Schule – wenn ich früh losmusste, bat ich jedes Mal meine Mutter, mir alles Gute zu wünschen, wobei meine Mutter Tränen in den Augen hatte und zur Schule mitkommen wollte, um die Lehrerin zur Rede zu stellen. Ich bat sie inständig, das nicht zu tun, denn ich wusste, ich hätte dann noch schlechtere Karten bei ihr …“
Während Doris Meyer als Einzelkind aufwächst, hat die sechsjährige Karla Browarzyck noch vier Geschwister. Sie ist die Zweitälteste, und Schule fand für sie überhaupt nicht mehr statt:
„Zwar wurde ich noch zu Ostern 1944 eingeschult, bin aber dann nicht einen Tag in die Schule gegangen. Wir frisch Eingeschulten haben kein Klassenzimmer mehr von innen gesehen. Denn Ende August 1944 ging es ja los mit den britischen Bombenangriffen auf Königsberg, und danach gab es keine Schule mehr.
Wie ich schon sagte: Wir waren eine Familie mit fünf Kindern. Eigentlich waren wir sechs, denn mein Vater brachte aus erster Ehe noch meinen großen Halbbruder mit – Dieter. Und mit meiner Mutter hatte er dann fünf weitere Kinder.
Ich frage mich, was in meinem Vater vorgegangen ist – er war schwer herzkrank, hat aber ein Kind nach dem anderen gezeugt: 1935, 1938, 1940, 41, 43 … Die Kinder kamen nur so angepurzelt – und er war chronisch krank! Ich kann das bis heute nicht begreifen. Er war ein Todeskandidat, und er starb dann auch schon im Februar 1944 … Und nun saß unsere Mutter mit uns Kindern alleine da.
Künstlerisch war mein Vater sehr begabt, er hat zum Beispiel wunderbare Dinge geschnitzt. Politisch wiederum Kommunist bis auf die Knochen – wir wurden alle nicht getauft, und das war etwas Seltenes in dieser Zeit. Er hat erst auf der Werft in Königsberg gearbeitet, dann wurde er Lehrausbilder, weil er die schwere Arbeit wegen seines Herzens nicht mehr machen konnte. Die Kommunisten in Königsberg waren alle organisiert, sie wussten ja damals noch nichts von den Schrecken Stalins …
Wir wohnten in einer Wohnung im dritten Stock. Und der ‚Spielplatz‘ lag gleich nebenan – auf der einen Seite war unsere Wohnung, auf der anderen der Boden. Dort gab es ein Guckfenster, so rund wie ein Bullauge. Da musste man sich auf den Bauch legen, um was zu sehen. Und das haben mein Bruder Peter und ich oft gemacht – wir haben die Leute beobachtet, die unten vorbeiliefen.
Mein Vater sammelte mit anderen Werftarbeitern Panzerfäuste, die wollten irgendwann losschlagen. Ich nehme mal an, die wollten den Russen helfen, wenn die da sind. Unser großer Halbbruder Dieter warnte uns beide jedenfalls auf einmal, nicht mehr in den Boden reinzugehen, weil dort die Panzerfäuste lagerten.
Ja, mein Vater erwartete sehnsüchtig die Russen, er war ja Kommunist. Er hat immer gesagt: ‚Vor den Russen braucht ihr keine Angst zu haben, die helfen euch!‘ Er hat sie als Befreier erwartet. Doch weil er schon im Februar 1944 starb, hat er nicht mehr erlebt, was dann passiert ist …“
Schon nicht mehr erleben muss der Vater den Auftakt der großen Tragödie – den britischen Luftangriff im August 1944. Was von da an über Familie Browarzyck kommt, trifft die Mutter mit ihren kleinen Kindern allein.
Das zunehmende Sirenengeheul treibt auch den sechzehnjährigen Michael Wieck und seine Eltern immer häufiger in den Luftschutzkeller:
„Niemand blieb inzwischen unbeeindruckt, wenn es nachts losging. Jedes Sirenengeheul bedeutete sofortiges Anziehen, Koffer ergreifen und in den Keller gehen. Das Warten auf den Entwarnungston der Sirenen konnte lange, aber auch nur ganz kurze Zeit dauern. Kaum war man eingeschlafen, gab es wieder Alarm … Und manche Nacht dreimal.
In der ersten Zeit saßen wir noch mit gelbem Stern unter allen anderen Hausbewohnern im Luftschutzkeller, später wurden wir in unseren eigenen, nicht extra abgestützten Kohlenkeller abgeschoben …“
Oft muss Michael an seine Schwester in Edinburgh denken. Und auch die dramatischen letzten Jahre in Königsberg lassen ihn nicht los: Das Leben war immer erdrückender geworden, und mehr und mehr füllten sich die Straßen mit Uniformen – HJ und BDM, SA und SS. Der Terror von Partei und Gestapo hatte irgendwann solche Formen angenommen, dass die Angst der Menschen zu greifen war. So mieden Bekannte zunehmend einen Haushalt, in dem Juden lebten.
Die Musikerfamilie flüchtete in andere, bessere Welten. Michaels Mutter übte Geige, sooft sie konnte, und spielte privat mit einem Pianisten Sonaten. Und sie las sehr viel:
„Mutter war mit ihrer Liebe zur Literatur und zur Musik selbst in der Zeit schlimmster Verfolgung noch eine bessere Deutsche als viele der an ‚Deutschwahn‘ erkrankten Volksgenossen. Mein Vater löste sich aus dem Christentum durch die Beschäftigung mit Goethe, Laotse und Konfuzius …“
Mit Hilfe von Büchern versetzte sich auch Michael in tröstlichere Umgebungen. Er las Adalbert Stifter, beschäftigte sich mit Künstlern der Renaissance und der Familie Mendelssohn. Er vertiefte sich in Meyers Lexikon und begann zu malen. Und er fühlte sich heftig zu einem bestimmten Mädchen hingezogen …
Michael Wieck im Alter von 14 Jahren ca. 1942
Unauffällig, den gelben Stern verdeckend, erkundete er mit seinem Rad auch die Stadt und ihre Umgebung. Er konnte damit seinem Vater ausweichen, der zunehmend unleidlicher wurde; von allen dreien kam er mit den drastischen Veränderungen des Lebens am wenigsten zurecht:
„Vater sah früher, in seinen besten Jahren, wie die Männer aus, die Manet so oft malte. Er war gut gewachsen, immer gepflegt, hatte dunkle Haare … Und er war ein hochbegabter Musiker. In der Zeit der Verfolgung, unter der er als ‚Arier‘ am wenigsten von uns zu leiden hatte, verkroch er sich mehr und mehr in die chinesische Philosophie …“
Und dabei bot sich die Chance einer Rettung. Denn Vaters Mutter wohnt zwar auch im Berliner Grunewald, im Hause der Wiecks, doch sie ist eine Schwedin … und nebenbei auch die Großtante von Olof Palme – jenem sozialdemokratischen Ministerpräsidenten, der viele Jahre später im friedlichen Schweden erschossen wird. Nun, inmitten der NSZeit, schien aus Schweden die Rettung zu nahen:
„Eines Tages bekam mein Vater eine Einladung seiner Verwandten, mit Frau und Sohn nach Schweden zu kommen. Das wäre die Rettung unserer Familie gewesen, wir wären noch aus Nazi-Deutschland herausgekommen.
Doch mein Vater folgte der Einladung nicht – ihm fehlte der Mut, mit fast sechzig Jahren ein neues Leben in der Fremde zu beginnen …“
Nun, im August 1944, ist Michaels Vater 64 Jahre alt. Er hastet bei Sirenengeheul mit Frau und Sohn in den Keller. Sein Gewissen peinigt ihn. Intensiv lernt er Chinesisch und spricht mit Michael über Laotse und Konfuzius. Allerdings ist er auch dünnhäutiger geworden und verpasst seinem rebellischen, jugendlichen Sohn schnell mal eine Ohrfeige.
Tagsüber muss Michael in die Chemie-Fabrik. Und auch seine Mutter, die Geigerin Hedwig Hulisch-Wieck, ist hier zur Zwangsarbeit eingeteilt:
„Die Arbeiter in der Fabrik waren Menschen, die von einem überheblichen Regime als minderwertig eingestuft wurden: Prostituierte, verschleppte russische Mädchen, französische Kriegsgefangene, Polen, Zigeuner und Juden. Wobei Juden als ‚Untermenschen‘ und ‚Ungeziefer‘ den niedrigsten Rang einnahmen. Bewacht wurden wir alle von älteren Vorarbeitern und Aufsehern, die aus verschiedenen Gründen frontuntauglich waren.“
Es ist eine gesundheitsgefährdende, stumpfsinnige Arbeit, bei der Michael immer eine Menge durch den Kopf geht. Seine Verwandtschaft ist auf eine belastende Art paradox: Auf der einen Seite ist da seine Cousine Dorothea Wieck – eine gefeierte Filmschauspielerin, die schon mehrfach die Tischdame Adolf Hitlers war. Dazu der Halbbruder – Sohn des Vaters aus erster Ehe – ein vom Nationalsozialismus überzeugter Wehrmachtsoffizier. Das, wie gesagt, ist die eine Seite.
Und die andere – die Verwandtschaft seiner jüdischen Mutter? Ihre Schwester, Tante Fanny, wurde 1942 deportiert, gemeinsam mit Hunderten jüdischer Frauen, Kinder und Männer. Sie würden „umgesiedelt“, hieß es offiziell. Doch wo hat man sie hingebracht? Auch die Lehrer seiner jüdischen Schule, die nicht rechtzeitig ausgewandert waren, mussten sich nun an der Königsberger Festungsanlage, unweit des Bahnhofs, einfinden.
Von keinem der Menschen an dieser Sammelstelle kam bisher ein Lebenszeichen.
Michael war Augenzeuge. Und was er sah, war so quälend, dass er es bis heute nicht verarbeiten kann.
All die verstörten Menschen an der Festungsanlage … Immer wieder sieht er seine geliebte Tante Fanny erschöpft am Straßenrand sitzen, sieht er ihren letzten flehenden Blick zu ihm herüber …
Er hadert mit Gott: Ihm scheint, als würden unbekannte Mächte stets nur die zerstörenden Kräfte schützen. Warum müssen so viele unschuldige Menschen leiden, ist Gott das egal?
Dass man die Frauen, Kinder und Männer, die aus Königsberg abtransportiert wurden, schon Tage später ermordet hat, ahnen Michael und seine Eltern nicht. Die Opfer liegen verscharrt in einem Grund bei Maly Trostinez, in der Nähe des weißrussischen Minsk. Und auch Mutters andere Schwester, Tante Rebekka, ist tot – umgekommen in Theresienstadt. Doch auch das werden die Wiecks erst viele Jahre später erfahren.
Es ist der 26. August 1944, als die Sirenen erneut zu heulen beginnen – und plötzlich beginnt auch die Flak zu schießen.
Michael spürt, dass diesmal wirkliche Gefahr droht. Er schleicht sich auf den Balkon, was verboten ist – und er sieht Lichtquellen am Himmel, die aussehen wie riesige Weihnachtsbäume, an denen Wunderkerzen brennen. Er hört das dunkle, bedrohliche Brummen der Flugzeuge … Schnell zurück in den Keller, zu den Eltern …
Ein nicht endendes Bombardement prasselt auf Königsberg nieder, Todesangst breitet sich aus. Und immer, wenn die Verängstigten in den Kellern hoffen, der Horror möge endlich vorüber sein, geht er von vorne los. Der Himmel im Norden der Stadt ist rot gefärbt, Brandgeruch steigt in die Nase.
Die Sowjets hatten in den Jahren zuvor die Stadt mehrfach aus der Luft angegriffen. Doch war das nichts gegen die Wucht, mit der nun, Ende August 1944, britisch-kanadische Bomberstaffeln Königsberg heimsuchen.
Nach der ersten Bombennacht sind einige Teile der Stadt in Flammen aufgegangen, etwa tausend tote Bewohner sind zu beklagen.
Doch das ist nur der Anfang.
Drei Nächte später geht es von neuem los. Wieder heulen die Sirenen, wieder stürzt alles in den Keller, und diesmal lässt sich das Inferno kaum noch beschreiben. Hunderte von britischen und kanadischen Bombern fliegen nun über schwedisches Hoheitsgebiet auf Königsberg zu … Die Angriffe und explodierenden Bomben nehmen in dieser Nacht kein Ende. Systematisch überschütten die Staffeln des Bomber-Commands die gesamte Innenstadt: Sprengbomben und phosphorgefüllte, flammenwerfende Stabbrandbomben sorgen dafür, dass innerhalb kurzer Zeit der ganze Innenstadtring zu brennen anfängt. Durch Hitzeentwicklung und den dadurch entstehenden Feuersturm hat die Bevölkerung der Innenstadt keine Chance zu entkommen. Wie ein halbes Jahr später in Dresden, verbrennen auch in Königsberg Menschen in und vor ihren Häusern. Manche springen als lebende Fackeln in den Fluss Pregel; doch nur, wer noch rechtzeitig die Innenstadt verließ, hatte eine Chance zu überleben.
Als der Morgen graut, sind fast sämtliche historischen Gebäude Königsbergs zerstört: der Dom und zwölf weitere Kirchen, das Schloss, die alte und die neue Universität mit vielen Instituten und Kliniken, das Rathaus, das Opernhaus, die Staats- und die Universitätsbibliothek, das malerische Speicherviertel, die Hälfte aller Schulen …
Für Karla Browarzyck ist es noch immer ein Wunder, dass ihre Familie überlebt hat. Denn auch ihr Haus hat es erwischt:
„Königsberg wurde zusammengeschossen. Wir wohnten in Mittelhufen, auf der Hermannallee 14, und auch in unserem Haus gab es einen Bombentreffer.
Plötzlich kam der Befehl über Lautsprecherwagen, alle Einwohner sollten raus aus den Kellern, raus aus der Stadt … und möglichst auf der Straßenmitte gehen. Es brannte alles links und rechts um uns herum, es kamen schon die zerbombten Wände runter.
Ich war zu dieser Zeit sechs Jahre alt. Ich sehe noch, wie meine Mutter auf den Kinderwagen ein Brett legte. Darauf setzte sie meine kleine Schwester Rosi. Im Kinderwagen lag Monika – die war erst acht Monate alt. Frank war fünf, der lief schon an der Hand mit. Dann kamen ich und mein Bruder Peter – wir drei trippelten so nebenher. Und mein älterer Halbbruder Dieter – mit ihm waren wir sechs Geschwister.
Ängstlich guckten wir ständig nach links und rechts – ein Flammenmeer, überall brannte es. Wir sahen beim Rausrennen, wie von unserer aufgerissenen Etage der Küchenschrank runtergeflogen kam. Der Himmel war feuerrot. Das sind Bilder, die prägen sich für immer ein. Ich sehe uns noch die Straße entlangrennen …
Wie viele andere Menschen sind auch wir runter zum Hafen gelaufen. Da lag ein Schiff, auf das wir alle rauf sind, und meine Mutter sagte: ‚Lehnt euch nicht an, die Wände sind kalt!‘ Es war alles so eisern, das müssen irgendwie Laderäume gewesen sein, wo wir dann reingekrochen sind. Das Schiff war völlig überfüllt.
Bis Pillau durften wir mitfahren, dort mussten alle wieder runter.
Wir sind dann per pedes weiter, zu Fuß. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir einen Leiterwagen oder so etwas hatten.“
Die siebenjährige Doris Meyer mit ihrer Mutter und dem Omchen haben großes Glück in diesem Inferno – ihr Haus gehört zu den wenigen in Königsberg, die unbeschädigt bleiben.
Auch Michael Wieck und seine Eltern haben überlebt – ihr Wohnbezirk Hufen liegt ein Stück weiter draußen als Mittelhufen, so blieb er weitgehend verschont.
Stunden nach dem Bombardement bricht der Sechzehnjährige in Richtung Innenstadt auf:
„Das Elend, das ich sah, war unbeschreiblich. Mit Leiterwagen, Handkarren, Kinderwagen, Schubkarren und allem, was Räder hatte, zogen die Ausgebombten durch die brennenden Trümmer. Vielleicht hunderttausend Obdachlose lagerten unter Schock in den Anlagen. Überall Koffer, Taschen und Gepäckstücke, die Reste der geretteten Habe …
Selbstverständlich erinnerte mich dieser Anblick an die vor ihrer Deportation versammelten Juden. Trotzdem war es völlig anders; diese Menschen hatten überlebt und konnten auf Hilfe rechnen. Viele waren rußverschmiert, trugen verbrannte Kleider und weinten um die Vermissten. Ich war voller Mitgefühl für die vielen völlig verstörten Kinder, die Mütter und hilflosen alten Menschen. Mit verdecktem Stern ging ich wieder nach Hause …“
Etwa drei Tage lang lässt sich die Innenstadt nicht betreten: Obwohl keine Flammen mehr lodern, sind Steine und Boden glühend heiß und kühlen nur ganz allmählich aus. Übrig bleiben Straßenzüge voller schwarzer Ruinen, die Fensterhöhlen gleichen Totenschädeln. Etwa 5000 Menschen haben diese Nacht des Feuersturms nicht überlebt. Spezialtrupps suchen die Leichen zusammen und schütten sie in Massengräber. Es hat vor allem Zivilisten getroffen – militärische Ziele wie Kasernen, der Festungsgürtel oder Bahnanlagen wurden von den Bombern weitgehend ausgespart.
Fast 200000 Menschen sind obdachlos, sie werden in der Umgebung der Stadt in Notquartiere eingewiesen.
Auch in die ländlichen Regionen Ostpreußens dringen die furchtbaren Nachrichten aus Königsberg.
Und im September 1944 wird die Familie des elfjährigen Günter Kropp, die verhängnisvoll nah an der litauischen Grenze wohnt, plötzlich aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen:
„Es wurde brenzlig, denn an der litauischen Grenze – also nicht weit von uns – war die Rote Armee aufmarschiert. Wir sollten fliehen, westwärts, aber erst mal nicht so weit weg. Die Orte für eine vorübergehende Unterkunft wurden vorgegeben. Und nun sollten sich alle Fuhrwerke in Rauschendorf sammeln.
Wir selbst wohnten einen Kilometer vom Dorf entfernt und hatten kein Telefon. Nur der Bürgermeister und wahrscheinlich der Ortsbauernführer, die hatten ein Telefon. Es konnte uns also niemand telefonisch benachrichtigen.
Wir hatten das Tor schon aufgemacht, um ins Dorf zu fahren, wo sich der Treck sammeln sollte. Wir beluden zwei Wagen. Die Kühe waren bereits alle im Stall, die Schweine auch, keine Tiere liefen mehr draußen rum. Und mein kleiner Bruder und ich saßen schon auf dem Fuhrwerk, als plötzlich ein Kradfahrer mit Beiwagen die Landstraße entlangkam. Und der teilte uns mit: ‚Sie brauchen nicht zu flüchten, die Sache ist abgeblasen, die Front ist zum Stehen gekommen! Genaueres kann ich Ihnen aber nicht sagen …‘
Trotzdem versuchten Mutter und Großmutter herauszufinden, wie denn nun überhaupt die Lage ist. Wir waren ja alle in Angst und Aufregung.
Sie fragten: ‚Ist das nun ganz abgeblasen mit der Flucht, oder sollen wir uns doch noch bereithalten?‘
Da hat sich der Kradfahrer umgeguckt, obwohl weit und breit außer uns niemand war, und sagte leise: ‚Ich kann Ihnen nur Folgendes raten: Lassen Sie die Wagen aufgeladen, fahren Sie alles komplett in die Scheune, damit Sie ganz schnell wegkommen, wenn es doch losgeht. Damit Sie dann keine Zeit verlieren …‘
Das hat uns erst mal gereicht. Wir blieben beunruhigt, und niemand konnte richtig schlafen. Es gab ja damals weder Fernsehen noch Telefon, man konnte sich überhaupt nicht informieren. Und im Volksempfänger lief nur irgendwelche Durchhaltepropaganda.
Wir bauten ein Dach auf dem einen Wagen. Die Großeltern meinten, wir sollten nicht so weit fahren – wir gingen auf jeden Fall davon aus, bald schon wieder zurückzukehren.“
Erst mal kümmert sich die Familie weiter um ihre Felder. Die Rüben- und die Kartoffelernte sind eingebracht. Nun zieht Günter die Winterfurchen, und sein Vater pflügt an. Doch dieses letzte friedliche Bauer-Sein währt nicht lange:
„Zu allem Übel wurde Vater plötzlich mit dem polnischen Knecht zum Panzergraben-Schippen an den Ost-Wall abkommandiert. Großvater durfte bleiben, aber Vater und der Hans mussten schippen gehen …
Wiederum bekamen plötzlich Soldaten der Wehrmacht den Befehl, beim Einbringen der Ernte zu helfen. Bei uns waren auch welche einquartiert, sieben Mann. Die hatten zum Teil Dienst, waren aber auch zum Ernten eingesetzt.
Einige haben uns gebeten, ein Schwein für sie zu schlachten. Sie haben eines ausgesucht und gefragt, wie viel das kostet. Vater war da gerade zurück vom Panzergraben-Schippen. Und er sagte: ‚Was soll ich denn für Geld nehmen? Ich muss die Schweine doch sowieso alle hierlassen. Ob ihr eines nehmt oder jemand die Tiere wegtreibt oder die Russen kommen und sie sich nehmen … Da ist es mir schon lieber, ihr esst sie! Ich wünsche euch guten Appetit dabei …‘
Sonst war ich beim Schlachten immer dabei, diesmal aber nicht. Also, die Soldaten haben eines unserer Schweine geschlachtet, da gab es ja auch welche, die das konnten.
Wir hatten Schweinefutter vorbereitet und baten die Soldaten, die Tiere, während wir auf der Flucht sind, zu füttern. Wir hatten keine Vorstellung davon, wie lange wir weg sein würden – sind aber davon ausgegangen, dass unsere Soldaten die vorrückenden Russen zurückschlagen werden. ‚Und wenn ihr abhaut‘, sagte mein Vater noch, ‚dann öffnet die Scheunentore – und alle Ställe, damit die Tiere ins Freie können, um sich selbst Futter zu suchen!‘
Vater kam also zurück, um Fluchtvorbereitungen für seine Familie zu treffen, während Hans weiter schippen musste als Pole. Ich habe ihn nie mehr wiedergesehen.
Die Sache spitzte sich im September 1944 weiter zu. Das Milchvieh sollte nun auch auf den Treck gehen, Kälber und Schweine aber zurückbleiben. Vater brannte unseren Kühen das ‚R‘ ein, für Rauschendorf, um später unterscheiden zu können, welche Kuh zu welchem Dorf gehört. Dann trieb er die Kühe ins Dorf, so wie die anderen Bauern auch. Von dort aus begannen die Männer vom Dorf und Treiber – die saßen auf Pferden, so wie Cowboys –, die Kühe die Landstraße entlangzutreiben, Richtung Königsberg. Dort sollten sie in die Pregel-Wiesen. Vorher wurden sie alle noch einmal gemolken.
Wie gesagt, mein Vater hat den Viehtrieb mitgemacht. Wir verabschiedeten uns: Er trieb die Kühe ostwärts ins Dorf – wir aber rüsteten uns jetzt für unsere Flucht westwärts …
In den Pregel-Wiesen standen später Hunderte Kühe, die furchtbar gebrüllt haben, weil niemand sie mehr molk. Es war ein Meer aus Weiß und Schwarz …“
Überstürzt werden die Bewohner des Memellandes im Oktober evakuiert, bevor die russischen Truppen dort einrücken.
Verzweifelte Bewohner schieben sich nun auf endlosen Landstraßen vorwärts und kollidieren mit den unzähligen Trecks ostpreußischer Dörfer, die nun endlich – und völlig verspätet – eine Fluchterlaubnis kriegen. Das Chaos auf verstopften Landstraßen setzt ein, mit zerbrochenen Fuhrwerken, weinenden Kindern, die ihre Mütter verloren haben, Tieren, die im Straßengraben verenden, alten Menschen, die zum Sterben zurückbleiben … Und der Angst im Nacken fliehender Frauen, denn die ersten Gerüchte von Grausamkeiten kursieren bereits, die die Soldaten der Roten Armee an deutschen Frauen begangen haben sollen.
Am 21. Oktober erobern Sowjetsoldaten das kleine Nemmersdorf und richten dort ein Massaker unter Zivilisten an.
Nur zehn Kilometer entfernt von Nemmersdorf wohnt Familie Matthus mit ihren Kindern, darunter der zehnjährige Siegfried. Auch sie gerät jetzt in einen dramatischen Fluchtstrudel:
„Bis zum Herbst 1944 hatten wir im ostpreußischen Osten vom Krieg eigentlich wenig mitgekriegt, die Bombardierungen fanden viel weiter westlich statt.
Doch im Oktober änderte sich das schlagartig. Der Räumungsbefehl kam viel zu spät – die Nazis waren völlig verbissen und auf Standhalten aus.
Die Russen kamen bei ihrem ersten Vormarsch im Herbst 1944 zunächst bis Nemmersdorf. Und dort sind furchtbare Sachen passiert. Nemmersdorf lag nicht weit von unserem Dorf entfernt, doch die russische Front war dort zum Stehen gekommen. Vermutlich haben sie Nachschub herantransportieren wollen, um dann im Frühjahr loszuschlagen.
So, nun mussten wir alle schnell raus, denn es wurde für Zivilisten brenzlig. In Eile wurden die Planwagen beladen: Betten und alles, was man für unverzichtbar hielt. Anderes vergruben wir, um es bei der Rückkehr wieder auszubuddeln – Besteck, gutes Geschirr und so weiter …
Dann brachen wir auf – meine Eltern und wir vier Kinder auf einem überladenen Fuhrwerk. Ich hatte mein Fahrrad mit und fuhr meistens neben unserem Planwagen her.