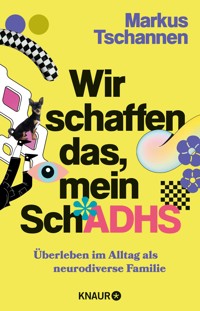
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Hat mein Kind ADHS? Was ist typisch für ADHS-Kinder? Und woran erkenne ich im Erwachsenenalter, ob ich selbst betroffen bin? Markus Tschannen über den bunten Alltag einer neurodiversen Familie und welcher Zauber inmitten des Chaos liegen kann. Kind: »Papa, was ist eigentlich ADHS?« Markus Tschannen: »Das Hirn funktioniert bei unterschiedlichen Mensch…« Kind springt ans Fenster. »Ist das ein Chihuahua?« Markus Tschannen: »Soll ich's dir jetzt erklären oder nicht?« Kind: »Was erklären?« ADHS betrifft häufig nicht nur ein Mitglied der Familie Schon länger vermutet Markus Tschannen, dass er ADHS hat. Als sein neunjähriges Kind typische Symptome zeigt und die Diagnose erhält, lässt auch er sich testen. Aus der Vermutung wird Gewissheit und es bestätigt sich, was vielen Eltern nicht bewusst ist: ADHS wird häufig vererbt und betrifft in vielen Fällen nicht nur ein Mitglied der Familie. Unterhaltsam und aus seiner besonderen persönlichen Perspektive heraus nimmt Markus Tschannen uns mit auf eine Reise durch den bunten Alltag einer neurodiversen Familie und erklärt: - wie aus ersten Anzeichen eine gesicherte Diagnose wird, - ob Ritalin & Co. Heilsbringer oder Pillen des Bösen sind, - was Kindern mit ADHS hilft, gut durchs Schulleben zu kommen - und wie Familien die Diagnose zum Anlass nehmen, eigene Erwartungen und Leistungsansprüche neu zu definieren. Ein humorvolles und sehr persönliches Buch über die Erfahrungen einer neurodiversen Familie und mit wertvollen Strategien für betroffene Eltern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 221
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Markus Tschannen
Wir schaffen das, mein SchADHS
Überleben im Alltag als neurodiverse Familie
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Kind: »Papa, was ist eigentlich ADHS?«
Markus Tschannen: »Das Hirn funktioniert bei unterschiedlichen Mensch…«
Kind springt ans Fenster. »Ist das ein Chihuahua?«
Markus Tschannen: »Soll ich’s dir jetzt erklären, oder nicht?«
Kind: »Was erklären?«
Schon länger vermutet Markus Tschannen, dass er ADHS hat. Als sein siebenjähriges Kind typische Symptome zeigt und schließlich die Diagnose erhält, lässt auch er sich testen. Aus der Vermutung wird Gewissheit, und es bestätigt sich, was vielen Eltern nicht bewusst ist: ADHS wird vererbt und betrifft oft mehrere Mitglieder der Familie.
ADHS ist komplex. Auch wenn immer offener über Symptome und Behandlungsmöglichkeiten geredet wird, sind immer noch viele Eltern verunsichert:
Soll ich mein Kind abklären lassen? Was spricht für Medikamente wie Ritalin und Medikinet – und was dagegen? Und: Wie gelingt es uns, das Kind besser zu verstehen und ihm die richtigen Strategien mitzugeben?
Markus Tschannen räumt auf mit Mythen und Vorurteilen, redet offen über Fallstricke im Alltag und stellt sich den eigenen Schwächen und enttäuschten Erwartungen. Am Ende hält der Humor alles zusammen: Anders sein ist nicht immer einfach, aber meist unterhaltsam.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Widmung
»Zuerst einmal …«
Moment! Wer sind wir überhaupt?
Ein Tag im Leben des Brechts
Der Brecht erhält sein Diplom
Ist das schon Störung oder noch Persönlichkeit?
»Papa, du bist auch nicht besser!«
Wer unterbricht, ist immerhin noch da
Schimpf, Schande und Scham
Drei Selbstversuche auf dem Weg zum gelassenen Vater
Eine erschreckend laute Familie
»Papa, ich bin wach!«
Ritalin zum Frühstück
Professionell reden
Das ADHS-Kind und die Schule
»Hörst du mir noch zu?«
Erst die Prokrastination, dann der Spurt
Wenn das Lieblingsinstrument die Liebe nicht spürt
»Kein Problem, das kann ich gut!«
Die Anzeichen des Beebers
»Du weißt, dass ich Vitamine nicht mag.«
»Träumt süß!« – »Wir dürfen ja nicht …«(Der große Zuckerverzicht)
Interview mit einem Brecht
Eine schlechte Idee?
Informationen und Anlaufstellen für Betroffene
Für den Brecht
Du hast mich zum Vater gemacht. Damit hast du mehr für mich getan, als ich je für dich tun könnte. Aber ich versuche, mich zu revanchieren.(Du musst trotzdem deine Schuhe wegräumen und am Wochenende den Tisch decken.)
»Zuerst einmal …«
Kind: »Papa, was ist eigentlich ADHS?«
Ich: »Das Hirn funktioniert bei unterschiedlichen Mensch…«
Kind springt ans Fenster: »Ist das ein Chihuahua?«
Ich: »Soll ich’s dir jetzt erklären, oder nicht?«
Kind: »Was erklären?«
Kennen Sie das gute alte Twitter noch? Den Dialog oben habe ich 2021 als Tweet verfasst – nach einigem Zögern. Das Gespräch schien mir so abgedroschen, dass ich mich kaum traute, es zu veröffentlichen. Dabei hatte es sich Minuten zuvor genau so zugetragen. ADHS entspricht manchmal exakt den stereotypen Vorstellungen, die in der Gesellschaft dazu rumgeistern. »Höhö, abgelenkt von einem Eichhörnchen. LOL! Typisch!« Und manchmal – oder sogar ziemlich oft – ist alles eben doch viel komplizierter.
Nur eine Person beschwerte sich damals über den klischeehaften Dialog: »1997 möchte seine ADHS-Witze zurückhaben.« Ansonsten löste der Tweet allerlei Diskussionen aus. Einige fühlten sich gesehen. Andere debattierten darüber, welches Verhalten bei Kindern »normal« sei. Wie toll oder wie böse Medikamente seien und warum überhaupt plötzlich alle ADHS haben. Mir machten diese Diskussionen bewusst, wie ungleich das Wissen über ADHS verteilt ist – sogar bei Betroffenen.
Können wir das ändern? Mit diesem Buch allein sicher nicht. Vielleicht sind Sie nach der Lektüre noch verwirrter als vorher. Die Erziehung von Kindern ist komplex – ein chaotisches System aus Aktionen und Reaktionen bei allen Beteiligten. ADHS ist ebenfalls komplex und schwer zu fassen. Wenn man nun beides zusammenknetet, wird nicht gerade ein Sonntagsspaziergang draus. Außerdem kann ich aktuell nicht ausschließen, dass dieses Buch ein Abbild meines Gehirns wird. Wenn dem so ist, dann gute Nacht!
Und damit willkommen in diesem Teufelswerk. Ein Buch, das ich vielleicht nicht hätte schreiben sollen, aber dazu später mehr.
Wahlweise herzliche Gratulation oder herzliches Beileid zur Diagnose ADHS – ob es nun Ihre eigene ist oder die eines Kindes, mit dem Sie regelmäßig zu tun haben. Wir akzeptieren selbstverständlich auch Selbstdiagnosen, das ist hier ein offener Klub. Sie benötigen keine Mitgliederkarte, kein ärztliches Attest und keinen Bootsführerschein, um dabei zu sein.
Können wir vielleicht zum Du wechseln? Das macht es gleich viel gemütlicher. Soll auch gelten, wenn wir uns persönlich treffen. Bei einer Lesung, an der Käsetheke oder in der Selbsthilfegruppe. Vielleicht nicht im Fast-Food-Restaurant, im Sexshop oder beim Schlagerkonzert. Da tun wir so, als würden wir uns nicht kennen. Es bereitet mir sozialen Stress, nicht mehr zu wissen, ob ich mit jemandem per Du oder per Sie bin. Also versuche ich, möglichst viele Leute gleich von Anfang an zu duzen. Das umgekehrte Vorgehen wäre auch eine Option, aber da man ja tendenziell irgendwann vom Sie zum Du wechselt, scheint es mir sinnvoller, diesen Prozess zu beschleunigen, als ihn hinauszuzögern. Kommt hinzu, dass man sich bei gemeinsamen Interessen sowieso duzen sollte, und wir interessieren uns ja nun alle für ADHS. Himmel, ich schweife ab. Aber was soll ich sagen, das liegt in der Natur der Sache. Kommt bestimmt noch öfter vor.
Ich spreche euch im Folgenden in der Mehrzahl an, weil ich mir vorstelle, dass ihr euch am Abend im Bett zu viert oder zu fünft gegenseitig ein paar Kapitel dieses Buches vorlest. Das ist unrealistisch, gibt mir aber ein gutes Gefühl.
Also dann. Schüttelt eure Kissen noch mal auf, füllt die Schüssel mit den Chips und macht es euch bequem für ein paar einleitende Worte.
Was ich vorhin vergessen habe: Ihr dürft dieses Buch natürlich auch lesen, wenn ihr gar nichts mit ADHS zu tun habt. Aber haha, das ist sehr unwahrscheinlich. ADHS gilt als die häufigste neurologische Entwicklungsstörung.
Menschen, die gerne Schätzungen aufstellen, gehen davon aus, dass zwischen 2,5 und sechs Prozent der Bevölkerung mit diesem Geschenk gesegnet sind. Pech beim Neuroschrottwichteln. So kann’s gehen.
Rein statistisch ist also jede gut sortierte Schulklasse mit einem ADHS-Kind ausgestattet, und in jedem Familien- und Freundschaftsumfeld dürfte es ein paar diagnostizierte oder undiagnostizierte ADHS-Erwachsene geben. Nur weiß man es oft nicht, denn ADHS ist für manche immer noch etwas sehr Negatives. »Ui, nein, Wolfgang, da reden wir lieber nicht drüber. Was sollen denn die Nachbarn denken?«
Immerhin: Es verändert sich gerade etwas. Und dazu soll auch dieses Buch beitragen. Für uns war von Anfang an klar, dass wir über unsere ADHS reden. Auch öffentlich. Einerseits, weil wir gerne reden – nicht untypisch für Menschen mit ADHS. Andererseits, weil wir uns nicht schämen für das, was wir sind. Und noch anderererseits, weil wir mit ein paar Vorurteilen aufräumen müssen. Vor allem aber: Jaaa, ADHS ist eine ernste Sache. Aber auch sehr witzig. (Das ist gleichzeitig ein Versprechen und eine Drohung.)
In diesem Buch erzähle ich die Geschichte meiner Familie. Es ist keine Autobiografie, dazu bin ich zu wenig prominent. Ich würde im Dschungelcamp noch nicht einmal als Kakerlake gecastet. Es ist auch kein Erfahrungsbericht, dazu ist das Buch zu wenig seriös. Und ganz bestimmt ist es kein Ratgeber. Bitte streicht diese Stelle mit einem Leuchtstift an, macht ein Ausrufezeichen daneben und klebt zur Sicherheit noch eine neongelbe Haftnotiz rein. Oder knickt wenigstens ein Eselsohr in die Seite. Für einen Ratgeber fehlt mir die fachliche Kompetenz. Ich bin kein Psychologe, kein Psychiater, kein Neurologe und auch sonst eher eine Enttäuschung für meine Eltern.
Damit wäre das geklärt. Aber wenn dieses Buch kein Roman, keine Autobiografie und kein Sachbuch ist, was ist es denn dann? Puh, wenn ich das wüsste. Möglicherweise mein Therapieprotokoll.
Moment! Wer sind wir überhaupt?
Es geschah vor elf Jahren. Der errechnete Geburtstermin war längst verstrichen, doch der Brecht trödelte. So, wie er es heute noch tut, wenn er sich für die Schule parat machen oder den Tisch decken soll. Nur stand damals mehr auf dem Spiel: Meiner Frau verging langsam die Lust, den stattlichen Fötus inklusive Plazenta, zwei Litern Fruchtwasser und weiterer zwei Liter Wasser in den Beinen herumzuschleppen. Zwar hatte sie schon seit einiger Zeit Wehen, die waren aber so produktiv wie ein trockener Husten und wurden auch nicht stärker. Irgendwann war die Geduld aufgebraucht. Die träge Fleischroulade musste raus. So zogen wir los, um uns im nächstgelegenen Krankenhaus eine Einleitung zu erbetteln.
Der Bus war ähnlich überladen wie meine Frau. Kein Sitzplatz mehr frei. Also standen wir. Ich hätte einen der vielen Jugendlichen der nahe gelegenen Schule anbellen können, seinen Sitzplatz für die keuchende Schwangere freizugeben. Doch dann hätte meine Frau jetzt keine Heldengeschichte parat, welch zäher Hund sie doch war, stehend mit dem Bus in den Kreißsaal zu holpern.
Das »Holpern« soll keine Metapher sein. Es gab da unterwegs eine Stelle, an der das Kopfsteinpflaster nur noch lose auf der Straße herumlag. Im Ruhrgebiet bestehen Baustellen immer etwas länger. Vermutlich war man nach dem Zweiten Weltkrieg noch gar nicht dazugekommen, die Straße wieder herzurichten. Das Holpern war so schlimm, dass man sich bei der Busfahrt selbst als gesunder Erwachsener gerne mal einen Bandscheibenvorfall einfing.
Und an diesem Montagmorgen hätte der Brecht tatsächlich fast in einem Bus das Licht der Stadt erblickt. Spoiler: Er wurde schlussendlich noch nicht einmal an diesem Montag geboren, sondern erst am späten Dienstag. Es brauchte viel Zureden, ein paar entnervte »Mach endlich vorwärts!« und zu guter Letzt Medikamente, bis er sich endlich auf den Weg durch den Geburtskanal machte. Das hätte uns eine erste Warnung sein sollen.
Vor elf Jahren machte uns der Brecht zur Familie. Fortan konnte ich mir die Bezeichnung Vater anheften und hielt ein selbst produziertes Kind im Arm. Wie surreal. Zwar hatte ich mich bereits neun Monate mit seiner Existenz beschäftigt, aber jetzt sah ich dem Knödel zum ersten Mal ins Antlitz.
Er hatte auf der Stirn eine Narbe in Form einer Pille Ritalin. Also jetzt rückblickend beurteilt. Damals hatten wir diese zweite Warnung nicht richtig gelesen. Ehrlich gesagt war es auch keine Narbe. Wir dachten das nur, bis wir dem Kind nach fünf Tagen endlich die Stirn wuschen und die »Narbe« im Waschlappen verschwand.
Plötzlich ein Kind zu haben, ist ein bisschen, wie eine selbst gebrannte, aber unbeschriftete CD zu finden: Glänzt schön, aber man hat keine Ahnung, was drauf ist.
Ich blickte meinem Baby ins Gesicht und sah eine lustige Nase, einen oft genervten Blick und ein Sabbermaul. Aber was aus dem Kind irgendwann wird, das sieht man nicht. Man kann es sich mit minimalem Basiswissen in Genetik höchstens ausmalen. Schließlich hat es einige Eigenschaften seiner Eltern geerbt. Dieser Gedanke hätte uns die dritte Warnung sein sollen.
Nach dem Auftreten einiger weiterer Warnzeichen wurde beim Brecht rund acht Jahre später schließlich eine ADHS diagnostiziert. Wie dramatisch ist so eine Diagnose? Man muss es im Kontext sehen. Eine Familie zu gründen ist vielleicht die extremste Entscheidung, die man im Leben trifft. Meist realisiert man das erst im Nachhinein, wenn die eigene bisher geordnete Welt im Chaos versinkt. Und das meine ich gar nicht negativ. Das Single- und Paarleben von früher mag noch so erfüllt gewesen sein – mit Kindern geht das Abenteuer erst richtig los. Das Leben wird rund zwölf- bis achtzehnmal absurder. Und mit ADHS noch mal ungefähr mit drei multipliziert. Oder als Metapher: Wenn man Kinder kriegt, dann ist das, wie wenn man von einem gemütlichen Fahrrad in ein Rennauto umsteigt. Hat das Kind ADHS, dann sitzt ihr immer noch im Rennauto, aber das Gaspedal klemmt in durchgedrückter Stellung und ihr habt gerade das Lenkrad aus der Befestigung gerissen. Hat der Vater auch noch ADHS, sitzt er mit dem Rücken zur Fahrtrichtung im Auto. Man kann das überleben, aber vermutlich nicht, ohne Schaden anzurichten.
Der Brecht ist seit elf Jahren die Hauptfigur unseres Familienabenteuers. Mit ihm erleben wir jede neue Phase der kindlichen Entwicklung zum ersten Mal. Er ist unser Lehrmeister und spurt für sein Geschwister vor. Es gibt dieses Sprichwort: »Kinder sind wie Pfannkuchen. Der erste kommt immer etwas komisch raus.« Das trifft in unserer Familie voll zu. Und wir wissen alle, dass es nicht die Schuld des Pfannkuchens ist. Über den Brecht werdet ihr in diesem Buch noch viel lernen, deshalb gehen wir mal weiter zu den Nebenfiguren:
Hallöchen, mein Name ist Markus. Ja, ja, man nennt sich selbst zuletzt, aber diese Liste ist nach Stärke der ADHS-Symptome sortiert.
Ich habe dem Brecht die dazugehörigen Gene weitergegeben, die ich seinerzeit von meiner Mutter erbte. Auch wenn sie das vehement bestreiten würde. In Vorstellungsrunden war ich nie gut … wo fange ich an?
Mein Alter tut nichts zur Sache. Nur so viel: Ich bin keine dreißig mehr. Von Motorrädern, Gravelbikes und Siebträgermaschinen hielt ich mich bisher fern, aber vielleicht ist dieses Buch meine Midlife-Crisis. Oder ADHS. Um Himmels willen, ja. Das muss es sein. Bis zu meinem vierzi…, äh zweiunddreißigsten Geburtstag habe ich mich nämlich kaum mit meiner ADHS beschäftigt.
Nicht, dass die Diagnose überraschend kam. Klar war mir das alles schon lange, aber ich dachte nicht oft drüber nach. Himmel, ich greife vor. Vielleicht noch etwas zu meinem Werdegang: Ich erlernte nie einen richtigen Beruf, sondern bin früh auf die schiefe Bahn geraten und habe BWL studiert. Seither schlage ich mich mit PR-Jobs durch. Sprich: Der Brecht ist mein erster konstruktiver Beitrag zur Gesellschaft.
Der zweite Beitrag heißt Beebers. Er schoss rund fünfeinhalb Jahre nach dem Brecht zügig in den Kreißsaal. Ich war gerade auf dem Sessel eingeschlafen und verpasste die wesentlichen Prozessschritte, bis ich jäh aus den Träumen gerissen wurde.
Während der Brecht nach der Geburt nämlich still war und uns lediglich mit großen Augen musterte, fing Beebers sofort an rumzubrüllen. Heute sind beide Kinder sehr laut.
Beebers – übrigens mit langem e ausgesprochen, wie Beere, nicht wie Justin Bieber – ist ein typisches Zweitkind: Er kompensiert seine freche, unbändige Art durch Witz und Niedlichkeit, sodass wir ihm deutlich mehr durchgehen lassen, als wir sollten.
»Macht zwei Kinder«, haben die Leute gesagt, »dann können sie zusammen spielen.« Und sie prognostizierten, der große Altersunterschied werde dafür sorgen, dass die Kinder nicht eifersüchtig aufeinander sein würden. »Die werden kaum streiten.«
Ha! Hört nie auf andere Leute. Menschen sind dreckige Lügner. Meine beiden Kinder führen täglich einen veritablen Bürgerkrieg. Manchmal gehe ich mir illegale Hundekämpfe anschauen, nur um etwas Ruhe zu haben.
Beebers hat unseres Wissens kein ADHS, aber es ist wie damals, als ich naives Stück kurz nach Brechti Geburt zu einer Nachbarin sagte: »Er schläft sogar schon durch.« Man sollte sich nie zu sicher sein.
Ganz eindeutig kein ADHS hat meine Frau. Ich meine, wir haben alle unser Päckchen zu tragen, aber dieses Päckchen wurde ihr nicht zugestellt.
Sie kann sich über Stunden hinweg auf das konzentrieren, was sie sich vorgenommen hat. Beeindruckend. Es ist praktisch, eine Person im Haushalt zu haben, die derart deutlich auf der NEIN-Seite des ADHS-Spektrums liegt.
Der Brecht und ich haben immer eine Referenz, wenn wir uns mal wieder fragen: »Ist das normal, oder hat die Störung zugeschlagen?« (Es ist selten normal.)
Was kann ich sonst noch über meine Frau sagen? Sie sieht so jung aus, wie ich gern wäre, hasst Schwangerschaften, arbeitet als Wissenschaftlerin und strickt, rätselt und puzzelt in ihrer Freizeit.
Ich bewundere, dass sie ihre Hobbys über Jahre hinweg pflegt und ihre Stricksachen nicht nach drei Wochen gelangweilt in die Ecke zimmert, wo schon fünf angefangene und eingestaubte Puzzles liegen.
Falls ihr bereits nach den ersten drei Zeilen dieses Buches begonnen habt, an etwas komplett anderem herumzuüberlegen, während eure Augen einfach weiter dem Text gefolgt sind: Ich kenne das. Darum hier als kostenloser Service eine Zusammenfassung unserer Familie in Listenform:
Der Brecht, 11, ADHS
Beebers, 5, wer weiß
Ich (Alter unerheblich bis bedenklich), ADHS
Meine Frau (jung und schön), definitiv kein ADHS
Höre ich da jemanden erzürnt fragen: »Wie bitte heißen diese Kinder?«
Keine Sorge, das sind natürlich nicht ihre richtigen Namen. »Brecht« ist kurz für »Brechtholdibus Maximus«, und das Akronym »BEEBERS« steht für »Bilbo Estefan Erika Bernulf Eckbert Ragnvald Stefan«. Wir wollten, dass unsere Kinder einzigartig sind.
Nein Quatsch, sie tragen ganz alltägliche bis langweilige Vornamen. »Brecht« und »Beebers« sind ihre Spitznamen, und ich wünschte, ich könnte hier eine tiefgründige Anekdote zum Besten geben, wie es zu diesen Namen kam. Aber wir haben sie uns einfach im Übermut ausgedacht. Die richtigen Namen bleiben geheim. Um die zu erfahren, müsst ihr schon zu einer Lesung kommen und zehn Bücher für eure ganze Verwandtschaft kaufen. Bei hundert Büchern rezitiert euch der Brecht sogar ein Gedicht.
Was gibt es sonst noch über uns zu erzählen? Wir leben mal in Deutschland, mal in der Schweiz. Aktuell auf einem ehemaligen Bauernhof. Das spielt für dieses Buch aber keine Rolle. ADHS funktioniert überall gleich.
Als Schweizer möchte ich aber eins betonen: »Müesli« schreibt man mit e. Es ist das einzige schweizerdeutsche Wort, das sich international durchgesetzt hat, leider in der falschen Schreibweise »Müsli«. Korrekt ist »Müesli«. Bitte beachtet das in Zukunft!
Ein Tag im Leben des Brechts
*pling*
Gerade so laut, dass es das große Kind hört, und leise genug, dass das kleine weiterschläft. Perfekt. Eventuell melde ich mich für die Musikhochschule an. Wobei, wahrscheinlich ist das Weinglas kein anerkanntes Instrument, auch wenn ich den Kaffeelöffel noch so präzise auf die Stelle schlage, die den hellsten Klang abgibt. Egal. Wer hat schon Zeit für ein Studium? Ich sicher nicht. Auch wenn ich mich gerade langweile, morgens um 06.15 Uhr auf dem kalten Boden sitzend, angelehnt an den Türrahmen zum Bad. Nicht bequem, nicht sehr inspirierend, aber mein Tun hier dient einem höheren Ziel.
*pling*
»Jetzt die rechte Socke«, rufe ich mit gedämpfter, fast schon krampfhaft freundlicher Stimme.
»Okay«, bestätigt mir der Brecht motiviert.
Und tatsächlich: Durch die Ritze der Tür sehe ich, wie er sich den Strumpf übers Füßchen klaubt und die Nähte an der Spitze zurechtzupft, die sonst immer zum Drama ausarten. Nach wenigen Sekunden bestätigt er: »Gut!«
»Super, jetzt darfst du drei Minuten in deiner Gedankenwelt spielen, dann putzt du dir die Zähne.«
»Juhuu!« Murmelnd erzählt sich der Brecht eine Geschichte und hüpft dabei im Badezimmer umher wie eine Kuh, die im Frühling zum ersten Mal wieder auf die Weide darf.
Mittwochs stehen wir jeweils um 05.30 Uhr auf, damit der Brecht um 07.01 Uhr den Bus in die Schule erwischt.
Eigentlich wäre unser Programm in den eineinhalb Stunden überschaubar: ein Müesli hinter das Fressbrett schaufeln, Ablasshandel auf dem Klo, die Kleidung am Körper befestigen und dann noch die Müeslireste aus den Zahnzwischenräumen kärchern.
Manche Kinder schaffen das in 20 Minuten. Meins nicht. Es würde ohne externen Peitschmeister um 07.15 Uhr noch in Gedanken vertieft vor der halb vollen Müeslischale sitzen. Wahrscheinlich auch noch um 09.30 Uhr. Denn der innere Peitschmeister funktioniert nicht.
Der externe Peitschmeister – also ich – ist zwar voll funktionstüchtig, aber unbeliebt.
Auf »Putz jetzt bitte deine Zähne« erhalte ich selten ein freudiges »Aber klar doch, werter Vater«. Eher ein geschnauztes »Jahaaa«, gefolgt von einer knallenden Tür.
Dabei weiß das Kind genau, dass es ohne meine Anweisungen nicht geht.
Was hingegen prächtig funktioniert, sind spielerische und humorvolle Rituale. Der Brecht ist leicht zu motivieren, solange ich den fröhlichen, ungeschickten Clown spiele – am besten rund um die Uhr. Dabei gibt es nichts Anstrengenderes, als ständig lustig sein zu müssen.
Manchmal wäre ich lieber der traurige Clown mit der aufgeschminkten Träne und möchte das Weinglas in meiner Hand seiner eigentlichen Bestimmung zuführen. Aber die Vernunft siegt und mit ihr der Wille, es gemeinsam zu schaffen. Schließlich klingt »Merlot am Morgen« wie der Titel einer TV-Tragikomödie eines zweitklassigen Privatsenders, nicht wie die richtige Antwort auf erzieherische Herausforderungen. Dazu kommt, dass ich Merlot nur zu Käse mag, und Käse liegt mir am frühen Morgen schwer auf dem Magen.
Das Gebimmel mit dem Löffel am Weinglas hilft heute gut. Wir hatten uns die Methode gerade erst gestern ausgedacht. Bei jedem *Pling* muss der Brecht einen Arbeitsschritt ausführen: sich den Pulli überstülpen, die Zahnpasta auf die Bürste quetschen oder seinen Endgegner besiegen und die vorbereitete Zahnbürste auch wirklich zum Schrubben in den Mund führen.
Als Belohnung erhält er klar vorgegebene Zwischenpausen ohne jeglichen Leistungsdruck. Die Methode wird nun ein paar Tage funktionieren, bis sie ihren Reiz verliert und dem *Pling* keine Reaktion mehr folgt. Dann müssen wir uns etwas Neues ausdenken, oder wir fallen ins Standardmuster zurück: Ich ermahne im Abstand von 30 Sekunden, und der Brecht rollt so hart mit den Augen, dass sie ihm beinahe aus dem Schädel fallen.
Eine Zeit lang haben wir es mit einer Eieruhr versucht, aber das war dem Brecht nach wenigen Tagen zu stressig.
Psychologisch raffiniert fand ich es, ihm aufzuzeigen, was wir alles Schönes machen könnten, wenn er schnell fertig ist. Er könnte dann zum Beispiel in seinem Lieblingsbuch versinken, oder ich würde ihm Witze aus dem Internet vorlesen. Die Idee gefiel ihm gut. Und für eine Weile war er auch tatsächlich so schnell, dass wir im Anschluss 20 Minuten Zeit für billigen Web-Humor hatten, wie beispielsweise: »Trifft eine Kuh einen Polizisten und sagt: ›Stellen Sie sich vor, mein Mann ist auch Bulle.‹« Doch irgendwann blieben nach dem Paratmachen nur noch 15 Minuten, später zehn, dann fünf, und die Woche darauf musste ich ihn wieder klassisch nörgelnd und ohne Rinderhumor antreiben.
Nach dem Weinglastrick wird uns etwas Neues einfallen – auch wenn die Kreativität manchmal ein paar Tage aussetzt. Die geistige Flexibilität für immer neue Strategien musste ich mir erst beibringen, und ehrlich gesagt: Ich bin immer noch dabei, sie zu erlernen.
Aber das ist das Schöne an der Elternschaft: Sie ist nach der Kindheit die zweitlehrreichste Lebensphase. Statt geistigem Stillstand zur Lebensmitte erlernen wir nun neue Skills im Wert von drei bis vier Master-Studiengängen.
Selbst in meinem Arbeitsleben hat mich nichts so sehr vorangebracht wie das, was ich aus den täglichen Verhandlungen mit meinen Kindern gelernt habe. Gehaltserhöhungen ertrotze ich mir mit Leichtigkeit, und wenn mein Chef sagt, er zähle jetzt bis drei, dann lasse ich ihn bis dreieinhalb zählen, bevor ich sage: »Naaa gut, ich schreibe dir den Bericht, wenn ich dafür ein Eis kriege.«
Ich werde jäh aus meinen Gedanken gerissen, als der Brecht mir seine blitzenden Zähne präsentiert. Heute ist er schon um 06.45 Uhr fertig und kann in Ruhe seine Turnschuhe anziehen und die von mir gepackte Schultasche aufsetzen. So viel Zeitreserve hat er längst nicht immer, aber irgendwie schaffen wir es jeden Morgen – mal mit Spaß, mal mit Drama. Den Bus hat er in seiner bisherigen schulischen Karriere nicht ein einziges Mal verpasst. Welch ein Leistungsausweis für ein Kind mit ADHS … und seinen Vater.
So gelassen sehe ich das an einem guten Tag. Aber selbst dann würde ich eigentlich gerne länger schlafen und die Morgenstunden sinnvoll nutzen. Um zu joggen zum Beispiel. Okay, ich würde nicht joggen, aber vielleicht schon mal die Steuererklärung vorbere… IST JA GUT, ich würde aufs Handy schauen und eine zusätzliche Schüssel Cornflakes in mich reinstopfen. Lasst mich. Selfcare ist wichtig.
Meine Nachbarin weckt ihre Kinder auch – aber eine Stunde später. Joël und Jennifer-Shakira sind grob in Brechts Alter. Sie löffeln sich dann rasch ein Frühstück rein, streichen sich die Pausenbrote selbst, ziehen sich an und gehen zum Bus.
Ein Idealfall, den ich alter Realist nicht einmal in meinen ehrgeizigsten Träumen anstreben würde. Mir ist schon bewusst, dass nicht jedes Kind, das am Morgen trödelt, gleich ADHS hat. Die Zeit nicht im Griff haben, über die Kleidung maulen, sich vor dem Zähneputzen drücken, das sind Dinge, die Kinder halt tun. Aber die meisten nicht so extrem wie meins.
Und dann sind da noch die richtig schlechten Tage, an denen der Morgen nicht als Tango mit Rose im Mund beginnt, sondern als Kneipenschlägerei mit Messer zwischen den Zähnen.
Wenn der Brecht an seinem Müesli so langsam lutscht, dass die Milch in der Schüssel ranzig wird. Im besten Fall zieht er sich danach im Tempo eines betäubten Faultiers an. Im schlechtesten Fall kritisiert er jedes Kleidungsstück und weigert sich, es zu montieren. Der Pulli kratzt, die Socken haben eine Naht, die Unterhose leuchtet nicht in der Lieblingsfarbe, die Hose braucht einen Gürtel, Gürtel sind des Teufels, und über das T-Shirt wollen wir gar nicht reden, sondern nur noch schreien.
Die immer genervter von mir herbeigetragenen Angebote aus dem Kleiderschrank sind kein Stück besser, bis die Situation völlig eskaliert und das Kind zwar schlussendlich in Stoff gehüllt ist, aber mit Schaum vor dem Mund um sich schnappt.
Ich putze ihm die Zähne, weil es sonst nicht mehr pünktlich in die Schule käme, und das gegenseitig hingeraunte »Ich hab dich lieb« zum Abschied klingt eher wie eine Drohung, weitere Lebensjahre miteinander verbringen zu müssen.
Natürlich beruhigen wir uns beide wieder, sodass wir uns am Mittag zu Brechti Heimkehr wohlwollend begrüßen. Doch er hat dann einen anstrengenden Vormittag in der Schule hinter sich, der ihm viel Konzentration abverlangte.
Die ständigen Reize trafen dabei auf einen schlechten Filter, und das Kindshirn wechselte irgendwann von Stufe »bei niedriger Temperatur garen« auf »sprudelnd kochen«. Außer Haus bleibt der Brecht dabei vordergründig fröhlich, aber nach etwa 20 Minuten zu Hause entlädt sich alles.
Das Mittagessen ist offenbar eine Zumutung. Erbsen wäh. Und Kartoffelpüree habe er ja noch nie gemocht. Das müsste ich wissen, er sage mir das schließlich regelmäßig. Alle Beschwichtigungsversuche des erst noch geduldigen Vaters prallen am Zornesbrecht ab. Die Wut kippt einige Minuten später in Selbstmitleid.
»Warum darf ich eigentlich nie Süßigkeiten?« (Der Brecht darf ständig Süßigkeiten.)
»Warum darf Maximilian-Jason nie zu uns zum Spielen kommen?« (Niemand hat es ihm verboten.)
»Nie gehen wir in den Zoo!« (Wir waren schon so oft im Zoo, dass mir die Giraffen zum Hals raushängen.)
Oft beruhigt sich das aufgebrachte Kind wieder, manchmal auch nicht. Der Brecht braucht nach der Schule Ruhe. Zeit für sich, in der er liest oder zusammen mit zwei-, dreihundert Plüsch- und Plastiktieren, Legofiguren und Autos im Wohnzimmer riesige Rollenspiele aufbaut. Da feiert dann zum Beispiel Ohrgundula, der Plüschhase, Geburtstag, und alle sind eingeladen. Der Brecht taucht dabei tief und unstörbar in seine Fantasiewelt ab. Er kann ein sehr, sehr pflegeleichtes Kind sein, das sich über Stunden selbst beschäftigt.
Manchmal sieht ADHS auch so aus – nicht nur wie das Klischee des ständig hyperaktiv rumhopsenden Kindes, das sich keine zwei Minuten auf seine Hausaufgaben konzentrieren kann.
Ein typischer Tag im Leben des Brechts geht so zu Ende, wie er angefangen hat.





























