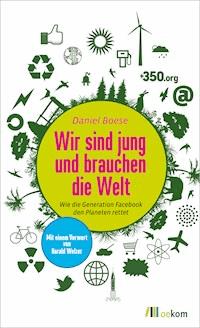
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: oekom verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Sie nutzt die Macht der neuen Medien, ist weltweit aktiv und kennt in ihrem Enthusiasmus keine Grenzen: Die Generation Klima bricht mit jeder Erwartung, die wir bisher von der Jugend hatten. Sie weiß, was sie will. Ihr Ziel ist nichts weniger als eine Revolution, an deren Ende die Rettung des Planeten steht. Um den Klimawandel zu stoppen, macht die Jugend mobil und lässt die fossilen Eliten ganz alt aussehen: Mit Facebook, Twitter & Co. mobilisiert sie weit mehr Menschen, übt weit mehr Druck auf Politik und Wirtschaft aus als dies jede Partei, jede Umweltschutzorganisation vermag. Daniel Boese hat sich in diese neue Bewegung hineinbegeben und zieht ein begeisterndes Fazit: Wir dürfen hoffen, denn die Klimarevolutionäre sind wild entschlossen und sie haben mächtige Verbündete: Unternehmer mit Gewissen, die IT-Branche und manch verantwortungsvollen Promi.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 405
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Daniel Boese
Wir sind jung
und brauchen
die Welt
Wie die Generation Facebook
den Planeten rettet
Mit einem Vorwort von Harald Welzer
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2011 oekom, München
oekom verlag, Gesellschaft für ökologische Kommunikation mbH,
Waltherstraße 29, 80337 München
Umschlaggestaltung: www.buero-jorge-schmidt.de
Umschlagabbildung: gettyimages (Illustration »Erde«)
Satz + Layout: Sarah Schneider, oekom verlag
Datenkonvertierung eBook:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-86581-298-8
Für Joanna
Vorwort
Harald Welzer
TEIL I
Vor Kopenhagen: Die Jugend legt los
Die Gipfelstürmer:
Wie die klimarevolutionäre Jugend sich ihren Platz bei den Vereinten Nationen erobert
Lernen von den Alten:
Unruhe in den Vereinigten Staaten
Aktivisten im Porträt:
Kim Nguyen, On the Road
Grüne Nerds:
Wie das Internet die Rettung des Klimas beschleunigt
Aktivisten im Porträt:
Anna Keenan, Gegen die Kohle
Der träge Pionier:
Deutschland vertrödelt die Energiewende
Aktivisten im Porträt:
Dan Glass, Flughafen-Blockierer
Wildwuchs:
Nirgendwo wächst die Klimabewegung schneller als in Indien
Aktivisten im Porträt:
Melina Laboucan-Massimo, Gegen die Teersande
Der Weckruf:
Wie Amerikas junge Aktivisten Lobbyisten besiegen
TEIL II
Nach Kopenhagen: Kampf für’s Klima
Aktivisten im Porträt:
Kevin Buckland, Blogs aus einer schmelzenden Landschaft
Willkommen in Utopia:
Ein deutscher Chemiker startet die Design-Revolution
Aktivisten im Porträt:
Andrew Tobert, Klimasturm mit Tweed und Schärpen
Tempomacher:
Wie China den grünen Kapitalismus antreibt
Aktivisten im Porträt:
Felix Finkbeiner, Plant for the Planet
In Afrika:
Jugendliche machen Entwicklungsländer zu Pionieren
Aktivisten im Porträt:
Charlie Young, In Kiribatis Diensten
Zeitenwende:
Deutschland nach dem Atomzeitalter
Aktivisten im Porträt:
Dorian Mazurek, Raven gegen Atomkraft
Aufgeheizt:
Der Protest in den Vereinigten Staaten wird härter
Aktivisten im Porträt:
Paul Ferris, Der Zukunftsstratege
Tipping Point:
Wird die Bewegung stark genug?
ANHANG
Klimakampfchronik:
Aktionen, Aktivisten und ihre Ahnen
Die 50 wichtigsten Jugendkampagnen der Welt (und 25 Websites, die man kennen muss)
Internet-Glossar
Abbildungsnachweis
Dank
Vorwort
Dies ist ein Buch über eine soziale Bewegung, die nicht viele Leute kennen. Dieser Satz ist nicht so absurd, wie er auf den ersten Blick erscheint: Alle sozialen Bewegungen, von der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung bis hin zur Frauenbewegung, waren zu Beginn bis auf einige prominente Akteure weitgehend unsichtbar und bestanden hauptsächlich aus einer latenten Community, in der nicht wenige gar nicht wussten, dass sie schon dazugehörten und zum selben Reformprojekt beitrugen. So steht es im Moment auch um die Bewegung, die Daniel Boese vorstellt, indem er über ihre Aktivisten berichtet, ihre Geschichte(n) erzählt.
Die Aktivisten eint vor allem, dass sie jung sind und zu Recht um die Zukunft besorgt, aber nicht nur um ihre eigene, sondern um die der Überlebensbedingungen der Menschheit insgesamt. Ihre Suche gilt demgemäß der verlorengegangen Zukunftsfähigkeit, und hier vor allem der Bekämpfung eines Lebensstils und einer Konsumkultur, die Umweltfolgen in einer Weise zeitigt, dass das Klimasystem aus den Fugen zu geraten droht. Boese schreibt aber kein weiteres Buch über den Klimawandel (davon gibt es ja auch genug), sondern eines über die Entstehung einer politischen Gegenbewegung gegen die globale Kultur der Verantwortungslosigkeit. Dass diese Gegenbewegung vor allem von jungen Menschen getragen wird, ist kein Zufall: Denn sie sind es ja, die noch eine Zukunft zu verlieren haben. Und sie sind es auch, denen das Internet und die sozialen Netzwerke nicht nur Kommunikations-, sondern Organisationsmedien sind.
Daraus resultieren Engagement- und Protestformen, die ein weit größeres Bewegungspotenzial bereithalten als die inzwischen etwas abgestandenen Formen des Straßenprotests mit ihren intellektuell schmerzhaften Parolen (»hopp hopp hopp – Atomkraftwerke stopp« usw.). Auch darin liegt ein Moment der Unsichtbarkeit, nämlich für diejenigen, die in der neue Protestkultur nicht zuhause sind und nicht verstehen, dass sich da gerade etwas ganz Neues entwickelt.
Seit dem Entstehen der ersten Ökologiebewegung sind vier Jahrzehnte vergangen, und damit hat sich nicht nur die Katastrophenkommunikation (»Es ist 5 vor 12!«) so sehr veralltäglicht, dass sie zur medialen Benutzeroberfläche so dazugehört wie die Sportnachrichten oder die Meldung des täglichen Anschlags in Afghanistan. In der Zwischenzeit haben auch Tschernobyl und Fukushima ihre generationenübergreifenden Verheerungen angerichtet, und seither ist es nicht mehr nur ein kleiner Teil der Welt, nämlich der Westen und – wie damals noch – der Ostblock, die die natürlichen Ressourcen plündern und den Planeten zerstören, sondern die Leitkultur der Zerstörung und Verschwendung hat sich globalisiert. Alles geht jetzt viel schneller, auch der Anstieg des Energieverbrauchs und der Emissionen.
Daniel Boese macht mit seinen Reportagen über die neuen Aktivistinnen und Aktivisten, Assoziationen und Aktionen klar, dass die Globalisierung der Zukunftsprobleme mit globalisierten Bewegungsformen beantwortet werden kann und beantwortet wird: und zwar so, dass die Kommunikation darüber, was man warum wo unternimmt, weltweit stattfindet, der konkrete Protest aber immer seinen Ort und immer eine nationale Politik, einen einzelnen Konzern, eine lokale Zerstörung zum Gegenstand hat. So wie es auch in einer Welt des Internets das Bier immer noch an der Theke gibt, so muss eine Bewegung gegen das zerstörerische Business as Usual Orte haben, Wege zurücklegen und an konkrete Menschen gebunden sein, die irgendwo sind, Flashmobs organisieren oder Petitionen formulieren, mit dem Fahrrad nach Kopenhagen fahren, Abgeordnete stressen oder Verwirrung stiften.
Und noch etwas macht dieses Buch deutlich: dass eine politische Bewegung immer eine Sache sozialen Lernens und der Herstellung von Gemeinsamkeit ist: Widerstände zu überwinden, Ziele zu erreichen, Spaß zu haben, Freunde zu finden – das gehört zur Entstehung einer sozialen Bewegung viel mehr als das ewige Vorführen von PowerPoints zu CO2-Emissionen, die unablässige Berechnung von Carbon Footprints und die wissenschaftliche Beweisführung dessen, was jedes siebenjährige Kind ohnehin schlüssig darlegen kann: dass unendlicher Ressourcenkonsum in einer endlichen Welt nicht möglich ist.
Auch deshalb übrigens sind alle sozialen Bewegungen immer auch Generationenprojekte: Das war bei der Anti-Atomkraftbewegung so und ist auch in der »Arabellion« der Fall. Es sind die jungen Gesellschaftsmitglieder, die den Ausverkauf der Zukunft am ehesten spüren und die dabei am meisten zu verlieren haben. Alle sozialen und politischen Umwälzungen des 20. Jahrhunderts waren Generationenprojekte; sie alle haben ihren Ausgangspunkt darin, dass gesellschaftliche Eliten die Lebens- und Zukunftschancen monopolisieren und die nachfolgenden Generationen damit konfrontieren, dass ihnen jetzt, leider, nicht mehr so viel übrig bleibt. »Aber empört Euch, macht was draus, dafür habt ihr alle unsere Sympathien ...«
Kein Wunder, dass die in ihren Konturen sich abzeichnende neue soziale Bewegung selbst die Zukunft und die Generationengerechtigkeit zum Inhalt hat; der Klimawandel ist ihr Anlass und ihr Kristallisationskern, aber ihre politische Sprengkraft liegt darin, dass es um die Zukunft geht. Überall tauchen daher Begriffe wie »Enkeltauglichkeit« (wie beim »Morgenland«-Festival in Liechtenstein) auf oder Vorsätze wie der, ein »guter Vorfahre« sein zu wollen. Dass damit Zukunft selbst wieder zum Kernbestand des Politischen wird, dürfte ein wesentliches Verdienst der neuen sozialen Bewegung sein. Wenn es sie denn gibt.
Denn nicht wenige Leser werden ja die ganze Zeit schon denken: »Wo zum Teufel ist sie denn, diese angebliche soziale Bewegung?« Gerade im Entstehen. Daniel Boese ist ein Überbringer der allerneuesten Nachrichten von ihr. Sein Buch ist wichtig, um die Aufmerksamkeit auf das zu richten, was da gerade entsteht und seine Gestalt sucht, um Geschichten zu haben, die man weitererzählen kann, um Ideen zu haben, die man nachmachen kann, um Communities zu finden, von denen man ein Teil werden kann.
All die Geschichten, die in diesem Buch erzählt werden, sind Geschichten vom Arschhochkriegen, Geschichten darüber, wie viel Spaß es macht, selbst verantwortlich zu sein für das, was man tut. Und natürlich auch für das, was man lässt. In diesen Geschichten geht es auch um das Experimentieren einer gesellschaftlichen Praxis, die Exits aus der Kultur der Ressourcenübernutzung und der Zukunftsvergessenheit sucht und die sie mit dieser Suche zugleich bahnt. Das mag einstweilen noch punktuell sein und wenig machtvoll erscheinen. Aber so haben, wie gesagt, alle sozialen Bewegungen begonnen, bevor sie die Welt verändert haben. Sie werden immer von Minderheiten vorangetrieben, und fünf Prozent einer Bevölkerung reichen locker, um die Verhältnisse in Bewegung zu bringen. Wer dieses Buch liest, möchte mit Sicherheit zu diesen fünf Prozent gehören.
Harald Welzer, im Juli 2011
TEIL I Vor Kopenhagen: Die Jugend legt los
Die Gipfelstürmer: Wie die klimarevolutionäre Jugend sich ihren Platz bei den Vereinten Nationen erobert
Deepa Guptas Hände sind leer, als sie das Mikrofon ergreift. Sie sieht 100.000 Demonstranten vor sich, daneben steht das Kongresszentrum des Weltklimagipfels – wie ein UFO in den Dünen – mitten am südlichen Kopenhagener Stadtrand. Von der eiskalten Dezemberluft zittern ihre Finger, ihr Herz schlägt im Stakkato, aber ihre Stimme bleibt ruhig: »Heute morgen um zwei Uhr früh war ich unendlich verzweifelt«, sagt sie. »Meine Augen taten weh, weil ich so viel geweint hatte. Die Diplomaten sind in ihren Verhandlungen so weit davon entfernt, ein faires und ehrgeiziges Klimaabkommen zu schließen.« Deepa sieht die Plakate und Transparente der US-amerikanischen Studenten, der afrikanischen Kleinbauern und deutschen Öko-Unternehmer. Sie spricht weiter von ihrer Ungeduld mit den Politikern, dann ruft sie: »Die Zeit für ›Yes we can‹ ist vorbei. Jetzt geht es um ›Yes, we will!‹«
Es ist ein klarer, sonniger Samstag im Dezember 2009. Hier in Kopenhagen, in den Sälen des Bella Centers, zweihundert Meter neben der Bühne, auf der Deepa steht, soll der Vertrag besiegelt werden. Rund um die Welt sind an diesem Tag Menschen auf der Straße, um ihren Politikern zu zeigen, wie wichtig ein Abkommen gegen den Klimawandel ist: 40.000 demonstrieren in Melbourne, am Brandenburger Tor in Berlin laufen Leute als Kohlendioxid-Moleküle auf. Deepa Gupta ist vor ein paar Tagen aus Neu Delhi, Indien, nach Dänemark geflogen. Die 21-jährige Aktivistin ist das Gesicht der globalen Jugendbewegung, sie spricht nach der UN-Hochkommissarin für Flüchtlinge und vor dem Direktor von Greenpeace. Es ist ein historischer Moment, sagt Deepa: »Heute ist einer der Tage, der unsere Bewegung definiert – rund um den Globus schließen sich Aktivisten zusammen!« Die Gesichter der Demonstranten sind zu weit weg, als dass Deepa die Entschlossenheit in ihrem Blick sehen könnte. Doch sie halten aus, Zehntausende Menschen trotzen der Kälte und der Trägheit der Funktionäre.
Acht Monate vorher hatte ich Deepa das erste Mal gesehen. In einem kleinen Fenster auf meinem Laptop erklärte sie mir in einer Videokonferenz auf Skype, wie sie Tausende indischer Jugendlicher zum Indian Youth Climate Network organisiert hatte. Ich suchte damals gerade junge Berliner Klimaschützer für einen Flashmob und hatte von einem britischen Studenten den Tipp bekommen, mit Deepa zu reden – die wisse, wie man schnell ein Netzwerk aufbaue. Zwei E-Mails später war ich mit Deepa verabredet. Das Bild bei Skype war dann zwar etwas langsam, aber ich war erstaunt, mit welcher Selbstverständlichkeit Deepa von der irren Geschwindigkeit sprach, mit der sie die Allianz indischer Jugendaktivisten aufgebaut hatte. Sie war gerade von einem Road Trip für erneuerbare Energien quer durch Indien zurückgekehrt und hatte dabei vor 50.000 Menschen gesprochen: auf dem Campus der Universität in Mumbai genauso wie beim indischen Softwareriesen Infosys. Ich musste daran denken, dass große deutsche Umweltschutzorganisationen schon froh sind, wenn ein paar hundert Teilnehmer bei einer Veranstaltung auftauchen. Und jetzt erzählte mir eine Studentin aus Indien, wie sie ohne großes Budget eine Massenbewegung gestartet hatte.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























