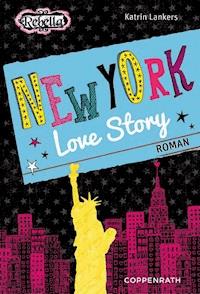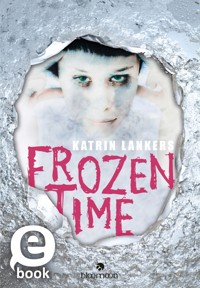9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Marie hat ein besonderes Talent: Sie organisiert Trauerfeiern, die trösten. Dabei hat sie selbst mit ihren jungen Jahren genug Tod und Trauer erlebt. Dann stürzt Ben buchstäblich in ihr Leben, mit dem Fallschirm in ihren Vorgarten. Auf seinem erfolgreichen Blog "Mein bester letzter Tag" lässt er seine Follower an einer ganz besonderen Challenge teilhaben: Ein Jahr lang lebt er jeden Tag, als wäre es sein letzter. Ben gelingt es, Marie aus ihrem Schneckenhaus zu locken - bis sie den wahren Grund für seinen Blog erfährt ... Aber wie kann sie einen Menschen lieben, vom dem sie weiß, dass er sie erneut verletzen wird?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Epilog
Ich danke …
Über das Buch
Marie hat ein besonderes Talent: Sie organisiert Trauerfeiern, die trösten. Dabei hat sie selbst mit ihren jungen Jahren genug Tod und Trauer erlebt. Dann stürzt Ben buchstäblich in ihr Leben, mit dem Fallschirm in ihren Vorgarten. Auf seinem erfolgreichen Blog »Mein bester letzter Tag« lässt er seine Follower an einer ganz besonderen Challenge teilhaben: Ein Jahr lang lebt er jeden Tag, als wäre es sein letzter. Ben gelingt es, Marie aus ihrem Schneckenhaus zu locken – bis sie den wahren Grund für seinen Blog erfährt … Aber wie kann sie einen Menschen lieben, vom dem sie weiß, dass er sie erneut verletzen wird?
Über die Autorin
Katrin Lankers dachte sich schon als Kind ganze Romane aus, arbeitete aber nach dem Studium zunächst als Journalistin und in der PR, bis sie dem Traum vom Bücherschreiben eine Chance gab. Mittlerweile ist die Autorin außerdem auch als Trauerrednerin tätig. Mit ihrer Familie und einem schwarz-weißen Raubtier lebt sie in Bornheim bei Bonn.
Katrin Lankers
Roman
Lübbe
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Copyright © 2022 by Bastei Lübbe AG, KölnTextredaktion: Claudia Schlottmann, BerlinUmschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, MünchenUmschlagmotiv: © Anne Costello/Arcangel ImageseBook-Erstellung: two-up, Düsseldorf
ISBN 978-3-7517-2101-1
luebbe.delesejury.de
1
Ein gebrochenes Herz kann dieselben Symptome verursachen wie ein Herzinfarkt. Schmerzen, Luftnot, Schweißausbrüche, Übelkeit. Es kann sogar zum Tode führen. Warum das so ist, ist unklar. Dass es so ist, wissen die meisten, denen es schon einmal passiert ist. Mir war vor nicht allzu langer Zeit gleich dreimal das Herz gebrochen worden. Man sollte meinen, das reicht für ein ganzes Leben. Ich jedenfalls war fest entschlossen, dafür zu sorgen, dass mir so etwas nie wieder passierte. Wie ich das schaffen wollte? Indem ich mein Herz an nichts mehr hängte. Das hatte zwei Jahre lang ganz gut funktioniert. Es gab also keinen Grund, etwas daran zu ändern. Dachte ich.
Ich sortierte gerade die Bananen aus, als mich plötzlich ein ganz mieses Gefühl beschlich. Später wurde mir klar, dass es wohl eine Vorahnung gewesen sein musste. In dem Moment dachte ich bloß: Der Spanner starrt mir mal wieder auf den Hintern! Ich beschloss, ihn zu ignorieren, wie immer, und konzentrierte mich auf meine Arbeit. Zumindest sollte er mir nicht vorwerfen können, dass ich sie nicht ordentlich erledigte.
Braune Druckstellen. Schon wieder. Das war jetzt der fünfte Strunk. Was machten die Leute eigentlich mit den Bananen? Drückten sie auf jeder einzelnen herum, bevor sie sich dann doch für Äpfel entschieden? Schweren Herzens legte ich sie in den Einkaufswagen zu den welken Salatköpfen, weichen Möhren und gammeligen Auberginen, den Himbeeren, von denen ein paar matschig waren, die aber ansonsten noch top aussahen, und dem ganzen anderen Obst und Gemüse, das sich bereits darin stapelte.
»Es ist sieben Uhr dreiunddreißig!« Eine halbe Stunde vor Ladenöffnung mutierte Herr Schneider, unser neuer Filialleiter, zur wandelnden Zeitansage. Er lief durch die Gänge und setzte alle unter Druck, indem er mit der Präzision einer Atomuhr verkündete, wie die Zeit verging. »Und siebenundzwanzig Sekunden«, fügte er hinzu. Beim nächsten Ton ist es … »Achtundzwanzig. Neunundzwanzig.« Fehlte nur der Piep.
»Darf ich mal?« Ich schob meinen voll beladenen Einkaufswagen auf Frank Schneider zu, der sich in letzter Sekunde im Gang mit den Cerealien in Sicherheit brachte.
»Na, na, nicht so stürmisch.« Herr Schneider zwinkerte mir vielsagend zu und rückte eine Packung Honigpops auf dem Aktionsstapel zurecht.
Ignorieren, einfach ignorieren, redete ich mir selbst gut zu und manövrierte den Einkaufswagen unter Ganzkörpereinsatz um das Kopfregal mit den Eierkartons herum.
»Es ist sieben Uhr sechsunddreißig«, war Frank Schneider aus Richtung Tiefkühlkost zu hören, als ich den Durchgang zum Lager passierte. »Und zwölf Sekunden … Dreizehn.« Die automatischen Schiebetüren schlossen sich hinter mir und sperrten seine Stimme aus.
Ich ließ den Einkaufswagen ausrollen, bis er vor den Paletten mit den Dosensuppen und Fertiggerichten zum Stehen kam, umrundete ihn und wandte mich nach links, vorbei an Mehl, Zucker, Backmischungen und Nudeln, in Richtung Mitarbeiterraum. Hier war um diese Zeit niemand. Nur ein paar kreisrunde Kaffeetassenflecken auf dem großen Tisch in der Mitte des Raums erinnerten an die Frühbesprechung. Herr Schneider bestand darauf, dass wir die Becher am Ende der Besprechung in unsere Spinde räumten und nicht auf dem Tisch stehen ließen.
Seit er die Filialleitung vor drei Monaten übernommen hatte, herrschte hier ein neuer Ton. ›Picobello‹, das war sein Lieblingswort. »Hier muss alles picobello aussehen.« Als ob sich die Kunden dafür interessierten, wie es in unserem Pausenraum aussah. Ob es sich bei den Kaffeeflecken wohl um einen revolutionären Akt handelte? Oder hatte bloß niemand daran gedacht, den Tisch abzuwischen? Ich schloss meinen Spind auf und schnappte mir den klappbaren Einkaufstrolley. Schnell nahm ich die Plastikdosen mit Gebäck heraus, die ich von zu Hause mitgebracht hatte, und verstaute sie oben im Schrankfach. Bloß keine Zeit verlieren. Nur noch zwanzig Minuten. Und ich hatte noch so viel zu erledigen.
Mit dem karierten Hackenporsche kehrte ich zu dem Einkaufswagen zurück, hängte ihn vorne dran und setzte den Wagen mit einem gezielten Schwung in Bewegung. An der Kühlung vorbei ging es zum Hinterausgang und in den Hof, wo die großen Mülltonnen aufgereiht an der Hauswand auf mich warteten.
Ich hatte nie geplant, in einem Supermarkt zu arbeiten. Ursprünglich hatte ich etwas ganz anderes gelernt, nämlich Bürokauffrau bei einer großen Spedition, was allerdings eine reine Vernunftwahl gewesen war. Denn seit ich mich erinnern konnte, hatte ich davon geträumt, ein eigenes Café zu führen. Doch als mein großer Traum endlich in Erfüllung gegangen war, hatte er sich zum größten anzunehmenden Albtraum entwickelt – und ich hatte dringend einen neuen Job gebraucht. Da hatte am Schwarzen Brett des Supermarkts in dem kleinen Ort, in dem ich wohnte, ein Zettel gehangen: Mitarbeiter/innen gesucht. So war ich hier gelandet. Es war nicht der schlechteste Job, den man haben konnte. Er war auch halbwegs ordentlich bezahlt. Aber ich mochte ihn nicht. Und das lag vor allem an den Mülltonnen.
Ich klappte den Deckel der ersten Tonne hoch. Griff mit beiden Händen in den Einkaufswagen. Nahm drei Köpfe Salat heraus, die die Blätter hängen ließen, als wüssten sie genau, welches Schicksal sie gleich ereilen würde. Holte tief Luft. Schloss die Augen. Und ließ die Salatköpfe in die Tonne fallen. Das hohle Geräusch, mit dem sie auf dem Plastikboden landeten, hallte überlaut in meinen Ohren nach. Im selben Moment ertönte auch die Stimme meiner Großmutter in meinem Kopf: »Wer die Krümel nicht ehrt, ist des Kuchens nicht wert.«
Meine Omi hatte Sprichwörter, Spruchweisheiten und überhaupt mehr oder minder kluge Sprüche jeder Art geliebt, und wenn sie keinen passenden kannte, hatte sie schnell einen erfunden. Auf jeden Fall hatte sie mich in der festen Überzeugung erzogen, dass Verschwendung bestraft gehörte. Und nun warf ich Salat in den Müll, bloß weil er ein bisschen welk war. Beinah spürte ich dabei körperliche Schmerzen. Werktags war der Job nicht so schlimm. Denn da holten zwei Mitarbeiter der Tafel die aussortierte Ware ab, um sie an bedürftige Menschen zu verteilen. Aber samstags kamen sie nicht. Und heute war Samstag.
Mit dem bedauernswerten Kopfsalat konnte ich leider nichts anfangen. Der wäre spätestens morgen tatsächlich hinüber. Es folgten fünf Lollo Rosso und ein Armvoll verschrumpelter Radieschen. Dann waren die gummiartigen Möhren an der Reihe. Karottenkuchen, dachte ich, als ich sie an den grünen Stängeln aus dem Wagen hob. Hervorragende Idee! Nicht gerade Meisterklasse, aber geschichtet mit einer Eierlikör-Frischkäse-Buttercreme und überzogen mit dunkler Schokolade und Orangensplittern bekäme er das gewisse Etwas und würde den Gästen beim Seniorentreff garantiert gut schmecken. Hatte ich nicht gerade ein paar Flaschen Eierlikör auf einem Wagen mit aussortierter Ware entdeckt, der im Lager neben der Kühlung ebenfalls zum Entsorgen bereitstand?
Schnell öffnete ich meinen Einkaufstrolley und legte drei Bund Möhren hinein. Und wo ich schon dabei war, packte ich auch noch die Himbeeren dazu. Des Weiteren vier Strunk Bananen, sieben Gurken, ein paar Orangen, Äpfel und Birnen und fünf Netze mit Kartoffeln, von denen einige bereits kurze Triebe gebildet hatten. Ich klappte den Trolleydeckel zu und entsorgte den Rest der Ware im Müll. Bei jeder Aubergine und jedem Knollensellerie litt ich mit, aber wenigstens einem kleinen Teil der Lebensmittel hatte ich die Tonne erspart.
Auf dem Rückweg durchs Lager stoppte ich bei den Wagen mit der restlichen aussortierten Ware. Ich sah mich um, schnappte mir eine Flasche Eierlikör, drei Pakete Frischkäse und ein paar Fertiggerichte und ließ sie ebenfalls in den Trolley wandern. Dann war der Hackenporsche so voll, dass gerade noch meine Plastikdosen obendrauf passen würden. Beim Blick auf all die abgeschriebenen Produkte, die nur noch darauf warteten, in der Tonne zu landen, schluckte ich. Aber ich konnte sie nicht alle retten.
Außerdem musste ich jetzt wirklich zurück an die Arbeit. Nicht, dass Frank Schneider mich doch noch erwischte! Zwar hatte ich noch kein einziges Mal erlebt, dass er zwischen Punkt sieben Uhr dreißig und Punkt acht Uhr ins Lager gekommen wäre. Da war er zuverlässig auf Atomuhr-Patrouille im Laden. Aber sollte er jemals herausfinden, was ich hier tat, würde er sicher kein Auge zudrücken, so wie unsere vorherige Filialleitung, die meine samstäglichen Aktivitäten stillschweigend geduldet hatte.
In anderen Ländern mussten Supermärkte die abgelaufenen Lebensmittel verschenken, auch in Deutschland gab es mittlerweile Geschäfte, in denen das üblich war. Doch rechtlich gehörte auch die Ware noch dem Supermarkt, die in den Müll wanderte. Wenn man es genau nahm, beging ich also Diebstahl. Und ich fürchtete, dass Frank Schneider zu den Menschen gehörte, die es gerne sehr genau nahmen.
»Morgen, Marie. Was hast du uns denn heute Gutes mitgebracht?« Ich zuckte zusammen, als ich mit meinem Trolley in den Pausenraum huschte und mich eine fröhliche Stimme begrüßte. Meine Kollegin Svetlana saß am Tisch und biss in ein dick belegtes Brot. »Zweites Frühstück«, erklärte sie kauend. »Oder drittes. Kommt drauf an, ob man das Rosinenbrötchen mitzählt.«
»Und Herr Schneider hat nichts dagegen, dass du eine Pause machst? Um …« Ich schaute auf die Uhr über der Tür. »Sieben Uhr, neunundvierzig Minuten und dreiundzwanzig Sekunden?«
»Frankyboy kann mich mal.« Svetlana schnaubte. »Also?«
»Popcorn-Salzkaramell-Cupcakes.« Ich ging zu meinem Spind und zog dabei den Trolley möglichst unauffällig hinter mir her. Schließlich wollte ich Svetlana nicht in Schwierigkeiten bringen, indem ich sie zur Mitwisserin machte. Aber sie schien sich ohnehin nicht besonders für den Hackenporsche zu interessieren.
»Du bist eine Göttin«, stöhnte sie theatralisch. Dass sie es mit vollem Mund nuschelte, nahm dem Kompliment ein wenig die Wirkung. Ich musste schmunzeln. Egal, welche meiner Backkreationen ich den Kolleginnen und Kollegen mitbrachte, Svetlana war immer hingerissen.
»Schwarzwälder-Kirsch-Brownies hab ich auch noch gebacken, extra für dich«, verriet ich und hievte den Trolley in meinen Spind. Svetlana war alleinerziehend mit drei Kindern. Ich fand, sie hatte sich ein paar ihrer Lieblings-Brownies verdient.
»Ahh«, machte sie. »Willst du mich heiraten?«
»Jetzt muss ich erst mal das Gemüse auffüllen«, erklärte ich ihr. »Und du solltest dich auch beeilen. Es ist sieben Uhr, zweiundfünfzig Minuten und achtundvierzig Sekunden.«
»Dann geh wenigstens mal mit mir und den anderen auf die Rolle.« Svetlana ließ nicht locker. »Meine Mutter kommt heute zum Babysitten. Neunzehn Uhr, Happy Hour in der Haifischbar.«
»Heute Abend passt mir leider gar nicht«, wich ich aus und wandte mich zur Tür. Ich wusste ohnehin, dass Svetlana ein enttäuschtes Gesicht zog. Es war nicht das erste Mal, dass sie mich fragte. Eigentlich erstaunlich, dass sie es immer wieder versuchte. Denn ich war noch nie mitgekommen, wenn sie und die anderen Kolleginnen zusammen weggingen. Ich ging seit zwei Jahren nicht mehr aus.
»Wenn du nicht so grandios backen könntest, würde ich dich für eine totale Langweilerin halten«, beklagte Svetlana sich halbherzig.
Ich warf ihr über die Schulter ein versöhnliches Lächeln zu, dann überließ ich sie ihrem Butterbrot, ging zurück ins Lager und belud einen Palettenwagen mit Frischware. Doch bevor ich mich damit in Bewegung setzen konnte, ertönte Frank Schneiders Stimme über Lautsprecher. »Es ist punkt acht Uhr. Wir öffnen. Frau Wandel, Frau Kowalska, Kasse bitte.«
Besten Dank. Ich seufzte. Der Filialleiter hatte mich kurzfristig zum Kassieren eingeteilt. Ich überlegte, ob er mich damit ärgern wollte. Aber er konnte ja nicht wissen, dass ich viel lieber in Ruhe die Ware verräumte, ab und zu unterbrochen von Fragen wie »Wissen Sie, was Sardellen sind? Meine Frau hat das aufgeschrieben«, als an der Kasse die ganze Zeit den Befindlichkeiten der Kundschaft ausgesetzt zu sein.
»Auf in die Schlacht.« Svetlana kam aus dem Pausenraum, wischte sich den Mund am Ärmel ihres Shirts ab, das sie unter dem Kittel trug, und klopfte mir aufmunternd auf die Schulter. »Wird schon nicht so schlimm werden. Ist ja bloß Samstag.«
Svetlana hatte recht. Es war der vollkommen normale Samstagvormittagswahnsinn. Die ersten Kunden hatten schon ungeduldig vor der Tür gewartet und drängten herein, kaum dass wir öffneten. Und ab dann hatten wir keine ruhige Minute mehr. Gestresste Mütter und Väter mit unausgeglichenen Kleinkindern im Einkaufswagen passierten meine Kasse, gefolgt von Rentnern, die ausgerechnet den Samstagvormittag nutzen mussten, um ihren Wocheneinkauf zu erledigen, Grundschulkindern, die ihre Spardosen geplündert hatten und die Gummibärchen mit einzeln abgezählten Münzen bezahlten, und Teenagern, die ihr Taschengeld in Chips und Energiedrinks investierten und grundsätzlich in Rudeln von mindestens fünf auftraten.
Ich scannte, rechnete, kassierte, scannte, versuchte, höflich zu bleiben, auch wenn am Ende der Schlange geschimpft wurde, warum das denn da vorne so lange dauere, und lächelte alle an, die ich mittlerweile als Stammkunden erkannte.
»Guten Tag, Marie, schön, Sie zu sehen. Ich hab mich extra bei Ihnen angestellt, obwohl die Schlange länger war.«
Ich schaute vom Scanner auf.
»Ach, hallo, Frau Stockhausen, wie geht’s Ihnen denn?«
»Am liebsten gut.« Die Lachfältchen um die Augen der alten Frau vertieften sich.
Ich warf einen schnellen Blick aufs Kassenband. Nur das Nötigste, und das ausschließlich von der Billigmarke. Es war Monatsende, da wurde das Geld bei manchen knapp.
»Was bringen Sie uns denn morgen Leckeres? Sie kommen doch morgen?«, setzte Frau Stockhausen unser Gespräch fort.
»Aber natürlich, das wissen Sie doch«, antwortete ich und zog nebenbei ihre Einkäufe über den Scanner. Frau Stockhausen leitete schon seit vielen Jahren das Seniorencafé im Gemeindezentrum unseres Ortes. Früher hatte meine Omi immer für die sonntäglichen Treffen gebacken, nun hatte ich diese Aufgabe übernommen. »Ich habe an Rüblitorte mit Eierlikör-Creme gedacht.«
»Wunderbar!« Frau Stockhausen leckte sich genießerisch die Lippen. »Sie sind ein gutes Mädchen, Marie.«
Ich lächelte, wies sie nicht darauf hin, dass man mit einunddreißig wohl kaum noch als Mädchen galt, und scannte die Tageszeitung, die sie als Letztes aufs Band gelegt hat.
»Haben Sie das gesehen?« Frau Stockhausen tippte auf die Zeitung. Hinter ihr hatte sich wie durch ein Wunder noch niemand angestellt, also warf ich einen Blick auf das Titelblatt. Darauf war ein Mann bei einem Bungee-Sprung abgebildet, sein euphorisches Lachen war in der Nahaufnahme gut zu erkennen. Die Überschrift lautete: Mein bester letzter Tag. Ich überflog den kurzen Text darunter: Ein Jahr lang will Benjamin Kaufmann (33) jeden Tag leben, als wäre es sein letzter. ›Nutze den Tag – es könnte dein letzter sein‹, so lautet sein Motto. Und offensichtlich trifft er damit einen Nerv. Sein Video-Blog, kurz Vlog, mit dem der junge Mann aus Bonn seine wachsende Fangemeinde an seinen meist waghalsigen Aktivitäten teilhaben lässt, hat bereits mehrere Zehntausend Abonnenten. Lesen Sie weiter auf der Seite Vermischtes …
»Und was würden Sie machen?« Frau Stockhausen sah mich gespannt an.
»Was meinen Sie?«
»Wenn Sie wüssten, dass es Ihr letzter Tag ist.«
»Ich weiß nicht … Darüber möchte ich gar nicht nachdenken.«
»Also, ich würde endlich mal die Füße hochlegen. Den ganzen Tag. Da würde mein Otto aber doof aus der Wäsche gucken!« Sie lachte in sich hinein.
»Macht vierundzwanzig einundsiebzig«, sagte ich, als ein gestresst wirkender Vater mit drei Kindern seinen vollbeladenen Wagen an meine Kasse schob und die Einkäufe aufs Band packte.
Frau Stockhausen zog ihr Portemonnaie aus der Handtasche und fing an, umständlich darin herumzukramen. Ein Zehner kam zum Vorschein, dann ein Fünfer. Dann nur noch Münzen. Viele kleine Münzen. Sie zählte, zählte noch mal. Der Mann hinter ihr verdrehte genervt die Augen. Zwei seiner drei Kinder fingen gleichzeitig an, lautstark nach etwas Süßem zu verlangen, das dritte plärrte nur, es war noch zu klein für andere verbale Wunschäußerungen.
»Ich fürchte, ich hab nur noch zweiundzwanzig Euro.« Frau Stockhausen schaute mich zerknirscht an. »Da müssen wir die Zeitung wohl stornieren. Schade, die lese ich am Sonntag immer so gern zum Frühstück.«
Der wartende Kunde trommelte ungeduldig mit den Fingern auf dem Griff des Einkaufswagens herum. Seine Kinder versuchten jetzt alle drei, sich gegenseitig zu übertönen.
»Schon gut.« Ich schob die Zeitung zu ihren übrigen Einkäufen in die Kassenablage.
»Aber das geht doch nicht!«, protestierte sie.
»Doch, das geht.« Ich nickte ihr zu, nahm den Warentrenner vom Band und fing an, die Einkäufe des gestressten Dreifachvaters zu scannen. Den fehlenden Betrag würde ich später aus meiner eigenen Tasche in die Kasse legen, um das Minus auszugleichen. So viel war es ja nicht.
»Sie sind wirklich ein gutes Mädchen, Marie«, verabschiedete Frau Stockhausen sich. »Ihre Großmutter wäre stolz auf Sie.«
Mein Hals schnürte sich zu bei ihren Worten, und ich musste kräftig schlucken. Dann hatte ich mich wieder im Griff. Ich kassierte den Familienvater ab und registrierte erleichtert, dass dahinter niemand mehr stand. Vielleicht hatte das Geschrei seiner Kinder die anderen Kunden verschreckt – umso besser.
»Ich geh mal kurz in Pause«, rief ich Svetlana zu, die immer noch an Kasse zwei saß.
Ich musste schon seit mindestens einer halben Stunde zur Toilette. Doch als ich auf dem Weg zum Mitarbeiterwaschraum durchs Lager lief, stand mir plötzlich Frank Schneider im Weg. Ich war in Gedanken noch bei dem Gespräch mit Frau Stockhausen, sonst hätte ich ihn vielleicht früher bemerkt. So rannte ich ihn beinah über den Haufen.
»Na, na, nicht so stürmisch«, sagte er, sein Repertoire an flotten Sprüchen war relativ begrenzt. Kurz beschlich mich der Verdacht, er könnte mir hier aufgelauert haben. Aber ich verwarf den Gedanken schnell wieder. Frankyboy war vielleicht ein Spanner, aber ein Draufgänger war er nicht. Eher der Typ Mann, der auch mit Mitte vierzig noch Kakao zum Frühstück trinkt.
»Das trifft sich ja, dass wir uns hier über den Weg laufen, also, quasi ineinander hineinlaufen.« Er schmunzelte über seinen eigenen schlechten Scherz, dann wurde er plötzlich ernst. »Mit Ihnen habe ich ohnehin ein Wörtchen zu reden.«
Das klang nicht gut! War es wegen der Zeitung von Frau Stockhausen? Frank Schneider achtete penibel darauf, dass die Kassen stimmten, bei einem Minus konnte er äußerst unangenehm werden.
»Tut mir leid, aber ich müsste dringend mal Nummer siebzehn«, entschuldigte ich mich. Das war unser Code für einen Gang zur Toilette, und Herr Schneider liebte Codes. »Hat das vielleicht noch einen Moment Zeit?« Ich versuchte, mich an ihm vorbeizudrücken, aber für einen nicht übermäßig breiten Menschen nahm er erstaunlich viel Gang ein.
»Nein, Frau Wandel, ich fürchte, das duldet keinen Aufschub.« Oje, das klang wirklich nicht gut! Er hatte doch hoffentlich nicht …
»Ich habe etwas in Ihrem Spind entdeckt, das da nicht hingehört.« Mist!
»Und ich dachte, die Mitarbeiterspinde sind privat«, wandte ich ein und hätte mir am liebsten sofort auf die Zunge gebissen. Sicher wäre Frank Schneider nicht besser auf mich zu sprechen, wenn ich ihm mit Spitzfindigkeiten kam.
»Ihr Spind stand sperrangelweit offen. Das geht so nicht. Ist Ihnen klar, oder? Der Mitarbeiterraum muss picobello aussehen, wo kommen wir denn sonst hin?«
Oh, nein! Ich hatte wohl vergessen, den Schrank wieder abzuschließen, weil mich das Gespräch mit Svetlana abgelenkt hatte. Und der Türmechanismus funktionierte nicht richtig. Die Tür musste von allein wieder aufgesprungen sein, nachdem wir den Pausenraum verlassen hatten.
»Ich habe schon eine Weile diesen Verdacht, aber erst wollte ich es nicht wahrhaben. Die Frau Wandel ist eine zuverlässige Mitarbeiterin, hab ich mir gesagt. Die würde niemals Ware mitgehen lassen …« Frank Schneider sah aus, als wäre er zutiefst enttäuscht darüber, dass ich seiner Vorstellung von mir nicht entsprach.
»Tut mir leid«, versicherte ich schnell. »Ich kann das erklären.« Allerdings hatte ich keine Ahnung, wie. Vermutlich war mein Chef nicht besonders offen für das Argument, es sei verantwortungslose Verschwendung, abgelaufene Lebensmittel in den Müll zu werfen.
»Nun, das hoffe ich«, sagte der Filialleiter und trat einen Schritt vor, näher an mich heran. »Das hoffe ich wirklich sehr, denn es wäre schade, Sie als Mitarbeiterin zu verlieren, Marie.« Dass er mich beim Vornamen genannt hatte, fiel mir erst auf, als er bereits sagte: »Wie wäre es, wenn wir das heute Abend bei einem Glas Wein miteinander besprechen? Oder trinken Sie Bier?« Er kam noch einen Schritt näher und legte mir eine Hand auf den Oberarm. »Das können wir doch regeln wie erwachsene Menschen.«
Ich stand wie erstarrt und schaute ihn völlig überrumpelt an. Sogar mein Drang, zur Toilette zu gehen, war von jetzt auf gleich verschwunden. Mit allem Möglichen hatte ich gerechnet. Mit einer Strafpredigt. Womöglich einer Abmahnung. Aber sicher nicht damit, dass er mich bitten würde, mit ihm auszugehen! Wobei, das tat er gar nicht. Genau genommen versuchte er gerade, mich zu erpressen, damit ich mit ihm ausging. Und was er noch alles von mir erwartete, falls er mich davonkommen ließ, das wollte ich mir lieber gar nicht ausmalen. Die ganze Zeit hatte ich bei ihm schon dieses miese Gefühl gehabt. Und offensichtlich hatte ich mich nicht getäuscht.
Mir war absolut bewusst, dass meine einzige Chance, aus dieser Sache wieder herauszukommen, vermutlich darin bestand, mich auf sein eindeutig zweideutiges Angebot einzulassen. Aber ich konnte einfach nicht. Von meinem Selbstbewusstsein mochte seit den Ereignissen vor zwei Jahren nicht mehr viel übrig sein. Aber dieses bisschen bäumte sich in diesem Moment auf, und mir fiel nur eine einzige Antwort ein. »Auf gar keinen Fall«, sagte ich und schüttelte seine Hand ab.
»Schade.« Frank Schneider sah aus, als hätte ich ihn zutiefst gekränkt. »Dann bleibt mir nur übrig, Ihnen fristlos zu kündigen.«
2
Ich drückte den ausgerollten Mürbeteig flach in die Form, nahm eine Gabel aus der überfüllten Besteckschublade und stach den Boden mehrfach an, bevor ich ihn in den Ofen schob. Dann wischte ich meine Hände an der geblümten Kittelschürze ab, die ich in der Küche immer trug, ging zur Spüle und hielt sie unter lauwarmes Wasser. Schließlich trocknete ich sie mit dem Geschirrtuch ab. Als ich es wieder an den Haken hängte, fiel mein Blick auf den Spruch, der darauf gestickt war: Ehrlich währt am längsten. Na, besten Dank, Omi, dachte ich.
Was für mich das Backen war, war für meine Großmutter das Sticken gewesen. Überall in dem kleinen Häuschen stieß man auf Küchentücher, Stofftaschentücher, Zierkissen und Wandbilder, auf denen sie mit spitzer Nadel ihre sprichwörtlichen Lebensweisheiten verewigt hatte. Ehrlich währt am längsten. Was sollte mir der Spruch wohl sagen? Dass es richtig gewesen war, Frank Schneider klarzumachen, was ich von seinem Angebot hielt? Oder dass ich besser von Anfang an ehrlich gewesen wäre und die Lebensmittel gar nicht erst mitgenommen hätte? Ich betrachtete das Geschirrtuch, aber es schwieg. Bestickte Geschirrtücher und Zierkissen waren einfach kein Ersatz für die Ratschläge meiner Omi! Ich presste die Lippen fest aufeinander und widmete mich dem Biskuit.
Erstaunlicherweise hatte Frank Schneider mich die Ware mitnehmen lassen, die ich in den Trolley gepackt hatte. »Ich bin ja kein Unmensch«, hatte er erklärt. Als ob ein paar Bund gummiartiger Möhren und drei Pakete abgelaufener Frischkäse etwas an seinem Karma hätten verbessern können …
Da ich auch die Himbeeren schnell verarbeiten wollte, hatte ich beschlossen, zusätzlich zu der Rüblitorte eine Schokoladenbiskuittorte mit Himbeercreme zu backen. Ich gab Eier in die Metallschüssel und griff zum Schneebesen, um sie über dem Wasserbad warmzuschlagen. Normalerweise war Backen die sicherste Methode, um mich vom Grübeln abzulenken. Doch heute funktionierte das nicht richtig. Während ich langsam den Zucker einrieseln ließ, fingen meine Gedanken wieder an zu kreisen.
Fristlos gekündigt! Vermutlich gab es eine ganze Palette an Gefühlen, die als Reaktion darauf passend gewesen wären. Erleichterung zählte wohl eher nicht dazu. Aber genau das hatte ich im ersten Moment empfunden. Ich war einfach nur unsagbar erleichtert gewesen, Frank Schneider entkommen zu sein. Den angedrückten Bananen, welken Salatköpfen und abgelaufenen Haltbarkeitsdaten. Und den Mülltonnen. Vor allem den Mülltonnen. Inzwischen war mir allerdings klar geworden, was eine fristlose Kündigung bedeutete. Nämlich, dass ich ab sofort kein Gehalt mehr bekam. Und das versetzte mich nun doch in Panik.
Mein Geld hatte die ganze Zeit gerade so gereicht. Die Miete für das kleine Häuschen war schon lange nicht mehr erhöht worden und deshalb verhältnismäßig günstig. Und ich selbst brauchte nicht viel. Aber ich musste den Kredit abbezahlen. Der Bank war es gleichgültig, dass der, dessen Namen zu denken ich mir verboten hatte, alles verkauft hatte, was damit bezahlt worden war. Sie wollte ihr Geld trotzdem zurückhaben.
Die Eierzuckermischung war auf Temperatur, und ich griff zum Handrührgerät, um sie hochzuschlagen. Nichts in dieser Küche war neu. Die altmodischen Küchenschränke aus Eichenfurnier waren an einigen Stellen vom Wasserdampf aufgequollen. Auf dem gelben Fliesenspiegel prangten Prilblumen. Über der Eckbank tickte überlaut die Küchenuhr aus den Siebzigern, und die Kochbücher, die auf dem Hängebord standen, waren noch ein bis zwei Jahrzehnte älter. Ähnlich verhielt es sich mit den Töpfen, Pfannen und Schüsseln, die die Schränke verstopften. Auch sämtliche Elektrogeräte gab es mindestens schon seit meiner Kindheit.
Kein Vergleich mit der schicken Gastronomieküche, die wir für das Café angeschafft hatten. Und die von Greg ohne mein Wissen weiterverkauft worden war. Jetzt hatte ich den Namen doch gedacht, und wie jedes Mal fühlte es sich an wie ein Hieb in den Magen. Wie hatte ich mich bloß so in einem Menschen täuschen können? Ich begriff es noch immer nicht.
Gregor. Greg. Ich hatte ihn auf der Party einer Kollegin aus der Spedition getroffen. Greg hatte jede Menge Lebenserfahrung und bereits in den verschiedensten Jobs gearbeitet. Zu der Zeit machte er irgendwas mit Aktien. Er sah gut aus, er war gut im Bett, aber vor allem gab er mir vom ersten Moment an das Gefühl, die Frau zu sein, auf die er schon immer gewartet hatte. Er glaubte an mich. Und er glaubte an meinen Traum vom eigenen Café.
Ich war Ende zwanzig und nach einigen langweiligen bis enttäuschenden Männergeschichten nun endlich überzeugt, die Liebe meines Lebens getroffen zu haben. Nach nur drei Monaten zog ich bei Greg ein. Und weitere drei Monate später zeigte er mir ein sanierungsbedürftiges, aber sehr süßes Ladenlokal in der Bonner Südstadt. »Das wird unser Café«, sagte er. Er hatte bereits die Kaution bezahlt. Und ein Schild hatte er auch schon bestellt. Glücksmarie stand darauf.
Ich nahm einen Kredit auf, damit wir eine hochmoderne Küche und neue Einrichtung anschaffen konnten. Wochenlang renovierten wir das Ladenlokal und eröffneten das Café schließlich mit einer Riesenparty. Es hielt ein Jahr, ein fantastisches Jahr. Dann wurde meine Omi krank, eine schwere Grippe. Greg drängte mich, mir frei zu nehmen, um mich um sie zu kümmern.
Eine Woche lang war ich rund um die Uhr bei ihr, bis mich eine Bekannte anrief und fragte, warum das Café verrammelt sei. Ich fuhr hin, aber das Schloss war ausgetauscht worden. Es dauerte einen ganzen Tag, bis ich endlich herausgefunden hatte, was los war. Greg hatte hohe Verluste bei seinen Aktiengeschäften gemacht. Er hatte heimlich Nachmieter gesucht, und um seine Schulden zu begleichen, hatte er alles, was sich im Café befand, an die neuen Betreiber verkauft. Es lief ja alles auf seinen Namen. Ich hatte ihm vertraut. Ich war zu naiv gewesen. Zu leichtgläubig. Zu verliebt. Es war alles meine eigene Schuld.
Aber das war nicht das Schlimmste. Das Schlimmste war, dass ich auch schuld daran war, dass meine Omi an genau diesem Tag gestorben war. Weil ich nicht bei ihr gewesen war …
Ich stellte die Butter auf den Herd, damit sie richtig heiß wurde, wog Mehl, Speisestärke und Backkakao ab und rührte alles zusammen, um es auf die Eischaummasse zu sieben und sanft unterzuarbeiten. Dann gab ich die geschmolzene Butter dazu und das Ganze in die Form.
Fristlos gekündigt! Ich war mir nicht einmal sicher, ob das rechtens war. Aber ohne anwaltliche Hilfe würde ich vermutlich nichts ausrichten. Und Anwälte kosteten Geld. Was ich nicht hatte. Genau an diesem Punkt war ich vor zwei Jahren schon einmal gewesen. Und genau wie damals fehlte mir auch jetzt die Energie, mich zu wehren. Nein, ich würde einen neuen Job finden müssen. Und zwar schnell. Die Frage war nur, wo ich suchen sollte. In einem Supermarkt wollte ich nicht wieder anfangen, so viel war sicher. Und dass ich auf die Schnelle etwas in einem Büro bekommen würde, nachdem ich mehrere Jahre nicht mehr in dem Beruf gearbeitet hatte, wagte ich zu bezweifeln. Garantiert gab es da geeignetere Bewerberinnen und Bewerber. Außerdem musste meine neue Stelle mit dem Fahrrad oder mit Bus und Bahn gut zu erreichen sein. Ich besaß zwar einen Führerschein, aber null Fahrpraxis, weil ich mich nach der Prüfung nie wieder hinter ein Lenkrad gesetzt hatte. Und ein Auto hatte ich natürlich auch nicht.
Ich sah auf die Uhr. Seit mehr als vier Stunden war ich schon in der Küche beschäftigt. Plötzlich hatte ich heftiges Verlangen nach einem Kaffee. Ich nahm den Mürbeteigboden aus dem Ofen und zog ihn mitsamt Backpapier auf einen Rost, damit er abkühlen konnte. Dann setzte ich den Kessel auf. Meine Großmutter hatte nichts von Kaffeemaschinen gehalten. Solange ich mich erinnern konnte, hatte sie den Kaffee in ihrer geblümten, bauchigen Kanne mit der spitzen Tülle von Hand aufgebrüht. Alles andere war für sie moderner Schnickschnack.
Vor Jahren hatte ich ihr mal eine kleine, schicke Maschine zum Geburtstag geschenkt, in der die Bohnen frisch gemahlen wurden. Doch das Gerät hatte sie zuerst in der Abstellkammer, anschließend im Wohnzimmerbuffet und am Ende im Schuhschrank verstaut. Benutzt hatte sie es nie. Ich nahm den Porzellanfilter und ein Filterpapier aus dem Hängeschrank, füllte Kaffeepulver hinein und stellte ihn auf einen Becher. Als der Kessel zu pfeifen begann, goss ich das heiße Wasser auf das Pulver. Handgefiltert. Das ließen sich manche Cafés inzwischen teuer bezahlen. So betrachtet, war meine Großmutter ihrer Zeit eigentlich voraus gewesen. Ich schob den Biskuit in den Backofen und ging mit meinem Kaffeebecher ins Wohnzimmer.
Auf dem Couchtisch stapelten sich ein paar Koch- und Backbücher, alte Fernseh- und Klatschzeitschriften, dazwischen fast schon dekorativ drei leere Verpackungen von Fertiggerichten: scharfes indisches Curry, vegetarische Lasagne und noch mal scharfes indisches Curry, das verkaufte sich nicht besonders gut, dabei war es höchstens mittelscharf. Die schmutzigen Kaffeetassen, vier an der Zahl, sollte ich auch mal wieder in die Küche bringen, dachte ich, bevor ich sie zur Seite schob, um meinen Becher abzustellen.
Ich ließ mich in den Berg von Zierkissen auf dem Sofa sinken und legte meine Füße auf dem Couchtisch ab, nur ganz vorn an der Tischkante, weil ich natürlich sofort die Worte meiner Omi im Ohr hatte: »Auf den Tisch gehört der Kuchen, da haben die Füße nichts zu suchen.« Ich zog die Fernbedienung aus der Polsterritze und schaltete den Fernseher ein. Genau zur richtigen Zeit, wie ich überrascht feststellte, als die Titelmelodie von 1000 tolle Torten ertönte.
Normalerweise war ich samstags den ganzen Tag auf der Arbeit und schaute mir die Show deshalb abends im Stream an. Oder eine andere der vielen verfügbaren Sendungen, in denen die Kandidatinnen und Kandidaten mit Teigschaber und Spritztülle um die Konditorkrone kämpften. Nicht, weil ich glaubte, noch viel von den Kreationen und Katastrophen, die die Hobbybäcker produzierten, lernen zu können. Ich hatte einiges an Zeit und Geld investiert, um den Sachkundenachweis und die Ausnahmebewilligung zu erwerben, die ich brauchte, um in unserem Café selbst gebackene Torten anbieten zu dürfen. Nein, ich fand es einfach beruhigend, Menschen zuzuschauen, deren größte Sorge darin zu bestehen schien, ob ihnen die Buttercreme gelang.
»Auf die Plätzchen, fertig, los!«, gab die strahlende Moderatorin den Startschuss zur heutigen Sendung, und die Teilnehmer stürzten sich auf die Zutaten, als hinge ihr Leben davon ab, in unter zwei Stunden eine Motivtorte zum Thema Wunder der Welt in 3D zu erschaffen. Es war die perfekte Realitätsflucht. Und die konnte ich heute wirklich gut gebrauchen. Ich beugte mich nach vorn, um meinen Kaffeebecher vom Couchtisch zu nehmen. Dabei rutschten meine Füße ein Stück zur Seite und beförderten einen Schwung Briefumschläge auf den Boden. Die ungeöffnete Post der letzten Tage, die ich hier abgelegt hatte, um mich irgendwann darum zu kümmern. Werbung und Rechnungen, was sonst … Wer hätte mir schon schreiben sollen?
Im Fernseher erklärte Kandidat Karsten, siebenunddreißig, Versicherungsmakler, dass er das Blue Hole backen werde, einen berühmten Tauchspot in Ägypten, und während ich mich nach unten beugte, um die Briefe aufzusammeln, fragte ich mich, wie ein blaues Loch wohl als Torte aussah. Noch dazu in 3D. Doch bevor Karsten zu einer längeren Erklärung ansetzen konnte, wurde meine Aufmerksamkeit von einem cremefarbenen Umschlag abgelenkt oder besser gesagt von dem Absender darauf: Bestattungsinstitut Gruber. Theodor Gruber war mein Vermieter. Was wollte der denn von mir?
Nach dem Greg-Debakel hatte ich schnell eine neue Bleibe gebraucht. Und nach dem Tod meiner Omi gab es nur einen einzigen Ort, an dem ich sein wollte: ihr Häuschen, wo mich alles an sie erinnerte. Herr Gruber hatte nichts dagegen einzuwenden gehabt, dass der Mietvertrag auf meinen Namen weiterlief, und ich hatte direkt einen Dauerauftrag für die Miete eingerichtet. Pünktlich zum Monatsersten. Damit hatte es bisher nie ein Problem gegeben.
Zum zweiten Mal an diesem Tag überkam mich eine ausgesprochen ungute Vorahnung, und ich wollte den Umschlag zusammen mit den anderen schnell zurück auf den Sofatisch legen. Doch da hatte ich die Rechnung ohne das Zierkissen zu meiner Rechten gemacht, das plötzlich auf den Boden plumpste, obwohl ich mich gar nicht bewegt hatte.
Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen, stand in fein säuberlich gestickten Stichen darauf. Ist ja schon gut, Omi, dachte ich unwillig und riss den Umschlag mit einer einzigen ruckartigen Bewegung auf. Dann starrte ich fassungslos auf das Blatt in meiner Hand und wünschte, ich hätte den Brief versehentlich ungeöffnet im Müll entsorgt. Was natürlich kein rationaler Wunsch war. Denn davon wäre das Problem, das ich hier schwarz auf creme in der Hand hielt, nicht verschwunden. Aber zu einer rationalen Reaktion war ich gar nicht in der Lage.
Denn zu seinem größten Bedauern musste mein Vermieter mir mitteilen, dass ich bisher leider viel zu geringe Nebenkostenvorauszahlungen geleistet hatte. Deshalb müsse ich erstens sofort fast tausend Euro nachzahlen und zweitens ab dem kommenden Monat fünfzig Euro mehr pro Monat vorauszahlen. Außerdem werde sich drittens die Miete, die seit zehn Jahren nicht mehr erhöht worden sei, ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt am ortsüblichen Mietspiegel orientieren und damit um knapp hundert Euro steigen.
Einige Sekunden lang flimmerten die Zahlen vor meinen Augen, dann drang das ganze Ausmaß der Katastrophe in mein Bewusstsein. So viel Geld! Das ich nicht hatte … und auf absehbare Zeit nicht haben würde. Denn seit heute hatte ich ja auch keinen Job mehr! Ich griff mir mit beiden Händen in die Haare, als mich Panik erfasste. Kein Job. Kein Geld. Kein Haus.
Nein! Das durfte auf keinen Fall passieren! Ich durfte das Häuschen nicht verlieren. Ziellos sprang mein Blick im Zimmer umher. Die bestickten Zierkissen auf dem moosgrünen Ecksofa mit der Fransenkante, die Spitzendeckchen auf dem Fernsehschrank, die verblichene Strukturtapete mit dem Blumenkranzmuster, das man auch beim besten Willen nicht mehr als retroschick bezeichnen konnte. An der Wand aufgereiht hingen Fotos von mir, erst vom Schulfotografen aufgenommen, vom Zahnlückengrinsen bis zum verkniffenen Zahnspangenlächeln, und dann, als der Fotograf in den höheren Klassen nicht mehr kam, hatte meine Omi darauf bestanden, jedes Jahr mit mir ins Porträtstudio zu gehen. An der anderen Wand die Rahmen mit ihren Stickbildern.
Mein Blick saugte jedes Detail auf, als würde ich all das hier zum ersten Mal richtig wahrnehmen. Dabei war es mir seit meiner Kindheit vertraut. Ich war bei meiner Omi aufgewachsen, weil meine Eltern bei einem Flugzeugabsturz über dem Roten Meer ums Leben gekommen waren, als ich gerade ein Jahr alt war. Bis auf die wenigen Jahre, in denen ich zuerst mit meiner früheren besten Freundin Sibel und dann mit Greg zusammengewohnt hatte, hatte ich immer hier gelebt. Deshalb hätte ich durch dieses Zimmer schlafwandeln können, ohne irgendwo anzustoßen, obwohl es viel zu vollgestellt war. Meine Großmutter hatte nie etwas weggegeben, das noch gut war.
Irgendwann hatte ich mal versucht, sie zu überreden, das Häuschen zu renovieren und es etwas moderner einzurichten. Aber meine Omi hatte bloß lächelnd den Kopf geschüttelt. »Wir haben es doch schön hier, wir zwei«, hatte sie gesagt, und damit hatte sie natürlich recht gehabt. Nachdem ich wieder hier eingezogen war, hatte ich nicht das kleinste Detail im Haus verändert. Warum auch? Ein dunkelgrünes Sofa mit Fransenkante, eine Schrankwand in Eiche rustikal, Tiffanylampen und jede Menge altkluge Zierkissen, das war alles, was mir von ihr geblieben war.
Ohne lange nachzudenken, sprang ich auf, schlüpfte in das erstbeste Paar Schuhe, das im Flur stand – Omis alte Gartengummistiefel – und rannte aus dem Haus. Ich war so außer mir, dass ich kaum etwas um mich herum wahrnahm. Aber ich kannte alle Wege in diesem Ort, in dem ich groß geworden war, ohnehin in- und auswendig. So viele waren es ja nicht. Mitten durch den Ort wand sich die Hauptstraße, die so schmal war, dass sie diesen Namen kaum verdiente, vorbei an der Grundschule, der Eisdiele Alfonso, dem Supermarkt und der Kirche mit dem Gemeindezentrum. Und kurz bevor sie am Ortsausgang auf die Bundesstraße stieß, die in der einen Richtung nach Bonn und in der anderen nach Köln führte, passierte sie eine kleine, alte Villa, die hinter hohen Mauern in einem großen Garten stand. Dort befand sich das Bestattungsinstitut Gruber.
Ich legte die gesamte Strecke im Dauerlauf zurück und bog schließlich keuchend in die Kieszufahrt ein. Gruber. Ihr Bestatter in dritter Generation war auf einem Schild am Eingangstor zu lesen. Die Villa sah aus wie ein Zuckerbäckerschloss im Miniaturformat, nur dass der Zuckerguss sein Haltbarkeitsdatum deutlich überschritten hatte. Der Putz war angegraut, der dunkelrote Anstrich blätterte von den Fensterläden, und die cremefarbenen Vorhänge hinter den Scheiben links und rechts der Eingangstür waren so gelbstichig, als befände sich im Inneren nicht ein Bestattungsinstitut, sondern ein Raucherclub. Davor parkte ein schwarzer, kastenförmiger Leichenwagen, dessen hintere Scheiben ebenfalls mit angegilbten, ehemals cremefarbenen Gardinen verhängt waren.
Ich hielt mich allerdings nicht mit langen Betrachtungen auf, sondern warf mich gegen die eine Seite der Doppeltür, die daraufhin sofort nachgab und mir mit einem ungnädigen Knirschen über den Steinfußboden Einlass gewährte. Ich war nie zuvor hier gewesen. Als meine Omi gestorben war, war Herr Gruber zu mir nach Hause gekommen, um die Formalitäten zu erledigen, ein Gespräch, an das ich mich nur sehr verschwommen erinnerte. Ich sah mich um, konnte aber niemanden entdecken.
Fünf Türen gingen von der Eingangshalle ab, eine geschwungene Treppe führte ins Obergeschoss. Daran war ein moderner Treppenlift montiert, der in diesem Ambiente seltsam fehl am Platz wirkte. An der rechten Seite stand eine dunkle Kommode mit Löwenfüßen, obendrauf ein Porzellanengel, der seinen Kopf schwer in die Hände stützte. Und in der Mitte des Raums zog ein wuchtiger Marmortisch meine Aufmerksamkeit auf sich, auf dem eine vertrocknete Topfpflanze traurig ihre braunen Blätter Richtung Boden hängen ließ.
»Hallo«, rief ich, noch immer etwas atemlos von meinem Sprint. »Ist hier jemand?« Stille. Totenstille. Fast ein bisschen gruselig.
»Hallo?« Ich machte drei Schritte in Richtung der toten Topfpflanze und lauschte angestrengt.
»Guten Tag«, ertönte da eine Stimme direkt hinter mir, und ich zuckte zusammen. Herr Gruber schien die Fähigkeit zu besitzen, sich geräuschlos anzuschleichen.
»Ah, Frau Wandel. Sie sind das. Wie schön, Sie mal wieder zu sehen.« Wirklich erfreut schien er allerdings nicht zu sein, sein Lächeln wirkte bemüht. Mein Vermieter war etwa Mitte fünfzig, trug einen schwarzen Anzug, dessen Schnitt wohl niemals modisch gewesen war, und hatte etwas zu lange, dünne Haare, die er sich mit seinen langen, dünnen Fingern über die Halbglatze strich.
»Was führt Sie denn zu mir?«, fragte er, ließ mich aber gar nicht zu Wort kommen. »Treten Sie doch ein.« Er wies auf eine der Türen.
Kaum hatten wir den Raum betreten, rückte er mir einen der vier Kunstlederstühle zurecht, die um einen Rauchglastisch gruppiert waren, auf dem sich Sargkataloge stapelten. »Nehmen Sie Platz, bitte.«
Herr Gruber setzte sich mir gegenüber, direkt vor ein deckenhohes Regal, in dem verschiedenste Urnenmodelle aufgereiht standen. Alles in diesem Raum erinnerte an Tod und Trauer. Selbst die bunten Fische, die in einem gewaltigen Aquarium in einer tropischen Unterwasserwelt ihre Kreise zogen, sahen irgendwie deprimiert aus. Ich fühlte mich furchtbar unwohl und brachte keinen Ton heraus.
»Nun, liebe Frau Wandel, was kann ich für Sie tun?« Herr Gruber knetete seine Hände, als wäre er nervös.
Warum sollte er nervös sein, fragte ich mich. Warum sollte es ihn interessieren, ob ich die höhere Miete zahlen konnte? Dann kündigte er mir halt und vermietete an irgendeinen Berufspendler, der nur von montags bis freitags eine Bleibe brauchte, weil er am Wochenende nach Hause zu seiner Familie ins Sauerland fuhr, und dem die Höhe der Miete völlig egal war, weil die sowieso von der Firma bezahlt wurde.
Es war eine ganz blöde Idee hierherzukommen, dachte ich. Meine Augen fingen an zu brennen, und ich kniff sie fest zusammen, doch da lief bereits eine Träne feucht an meiner Nase entlang. So ein Mist! Es war nicht mein Plan gewesen, hier auf die Tränendrüse zu drücken. Wobei, was war eigentlich mein Plan gewesen? Wenn ich ehrlich war, hatte ich gar keinen gehabt, sondern war einfach kopflos aus dem Haus gerannt.
»Na, na, Frau Wandel …«, sagte Herr Gruber erschrocken. »Soll ich Ihnen vielleicht ein Glas Wasser holen? Oder brauchen Sie ein Taschentuch?« Hektisch angelte er nach einer Box mit Papiertaschentüchern, die auf dem Tisch bereitstand, und reichte sie mir. Als sich dabei unsere Hände versehentlich berührten, merkte ich, dass seine ganz feucht waren und leicht zitterten. Ich fragte mich, wie er in seinem Job zurechtkam, in dem er sicherlich regelmäßig mit emotionalen Ausnahmezuständen konfrontiert war. Aber irgendwie führte seine Unsicherheit dazu, dass ich es schaffte, mich wieder in den Griff zu bekommen. Herr Gruber war auch nur ein Mensch. Womöglich hatte ich ja doch eine Chance.
»Nein, schon gut, es geht wieder«, versicherte ich schnell und schnäuzte mich ein bisschen zu lautstark in das Taschentuch, bevor ich endlich zu meinem Anliegen kam. »Die Nebenkosten. Und die Miete. Ich kann das nicht zahlen. Zumindest im Moment nicht. Ich hab nämlich heute meinen Job verloren, und dann muss ich auch noch einen Kredit abbezahlen …« Ich schluckte kräftig. »Aber ich will doch nicht ausziehen. Meine Großmutter hat da immer gewohnt. Und ich hab meine ganze Kindheit in dem Haus verbracht.« Ich zuckte mit den Schultern, und als ich Herrn Grubers betretenen Blick sah, fuhr ich schnell fort: »Vielleicht können Sie das ja noch aufschieben, diese Nachzahlung, meine ich. Und vielleicht auch die Erhöhung. Ich muss nur einen neuen Job finden.« Und zwar einen besser bezahlten, fügte ich in Gedanken hinzu, aber darüber wollte ich mir jetzt nicht auch noch Sorgen machen. »Und die Mieterhöhung, vielleicht können Sie darauf ja erst mal verzichten …«
Ich verstummte, weil ich nicht wusste, was ich noch sagen sollte, und in die Stille hinein ertönte plötzlich ein lautes Pochen. Ich zuckte schon wieder zusammen. In diesem Haus gingen seltsame Dinge vor sich. Herr Gruber seufzte tief. Erneut pochte es. Energischer als zuvor. Es kam von oben, direkt über uns schien jemand mit einem harten Gegenstand kräftig auf den Boden zu schlagen. Herr Gruber seufzte noch einmal, ging aber nicht weiter darauf ein.
»Nun, liebe Frau Wandel«, sagte er. »Das mit Ihrer Arbeitsstelle ist wirklich ausgesprochen bedauerlich.« Auf seinem Gesicht erschien ein trauriger Ausdruck. Mit seinem betrübten Blick, der mitleidvoll gefurchten Stirn und den ausgeprägten Tränensäcken hatte er starke Ähnlichkeit mit einem sorgenvoll dreinblickenden Basset. Das perfekte Bestattergesicht, schoss es mir durch den Kopf. Gleichzeitig sank meine gerade erst erwachte Hoffnung. Wer so guckte, hatte keine guten Nachrichten zu überbringen.
»Es tut mir sehr leid, dass Ihre zu geringen Vorauszahlungen nicht früher aufgefallen sind und der Mietpreis nicht mehr zeitgemäß ist. Mein Steuerberater hat mich gerade erst darauf aufmerksam gemacht, dass da Handlungsbedarf besteht.«
Mehr sagte er nicht, er verzog nur bedauernd das Gesicht, und meine Augen fingen wieder an zu brennen. Das hier war aussichtslos. Für meinen Vermieter bestand Handlungsbedarf, und ganz gleich, was ich sagte, es würde nichts daran ändern können.
»Nicht doch, liebe Frau Wandel.« Eilig hob Herr Gruber die Hände in einer beschwichtigenden Geste. »Ich bin mir sicher, es wird sich eine Lösung finden, also, ich meine …« Er sah mich ratlos an.
»Schon gut, vergessen Sie es.« Ich wollte aufstehen und so schnell wie möglich aus dem Bestattungsinstitut verschwinden. Da ertönte von oben erneut das energische Pochen.
»Warten Sie.« Herr Gruber bedeutete mir, dass ich mich wieder hinsetzen sollte. »Gerade eben ist mir ein Gedanke gekommen. Vielleicht kann ich Ihnen doch etwas anbieten«, sagte er zögernd und strich sich die dünnen Haarsträhnen über die Halbglatze. »Nämlich eine Anstellung. Ich könnte hier ein bisschen Unterstützung gebrauchen. Bei der Büroarbeit. Rechnungen, Bestellungen, Buchhaltung, der ganze lästige Papierkram, Sie wissen schon. Und bei der Beratung unserer Kunden. Das hat früher alles die liebe Frau Meyering gemacht, die hatte ich noch von meinem verstorbenen Vater übernommen. Seit sie in den Ruhestand gegangen ist, habe ich es dann alleine versucht. Aber, wie soll ich sagen, das ist mir wohl alles etwas über den Kopf gewachsen … Nun, sonst wäre das mit Ihren Nebenkosten ja auch längst aufgefallen.« Er strich sich erneut über die dünnen Haare. »Ich denke schon ein Weilchen darüber nach, dass ich wieder jemanden einstellen sollte. Und Sie haben das doch mal gelernt, Frau Wandel. Büro und so …« Er strahlte mich an. Plötzlich wirkte er wie ausgewechselt.
Ich nickte, völlig überrumpelt von seinem Angebot.
»Großartig. Dann ist das abgemacht, ja?«
»Aber … ich …«, stammelte ich. Auf gar keinen Fall wollte ich hier arbeiten! In einem Bestattungsinstitut, täglich umgeben von Tod und Trauer … Es gab eigentlich keinen Job, den ich weniger gerne machen wollte. Wenn ich bloß daran dachte, schnürte sich mir der Hals zu.
Als meine Omi gestorben war, am selben Tag, an dem ich erfahren hatte, dass der Mann, von dem ich geglaubt hatte, er sei meine große Liebe, mich hintergangen und meinen größten Traum zerstört hatte, da hatte das etwas in mir zerstört. Es war einfach kaputtgegangen. Seitdem fühlte ich mich, als wäre ich innerlich vollkommen leer. Was immer noch besser war als der Schmerz, von dem ich genau wusste, dass er nach wie vor in mir lauerte. Und dass ich ihn nur in Schach halten konnte, wenn ich möglichst wenig daran rührte. Aber wie sollte das gehen, an einem Ort wie diesem?!
»Ich weiß wirklich nicht, ob ich die Richtige dafür bin«, sagte ich schnell. »Ich habe zwar Bürokauffrau gelernt, aber mit diesen ganzen Bestattungssachen kenne ich mich überhaupt nicht aus.«
»Keine Sorge, liebe Frau Wandel«, tat Herr Gruber meinen Einwand sofort ab. »Erst mal kümmern Sie sich nur ums Büro, in alles andere arbeite ich Sie dann nach und nach ein.«
»Aber …«, startete ich einen weiteren Versuch, doch Herr Gruber ließ mich gar nicht mehr zu Wort kommen.
»Wissen Sie was, wir machen es so: Ich zahle Ihnen nicht nur ein angemessenes Gehalt, sodass die Nebenkosten kein Problem sein sollten. Wir überlegen uns auch etwas wegen der Nachzahlung. Vielleicht können Sie das in Raten abbezahlen, oder wir verschieben es ein bisschen, da spreche ich noch mal mit meinem Steuerberater. Ja, und was die Miete angeht, da habe ich auch einen wunderbaren Vorschlag …« Er holte tief Luft. »Wenn Sie sich bitte zusätzlich ein wenig um meine liebe Tante kümmern könnten. Sie hat bis vor Kurzem in einer sehr exklusiven Seniorenresidenz gewohnt. Leider konnte sie dort nicht bleiben. Deshalb habe ich sie bei mir aufgenommen. Keine Sorge, wir sprechen da nicht über pflegerische Aufgaben, sie braucht nur ein bisschen Gesellschaft. Das würde ich Ihnen dann extra vergüten.« Er nannte mir eine Summe, die meine Geldprobleme tatsächlich lösen würde, zumindest, wenn sich die Nachzahlung aufschieben ließ, bis ich den Kredit abbezahlt hatte. Ich nickte nachdenklich.
Wieder klopfte es über unseren Köpfen.
»Ich muss jetzt wohl auch mal zu ihr. Sie besitzt eine recht energische Art, ihre Wünsche zum Ausdruck zu bringen.« Herr Gruber deutete zur Decke. Dann stand er auf und streckte mir seine Hand entgegen. »Liebe Frau Wandel, wir sehen uns dann direkt am Montag, pünktlich um acht bitte. Und dass wir uns hier pietätvoll kleiden, versteht sich sicher von selbst. Es könnten ja jederzeit Kunden hereinkommen.«
Er wartete nicht ab, bis ich seine Hand hätte schütteln können, sondern eilte aus dem Zimmer. Noch immer sprachlos schaute ich erst ihm hinterher und dann an mir hinunter. Zu Omis Gartengummistiefeln trug ich meine ausgeleierte Jogginghose und die geblümte Kittelschürze, die noch voll Mehl war. Eigentlich ein Wunder, dass Herr Gruber mir eine Anstellung angeboten hatte, anstatt mich einweisen zu lassen.
Und dann sickerte die ganze Tragweite dessen, was gerade geschehen war, in mein Bewusstsein. Ich hatte einen Job in einem Bestattungsinstitut angenommen – oder zumindest hatte ich ihn nicht vehement genug abgelehnt. Was war bloß in mich gefahren?
Andererseits, hatte ich überhaupt eine Wahl? Vermutlich wäre Herr Gruber nicht mehr so entgegenkommend, was die Nachzahlung anging, wenn ich sein Stellenangebot ablehnte. Und um ehrlich zu sein, war es ein gutes Angebot. Ich war mir nicht sicher, ob ich auf die Schnelle etwas Vergleichbares finden würde.
Es ist erst mal nur ein Bürojob, redete ich mir auf dem Heimweg selbst gut zu. Ein Bürojob wie jeder andere. Mit den Särgen und den Urnen und den ganzen anderen Bestattungssachen würde ich zunächst nichts zu tun haben. Und was die »liebe Tante« anging, die offenbar zu sehr energischem Pochen neigte, nun, das würde ich schon irgendwie hinkriegen. Mit älteren Leuten war ich bisher immer gut klargekommen.
Als ich zu Hause ankam, hatte ich mich auf diese Weise halbwegs selbst beruhigt. Auch wenn mir mein neuer Job noch immer Bauchgrummeln verursachte, war wenigstens meine allergrößte Sorge vom Tisch. Ich würde mein geliebtes Häuschen nicht verlieren. Jetzt wollte ich mich erst mal in Ruhe meiner Himbeerschokotorte widmen, das würde mir hoffentlich helfen, mein inneres Gleichgewicht wiederzuerlangen. Doch als ich den engen Hausflur betrat, schlug mir der beißende Gestank von Angebranntem entgegen. Der Biskuit! Ich hatte ihn im Backofen vergessen!
Ich stürzte in die Küche, zerrte den verkohlten Klumpen aus dem Ofen, warf ihn in die Spüle und riss das Küchenfenster auf. Von den Feldern, die zwischen meinem alten Fachwerkhäuschen und dem Rhein lagen, zog leichter Güllegeruch herein, aber das war immer noch besser als der Gestank des verbrannten Kuchens. Was ist nur mit diesem Tag los, dachte ich, dass er so viele unschöne Überraschungen für mich bereithält?
In diesem Moment hörte ich durch das geöffnete Fenster seltsame Geräusche hinter dem Haus. Zuerst einen langanhaltenden Schrei. Gefolgt von einem heftigen Krachen und einem etwas leiseren Poltern. Und schließlich eine Männerstimme, die lauthals fluchte.
»Ahh, Scheiße, autsch, aua, AU-A! Ausgerechnet in die Rosen!«
3
Aus meinem Haus gab es keinen direkten Zugang in den Garten. Man musste durch die Eingangstür auf die Straße laufen und von dort über die seitliche Einfahrt, die zur Hälfte von einem alten Holzschuppen versperrt wurde, in dem sich neben meinem Fahrrad eine Vielzahl von Gartengeräten und anderem Kram stapelte. Durch ein schmiedeeisernes Tor gelangte man schließlich in Omis kleines, grünes Paradies. Oder das, was davon noch übrig war. Denn leider besaß ich nicht einen Bruchteil der Fähigkeiten meiner Großmutter im Umgang mit allem, was blühte. Oder theoretisch hätte blühen sollen.
Zu sagen, ich hätte mich nicht besonders gut um den Garten gekümmert, wäre noch eine Untertreibung gewesen. Ich hatte ihn in den zwei Jahren schlicht und ergreifend komplett vernachlässigt. Nur die Äpfel von dem knorrigen Baum, der am hinteren Ende des Grundstücks direkt am Feld stand, hatte ich eingesammelt, und aus allen, die ich nicht zu Apfeltartes, Apfelbeignets und Apfelplätzchen hatte verarbeiten können, hatte ich Mus oder Gelee gekocht. Die Gläser nahmen drei ganze Regalborde im Vorratskeller ein.
Zwei weitere Borde hatte ich mit Himbeer-, Brombeer- und Johannisbeermarmelade gefüllt. Dieses Jahr hatten die Beerensträucher dann nichts mehr getragen, weil sie vertrocknet waren. Ebenso wie fast alle anderen Pflanzen, die meine Großmutter mit Hingabe gehegt und gepflegt hatte. Einzig und allein die Rosen, ihr ganzer Stolz, hatten wieder geblüht, wie ich neulich beim Blick aus dem Fenster festgestellt hatte. Ich ging so gut wie nie in den Garten, vor lauter schlechtem Gewissen.
Doch jetzt rannte ich. Der Schrei, das Krachen und dann das laute Fluchen – da musste etwas passiert sein. Ich stieß das schmiedeeiserne Tor auf, das quietschend zur Seite schwang, und stürmte in den Garten. Dann blieb ich abrupt stehen. Der Anblick, der sich mir bot, war so seltsam, dass ich im ersten Moment gar nicht begriff, was ich sah.
Als Erstes bemerkte ich die riesige, bunte, zerfetzte Plane, die in der Krone des Apfelbaums hing. An der Plane war eine Vielzahl dünner Schnüre befestigt, und als mein Blick diesen zum Boden folgte, wurde mir klar, worum es sich handelte. Das da im Baum musste ein Fallschirm sein. Und auf dem Boden, mitten in den Rosen meiner Großmutter, lag ein Mann, der offensichtlich an dem Fallschirm gehangen hatte. Nun kämpfte er gleichzeitig mit den Schnüren und den dornenbesetzten Zweigen der Rosen und fluchte dabei in einem fort.
Fluchen ist gut, dachte ich, dann ist er nicht bewusstlos. Und auch nicht schwer verletzt. Hoffentlich. Trotzdem schien er dringend Hilfe zu benötigen. Also lief ich eilig durch das kniehohe Gras zu ihm, wobei ich mehreren großen Ästen ausweichen musste, die zusammen mit dem Bruchpiloten aus dem Apfelbaum gestürzt waren.
»Kann ich Ihnen helfen?«, rief ich im Näherkommen.
Der Mann unterbrach seinen Kampf mit Schnüren und Dornen und schaute zu mir hoch, als ich vor ihm stehen blieb.
»Absolut«, sagte er. »Könntest du ein kurzes Video von mir machen? Ich komme einfach nicht an mein Handy ran.«
»Was?« Ich schaute ihn fassungslos an.
»Für meine Follower. Die Story gibt Klicks ohne Ende.«
»Was?«, wiederholte ich wenig sprachgewandt.
»Und lächle mal. Die Aufzeichnung läuft noch. Schickes Outfit übrigens.«
Ja, ich trug immer noch die geblümte Kittelschürze. Aber was ging ihn das an? An dem Helm auf seinem Kopf entdeckte ich eine Kamera, die rot leuchtete. Außerdem hatte er eine Schutzbrille auf der Nase. Trotzdem erkannte ich ihn schließlich. »Sie sind der Typ aus der Zeitung«, stellte ich fest. »Dieser Verrückte, der Bungee-Jumping macht und das ganze Zeug. Von wegen letzter Tag und so.« Ich überlegte kurz, dann fiel mir sogar der Name ein. »Benjamin Kaufmann, richtig?«
»Bitte sag Ben, so nennen mich alle meine Freunde. Benjamin haben mich nur meine Eltern gerufen, wenn ich etwas ausgefressen hatte.« Er grinste breit und zeigte dabei eine Reihe gerader, weißer Zähne. »Und bitte siez mich nicht, sonst komm ich mir so alt vor, wie meine Knochen sich gerade anfühlen.«
»Okay.«
»Und du bist?«
»Marie.«
»Super, Marie, freut mich. Was ist jetzt mit dem Video? Ich wollte hier eigentlich nicht länger als unbedingt nötig liegen bleiben.«
Der Typ war wirklich verrückt. Und ziemlich unverschämt.
»Ich hab leider mein Handy drinnen gelassen«, erklärte ich. »Aber ich könnte dir hochhelfen. Dann kommst du vielleicht an deins dran. Und zerstörst nicht weiter die Rosen.« Ich wusste selbst nicht, warum ich so schnippisch reagierte, das war sonst gar nicht meine Art. Aber irgendwie nahm ich es diesem Ben übel, dass er einfach so in meinem Garten abgestürzt war. Nach diesem irren Tag wollte ich eigentlich bloß noch meine Ruhe haben. Einfach liegen lassen konnte ich ihn allerdings auch schlecht. Also streckte ich ihm eine Hand entgegen.
Ohne weiter zu diskutieren, löste er daraufhin die Gurte, die an seinen Beinen und auf seiner Brust befestigt waren, und wand die Arme aus den Schlaufen. Dabei schien er die Zähne zusammenzubeißen, jedenfalls fluchte er nicht mehr.
Dann zog er sich den Helm und die Schutzbrille vom Kopf, griff tatsächlich nach meiner Hand und kam mit schmerzverzerrtem und ziemlich zerschrammtem Gesicht mühsam auf die Füße.
»Aua, Shit«, presste er zwischen den zusammengebissenen Zähnen hervor und stützte sich plötzlich mit seinem ganzen Gewicht auf meinen Arm, sodass wir gemeinsam zur Seite torkelten und fast im Gras gelandet wären, bevor ich mich wieder fangen konnte. »Ich glaube, der Baum hat meinen Fuß zerlegt«, stellte er mit einem Stöhnen fest.
Und dein Fuß den Baum, verkniff ich mir gerade noch zu sagen. »Soll ich einen Krankenwagen rufen?«, bot ich stattdessen an.
»Quatsch, das passt schon. Bloß nicht ins Krankenhaus!«, lehnte er unwirsch ab.
»Schon gut«, beschwichtigte ich ihn. »Komm erst mal mit rein. Ich kann dir was zum Kühlen für deinen Fuß geben.« Keine Ahnung, ob das helfen würde, aber war es nicht das, was man mit Verletzungen aller Art machte? Zumindest hatte meine Großmutter immer mehrere Waschlappen im Eisfach gehabt, die sie mir bei Bedarf auf Schürfwunden, Bienenstiche und bei Zahnschmerzen auf die Wange drückte. Womöglich lagen sie noch im Gefrierschrank. »Du kannst deinen Arm über meine Schultern legen.«
»Moment, ich brauch erst mein Handy. Kannst du mir mal eben helfen? Das steckt hier in der Innentasche.«
»Ernsthaft?« Ich schüttelte den Kopf. »Du willst wirklich unbedingt, dass ich dieses Video mache?«
»Nein.« Er lachte. Dafür, dass ihm sein Fuß und vermutlich auch eine Menge anderer Körperteile wehtaten, klang er erstaunlich gut gelaunt. »Aber ich muss mich dringend bei dem Team von der Fallschirmschule melden und ihnen sagen, wo ich bin. Die sind garantiert schon in totaler Panik, weil ich zu früh abgesprungen bin.«
»Wie, zu früh abgesprungen?«, wunderte ich mich. Aber eigentlich wollte ich das Gespräch gar nicht hier im Garten fortsetzen. Dieser Ben war groß und, soweit ich erkennen konnte, auch recht sportlich gebaut, aber definitiv kein Fliegengewicht, und so langsam wurde es mir zu schwer, ihn zu stützen. »Du kannst sie anrufen, wenn wir im Haus sind«, erklärte ich also, und zu meinem Erstaunen humpelte er daraufhin ohne Protest neben mir her, bis ich ihn mühsam in die Küche und dort auf einen Stuhl am Tisch bugsiert hatte.
»Riecht nach verkohlter Schuhsohle«, stellte er fest und rümpfte die Nase. »Was hast du denn hier angezündet?«
»Wolltest du nicht telefonieren?« Je eher ich ihn wieder loswurde, desto besser. Er kramte sein Handy hervor, während ich die Fächer des Gefrierschranks nach den Waschlappen durchforstete. Aber ich fand nur jede Menge Plastikdosen mit eingefrorenen Essensvorräten, das meiste davon hatte noch meine Omi gekocht.
»Den Landepunkt konnte ich nicht ausmachen«, erklärte Ben währenddessen seinem Handy. »Deshalb hab ich dieses Feld angepeilt. Dann hab ich es allerdings nicht geschafft, mich rechtzeitig in den Wind zu drehen, und bin in einen Baum gekracht. Ja, nein, alles gut, echt. Klar könnt ihr mich einsammeln. Warte mal … du, Marie, wo bin ich hier eigentlich gelandet?«
Ich nannte ihm die Adresse und zog eine Tüte Tiefkühlerbsen aus dem Eisschrank, die seit einem Jahr abgelaufen waren. Egal, für einen Fußwickel waren sie mehr als gut genug. Ich nahm ein frisches Geschirrtuch aus der Schublade, auf das Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben gestickt war, wickelte die Erbsen darin ein und reichte das Päckchen an Ben weiter, der sein Telefonat inzwischen beendet hatte. Irritiert musterte er es.
»Auf den Fuß«, erklärte ich. »Zum Kühlen.«
»Ach so, danke.« Sein Blick wanderte planlos von dem Erbsenpaket in seiner Hand zu seinen Füßen, die in festen Schnürboots steckten, und wieder zurück zum Erbsenpaket.
»Du müsstest den Schuh wohl ausziehen. Und den Fuß solltest du hochlegen«, riet ich.
»Klar.« Er wollte sich vorbeugen, doch die Bewegung entlockte ihm ein Stöhnen, und er ließ sich sofort wieder gegen die Stuhllehne sinken. »Mist.«
»Warte mal.« Ich hockte mich vor ihn hin und schnürte den Schuh auf, befreite seinen Fuß und half ihm, das Bein auf die Eckbank zu legen. Dann nahm ich ihm das Erbsenkühlpäckchen wieder ab und platzierte es auf seinem Knöchel, der mir etwas geschwollen vorkam. »Siehste, geht doch.«