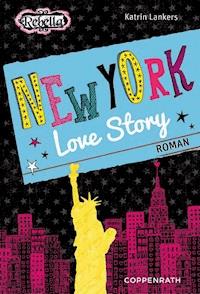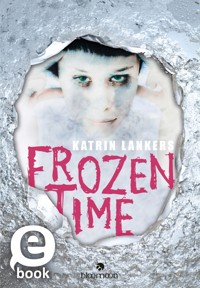Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Coppenrath
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: Verrückt nach New York
- Sprache: Deutsch
Love and the City Als der neue Besitzer von Pinkstone plötzlich bei uns hereinschneite, fielen meine WG-Mitbewohner aus allen Wolken. Ich hatte allerdings schon geahnt, wer der ominöse Bieter war, der Investor Miller das Haus vor der Nase weggeschnappt hatte. Und ich hatte versucht, mich auf den Moment vorzubereiten, in dem er durch die Tür kommen würde. Vergeblich! Denn wie sich schon bald zeigte, waren sein und mein Schicksal unabdingbar miteinander verknüpft ... Liebe, Glamour & Intrigen: Diese Serie macht süchtig!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
eBook-ISBN: 978-3-649-66777-3
© 2015 Coppenrath Verlag GmbH & Co. KG,
Hafenweg 30, 48155 Münster
Alle Rechte vorbehalten, auch auszugsweise
Umschlaggestaltung: Anna Schwarz unter
Verwendung von Illustrationen von Sara Vidal Peiró
Redaktion: Valerie Flakowski
www.coppenrath.de
Das Buch erscheint unter der ISBN: 978-3-649-61776-1
COPPENRATH
Vergeben und vergessen – das ist eine Redewendung, die man ganz selbstverständlich benutzt. Als würde das eine zwingend mit dem anderen einhergehen. Aber so einfach war das nicht! Das musste ich erst schmerzhaft lernen. Und nicht nur ich.
Eure Maxi
Kapitel 1
Als ich seinen Schlüssel in der Haustür hörte, atmete ich tief durch. Ich hatte meinen Entschluss gefasst und meinen Koffer gepackt. Ich würde gehen. Heute Abend. Ich musste es ihm nur noch sagen.
»Hi.« Alex ließ sich müde auf einen Küchenstuhl fallen. Seine Haare standen zu Berge, als hätte er den Tag damit verbracht, sie sich zu raufen. »Alles klar?«
Anstelle einer Antwort stand ich auf und ging zum Kühlschrank. Als ich dabei an Alex vorbeikam, musste ich den Impuls niederringen, ihm über den verstrubbelten Kopf zu streichen. Aber ich war gut darin geworden, solche Impulse nicht mehr zuzulassen.
»Möchtest du etwas trinken?«, fragte ich und starrte angestrengt in den geöffneten, aber dunklen XXL-Kühlschrank. »Es gibt saure Milch und warmes Bier.«
»Leitungswasser wäre prima.«
»Sorry. Das ist leider aus.«
»Shit. Schon wieder? Seit wann?« Ich hörte ihn seufzen, wandte mich aber nicht um.
»Heute Morgen.«
»Erst der Strom. Und jetzt das Wasser. Was kommt wohl als Nächstes?« Wieder seufzte er schwer.
»Viel bleibt ja nicht. Das Telefon ist schon seit Wochen lahmgelegt. Immerhin haben unsere Handys noch Empfang.« Nun drehte ich mich doch zu Alex und lehnte mich mit dem Rücken gegen den Kühlschrank, ohne mir die Mühe zu machen, ihn vorher zu schließen. Hätte er funktioniert, wäre seine kalte Luft eine willkommene Erfrischung gewesen. Die hochsommerliche Hitze verwandelte unsere Küche in eine Sauna, seit vor ein paar Tagen mal wieder der Strom und damit auch die Klimaanlage ausgefallen waren. Aber so war das Einzige, was dem Gerät entströmte, der intensive Geruch nach überreifem Käse.
»Ich geh gleich noch mal los und besorge uns ein paar Kanister Wasser«, bot Alex an und stützte den Kopf in seine Hände, die Ellbogen auf dem Tisch.
»Quatsch, spar dir den Weg. Bier tut’s auch.« Ich nahm zwei Dosen aus dem Fach in der Tür und schloss sie dann, um den penetranten Käsegeruch einzudämmen.
»Und womit sollen wir uns die Haare waschen? Auch mit Bier?« Alex seufzte bereits zum dritten Mal.
»Das soll dem Haar zumindest Glanz verleihen. Meine Omama schwört drauf.« Ich stellte eine Dose vor ihn auf den Tisch, setzte mich ihm gegenüber und drückte den Verschluss meines Budweisers mit dem Daumen nach oben.
»Und die Zähne putzen wir uns auch mit Bud?« Alex blickte zu mir auf und verzog den Mund zu einem schiefen Grinsen, bevor er seine Dose ebenfalls mit einem zischenden Geräusch öffnete.
»Besser mit Bier als mit Wein, der verfärbt die Zähne.« Ich ignorierte das Glücksgefühl, das sich in meinem Bauch ausbreiten wollte, als Alex’ Grinsen bei meiner Bemerkung breiter wurde, prostete ihm zu und trank einen großen Schluck aus meiner Dose. Brr! Ich stand ohnehin nicht auf Bier, aber warm schmeckte es zum Abgewöhnen! Trotzdem nahm ich schnell einen weiteren Schluck.
Vermutlich war dies die letzte Gelegenheit, bei der Alex und ich gemeinsam etwas trinken würden. Ich war es ihm schuldig, dieses Bier mit ihm zu leeren. Und ehrlich gesagt war ich froh über die Gnadenfrist, die es mir verschaffte, bis ich mit meinem Entschluss herausrücken und dieses Haus – und damit auch Alex – verlassen musste. Obwohl mir mein schlechtes Gewissen zusetzte, weil ich ja bereits wusste, wie dieser Abend enden würde – und Alex noch keine Ahnung hatte.
»Wie war dein Tag?«, fragte ich möglichst unbeschwert, aber ich fand selbst, dass ich wie die mäßige Parodie einer übereifrigen Ehefrau klang, die etwas zu verbergen hatte. Auch Alex schien es bemerkt zu haben, irritiert runzelte er die Stirn.
»Ganz okay, schätze ich.« Er zuckte mit den Schultern. »Ich war noch mal bei den Cops wegen der Schmierereien, aber sie haben wieder nur gelacht. Sie meinten, die Chance, die Sprayer zu fassen, liege exakt bei Nullkommanull.«
»Dabei wissen wir genau, wer dahintersteckt …«
»Ja, nur hilft uns das nicht weiter. Denn er würde die Spraydose niemals selbst in die Hand nehmen.« Alex fuhr sich mit gespreizten Fingern durch die ohnehin chaotischen Haare und stützte das Kinn dann resigniert auf die geballte Faust.
Die Sprayerattacke der vergangenen Nacht war nicht die erste auf Pinkstone gewesen, aber definitiv die scheußlichste. Schon mehrmals zuvor hatten wir in den letzten Wochen auf unserer Fassade eilig hingeschmierte Beschimpfungen vorgefunden und notdürftig immer wieder mit pinker Farbe überstrichen. Doch dieses Mal hatten die Sprayer sich mehr Mühe gegeben. Mit dicken Buchstaben aus roter Sprayfarbe hatten sie ihre Drohung auf der Wand verewigt: Letzte Warnung: Verschwindet! Sonst wird es euch leidtun!
Es war erstaunlich, dass weder Alex noch ich aufgewacht waren, als der oder die Sprayer ihre Botschaft überbracht hatten. Das sprach meiner Meinung nach dafür, dass es sich nicht bloß um eine Horde besoffener Jugendlicher gehandelt hatte, sondern um Profis, die Investor Larry Miller engagiert hatte, um uns Angst einzujagen. Und auch wenn ich es ungern zugab, war ihm mittlerweile – zumindest was mich betraf – genau das gelungen.
Als ich morgens das Haus verlassen hatte, um zur Arbeit zu gehen, und den blutroten Schriftzug bemerkt hatte, war mir der Schreck durch den ganzen Körper gefahren. Nach allem, was in den letzten Tagen Furchtbares vorgefallen war, war diese Drohung wie der Tropfen gewesen, der das Fass zum Überlaufen gebracht und mich schließlich meinen schweren Entschluss hatte treffen lassen.
»Alex«, sagte ich jetzt zögerlich. »Ich denke wirklich, du solltest mit dieser ganzen Sache aufhören. Vielleicht wäre es das Beste, du würdest mit deinem Vater reden …«
»Nein.« Alex ließ die Faust, mit der er sein Kinn abgestützt hatte, auf den Tisch fallen. Es wirkte eher entkräftet als energisch. »Das kommt nicht infrage.«
»Aber … ich bin mir sicher, dass er dir ein gutes Angebot machen wird. Trotz allem. Damit wärst du aus der Geschichte raus und könntest wieder anfangen, dein Leben zu leben.«
»Nein.« Er streckte seine Hand über den Tisch, um nach meiner zu greifen, aber ich umfasste schnell meine Bierdose und hoffte, dass es wie zufällig wirkte. »Falls du es noch nicht bemerkt hast: Das hier ist jetzt mein Leben.« Er machte eine vage Geste durch unsere Küche.
»Alex«, versuchte ich erneut, an seine Vernunft zu appellieren. »Ich weiß, dass du das alles nur gemacht hast, weil du dich schuldig fühlst. Aber das musst du nicht. Du hast wirklich mehr als genug für uns getan. Und für Pinkstone.«
»Glaubst du das wirklich?« Alex fuhr sich einmal mehr durch die wirren Haare. »Dass ich das alles bloß getan habe, weil ich mich schuldig fühle? Kannst du dir immer noch nicht vorstellen, dass mir wirklich etwas daran liegt? An dem Haus? Und an dir?«
»Doch, schon …« Mein schlechtes Gewissen drängte sich nun mit aller Macht vor. »Aber du musst doch auch einsehen, dass wir keine Chance mehr haben. Pam, Rick, Saida und Abby sind weg. Pinkstone ist ohnehin nicht mehr das, was es war. Welchen Sinn hat es noch, hier zu hocken, bloß um deinen Vater zu ärgern?«
»Maxi!« Obwohl Alex leise gesprochen hatte, klang es wie ein Aufschrei. »Glaubst du wirklich, ich würde an Pinkstone festhalten, nur um meinem Vater eins auszuwischen?«
»Ja, ehrlich gesagt glaube ich das.« Ich sah ihm fest in die meerblauen Augen, auch wenn es mir schwerfiel, weil sie in diesem Moment beinahe schwarz funkelten, ein untrügliches Zeichen dafür, dass Alex wütend war. Doch dann sank er von einer Sekunde auf die andere in sich zusammen und die Wut verpuffte.
»Tja, vielleicht hast du recht. Vielleicht ist das der Grund. Aber ist dieser Grund nicht so gut wie jeder andere?«
»Mag sein«, antwortete ich. »Aber es ist nicht mein Grund. Mein Grund war immer nur die Freundschaft, die hier zu Hause war.« Ich schluckte trocken. Ich musste es ihm sagen. Jetzt. »Und deshalb werde ich auch ausziehen.«
»Das meinst du nicht ernst!« Alex’ sonnengebräuntes Gesicht wirkte plötzlich kalkweiß. Fassungslos starrte er mich über den Tisch hinweg an.
»Es tut mir leid, aber ich kann nicht mehr. Und es sind ja auch nur noch ein paar Wochen bis zum Ende meines Praktikums. Dann werde ich zurück nach Deutschland gehen. Und so lange kann ich bei meiner Mutter wohnen …« Ich redete hektisch, als würden meine Worte irgendetwas erklären, aber ich war mir bewusst, dass sie das nicht konnten. Alex zumindest schüttelte die ganze Zeit den Kopf, als würde er nichts davon verstehen.
»Wann wirst du mir endlich vergeben?«, fragte er schließlich leise. Es versetzte mir einen Stich direkt ins Herz, ihn so traurig zu sehen und ihn diese Frage stellen zu hören, trotzdem war ich fest entschlossen, an meiner Entscheidung festzuhalten. Es war das Beste, auch wenn es mir unsagbar schwerfiel.
»Darum geht es doch gar nicht …«, erwiderte ich ausweichend, aber Alex ließ mich nicht ausreden.
»Doch, genau darum geht es. Darum ging es die ganze Zeit …« Er stand auf, und ich dachte, er wollte die Küche verlassen, aber stattdessen kam er um den Tisch herum zu mir. Er legte seine Hände auf meine Schultern, und ich begann, ganz flach zu atmen, als ich seinen schwachen Duft nach Minze wahrnahm, seinen Alex-Geruch, den ich so mochte. Sanft drückte er mir einen Kuss auf den Kopf.
»Dann verschwinde besser, bevor es dunkel wird.« Er drehte sich um und ging nun tatsächlich hinaus.
Ich blieb noch einen Moment sitzen, während das Tageslicht vor dem Küchenfenster schwächer wurde, und versuchte, mich zu sammeln. Es fiel mir nicht leicht zu gehen. Überhaupt nicht! Nicht nur wegen Alex. Ich hatte fast ein Jahr in diesem Haus gelebt. Ich hatte um dieses Haus gekämpft. Es war mein Zuhause in New York. Und meine Freunde waren mein Ersatz für eine Familie, die ich nie gehabt hatte. Nein, ich wollte nicht gehen. Aber es war die einzig vernünftige Entscheidung.
Als ich wenig später meinen Zwergponykoffer die Stufen vor Pinkstone hinunterbugsierte, zwang ich mich dazu, mich nicht umzudrehen. So gern ich mir unser pinkes Häuschen noch einmal angeschaut hätte, die blutrote Drohung darauf sollte nicht das Letzte sein, was ich von Pinkstone sah. Deshalb ging ich mit stur nach vorn gerichtetem Blick durch die schmale Gasse, die zwischen den hohen Bauzäunen auf beiden Seiten entstanden war, hinter denen bereits die ersten Stockwerke von Millers neuen Appartementkomplexen in die Höhe wuchsen.
Ich hatte das Ende des Durchgangs fast erreicht, als ich hinter mir das laute Klirren von Glas hörte. Ohne nachzudenken, fuhr ich herum. Gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie drei schwarze Schatten mit länglichen Gegenständen – ich tippte auf Baseballschläger – auf ein Fenster im Erdgeschoss von Pinkstone zielten. Den Bruchteil einer Sekunde später zerbarst auch diese Scheibe mit einem lauten Klirren. Aus dem Innern des Hauses ertönte heftiges Fluchen, dann wurde die Haustür aufgerissen und Alex stürmte hinaus.
»Nein!« Mein Ruf verhallte scheinbar ungehört. Denn schon stürzte Alex sich mit wütendem Gebrüll auf die drei Randalierer, und dann erkannte ich nur noch schemenhafte Bewegungen, fliegende Arme und Baseballschläger, die durch die Luft geschwungen wurden. Ich hörte einen Schmerzensschrei. Ich sah, wie einer der Kämpfenden zu Boden fiel – das musste Alex sein! –, sah, dass seine Angreifer nach ihm traten, obwohl er bereits am Boden lag, sah, wie die Baseballschläger erneut auf ihn niedergingen, vernahm Keuchen, Stöhnen und Wimmern … und konnte nichts tun. War unfähig, mich zu rühren. Unfähig zu rufen. Aber was hätte das auch gebracht?
Es dauerte nur wenige Sekunden, die sich für mich anfühlten wie eine Ewigkeit. Dann ertönte in der Ferne eine der in New York allgegenwärtigen Polizeisirenen, die drei schwarzen Gestalten ließen von ihrem Opfer ab und liefen in die entgegengesetzte Richtung der schmalen Gasse davon. Erst in dem Moment, als sie dort um die Ecke des Bauzauns verschwanden, löste sich meine Starre. Ich ließ den Griff meines Koffers los, der auf den Asphalt knallte, und rannte zu Alex, der noch immer am Boden lag.
»Alex! Alles okay?« Ich hockte mich neben ihn. Panik erfasste mich, als ich in sein blutüberströmtes Gesicht blickte. Sein eines Auge war zugequollen, auf der Stirn klaffte eine Wunde, aus der das Blut in sein Haar sickerte. »Alex! Sag was!«
»Hm.« Er drehte mühsam den Kopf und stöhnte.
»Shit! Wieso bist du rausgekommen? Du Idiot! Hättest du nicht einfach drinnen warten können, bis sie wieder abhauen?! Ach, verflucht. Und was jetzt?«
»Geht schon«, nuschelte er und versuchte, sich auf einen Ellbogen zu stützen. Wieder stöhnte er.
»Lass das! Bleib still liegen. Ich alarmiere den Notruf.« Hektisch suchte ich in meinem Beuteltier nach meinem Handy und wählte, als ich es endlich gefunden hatte, die 911. Ich konnte nur hoffen, dass die Frau am anderen Ende der Leitung aus meinen wirren Erklärungen schlau wurde. Während wir auf den Rettungswagen warteten, hielt ich Alex’ Hand und redete ununterbrochen auf ihn ein, weil ich panische Angst hatte, er könnte das Bewusstsein verlieren. Wieder erschien es mir, als würde die Zeit sich bis in alle Ewigkeit ausdehnen, doch als die Sanitäter schließlich eintrafen, ging plötzlich alles ganz schnell. Sie packten Alex auf eine Trage auf Rollen, und ich rannte neben ihm her, ohne seine Hand loszulassen, während sie ihn durch die schmale Gasse schoben.
»Es tut mir leid, es tut mir so leid«, stammelte ich die ganze Zeit vor mich hin.
»Nicht deine Schuld«, flüsterte Alex kaum hörbar.
»Sie können nicht mitfahren, Miss.« Der eine der beiden Sanitäter schob mich unsanft zur Seite, als wir den Rettungswagen erreichten, dessen flackernde rote und blaue Lichter eine unwirkliche Atmosphäre über die Szene warfen. Alex’ Hand glitt aus meiner, als sie die Trage in den Wagen schoben. Ich hatte mich noch nie so hilflos gefühlt.
»Kann ich irgendwas tun?«, rief ich. »Soll ich deinen Vater anrufen?«
»Untersteh dich«, drang Alex’ Stimme schwach aus dem Inneren des Wagens, dann wurden die Türen zugeschlagen.
Als ich wenig später zu meinem Koffer zurückschlich, konnte ich nicht verhindern, dass mein Blick auf unser pinkes Häuschen fiel. Und auf den blutroten Schriftzug. Sonst wird es euch leidtun. Unwillig wischte ich mir die Tränen aus den Augen. Es tat mir leid, unendlich leid, dass ich zugelassen hatte, dass es so weit hatte kommen können.
ZWEI MONATEZUVOR
Totgesagte leben länger – so lautet eines der vielen Sprichwörter, die meine Omama so liebt. Bezogen auf Pinkstone muss ich ihr wohl recht geben! Pinkstone steht noch immer – allen Intrigen zum Trotz –, denn ein anonymer Käufer hat es Investor Larry Miller vor der Nase weggeschnappt. Die Geschichte ist also noch nicht zu Ende, auch nicht auf diesem Blog. Und ich muss sagen, dass ich mich sehr freue, weiter über Pinkstone berichten zu können.
Allerdings sieht unser Leben zurzeit nicht so rosig aus wie die Fassade unseres Hauses. Wir wohnen auf einer Großbaustelle, umgeben von einem Bauzaun und vom Lärm der Abrissbagger, die die anderen Häuser am Petticoat Place eines nach dem anderen dem Erdboden gleichmachen. Auch von Pinkstone selbst ist kaum mehr als ein Gerippe übrig, einzig die unterste Etage ist noch bewohnbar und die Arbeiten liegen brach. Deshalb teilen Pam, Saida, Abby, Rick und ich uns das Wohnzimmer zum Schlafen und die Küche für alles andere inklusive Haare waschen und Zähne putzen über dem Spülbecken. Ihr könnt euch vermutlich vorstellen, dass der Haussegen darunter ziemlich leidet.
Und auch eine Woche nach Ende der Auktion wissen wir nicht, wer Pinkstone gekauft hat. Es bleibt also spannend!
Kapitel 2
Rick, das ist so was von eklig!« Pamela verzog angewidert das Gesicht und schob sich gleichzeitig eine Handvoll – meiner! – Gummibärchen in den Mund. Seit wir nur noch das Wohnzimmer und die Küche von Pinkstone bewohnen konnten, weil alle anderen Räume von Jack und Mr U. verwüstet worden waren, standen meine Bärchengläser auf dem Küchentisch. Was dazu führte, dass ich sie ständig nachfüllen musste.
»Hey, bleib cool! Dein klebriges Waxing-Zeug ist nicht weniger eklig. Außerdem steh ich halt nicht auf Schmerzen.« Rick lehnte sich weit über das Spülbecken und ließ den Rasierer über seine muskulöse Brust gleiten. Bis wir gezwungen worden waren, unsere gesamte Körperhygiene in der Küche zu verrichten, hatte ich nicht einmal gewusst, dass mein Mitbewohner Rick sich am ganzen Körper rasierte. Und ehrlich gesagt hätte ich auf dieses Wissen auch gerne verzichtet!
»Der Unterschied zwischen dir und mir ist aber, dass ich mich nicht in aller Öffentlichkeit meiner Körperpflege widme, sondern mir dafür extra mitten in der Nacht den Wecker stelle«, regte Pam sich weiter auf.
»Ja, um drei Uhr morgens, um genau zu sein.« Saida schnaubte, wobei ihr die Stecknadeln, die sie zwischen den Zähnen aufgereiht hatte, aus dem Mund fielen. »Und dann lässt du das Scheißding stundenlang klingeln.«
»Pass doch auf«, quietschte Abby und suchte hektisch in den Falten ihres Minirocks nach einer verirrten Nadel. »Autsch! Jetzt hab ich eine Laufmasche.« Anklagend wies sie auf einen schmalen Riss in ihrer Nylon, der sich innerhalb von Sekunden bis zum Knie ausbreitete, als sie aufsprang und mit den Hüften wackelte, vermutlich um weitere Nadeln abzuschütteln. Es wirkte allerdings eher wie ein bizarrer Ententanz.
Beschwichtigend hob ich beide Hände, um den aufkommenden Streit zu schlichten, aber niemand schien meine Geste überhaupt zu bemerken. So ging das nun schon seit Tagen!
»Du bist so supirücksichtslos«, zickte Abby Saida an. »Jetzt muss ich mich für mein Date mit Will noch mal umziehen!«
»Und du bist so supinaiv«, äffte Saida sie nach. »Als ob eine Laufmasche der Weltuntergang wäre! In Afrika verhungern Kinder!«
»Immerhin befindet sie sich mit ihrer Rücksichtslosigkeit hier in guter Gesellschaft.« Pam schnitt eine Grimasse in Ricks Richtung, der daraufhin einen nassen Spülschwamm aus dem Handgelenk treffsicher gegen Pams Kopf warf.
»Dadgumit! Spinnst du jetzt völlig?«, kreischte sie.
»Das spart dir das Haarewaschen. Dann muss ich wenigstens nicht wieder den Abfluss aufschrauben, weil du ihn mit deinen blonden Flusen verstopft hast.« Auch Rick schnitt eine Grimasse mit akrobatisch hochgezogener Augenbraue.
»Du … Mistkerl!« Pam schleuderte den Schwamm zurück, bewies aber weniger Treffsicherheit als Rick und erwischte stattdessen Saida, die wutentbrannt aufsprang und dabei ihr gerade abgestecktes Stück Stoff auf den Boden schmiss, wobei weitere Nadeln herumflogen, was zu einem erneuten Kreischanfall von Abby führte.
»Mensch, Leute, beruhigt euch mal«, bemühte ich mich um einen Waffenstillstand, aber auch dieser Versuch ging unter, weil in genau diesem Moment ein Presslufthammerkonzert vor unserem Fenster eröffnet wurde. Das Dröhnen war so unerträglich laut, dass es zu einer unverhofften Unterbrechung unseres Küchenstreits führte, weil ohnehin keiner mehr ein Wort von dem verstanden hätte, was die anderen zu motzen hatten. Kopfschüttelnd lehnte ich mich auf meinem Stuhl zurück, der sich durch die heftigen Vibrationen des Presslufthammers überraschend in einen Massagesessel verwandelt hatte. Resigniert überlegte ich, wie wir es schaffen sollten, in Pinkstone zusammenzuwohnen, ohne Gefahr zu laufen, dass wir uns gegenseitig mit unseren Kissen im Schlaf erstickten oder mit Ricks Hanteln erschlugen.
Als wir erfahren hatten, dass nicht Investor Larry Miller, der unser Haus abreißen lassen wollte, sondern ein ominöser anonymer Bieter Pinkstone ersteigert hatte, waren wir plötzlich wieder hoffnungsvoll und geradezu euphorisch gewesen. Doch beides hatte nicht lange angehalten. Sowohl die beengten Verhältnisse, in denen wir leben mussten, als auch die permanente Belästigung durch den Lärm und den Dreck der Baustelle, die Miller mittlerweile rund um unser Haus errichtet hatte, zerrten gewaltig an unser aller Nerven. Und die Tatsache, dass der neue Besitzer von Pinkstone sich noch immer nicht bei uns gemeldet hatte und wir somit keinen Schimmer hatten, wie es in Zukunft mit unserem Zuhause weitergehen würde, verbesserte die Stimmung nicht gerade. Hinzu kam, dass alle meine Mitbewohner auf die eine oder andere Weise ohnehin unter Druck standen.
Saida zum Beispiel hatte den verlockenden Auftrag erhalten, zwei Abendkleider zu entwerfen und zu nähen. Allerdings hatte sie dafür nur eine Woche Zeit. Und obwohl sie morgens bereits um sieben aufstand – was gegen ihren Biorhythmus verstieß und sie noch unleidlicher machte, als sie ohnehin meist war – und bis spätabends nähte, war sie fest überzeugt, nicht einmal eins der beiden Kleider rechtzeitig fertigzustellen. Sie brauchte das Geld für diese Aufträge dringend, um endlich einen Teil ihrer Schulden bei ihrer Mutter abzustottern. Deshalb blockierte der Gedanke, sie könnte nicht rechtzeitig fertig werden, sie komplett, und meist riss sie alles, was sie am Tag genäht hatte, abends wieder in Fetzen und fing von vorn an. Das Rattern ihrer Nähmaschine verfolgte uns dann bis in den Schlaf und war mindestens ebenso nervig wie der tägliche Krach der Baumaschinen.
Pam hatte endlich ihr Schauspielstudium geschmissen und die Affäre mit ihrem Professor gleich dazu. Zunächst waren wir über die Entwicklung erleichtert gewesen, doch nun stürzte Pam sich mit der gleichen Energie auf die Erweiterung ihres Gesangsrepertoires wie zuvor in das Einstudieren neuer Rollen. Wenn sie nicht gerade meinen Gummibärchenvorrat dezimierte und dementsprechend den Mund voll hatte, machte sie Stimmübungen, die an das Keuchen eines altersschwachen Staubsaugers erinnerten, oder trällerte in Endlosschleife die immer gleichen Songs, die auf neun von zehn Hochzeiten gewünscht wurden. Halleluja – wie ging mir Leonard Cohen inzwischen auf den Wecker! Whitney Houston hätte ich – wäre sie nicht bereits auf tragische Weise gestorben – für »One moment in time« glatt umbringen können. Und als hätte er Stevie Wonders »I just called to say I love you« vernommen, rief zu allem Überfluss Pams Ex-Professor und Ex-Lover fast stündlich an, um Pam zur Vernunft und zurück auf seine Bühne sowie in sein Bett zu locken.
Rick ließ es sich zwar nicht so anmerken, aber der Deal mit seiner kleinen Schwester Maria bereitete ihm heftige Bauchschmerzen. Weil Ricks Vater nach einem Herzinfarkt noch immer im Krankenhaus lag, hatte seine Mamma ihn gebeten, bis auf Weiteres das Familienrestaurant Bella zu führen. Pizza und Pasta zuzubereiten, war immer das Letzte gewesen, wovon Rick geträumt hatte, zumal er gerade dabei war, sich ein eigenes Geschäft mit seinem Fitness Bootcamp aufzubauen. Doch nachdem er sich bereits nach seinem öffentlichen Outing mit seiner geliebten Großfamilie überworfen hatte, kam eine zweite Konfrontation für ihn wohl nicht infrage. Da erschien es wie ein Rettungsanker, als Maria ihm anbot, das Bella zu übernehmen. Maria ging allerdings noch zur High School und Ricks Eltern wären strikt gegen diese Lösung gewesen. Deshalb behauptete Rick ihnen gegenüber zwar, das Ristorante zu leiten, in Wirklichkeit aber schmiss Maria den Laden. Doch nachdem wir bereits einmal sehr schlechte Erfahrungen mit einer solchen Lügengeschichte gemacht hatten, konnte ich mir vorstellen, dass Rick sich damit unwohl fühlen musste.
Abby hingegen hätte glücklich sein können. Okay, Alex hatte sie, wie uns alle, um ihr Geld gebracht. Aber der Verlag hatte ihr bereits einen Vertrag für ein weiteres Buch angeboten. Außerdem hatte Abby neuerdings einen Freund. Will, der abgesehen von seinen Segelohren nur entfernt Ähnlichkeit mit dem britischen Prinzen gleichen Namens aufwies, hatte sich dennoch als Abbys Traumprinz entpuppt. Sie würde nicht ungeküsst sterben müssen, was lange Zeit ihre größte Sorge gewesen war. Aber Abby war nicht glücklich. Denn ihre Mutter und ihr Vater hatten sie rausgeworfen, als sie entdeckt hatten, welche Art von Roman Abby verfasst hatte. Eine ziemlich übertriebene Reaktion, fand ich. »Geheime Gedanken« war eine schwülstige Liebesgeschichte, in der der Held (ein englischer Graf namens William – hallo!) und die Heldin (ein irisches Dienstmädchen namens Abigail – hallooo!) bei jeder Gelegenheit übereinander herfielen. Seichte Hausfrauenpornos nannte meine Omama solche Werke. Doch für Abbys strenggläubige Eltern war es ein Werk des Teufels! Erst wenn Abby auf Gottes Pfad zurückkehrte, würde ihr wieder die Tür ihres Elternhauses offen stehen. Deshalb brütete sie, seit sie nach Pinkstone zurückgekehrt war, darüber nach, was sie tun musste, damit ihre Eltern ihr vergeben würden.
Und ich? Tja, ich kittete einmal mehr die Splitter meines Herzens. Der Junge, der es zerbrochen hatte, hatte nicht nur mich, sondern uns alle hintergangen. Er hatte für seinen Vater Larry Miller spioniert, hatte uns unser Geld abgezockt und war dann damit verschwunden. Nicht ohne unser Haus als Bruchbude zurückzulassen. Ich fragte mich, wie es möglich war, dass ich Alex gegen meinen entschiedenen Willen und trotz allem, was geschehen war, nicht hassen konnte.
»So geht es nicht weiter!« Als der Presslufthammer endlich verstummte, hieb ich energisch auf den Tisch, um jeder weiteren Eskalation der Streitigkeiten vorzubeugen.
Tatsächlich wandten meine Mitbewohner mir ihre Aufmerksamkeit zu und ich fuhr fort: »Ich meine, seht euch doch mal an! Wenn wir uns hier gegenseitig zerfleischen, muss Larry Miller bald nur noch unsere sterblichen Überreste hinausschaffen, bevor er Pinkstone abreißen lässt. So können wir einfach nicht weitermachen.«
»Ja, aber wie dann?« Pam schnappte sich ein Küchentuch und frottierte damit ihre nasse Mähne. »Du musst selbst zugeben, dass die Situation unerträglich ist.«
»Wo sie recht hat, hat sie recht.« Rick, plötzlich absolut einer Meinung mit Pamela, warf den Rasierer ins Spülbecken und streifte sich ein Muskelshirt über. »Ich habe sogar schon überlegt, in die Wohnung meiner Eltern zu ziehen. Aber mein Papa kommt heute aus dem Krankenhaus. Und so unerträglich, wie es dann dort sein wird, kann es hier eigentlich kaum werden.«
»Du hast überlegt auszuziehen?« Fassungslos musterte ich meinen Mitbewohner. Ausgerechnet Rick, den ich in dieser Gemeinschaft als meinen besten Freund betrachtete, wollte uns im Stich lassen?!
»Bleib cool, Kleine, ich mach’s ja nicht«, wiegelte er schnell ab. Aber allein, dass er darüber nachgedacht hatte, brachte mich aus dem Konzept. Bislang hatten wir Pink stoner in allen Wirren zueinandergestanden. Meine Freunde waren der Grund, warum mir dieses Haus so viel bedeutete.
Aber ging es ihnen überhaupt genauso?
»Also gut. Karten auf den Tisch.« Wieder schlug ich mit der Hand auf die Holzplatte vor mir. »Wer von euch überlegt, sich was anderes zu suchen?« Ich ließ einen inquisitorischen Blick über die Runde wandern und sah in betretene Gesichter. »Das ist nicht euer Ernst!«
»Komm schon«, lenkte Pam schließlich ein. »Wir wohnen jetzt seit Wochen in dieser Bruchbude. Es ist furchtbar. Und niemand weiß, wie es weitergehen wird.«
»So ist es«, stimmte Saida zu. »Wenn der neue Hausbesitzer hier auftaucht und uns von heute auf morgen vor die Tür setzt, ist eh Schluss.«
»Aber vielleicht hat er das ja gar nicht vor«, wandte ich hitzig ein. »Vielleicht können wir hier wohnen bleiben und …«
»Und was?« Pam schüttelte den Kopf, sodass ihre feuchten Strähnen flogen. »… und darauf warten, dass eine Abrissbirne versehentlich in unser Haus knallt?«
»Oder zusehen, wie Miller uns unter seinen Hochhäusern begräbt?«, steuerte Saida hilfsbereit bei.
»Es ist wirklich supigemein«, mischte sich nun auch noch Abby ein. »Aber was sollen wir denn tun?«
»Tja, wenn das so ist.« Ich zuckte mit den Schultern, plötzlich furchtbar enttäuscht. »Warum seid ihr dann nicht schon längst weg?«
»Kein Geld.« Pam hob die leeren Hände, um ihre Worte zu unterstreichen.
»Dito.« Saida machte dieselbe Geste, genau wie Abby und Rick. Es hätte komisch gewirkt, wenn die Situation nicht so deprimierend gewesen wäre. Doch während ich meine Mitbewohner betrachtete, wurde mir klar, dass das fehlende Geld eigentlich nicht der Grund dafür sein konnte, dass sie noch immer alle in Pinkstone hockten. Die Mieten in New York waren zwar hoch, aber irgendwie hätten sie sich sicher alle ein Zimmer in einer anderen WG leisten können. Nein, auch sie hingen an Pinkstone, obwohl sie es sich und mir nicht eingestehen wollten. Und wenn ich die Lage richtig einschätzte, dann würden sie zumindest so lange bleiben, bis sich endlich klärte, wer unser Haus gekauft hatte. Ich hoffte bloß, dass das geschehen möge, bevor wir tatsächlich ins Stadium des Zerfleischens übergangen wären.
Wie aufs Stichwort hörten wir in diesem Moment, dass ein Schlüssel in das Schloss unserer Haustür gesteckt wurde.
Kapitel 3
Alle hielten kollektiv die Luft an, lauschten den Schritten im Flur und starrten auf die Küchentür, die nur ein paar Sekunden später aufgestoßen wurde. Und herein kam: Alex!
»Du?!«, fragte Pam erstaunt und wütend.
»Was machst du denn hier?«, blaffte Saida.
»Das ist ja supikrass«, quietschte Abby.
Nur Rick sagte nichts, sondern war mit wenigen Schritten bei Alex und baute sich so drohend vor ihm auf, dass einem beim Zusehen angst und bange wurde.
»Schlüssel her, und dann hau ab«, zischte er zwischen zusammengebissenen Zähnen und ballte die Fäuste.
»Dadgumit«, schimpfte Pam. »Dass du es wagst, dich hier noch mal blicken zu lassen …!«
»Was willst du überhaupt?«, giftete Saida. »Hast du etwa deine Rolex im Bad liegen gelassen?«
»Oder bringst du uns endlich unser Geld?«, fragte Abby spitz, immerhin hatte sie ihr gesamtes Buchhonorar Alex anvertraut und dadurch verloren.
Während die Mädchen sich weiter aufregten, rückte Rick keinen Zentimeter von seiner Position ab und veränderte seine Drohhaltung auch nur insofern, dass er eine der geballten Fäuste öffnete, damit Alex den Haustürschlüssel hineinlegen konnte.
Offensichtlich gingen alle meine Mitbewohner davon aus, dass Alex bloß zurückgekommen war, um etwas abzuholen, das er hier vergessen hatte. Oder vielleicht sogar, um uns seinen Haustürschlüssel persönlich vorbeizubringen. Aber ich hegte einen ganz anderen Verdacht. Im Grunde hatte ich diese Vermutung schon, seit der geheimnisvolle, anonyme Bieter Investor Miller das Haus weggeschnappt hatte. Deshalb war ich weniger überrascht, als Alex abwehrend die Hände hob und erklärte: »Sorry, Leute, aber ich bin nicht zurückgekommen, um irgendwas abzuholen. Ich bin hergekommen, um hierzubleiben. Das Haus gehört mir nämlich jetzt.«
»Was!?« Es klang echt laut, wenn vier Leute gleichzeitig dasselbe riefen. Dann redeten meine Mitbewohner wieder alle durcheinander und in dem allgemeinen verbalen Chaos hatte Alex keine Chance für weitere Erklärungen. Immerhin trat Rick ein paar Schritte zurück, sodass es nicht mehr wirkte, als wollte er ihm eins auf die Nase hauen.
Ich war die Einzige, die nichts zu der Diskussion beitrug. Mit verschränkten Armen saß ich am Tisch und konzentrierte mich auf die verschlungenen Muster der weiß lasierten Kiefernholzplatte. Wir hatten den Tisch selbst angestrichen, es war ein schöner Tisch, und so viel unverfänglicher anzuschauen als Alex. Denn meine Gefühle ihm gegenüber waren noch viel verschlungener als die Maserung des Holzes.
Seit einer Woche hatte ich mir nun diese oder eine ähnliche Situation vorgestellt. Ich hatte den anderen zwar nichts von meinem Verdacht erzählt, Alex könnte das Haus gekauft haben. Aber ich hielt es für besser, mich mental auf den Moment vorzubereiten, in dem er durch die Tür kommen würde. Folgende drei Überlegungen hatte ich angestellt:
Alex hatte mich belogen und betrogen. Er hatte mir wiederholt das Herz gebrochen, mich tief verletzt und mein Vertrauen missbraucht. Nach allen Regeln der Logik hätte ich ihn dafür hassen müssen. Leider war das wahre Leben oft weit weniger logisch, als mir lieb war. DennAlex hatte mir in den vergangenen Monaten viele seiner Geheimnisse verraten. Obwohl das immer nur ein Teil seiner selbst gewesen war und er mir andere – wichtige – Informationen verschwiegen hatte, hatte ich das Gefühl, ihn zu kennen. Er war, genau wie ich, sein Leben lang auf der Suche nach Anerkennung und Liebe gewesen. Wir waren uns ähnlich. Ähnlicher, als mir lieb war. Undich hatte ihm trotz der vorangegangenen Lügen geglaubt, als er mir sagte, dass es ihm leidtue. Ich hatte ihm geglaubt, als er sagte, dass er es wiedergutmachen werde. Und als er sagte: Ich liebe dich – selbst da hatte ich ihm geglaubt. Und das machte die ganze Sache kompliziert. Viel komplizierter, als mir lieb war.Denn daraus ergab sich folgende Schlussfolgerung: Hätte ich Alex hassen können, wäre ich auf der sicheren Seite gewesen. Keine verwirrenden Gefühle und Gedanken mehr. Bloß noch Abneigung. Ich würde nie mehr Gefahr laufen, ihn näher an mich heranzulassen, als gut für mich war. So aber musste ich selbst dafür sorgen, dass genau das nicht geschah. Alex durfte mir nie wieder so nahe kommen, dass er mir noch einmal wehtun konnte.
Doch erst in diesem Moment, als er wirklich in Pinkstone auftauchte, meine Mitbewohner ihn wild beschimpften und ich auf die Maserung des Tisches starrte, wurde mir klar, was ich tun musste. Egal, was passierte, ich würde Alex künftig emotional immer auf mindestens einer Armlänge Abstand halten. Zum Glück hatte ich darin dank meiner schwierigen Beziehung zu meiner Mutter jahrelange Übung. Als ich diesen Plan einmal gefasst hatte, ging es mir sofort besser. Jetzt konnte ich Alex endlich ansehen. Und mir fiel sofort auf, wie unglücklich er aussah. Was allerdings auch kein Wunder war.
»Warum willst du ausgerechnet hier wohnen?«, zeterte Pam gerade. »Du hast doch genug Kohle. Kauf dir ein schickes Loft in Manhattan.«
»Na ja …« Alex zuckte mit den Achseln. »So viel ist nicht übrig. Vielleicht würde es für ein Einzimmerappartement reichen. Aber dann hätte ich nichts mehr zum Leben …«
»Du Armer!« Saidas Stimme triefte vor Spott. »Von dem Wort arbeiten hast du aber schon mal gehört, oder?«
»Von meinen zweihundertfünfzig Riesen müsstest du doch eine Weile über die Runden kommen«, ergänzte Abby spitz.
»Moment mal.« Abwehrend hob Alex die Hände. »Ich habe euch das Geld zurücküberwiesen. Jeden Cent. Glaubt ihr wirklich, ich wollte euch bestehlen?«
»Ja, das ist so ziemlich genau das, was wir denken«, schimpfte Pam.
»Auf meinem Konto ist jedenfalls kein Geld eingegangen.« Abby, die den Laptop ohnehin ständig vor sich hatte, schien schnell ihre Finanzen überprüft zu haben.
»Ich habe es erst heute Morgen überwiesen«, versuchte Alex eilig zu erklären. »In der vergangenen Woche hatte ich ein paar andere Sachen zu regeln.«
»Richtig, zehn Millionen von deinem verbrecherischen Dad zu kassieren, zum Beispiel.« Saida rümpfte ihre hübsche Nase, als würde es in unserer Küche plötzlich stinken.
»Und unser Haus zu kaufen«, brummte Rick.
»Euer Haus?« Alex wurde allmählich wütend. »Jetzt wollen wir aber mal bei den Fakten bleiben. Dieses Haus hat euch nie gehört. Und wenn ich es nicht gekauft hätte, würde mein Vater es mittlerweile besitzen, und der hätte es längst abreißen lassen.«
Wie zur Bestätigung seiner Worte drang von draußen wieder der ohrenbetäubende Presslufthammerkrach zu uns herein.
»Dadgumit! Wenn du uns nicht unser Geld abgezockt hättest, hätten wir das Haus vielleicht selbst kaufen können«, brüllte Pam gegen den Baulärm an. (Was definitiv eine unrealistische Annahme war.)
»Oder wir hätten es wenigstens in Würde verloren«, schimpfte Saida. (Was weitaus realistischer war.)
»Wir wollen dich hier nicht«, pflichtete Abby ihnen bei. (Was vermutlich der Realität entsprach, aber nicht gerade nett war.)
»Zisch ab«, forderte auch Rick. (Was definitiv nicht nett war und zudem sehr unrealistisch.)
Wieder schaute ich zu Alex. Er wirkte noch unglücklicher als zuvor.
»Hey, jetzt macht mal halblang«, rief ich genau in dem Moment, als der Presslufthammer verstummte. In der plötzlichen Ruhe wirkten meine Worte überlaut. Überrascht sahen die anderen mich an. »Das hier ist jetzt Alex’ Haus, ob es uns nun passt oder nicht«, versuchte ich, sie zu beschwichtigen.
»Ausgerechnet du verteidigst ihn? Nach allem, was er dir angetan hat?« Pamela schüttelte verwirrt den Kopf.
»Ich verteidige ihn doch gar nicht«, sagte ich schnell, weil es sich für mich selbst komisch anfühlte, genau das zu tun. »Ich bin bloß realistisch!«
»Pah«, war Saidas einzige Reaktion auf meine Bemerkung. Aber nachdem ich mich einmal eingemischt hatte, wollte ich nicht wieder zurückrudern.
»Hört euch doch erst mal an, was er überhaupt zu sagen hat«, schlug ich deshalb vor. Meine Mitbewohner machten allesamt ablehnende Gesichter, aber sie schwiegen, was Alex als Aufforderung zu einer Erklärung auffasste.
»Ich habe einen riesigen Fehler gemacht«, sagte er und fuhr sich mit der Hand durch seinen Wuschelkopf, ein eindeutiges Zeichen seiner Nervosität. »Es tut mir leid, dass ich euch belogen habe. Aber ich habe gehofft, dass wir trotzdem wieder Freunde werden. Und gemeinsam dafür kämpfen können, dieses Haus zu retten.«
»Pah«, machte Saida wieder, die anderen schwiegen immer noch.
»Natürlich könnte ich mir was anderes suchen. Zumindest zur Miete«, fuhr Alex fort. Trotz seiner sichtlichen Nervosität sprach er mit fester Stimme. Und er konnte ein sehr überzeugender Redner sein. »Ich könnte natürlich auch schlicht darauf pochen, dass ihr alle auszieht, und allein hier in Pinkstone leben. Aber …« Er legte eine Pause ein und ließ seinen Blick über die Runde schweifen, bis er an mir hängen blieb. Ich musste mich sehr anstrengen, um ihn mit unbewegtem Gesicht zu erwidern. »Ich möchte das nicht. Ich möchte hier wohnen. Mit euch allen zusammen. Ich mag euch nämlich. Und ich kann mir nicht vorstellen, ohne euch hier zu leben. Pinkstone und diese WG, das gehört einfach zusammen.«
Nach dieser Erklärung herrschte einen Moment lang absolutes Schweigen, das Pamela schließlich brach.
»Glaubst du wirklich, wir würden nur eine einzige Nacht mit dir unter einem Dach wohnen? Oder unter dem, was davon übrig ist?«, fragte sie eher erstaunt als wütend.
»Ich hoffe es zumindest«, entgegnete Alex mit entwaffnender Offenheit. »Ich brauche euch nämlich. Denn ich glaube, dass wir es nur gemeinsam mit meinem Vater aufnehmen können. Er muss Pinkstone abreißen, um seine Luxuswohnungen fertig zu bauen. Deshalb wird er nichts unversucht lassen, um uns hier rauszubekommen.«
»Es mit deinem Vater aufnehmen, pah.« Saidas Gesichtsausdruck war zwar abschätzig, aber ihr Tonfall hatte einiges von seiner Schärfe eingebüßt. »Als ob wir dazu noch eine Chance hätten.«
»Unsere Chancen stehen besser denn je«, erwiderte Alex unbeirrt. »Denn jetzt gehört Pinkstone mir. Und ich werde es nie im Leben meinem Vater überlassen.«
»Erzähl uns doch nichts!« Rick verschränkte die muskulösen Arme in ablehnender Haltung vor der Brust. »Dein Dad muss bloß noch mal mit ein paar Millionen winken, dann tust du exakt das, was er von dir verlangt.«
»Das werde ich nicht«, verteidigte Alex sich ruhig, sein ganzer Körper strahlte Entschlossenheit aus. »Ich bin fertig mit meinem Vater.«
Die anderen schnauften als Antwort auf diese Erklärung, doch plötzlich wurde mir klar, dass ich ihm glaubte. Alex’ Versprechen, seinen Fehler wiedergutzumachen, war ernst gemeint gewesen. Er war tatsächlich wild entschlossen, Pinkstone gegen seinen Vater zu verteidigen. Und dass er hier vor uns stand, sich all die Vorwürfe anhörte und dem Streit stellte, war ein klarer Beweis dafür, dass wir Pinkstoner ihm am Herzen liegen mussten.
»Nun gebt ihm doch noch eine Chance«, hörte ich mich deshalb zu meinem eigenen Erstaunen sagen. »Findet ihr nicht, dass selbst Alex eine zweite Chance verdient hat?«
Alle meine Mitbewohner inklusive Alex bedachten mich mit einem erstaunten Blick, doch schließlich lenkte Pam ein.
»Es gibt allerdings ein Problem: Hier ist es ziemlich eng, seit deine Handwerkerfreunde das Haus halb abgerissen haben. Ich wüsste nicht, wo wir dich unterbringen sollen.«
»Keine Sorge.« Alex’ Erleichterung war ihm anzusehen. »Ich werde so schnell wie möglich dafür sorgen, dass Pinkstone fertig saniert wird. Dann kann jeder wieder sein eigenes Zimmer bewohnen. Und wenn ihr nichts dagegen habt, ziehe ich ins Wohnzimmer.«
Meine Freunde nickten, vielleicht noch nicht wirklich überzeugt, aber sichtlich beschwichtigt. Kurz darauf verabschiedeten sich alle. Saida brach zu ihren wöchentlichen Sozialstunden in einem Frauenhaus in der Bronx auf, Pam hatte eine Hochzeitsprobe, Abby ein Date mit Will und Rick wurde im Ristorante Bella gebraucht, wo er seinem Vater, der aus dem Krankenhaus entlassen wurde, vorgaukeln musste, dass er den Laden führte. Dummerweise hatte ich keine so gute Ausrede, um zu verschwinden.
Als wir nur noch zu zweit in der Küche waren, schnappte Alex sich einen Stuhl und rückte ihn dicht an meinen heran.
»Danke«, sagte er. »Ich weiß nicht, womit ich ausgerechnet deine Unterstützung verdient habe, aber sie bedeutet mir viel.« Er wollte seine Hand auf meine legen, doch ich zog sie weg.
»Es ist dein gutes Recht, hier zu wohnen«, sagte ich. Wieder zwang ich mich, ihm dabei in die Augen zu schauen. Ich würde mich endlich an seinen Meerblick gewöhnen müssen, wenn ich mit ihm wieder in einem Haus lebte. »Aber das ist auch schon alles. Mehr Unterstützung brauchst du von mir nicht zu erwarten.«
»Schade«, sagte er, aber er lächelte dabei, was das winzige Muttermal in seinem Mundwinkel zum Hüpfen brachte. Auch daran würde ich mich endlich gewöhnen müssen! »Schade, denn ich habe vor, meinen Vater fertigzumachen. Und dabei könnte ich deine Unterstützung gut gebrauchen.«
Kapitel 4
Noch am selben Tag beauftragte Alex ein ganzes Heer von Handwerkern. Sie fielen in Pinkstone ein wie die Heinzelmännchen auf Speed und veranstalteten so viel Lärm in unserem Haus, dass wir uns nach den Abrissbaggern und Presslufthämmern vor unseren Fenstern zurücksehnten, die dagegen die reinste Entspannungsmusik geboten hatten. Immerhin versetzten die Heinzel-Handwerker Pinkstone in Rekordzeit wieder in einen bewohnbaren Zustand. Doch währenddessen taten sich im Leben meiner Mitbewohner bereits neue Baustellen auf.
Abbys Baustelle
»Ich liebe dich.« Will vergrub sein Gesicht an Abbys Hals, atmete genüsslich und hörbar ihren Geruch ein und küsste sie dann sanft aufs Schlüsselbein. »Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich.« Auf jede dieser Beteuerungen folgte ein Kuss und mit jedem Kuss arbeitete er sich ein Stück weiter in Richtung von Abbys Brüsten vor.
»Ich …«, antwortete Abby kurzatmig. »Ich … Moment mal … ich liebe … hey, stopp … ich liebe dich … stopp, habe ich gesagt … ich liebe dich auch … Schluss jetzt!« Sie legte ihre eine Hand auf Wills, die sich am Frontverschluss ihres BHs zu schaffen machte, und fasste mit der anderen Hand in sein Haar, um zwischen seinen Kopf und ihre Brust einen Sicherheitsabstand zu bringen.