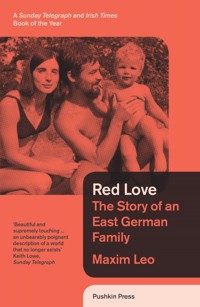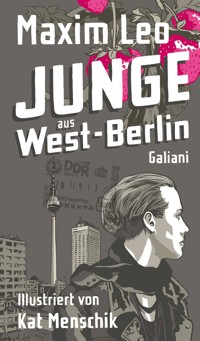9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ihr Leben gerät aus den Fugen, als die Teilnehmer einer Medikamentenstudie an der Berliner Charité plötzlich jünger werden. Jakob ist gerade seiner ersten Liebe begegnet und verliert auf einmal jegliche Lust. Jenny wünscht sich seit vielen Jahren vergeblich ein Kind und wird plötzlich schwanger. Wenger, ein schwerkranker Immobilienpatriarch, verabschiedet sich mit einem rauschenden Fest von der Welt, um kurz darauf – zur Verzweiflung seiner Erben – wieder aufzublühen. Und Verena, die zweifache Olympiasiegerin über 100 Meter Freistil, hat ihre Profizeit längst hinter sich, als sie bei einem Schaukampf der Ex-Stars überraschend neue Rekorde aufstellt. Als die Öffentlichkeit von ihrer Verjüngung erfährt, überschlagen sich die Ereignisse. Ein ungeheuer hellsichtiger Roman, der seinen Protagonisten voller Witz und Wärme durch das verrückteste Jahr ihres Lebens folgt. Und der wie nebenbei die großen ethischen und gesellschaftlichen Fragen stellt, die sich ergeben, wenn die weltweit auf Hochtouren laufende Forschung zur biologischen Verjüngung des Menschen Erfolg hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 346
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Maxim Leo
Wir werden jung sein
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Maxim Leo
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Maxim Leo
Maxim Leo wurde 1970 in Ostberlin geboren. Er schreibt gemeinsam mit Jochen Gutsch Bestseller über Alterspubertierende und sprechende Katzen, außerdem Drehbücher für den »Tatort«. Für sein autobiografisches Buch »Haltet euer Herz bereit« wurde er 2011 mit dem Europäischen Buchpreis ausgezeichnet. 2014 erschien sein Krimi »Waidmannstod«, 2015 »Auentod«. 2019 erschien sein autobiografisches Buch »Wo wir zu Hause sind«, das wie der Roman »Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße« (2022) zum Bestseller wurde.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Vier Menschen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, haben eines gemeinsam: Sie sind Probanden einer medizinischen Studie, deren »Nebenwirkung« ungeahnte Folgen hat – eine Verjüngung um gleich mehrere Jahre. Was wie die Erfüllung eines alten Menschheitstraums klingt, hat nicht nur positive Effekte, sondern bringt spektakuläre Komplikationen mit sich.
Jakob ist gerade seiner ersten Liebe begegnet und verliert auf einmal jegliche Lust. Jenny wünscht sich seit vielen Jahren vergeblich ein Kind und wird plötzlich schwanger. Wenger, ein schwer kranker Immobilienpatriarch, verabschiedet sich mit einem rauschenden Fest von der Welt, um kurz darauf – zur Verzweiflung seiner Erben – wieder aufzublühen. Und Verena, die zweifache Olympiasiegerin über 100 Meter Freistil, hat ihre Profizeit längst hinter sich, als sie bei einem Schaukampf der Ex-Stars überraschend neue Rekorde aufstellt. Als die Öffentlichkeit von der Wirkung des Medikaments erfährt, überschlagen sich die Ereignisse.
Maxim Leo ist ein so hellsichtiger wie vergnüglicher Roman gelungen, der seinen vielschichtigen und liebenswerten Protagonisten durch das verrückteste Jahr ihres Lebens folgt und mit Klugheit, Witz und Wärme zum Nachdenken anregt.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2024, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotiv: © Mario Wagner/2agenten
ISBN978-3-462-31069-6
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
JAKOB
WENGER
VERENA
MARTIN
JENNY
MARTIN
MIRIAM
Ein Jahr später …
JAKOB
WENGER
VERENA
JENNY
MARTIN
MIRIAM
STATION 17
MARTIN
STATION 17
MARTIN
BRANDENBURG
IMMER WEITER
SECUNDA VITA
Dank
JAKOB
Wenn ihn später mal jemand fragen sollte, wann sein Leben so richtig begonnen hatte, dann würde er sagen: Am 21. Juni 2024 um 15.14 Uhr. Was genau der Moment war, in dem die Nachricht von ihr in seinem Handy landete. Was genau der Moment war, in dem das ziemlich unwichtige Davor das absolut wichtige Danach berührte.
Eigentlich wollte er mit dem Lesen warten, bis er zu Hause war, aber da hatte er die ersten zwei Zeilen schon überflogen, und die Nachricht war ja auch nicht besonders lang, sodass er sie dann doch schon auf dem Schulhof las. Sie schrieb: Hey, cooler Sound bei den glücklichen Elefanten. Wie machst du das? Musst du mir mal erklären, irgendwann …
Er saß in der Straßenbahn, ihre Sätze spukten durch seinen Kopf wie die Geisterstimmen in »Call of Mercy«, dem Computerspiel, das er letzte Woche in der Betaversion ausprobiert hatte. Was bedeutete irgendwann? Dass sie nur so ein bisschen neugierig war und grundsätzlich nichts dagegen hätte, mal unverbindlich mit ihm abzuhängen? Oder deuteten die drei Punkte am Ende auf mehr hin? Schwang da nicht etwas irre Verheißungsvolles mit, so in dem Sinne, dass sie es kaum erwarten konnte, ihn endlich zu sehen?
Verdammt, er wusste es wirklich nicht. Alles Mögliche wurde ihnen in der Schule beigebracht: wie man Winkel in Dreiecken berechnete, wie die Fotosynthese funktionierte, was Goethe durch den Kopf ging, als er mal wieder durch Italien reiste, wie man ein Gedicht interpretierte. Aber wie man eine völlig unerwartete Nachricht des tollsten Mädchens des Jahrgangs zu interpretieren hatte, das erklärte einem niemand. Obwohl es doch nun wirklich das Wichtigste war.
Er beschloss, sich auf den unumstritten positiven Kern des Ganzen zu konzentrieren: Marie hatte ihm geschrieben! Noch vor ein paar Stunden hätte er nicht mal mit Bestimmtheit sagen können, ob sie überhaupt wusste, dass er existierte. Und jetzt hatte sie ihm geschrieben! Ihre Finger hatten die Buchstaben berührt, die jetzt auf seinem Handy leuchteten, allein dieser Gedanke war so überwältigend, dass er ihn kaum zu Ende brachte.
Die Tram fuhr die Danziger Straße hinunter, Jakob las die Nachricht immer wieder, und wenn er mal ein paar Minuten nicht auf sein Handy guckte, kriegte er gleich die Panik, weil es ja nicht ausgeschlossen war, dass ihre Nachricht zwischendurch verschwunden sein könnte.
Erst als er am Arnswalder Platz aus der Bahn stieg und die letzten Meter nach Hause lief, fiel ihm ein, dass er nun ja auch antworten musste. Nicht sofort, wenn er einigermaßen lässig rüberkommen wollte. Aber auch nicht zu spät, das würde arrogant wirken. Neunzehn Uhr, dachte Jakob, das wäre eine gute Zeit. Knapp vier Stunden nach Erhalt der Nachricht, das wirkte entspannt, aber nicht unhöflich. So als hätte er vor dem Abendessen noch mal eben die Lage gecheckt und dabei zufällig diese Nachricht gefunden, inmitten der vielen anderen Nachrichten, die ihm ständig von irgendwelchen Mädchen geschickt wurden.
In Wahrheit bekam er nur von vier Personen regelmäßig Nachrichten: von seiner Mutter, von Philipp und Julian, zwei Computernerds aus der 10c, und von Klaus, der bei Ubisoft Entertainment die Soundabteilung leitete. Wobei, das hörte sich jetzt echt so an, als wäre er ein Soziopath, ein Freak. Was er aber nicht war, wenigstens nicht von Anfang an. Es hatte alles mit seiner blöden Krankheit zu tun, eine angeborene Herzmuskelschwäche, ständig war er müde und erschöpft, musste sich schonen. Wenn er in der Schule die drei Treppen zum Chemieraum hochstieg, wurde ihm schwindelig und er hatte Schweißausbrüche. Kein Sport, kein Tanz, keine Klassenfahrt, keine Übernachtung bei Freunden. Nie. Dadurch irgendwann auch: keine Freunde. Dafür aufpassen, Angst haben, außer Atem sein. Immer die Notfallspritze in der gelben Plastikschachtel dabeihaben, die besorgten Augen der Mutter sehen, die mitleidigen Blicke der anderen.
Zu Hause sitzen war ungefährlich, am Computer daddeln, »FIFA« spielen, Monster abknallen, sich irgendwie lebendig fühlen. Mit zwölf hatte er »Fortnite« gespielt, wo es grob gesagt darum ging, dass die Menschheit nach einer globalen Katastrophe fast ausgelöscht worden war, überall Zombies rumsprangen und nur wenige Überlebende eine neue Zivilisation erschufen. Das fand Jakob nicht besonders spannend, aber die Grafik war toll, und noch toller waren die Sounds, wenn ein Sandsturm übers Land zog oder einem einäugigen Untoten mit der Spitzhacke der Schädel gespalten wurde. Enttäuschend fand er nur das Geräusch, das entstand, wenn einem Spieler Lebenspunkte abgezogen wurden. Es klang wie Geldstücke, die in einen Gully fielen, was, so sah es zumindest Jakob, nicht mit der restlichen Soundkulisse zusammenpasste. Das schrieb er dann auch genau so in der Mail an Darren Sugg, den »Fortnite«-Entwickler, und schickte auch gleich einen Sound mit, den er selbst am Computer gemischt hatte. Drei Tage später meldete sich die Rechtsabteilung von Epic Games aus Cary, North Carolina, bei ihm und fragte, wohin sie die Verträge schicken sollten. Zwei Wochen später wurden 12000 US-Dollar auf das Konto seiner Eltern gebucht, weil er noch kein eigenes hatte.
So war das losgegangen vor vier Jahren, und seitdem waren so einige Verträge zusammengekommen. Aktuell verdiente Jakob mehr als seine Eltern zusammen, was allerdings auch an den Sounds lag, die »The Happy Elephants« vor zwei Monaten bei ihm gekauft hatten. Keine Ahnung, wie die kalifornische Band auf sein Zeug gekommen war, aber seitdem interessierten sich eben nicht nur Gamer für ihn, sondern auch ganz normale Menschen. Sogar Mädchen wie Marie.
Ach, Marie. Sie war in der Neunten dazugekommen, kurz vor den Winterferien. Sie hatte eine erstaunlich tiefe Stimme, eine Narbe unter der linken Augenbraue und schmale grüne Augen. Sie trug XL-Männerpullover, die ihr bis zu den Kniekehlen reichten, und selbst gemachte Muschelketten. Sie war nicht auf den ersten Blick schön, wobei, das ist Schwachsinn, natürlich war sie auf den ersten Blick schön. Aber es war eben nicht diese trullige Mädchenschönheit, wie bei Leonie mit ihren Pling-pling-Wimpern und den Grübchen in den Wangen. Marie hatte so ein Strahlen, eine Energie, die sie umwehte. Sie war unglaublich selbstbewusst, machte ihr Ding, sagte, was sie dachte. War sogar manchmal traurig, ohne es zu verstecken.
Alle hatten Respekt vor ihr, auch die, die ihren Style und ihre Art seltsam fanden. Marie zog die Leute magisch an, vielleicht weil sie so ehrlich war. Sie saß zwei Bänke schräg vor Jakob, ziemlich genau in der Sichtachse zur Tafel, was ihm die Möglichkeit gab, sie stundenlang anzustarren, ohne dabei bemerkt zu werden. Das heißt, vielleicht merkte sie es schon, aber sie sagte nie etwas.
Überhaupt hatte er mit ihr in diesem ganzen Schuljahr vielleicht drei Mal gesprochen. Wenn man Dialoge wie »Meine Fresse, ist das kalt hier!« – »Ja, stimmt« schon als Gespräche gelten ließ. Marie begann viele Sätze mit »Meine Fresse«, das war so ziemlich die einzige Sache, die Jakob an ihr störte.
Zu Hause angekommen, setzte er sich sofort an seinen Schreibtisch. Es war kurz nach fünf, er hatte also nicht mal zwei Stunden, um Marie zu antworten. Klar, das klang nach viel Zeit für ein paar Sätze. Aber so gut und leicht er sich mit Sounds ausdrücken konnte, so schwer fiel es ihm mit Worten. Er galt als schweigsam, was nicht daran lag, dass er gerne schwieg, er hatte nur meistens nicht die geringste Ahnung, was er sagen sollte. Eine geschlagene Stunde lang saß er grübelnd da.
Es ging schon los mit der Anrede. Sie hatte Hey geschrieben. Sollte er jetzt auch einfach Hey schreiben, oder war das fantasielos? Am liebsten hätte er Liebe Marie geschrieben, aber das machte kein Mensch. Er beschloss, die Anrede erst mal wegzulassen. Er schrieb: Danke für dein Kompliment. Wie ich die Sounds mache, weiß ich auch nicht, es passiert irgendwie. Deshalb kann ich es dir auch nicht erklären, höchstens vormachen. Das klang halbwegs okay, fand er. Wenn er mutig wäre, dann würde er sie zu sich nach Hause einladen, denn wo sonst könnte er Marie seine Soundproduktion demonstrieren? Aber er war nicht mutig, lediglich zum Spaß tippte er weiter: Mein Studio befindet sich in der Bötzowstraße 32, aber beeil dich, es gibt kaum noch Termine. In diesem Moment öffnete seine Mutter die Zimmertür, er wollte schnell den letzten Satz löschen, kam aus Versehen auf den Sendebutton.
Am nächsten Tag ging Jakob nicht zur Schule, er simulierte eine Magenverstimmung, was auch als Entschuldigung für den Tag darauf herhalten musste. Marie hatte nicht geantwortet, kein Wunder nach dieser bescheuerten Nachricht. Was musste sie von ihm denken? Dass er ein selbstzufriedenes Arschloch war!
Am dritten Tag musste er wieder in die Schule. Er lief mit gesenktem Kopf über den Hof, vielleicht bemerkte sie ihn ja gar nicht, womöglich hatte sie seine Arschloch-Nachricht sogar schon vergessen. Man durfte sich nie zu wichtig nehmen, dachte Jakob, kurz bevor er hörte, wie jemand seinen Namen rief. Er drehte sich um und sah sie direkt auf sich zukommen. Es war wie in »Battlefield«, wenn eine Rakete auf einen zuraste und man nichts mehr tun konnte. Sie würde ihn jetzt gleich mit ihrer Verachtung zerquetschen, er könnte noch ein paar matte Worte der Entschuldigung murmeln, dann wäre auch dieses Kapitel abgeschlossen.
Doch dann klang sie weder verachtend noch sonst irgendwie böse, als sie schließlich vor ihm stand. »Also, ich habe deine Sekretärin mehrmals angerufen. Sie sagte, du hättest erst nächsten Monat wieder was frei. Deshalb frage ich dich lieber direkt.«
Er blickte auf. »Es war ein Joke, ich meine, es war nicht wirklich ernst gemeint …«
Sie lächelte. »Ach, echt? Gut, dass du das sagst, hätte ich von alleine nicht kapiert.«
»Ich meine ja nur … also … ich wollte das eigentlich gar nicht schreiben.«
»Warum? Ist doch voll lustig.«
»Findest du?«
»Hey, du kannst schreiben, was du willst, du bist der Star, ich bin das Groupie.«
»Wie kommst du darauf?«
»Meine Fresse, du schreibst Musik für meine Lieblingsband!«
»Ich schreibe keine Musik, sie haben nur ein paar Sounds von mir benutzt.«
»Na, dann ist es ja echt kein großes Ding! Wer wurde nicht schon mal von einer berühmten amerikanischen Band angerufen? Passiert mir persönlich ständig.«
Jakob spürte, wie er rot wurde. »Ist das wirklich deine Lieblingsband?«
»Yep. Ich meine, die machen krasse Songs, oder?«
»Du meinst so wie ›Waiting For The Nightmare‹?«
»Du bist auch Fan?«
»Nein, das ist der Soundtrack von ›Borderlands‹.«
»Borderlands?«
»Ein Ego-Shooter-Spiel, habe ich früher manchmal gezockt.«
Sie sah ihn überrascht an, jetzt hatte sie wohl endlich kapiert, was für ein lahmer Typ er war. Sie ging wahrscheinlich auf Konzerte, tanzte, rauchte und trank Alkohol. Während er zu Hause vor seinem Computer saß und »Pringles Cheese & Onion« mampfte. Sie legte den Kopf schief und sagte: »Tut mir leid, ich bin ein Mädchen, das nie gezockt hat. Darf ich trotzdem das Studio des Meisters besuchen?«
Die nächsten Tage vergingen quälend langsam. Sie hatten sich für Freitagabend verabredet, und eine von Jakobs größten Herausforderungen war, wie er es schaffen konnte, dass es bei ihm zumindest ein bisschen mehr nach Studio und ein bisschen weniger nach Kinderzimmer aussah. Zuerst nahm er die Poster mit den Kegelrobben von der Wand, was ihn schmerzte, weil er Kegelrobben wirklich mochte. Außerdem stellte sich nun die Frage, was er stattdessen aufhängen sollte. Er dachte an ein »Happy Elephants«-Poster, aber das hätte sie natürlich sofort durchschaut. Weshalb er sich schließlich für einen Kunstdruck entschied, den seine Mutter ihm mal nach einem Besuch in der Gemäldegalerie gekauft hatte. Es war das Bild einer Frau mit einem Perlenohrring, die bei längerem Hinsehen Marie ähnlich sah. Besser ein Freak, der auf flämische Maler stand, als ein Typ mit einer Robbenmacke.
Für die Studio-Optik hatte er zwei schwarze Polystyrolplatten um seinen Schreibtisch herumgestellt und von seinem Vater ein altes Sennheiser-Mikrofon ausgeliehen. Das ergab zwar wenig Sinn, weil er seine Sounds nicht live einspielte, sondern am Computer mischte, aber manchmal war Optik wichtiger als Sinn. Weitere offene Fragen waren, was er anziehen sollte, wie er seinen jüngeren Bruder dazu bringen konnte, in seinem Zimmer zu bleiben, was er seinen Eltern sagte, welche Getränke er anbieten sollte, ob Kerzen auf dem Fensterbrett übertrieben romantisch wirkten und ob der Pickel, der sich gerade prächtig an seinem Kinn entwickelte, bis Freitag abheilen würde.
Er hatte wenig Erfahrung mit Mädchenbesuch, um nicht zu sagen, gar keine. Auch sonst war er nicht besonders erfahren, er hatte nur ein Mal mit einem Mädchen geknutscht, aber so richtig zählte das eigentlich nicht, weil das Mädchen seine Cousine Lotte war, die ihn vor ihrem ersten Date zum Üben benutzt hatte.
Hinzu kam, dass er sich extrem unattraktiv fand. Er mochte seinen Körper nicht, der hatte ihn immer nur enttäuscht, er hatte keine Muskeln, seine Haut war übertrieben hell und teigig, und die paar Haare, die auf seiner Brust wuchsen, waren gerade wieder ausgefallen. Wie übrigens seltsamerweise auch seine Schamhaare, die eigentlich immer ganz ordentlich gewuchert hatten und die nun nur noch in vereinzelten Büscheln vorhanden waren. Vermutlich hatte es mit den neuen Medikamenten zu tun. Seit er denken konnte, musste er ständig irgendwelche Tabletten und Kapseln schlucken. Mal wurde ihm schlecht davon, mal bekam er Ausschlag oder schlimme Kopfschmerzen. Da waren ein paar verlorene Sackhaare schon fast eine Wohltat.
Abgesehen von alldem versuchte er, sein unverhofftes Glück so gut wie möglich zu genießen. Der Gedanke, dass Marie ihn nun wirklich bald besuchen würde, jagte ihm immer wieder ungläubige Schauer durch den Körper. Er hätte es allerdings einfacher gefunden, sie bis Freitag nicht zu sehen, weil er nicht wusste, wie er sich bis dahin in der Schule verhalten sollte. Sollte er so tun, als wäre alles wie immer? Durfte er sie ansprechen? Zum Glück machte ihm Marie die Sache leicht, sie winkte ihm vor allen anderen zu, setzte sich in der Cafeteria neben ihn, erzählte jedem, der es hören oder auch nicht hören wollte, dass sie am Freitag zu Jakob gehen werde. Was er einerseits toll fand, aber andererseits auch nicht. Denn wer so gar nicht aufgeregt war, der war doch auch so gar nicht interessiert, oder?
Es kam der Freitag, die Schulstunden zogen träge an Jakob vorbei, wie ein »Mario Kart«-Rennen mit schlechter Internetverbindung. Er sah nichts, er hörte nichts, er saß da wie betäubt und hoffte, dass er nicht vor Aufregung vom Stuhl kippte, bevor endlich das Wochenende begann. Manchmal blickte er verstohlen zu Marie, aber sie schien sehr beschäftigt zu sein, war erst in irgendein Buch vertieft und quatschte und kicherte dann die ganze Zeit mit Tom. Es war möglich, dachte Jakob, dass sie die Verabredung längst vergessen hatte. Es war sogar ziemlich wahrscheinlich. Er spürte Enttäuschung in sich aufsteigen, die noch größer wurde, als Marie ihn auch später keines Blickes würdigte und dieser Schultag ohne jedes Wort von ihr zu Ende ging.
Da hätte er am liebsten alles abgesagt. Besser, man cancelt selber ein Date, als gecancelt zu werden. »Sorry, Marie«, könnte er sagen, »ich habe total vergessen, dass ich heute Abend diesen wichtigen Videocall habe. West Coast, du weißt schon, brutale Zeitverschiebung. Über die Details darf ich noch nicht reden, aber ich denke, es wird ein ziemlich großes Ding …« Lediglich der Umstand, dass es ihm noch unangenehmer war, sie anzulügen, als von ihr vergessen zu werden, hinderte ihn daran, zum Telefon zu greifen. Und so wurde es Abend. Er saß in seinem Zimmer, strich mit den Fingern über die schwarzen Polystyrolplatten und hoffte auf das Türklingeln.
Aber es klingelte nicht, stattdessen klopfte seine Mutter und fragte, ob sein Besuch mit ihnen zu Abend essen wolle. Und wann denn der Besuch käme. Und wie er heiße. Und dann klopfte auch noch sein Bruder, weil der irgendein beschissenes Playmobil-Haus suchte.
Und dann klingelte es.
Die ersten Minuten waren komplett surreal, weil er diese beiden Bilder einfach nicht zusammenkriegte: sein Zimmer. Und sie. Dass Marie jetzt da stand, wo er sonst immer nur alleine war, das musste er erst mal verarbeiten. Sie betrachtete die Fotos über seinem Schreibtisch, die ihn an seinem vierzehnten Geburtstag am Außenbecken der Robbenanlage im Tierpark zeigten.
»Magst du Robben?«
»Na ja, geht so.«
Gestern Abend noch hatte er in einem Onlineratgeber gelesen, dass man bei einem ersten Date möglichst viele Fragen stellen sollte, weil man damit einerseits klarmachte, wie sehr man sich für das Mädchen interessierte, und gleichzeitig die Kontrolle im Gespräch behielt. Er hatte ein paar Fragen vorbereitet, die ihm allerdings auf einmal total dämlich erschienen. Die Fragen sollten ehrlich und sehr persönlich sein, wurde geraten, im besten Fall sollten sie sich auf natürliche Weise aus dem Gespräch ergeben. Na super, dachte Jakob, und was mache ich, wenn das Gespräch noch gar nicht in Gang gekommen ist? Marie ging wie eine Katze in seinem Zimmer umher, betrachtete alles mit großer Aufmerksamkeit.
»Und was machst du so, ich meine, außerhalb der Schule … Hast du Hobbys?«, stammelte Jakob und hätte sich am liebsten selbst geohrfeigt für diese banalste aller banalen Fragen.
»Hobbys?«, fragte Marie und sah ihn belustigt an.
»Ich dachte nur … wegen der Robben, ob du vielleicht Tiere hast?«
»Nö. Ich habe eine kleine Schwester, die brüllt wie ein Tier und ist auch total behaart.«
»Wie alt ist sie denn?«
»Gerade geboren, meine Eltern hatten, glaube ich, Angst davor, irgendwann kein Kind mehr zwischen sich zu haben, da haben sie lieber noch schnell eins gemacht.«
»Und wie ist das für dich?«
»Das ist okay, wenn die sich dann weniger zoffen, wobei sie gerade so fertig sind, dass sie sich noch mehr zoffen als vorher.«
»Meine Eltern streiten sich meistens heimlich im Badezimmer, und sie denken, wir kriegen das nicht mit.«
»Worum geht es?«
»Ach, es ist immer dasselbe. Es reicht schon, wenn mein Vater sagt, meine Mutter sei genau wie ihre Mutter. Dann geht es direkt ab.«
Marie setzte sich auf den Schreibtischstuhl. »Kann ich verstehen. Wer will schon so werden wie die eigenen Eltern? Ich versuche mir manchmal vorzustellen, wie ich so leben werde später. Als Erwachsene.«
»Und?«
»Das Seltsame ist, ich kann es mir nicht vorstellen, weil mich das Konzept nicht überzeugt. Ich finde, Erwachsene haben wenig Spaß, dafür aber jede Menge Sorgen und Verantwortung. Warum soll ich mir das antun?«
»Na ja, als Kind musst du immer jemanden fragen, bevor du irgendwas machen darfst. Außerdem gibt es bestimmt Erwachsene, die Spaß haben.«
»Ja klar, aber den meisten Spaß haben die doch, wenn sie sich unerwachsen verhalten. Wenn meine Eltern was rauchen, dann fangen sie an zu kichern, dann sind die auf einmal richtig glücklich, weil sie mal kurz den ganzen Stress vergessen dürfen.«
»Okay, ich verstehe, was du meinst«, sagte Jakob, der sich immer mehr entspannte. »Vielleicht sollten wir hier und jetzt beschließen, dass wir später die unerwachsensten Erwachsenen werden, die es je gegeben hat.«
»Das machen wir!«, rief Marie begeistert. »Wir werden wie Wildgänse sein, die einfach in den Sommer fliegen, wenn der Winter kommt.«
»Fliegen Wildgänse nicht immer zusammen?«
»Ist das ein Heiratsantrag?«
Jakob wurde rot. »Nein, ich meine …«
»Wie, du willst mich nicht heiraten?«
»Ich … nun ja, ich würde es tun, wenn es nicht so wahnsinnig erwachsen wäre«, sagte Jakob, der staunend zur Kenntnis nahm, dass er gerade in Anwesenheit eines Mädchens einen Witz gemacht hatte.
Marie lachte. »Ich schlage vor, wenn einer von uns später mal zu erwachsen werden sollte, dann darf der andere sich eine peinliche Strafe für ihn ausdenken.«
»Was wäre dir denn peinlich?«
»Das werde ich dir doch nicht sagen.«
»Klar, verstehe ich. Mir ist so ziemlich alles peinlich, insofern wirst du es leicht haben.«
»Ziel ist es, den anderen zum Lachen zu bringen.«
»Oder zum Weinen. Weil Erwachsene das auch so selten machen.«
»Das stimmt. Wann hast du zum letzten Mal geweint, Jakob?«
Er stutzte, er war es nicht gewohnt, über solche Fragen nachzudenken, geschweige denn, darüber zu sprechen. Aber aus irgendeinem Grund waren seine Scham und Vorsicht verschwunden. Es war so, als würden Maries Unbefangenheit und Direktheit auf ihn überschwappen. Als hätte er sich in ihrer Gegenwart in jemand anderen verwandelt. »Vor zwei Wochen war ich im Park, da spielten ein paar Jungs Fußball und einer fragte mich, ob ich nicht Lust hätte, mitzuspielen. Und ich hätte große Lust gehabt.«
»Aber du konntest nicht? Wegen deiner Krankheit?«
»Du weißt davon?«
»Klar.«
»Jedenfalls hat mich das sehr … traurig gemacht, die Vorstellung, dass ich nie …« Jakobs Stimme zitterte, er verstummte. Marie stand von ihrem Stuhl auf, trat auf ihn zu und nahm ihn in die Arme. Er spürte ihre Wange neben seiner Wange, ihre Haare rochen nach Zigarettenrauch. Er stand da wie erstarrt und wusste nicht, ob er gerade traurig oder glücklich war.
»Guter Trick, das mit dem Weinen«, sagte Marie und löste sich langsam von ihm. »Kriegst du damit alle Mädchen rum?«
»Die meisten«, sagte Jakob, er musste lachen und fühlte sich leicht wie lange nicht. Dann wollte Marie, dass er ihr endlich zeigte, wie er seine Sounds machte, und sie setzten sich an den Computer, er erklärte, sie hörte zu. Er genoss ihre konzentrierte Aufmerksamkeit, er spielte ihr seine Lieblingssounds vor, sie schloss die Augen.
»Jakob, das ist krass, wie so kleine Gefühlsbomben, die in mir drin explodieren.«
»Na ja, ich bin nicht der große Redner. Das hier ist meine Sprache, ich kann damit so ziemlich alles sagen.«
»Wenn du einen Sound über mich machen solltest, wie würde der klingen?«, fragte sie.
Er überlegte, öffnete einen Ordner und klickte auf eine Datei, die »Marie« hieß. Ein weiches Plätschern und Glucksen war zu hören, wie das Wasser eines Bergbaches.
»Du hast einen Sound über mich gemacht?«
Wieder wurde Jakob rot. »Ich hätte nie gedacht, dass ich dir den vorspielen würde.«
Keine Stunde später, als Marie längst gegangen war und sein Zimmer wieder ihm allein gehörte, erschien es ihm schon total unwirklich, was gerade zwischen ihnen passiert war. Als er kurz vor Mitternacht im Bett lag, ging er in Gedanken immer wieder die Sekunden durch, in denen sie ihn umarmt hatte. Und auch wenn sie ihn vielleicht einfach nur hatte trösten wollen, so würde er ihren Geruch und ihre Wärme nie vergessen. Er spürte eine Erektion und fand, es gäbe jetzt eigentlich nichts Besseres, als sich einen runterzuholen, was ihm allerdings nicht gelang, weil sein Schwanz seltsam leblos blieb. Vielleicht, dachte Jakob, ist das normal, wenn man frisch verliebt ist, wenn das Gefühl so viel größer ist, als es je war.
Allerdings machte er sich schon Sorgen, als es ihm auch am nächsten Tag nicht gelang, sich ein wenig Entspannung zu verschaffen, sogar ein YouPorn-Video konnte daran nichts ändern. Sein Schwanz schien abwesend zu sein, lag da wie ein müdes Tier. Er überlegte, wann er zum letzten Mal onaniert hatte, das musste schon eine Weile her sein. Er war kein großer Fan der Onanie, seit der Arzt ihm mal gesagt hatte, dass ein Orgasmus bei ihm einen Kreislaufzusammenbruch auslösen könnte. Das hatte sich zwar später als übertrieben herausgestellt, aber ein grundsätzliches Unbehagen war geblieben, weshalb Jakob, anders als die meisten Jungs aus der Klasse, eher selten selber Hand anlegte.
Was war los mit ihm? Hatte auch das mit den neuen Medikamenten zu tun? Oder war er immer noch so aufgeregt wegen Marie? Die hatte ihm gleich am nächsten Morgen eine Nachricht geschickt: Danke für den Abend und bis ganz bald … Unerwachsen für immer! Er hatte geschrieben: Danke. Es war toll. Ich habe noch nie so mit jemandem gesprochen, mich noch nie so mit jemandem gefühlt. Aber dann hatte er die Nachricht doch nicht abgeschickt, weil sie ihm so schwach und bedürftig erschien. So als hätte es vor ihr nichts Wichtiges in seinem Leben gegeben, was zwar grundsätzlich richtig war, aber das musste er ihr ja nicht sofort mitteilen. Er schrieb stattdessen: Ja, es war toll, müssen wir bald mal wieder machen. Unerwachsen für immer!
Die Sommerferien begannen, sie gingen im Park spazieren, bauten Sandburgen am Weißensee, warfen sich Gummibärchen in den Mund. Im Gummibärchen-Schnappen war Marie sehr geschickt, ganz anders als er. »Ich werde das nie schaffen«, sagte Jakob, woraufhin sie ihren Mund auf seinen drückte und mit zuckriger Zunge zwei Gummibärchen in seinen Rachen schob. Das war ihr erster Kuss, er spürte ihre rauen Lippen, sein Herz raste. Er fragte sich, ob das gefährlich sein könnte, ob er gleich das Bewusstsein verlieren würde, wie neulich auf dem Kettenkarussell, beschloss dann aber, dass es nicht nur völlig okay wäre, sondern vermutlich sogar absolut angemessen, sich von einem solchen Mädchen ohnmächtig küssen zu lassen.
Von da an sahen sie sich fast jeden Tag, besuchten die Robben im Zoo, fütterten sich gegenseitig mit Spaghettieis, lagen nachts knutschend am Spreeufer, tranken Bier und hörten schwermütige Musik. Sie brachte ihm Tischtennisspielen bei, er nahm sie mit zu einem »Happy Elephants«-Konzert. Jede Nacht schickte Jakob ihr einen Sound, der sie in den Schlaf begleiten sollte. Er konnte ihr jetzt alles sagen, er hatte keine Angst mehr vor nichts. Nur davor vielleicht, dass das alles aus irgendeinem bescheuerten Grund irgendwann zu Ende sein könnte.
Wobei, so ganz stimmte das nicht, denn es gab eine Sache, die er ihr nicht sagen konnte. Die mit seinem Schwanz, der noch immer komplett benommen wirkte. Vielleicht hatte sie es auch schon mitbekommen, als sie in der Dunkelheit am Spreeufer lagen und ihre Hand in seinen Schritt gewandert war. Sie hatte ihn ein bisschen gestreichelt und, als dann nichts passierte, wieder aufgehört. Im Internet hatte er gelesen, es könne vorkommen, dass man keine Erektion bekomme, wenn man zu aufgeregt sei. Dass man Geduld haben müsse.
Vielleicht würde es anders werden, wenn sie zum ersten Mal miteinander schliefen, dachte Jakob. Er stellte sich vor, wie es wäre, ihren nackten Körper an seinem zu spüren, eine warme Welle jagte durch ihn hindurch, was auch seinen Schwanz nicht unbeeindruckt ließ und Jakob neue Hoffnung gab.
Ein paar Tage später sagte Marie, ihre Eltern seien übers Wochenende verreist und er könne bei ihr übernachten. Da war sie also, die ultimative Prüfung, dachte Jakob. Er kaufte Kondome, Sekt, ihre Lieblingskartoffelchips und klingelte an ihrer Tür. Sie guckten einen Film, tranken den Sekt, tanzten zu Musik von »Arlo Parks«, zogen sich aus und legten sich in Maries schmales Kinderbett. Sie sahen einander in die Augen, er spürte ihre Brüste an seiner Brust und er wusste, dass dieser Moment jetzt gerade wunderbar sein könnte. Dass er eigentlich wunderbar war, wenn er selbst nicht wie gelähmt daliegen würde, in sich reinhorchend, ob sich untenrum was tat.
Es tat sich dann gar nichts, und Marie sagte, es sei doch nicht schlimm, aber natürlich war es schlimm. Zumal es auch das erste Mal für sie gewesen wäre. Marie sagte, sie finde es süß, dass er so unsicher sei, und Sex sei doch keine Leistungskontrolle, und es gebe doch auch noch andere Sachen, die man erst mal machen könnte, und sie hätten doch ewig Zeit. Aber nichts davon tröstete ihn, er lag im Bett mit dem wunderbarsten Mädchen der Welt und seine Verzweiflung wuchs mit jedem Atemzug.
WENGER
In der Nacht war er aufgewacht, wie immer gegen 4.30 Uhr. Sofort waren die Gedanken da, die in der Dunkelheit so teuflisch wuchsen, die ihn wie Efeu umrankten, ihm die Brust zuschnürten. Und immer wieder diese verfluchten Bilder, das braune Fläschchen im obersten Fach des Panzerschranks, die behaarten Hände des Pfarrers, das leise Wimmern der Mutter, der Umschlag mit dem roten Wachssiegel, der Blick von oben auf das Bett, in dem er sich mit Krämpfen wälzte, Mathildes Tränen, das gleißende Nichts, das ihn verschlang. Es waren immer dieselben Bilder, die zu Staub zerfielen, sobald das erste Tageslicht durch das Fensterglas kroch. Weil böse Gedanken, ähnlich wie Vampire, nur in der Finsternis mächtig sind.
Das Gespräch mit Professor Mosländer war anders verlaufen, als Wenger es sich vorgestellt hatte. Weniger dramatisch, sehr gefasst. Mosländer hatte ihm erklärt, dass nun auch die rechte Herzseite geschwächt sei, dass die Atemnot zunehmen werde, auch die Schmerzen in den Beinen. Ein Schrittmacher könne da nicht mehr helfen, für eine Transplantation sei er zu alt. Besorgniserregend waren auch seine Nieren- und Leberwerte. Das neue Medikament, das ja wohl seine letzte Hoffnung war, schien nicht anzuschlagen. »Wie lange noch?«, hatte er gefragt. »Vielleicht zwei Monate, vielleicht zwei Jahre«, hatte Professor Mosländer gesagt.
Das war jetzt sechs Wochen her. Er hatte nur Mathilde davon erzählt, die komplett zusammengeklappt war, obwohl er die Lage wesentlich positiver beschrieben hatte als Mosländer. Na gut, sie kannte ihn und wusste, dass er in solchen Dingen immer untertrieb. Außerdem hatte sie dann selbst mit Mosländer gesprochen, der nichts gesagt, aber dafür wohl recht traurig geguckt hatte. Jedenfalls war ihm da klar geworden, dass er das alles erst mal für sich klären musste, bevor er anderen davon erzählte.
Aber wie soll man Dinge klären, die man selbst kaum begreifen kann? Er war es nicht gewohnt, dass es Probleme gab, die er nicht lösen konnte. Dass es einen Willen gab, der stärker als seiner war. Es hatte ihn immer wütend gemacht, wenn Leute vom Schicksal sprachen, weil ihm das so mutlos und unengagiert erschienen war. Eine bequeme Ausrede von irgendwelchen Sesselfurzern, die nicht bereit waren, Verantwortung zu übernehmen. Was sollte denn das sein, dieses Schicksal? Irgendein göttlicher Plan vielleicht? Er war überzeugt, dass nur die Dummen und die Faulen vom Schicksal überrascht wurden, alle anderen bestimmten ihr Leben selbst.
Das ging ein paar Wochen so, dieser Kampf mit sich selbst und mit der Einsicht, dass all seine Stärke und Entschiedenheit ihm nichts nutzten angesichts des Unvermeidlichen. Nicht unwichtig war vermutlich ein Telefongespräch mit Professor Mosländer, der ihm eine Pflegerin vermitteln wollte. »Sie brauchen Hilfe«, hatte Mosländer gesagt, »schon bald werden Sie sich nicht mehr alleine anziehen können, in spätestens einem halben Jahr wird es Ihnen schwerfallen, ohne Hilfe das Bett zu verlassen.«
Da war für ihn die Entscheidung gefallen.
Die Fragen, die dann kamen, erschienen ihm schon wieder vertrauter, weil sie praktisch und lösbar waren. Wo bekam man das Natrium-Pentobarbital her, dieses Zeug, das sie in der Schweiz in den Sterbehäusern verwendeten? War es angeraten, dazu noch Metoclopramid zu schlucken, um den Brechreiz auszuschalten? Könnte Professor Mosländer ihm das Gift auch intravenös verabreichen? Oder zumindest einen Zugang legen? Wenn das alles organisiert wäre, so dachte Wenger, dann würde es ihm besser gehen, weil er sein Schicksal wieder selbst in der Hand hätte. Nun ja, das war nur einer von mehreren Irrtümern gewesen.
Er drehte sich zur Seite, ließ die Beine über die Bettkante gleiten, spürte den weichen Teppich unter den Füßen. Nach ein paar Minuten stemmte er sich hoch, blickte aus dem Fenster zum Ahorn hinüber, der wie ein knorriger Wächter vor seiner Villa im Berliner Westend wuchs. Der Baum beruhigte ihn, wie er da so stand, unerschütterlich, selbstverständlich. Der weiße Kastenwagen von »Feinkost Mayer« parkte in der Auffahrt. Der alte Mayer sprach mit Mathilde, während die Haushälterin, die Köchin und der Gärtner riesige Tüten und Kartons ins Haus brachten, als würde die halbe Stadt zu Besuch kommen. Dabei kamen doch nur Selma und Philipp samt Ehepartnern. Und Hubert, der Notar der Familie, der über die Jahre so etwas wie ein Freund geworden war, auch wenn Wenger ihn selbstverständlich nie so nennen würde.
Mathilde hätte am liebsten noch mehr Leute eingeladen, weil der Achtzigste doch angeblich so ein wichtiges Datum war. Aber Wenger waren Geburtstage schon immer suspekt gewesen. Er mochte es nicht, auf diese Weise im Mittelpunkt zu stehen. Was war es denn für ein Verdienst, geboren worden zu sein? Jeder wurde irgendwann geboren, selbst die größten Trottel hatten das geschafft. Alle, die auf diese Welt kamen, waren Sieger, waren aus Samenzellen entstanden, die sich gegen Millionen anderer Samenzellen hatten durchsetzen müssen, um als Erste in der Eizelle anzukommen. Wenn aber alle Sieger waren, fand Wenger, war es doch ziemlich lächerlich, sich dafür auch noch feiern zu lassen.
Wobei er zugeben musste, dass er Geburtstage schon als Kind nicht gemocht hatte, was vor allem mit seiner Angst zusammenhing, die anderen könnten ihn vergessen haben. Sie waren fünf Söhne zu Hause gewesen, da konnte man schon mal übersehen werden. In jeder Geburtstagsnacht war er sicher gewesen, dass diesmal keiner an ihn dachte. Dass niemand am nächsten Morgen vor seinem Bett stehen würde, um ihm im Schein der Kerzen und im vielstimmigen Familienchor »Viel Glück und viel Segen« zu wünschen. Und selbst der Umstand, dass er nie vergessen wurde, dass sie immer vor seinem Bett standen, hatte ihm die Sache nicht leichter gemacht.
Hinzu kam, dass seine Mutter am Morgen seines einunddreißigsten Geburtstages gestorben war, was ihn später zu der, zugegeben übertriebenen, Annahme verleitete, sie hätte sein Leben mit ihrem Tod bezahlt. Er war mit ihr alleine gewesen, als sie starb, seine Mamusch, noch heute spürte er ihre knöcherne Hand in seiner, hörte das Wimmern ihres letzten Kampfes, das sich jetzt in seine Nächte schlich und ihn darin bestärkte, eine Abkürzung aus dem Leben zu nehmen.
Er würde es ihnen heute Abend sagen, nach dem Dessert. Sie könnten dann anschließend einen Pflaumenbrand trinken, zur Verdauung des Essens und der traurigen Nachricht. Er musste sich noch die richtigen Worte zurechtlegen, die Frage war vor allem, wie direkt, wie konkret er es sagen sollte. War es besser, in vagen Metaphern zu sprechen, oder sollte er ihnen klipp und klar sagen, was er vorhatte?
Am meisten Sorgen machte er sich um Mathilde. Deshalb hatte er in den letzten Tagen immer mal wieder Anläufe unternommen, um sie darauf vorzubereiten. Aber jedes Mal, wenn er etwas sagen wollte, und sei es auch nur eine Andeutung darüber, wie es um ihn stand, wurde er von der Wucht der eigenen Nachricht übermannt. Er spürte, dass im Moment der Verkündung aus bloßen Gedanken so etwas wie Wirklichkeit werden würde.
Was seine Kinder betraf, gab sich Wenger keinen Illusionen hin. Vielleicht würden sie erst mal schockiert sein, aber vermutlich nicht stärker als damals, als Benno, der Foxterrier der Familie, nach einem stolzen Hundeleben von ihnen gegangen war. Sie würden vermutlich vor allem erleichtert sein, weil der Alte endlich keinen Druck mehr machen konnte. Er hatte Selma und Philipp immer gefördert, wollte sie zu seinen Nachfolgern aufbauen, aber sie scheuten die Verantwortung, erfanden immer neue Gründe, sich der Aufgabe zu entziehen. Mathilde meinte, die Kinder könnten nicht gedeihen in seinem Schatten, aber das war natürlich Blödsinn. Was denn für ein Schatten? Er gab ihnen Luft, er gab ihnen Sonne, er gab ihnen alles, was sie brauchten. Aber Selma und Philipp beklagten sich immer nur, weil sie angeblich Gefangene der Familie waren, ihre Existenz schon vorherbestimmt war.
Wie oft hatte er sich dieses Gejammer anhören müssen. Auf Mathildes Wunsch hin, die meistens auf der Seite der Kinder stand, hatte er versucht, sich etwas Verständnis für die beiden abzuringen. Aber es fiel ihm nicht leicht, weil er es schlicht nicht kapierte. Glaubten diese verwöhnten Bälger wirklich, dass sie es schwerer hatten als er? Er, der als Kind noch Hunger und Krieg erlebt hatte, der sich ohne Ausbildung hocharbeiten musste, der mit zwanzig seine Bau- und Immobilienfirma gründete und seit dem frühen Tod des Vaters die komplette Familie durchfüttern musste? Glaubten Selma und Philipp wirklich, sie hätten leiden müssen? Mit ihren englischsprachigen Kindermädchen, den Skiurlauben in Davos, dem Segelboot auf dem Wannsee, dem Studium in Oxford? Dazu noch die liebevollste Mutter der Welt. Und ja, zugegeben, ein ziemlich beschäftigter Vater, der sich erdreistete, sich nicht nur für seine Kinder, sondern auch ein wenig für seine zweitausend Mitarbeiter verantwortlich zu fühlen.
Im Grunde, davon war Wenger überzeugt, war das Gejammer seiner Kinder nur ein Vorwand, um sich aus der Pflicht zu stehlen. Denn ganz offensichtlich hatten beide sein unternehmerisches Talent geerbt, Selma sogar noch mehr als Philipp. Hinzu kam ihr Gespür für Menschen, ohne das im Immobilienbereich gar nichts ging. Als Selma im zweiten Jahr in der Firma war, hatten sie einen Großkunden aus Schweden, der zweihundertfünfzig Wohnungen kaufen wollte. Kurz vor der Unterzeichnung der Kaufverträge versuchten die Schweden den Preis zu drücken, was Wenger vor große Probleme stellte, da er in Geldnot war und verkaufen musste. Selma schlug damals vor, die Gespräche mit den Schweden alleine weiterzuführen. »Man spürt deine Angst, Papa«, hatte sie gesagt. Er ließ sie machen und sie verkaufte nach kurzen Verhandlungen für den ursprünglich ausgehandelten Preis, »weil die Schweden eigentlich nur spielen wollten«, wie sie sagte.
Selma war ein Naturtalent und Philipp auf seine Art auch, es war völlig klar, dass sie irgendwann die Firma übernehmen sollten, stattdessen waren sie beide weggegangen, hatten ihn alleingelassen. Weil er angeblich niemanden neben sich duldete, weil er angeblich alles selbst bestimmen wollte. Was für ein Blödsinn! Der Deal mit den Schweden war doch der beste Beweis dafür, dass er zurückstecken konnte! Dass er seinen Kindern vertraute!
Tja, sie waren trotzdem gegangen, zuerst Philipp, der unbedingt auf irgendeiner Insel irgendwelche bescheuerten Schildkrötenbabys retten wollte, und dann auch noch Selma, die diesen komplett nichtsnutzigen Typen geheiratet hatte, der sie in jeglicher Hinsicht nach unten zog. Es war zum Verzweifeln, wie die beiden ihr Talent verschwendeten, sie waren jetzt bald vierzig und hatten noch rein gar nichts geschafft. Noch nicht mal Enkelkinder hatten sie ihm geschenkt, nicht mal das gönnten sie ihm, obwohl doch jeder wusste, wie gerne er Großvater wäre.
Er duschte lange, zog sich gemächlich an, je später er nach draußen trat, um sich von allen gratulieren zu lassen, umso besser. Beim Anziehen der Hose fiel ihm auf, dass es ihm an diesem Morgen kaum Mühe bereitete, sich auf einem Bein stehend hinunterzubeugen, um den Fuß ins Hosenbein einzufädeln. Normalerweise saß er beim Hosenanziehen, weil er Angst hatte, das Gleichgewicht zu verlieren. Er beschloss, auch stehend in das andere Hosenbein zu schlüpfen, und es gelang ihm auf Anhieb. Potztausend, dachte Wenger, das waren vermutlich die berühmten letzten Kräfte, die man aufbrachte, kurz bevor es zu Ende ging.
Leidlich beschwingt stieg er die Freitreppe zum Esszimmer hinab, beschloss dann aber, lieber an dem kleinen Tisch in der Küche zu frühstücken und Anita, der Köchin, ein wenig bei der Arbeit zuzuschauen. Im Vestibül traf er auf Mathilde, die ihn umarmte und »Herzlichen Glückwunsch, mein Liebster« in sein Ohr flüsterte. Er aß mit großem Appetit, ging eine geschlagene Stunde im Park spazieren, ließ sich von Theo, dem Gärtner, die im Herbst gepflanzten Birnbäume zeigen und zog sich anschließend zur Zeitungslektüre in den Wintergarten zurück. Nach dem Mittagessen legte sich Wenger ein Stündchen hin, wachte erquickt und gut gelaunt auf und fragte sich, wann er zum letzten Mal so einen faulen, netten Tag gehabt hatte.
Erst da fiel ihm wieder die Rede ein, die er nach dem Dessert halten musste, und die Leichtigkeit war mit einem Schlag verschwunden. Was allerdings, dachte Wenger, viel weniger verwunderlich war als die geradezu aufreizende Fröhlichkeit, die ihn bis dahin durch den Tag getragen hatte.
Am Abend vor dem Kleiderschrank entschied er sich für den nachtblauen Smoking, den Mathilde ihm vor ein paar Jahren in Mailand gekauft hatte und den er danach nicht ein einziges Mal hatte anziehen wollen. Es wäre doch schade, fand er, diesen schönen Smoking so völlig ungetragen zu hinterlassen. Dabei fiel ihm auf, wie viel Kleidung in seinen Schränken hing, deren Existenz er vergessen hatte. All diese Kleidung würde ihre Daseinsberechtigung verlieren in dem Moment, in dem ihr Besitzer von dannen ging. Wobei das eigentlich Seltsame war, dass die Kleidung den Besitzer überlebte. Dass er selbst verschwinden würde, während seine Unterhosen noch ordentlich gefaltet in der Schublade lagen.