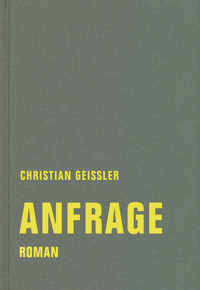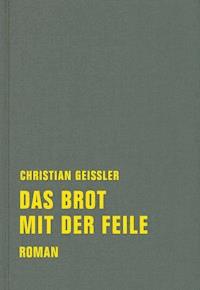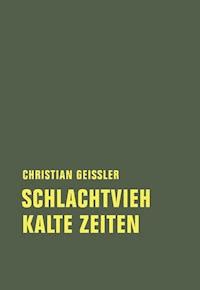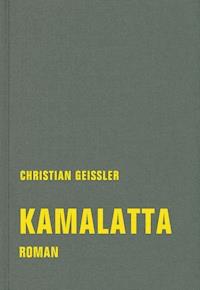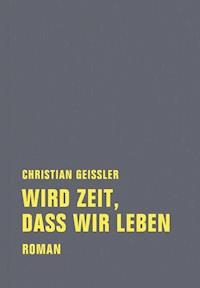
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verbrecher Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Christian Geissler Werke
- Sprache: Deutsch
Schlosser ist Funktionär der KPD. Bis zu seiner Verhaftung bremst er den Eifer der Genossen im Kampf gegen die Nazis, verweigert die Waffen und pocht auf Disziplin. Die Genossen von der Basis aber wollen kämpfen. Kämpfen bedeutet für sie Lust und Leben. Vor allem für Karo, aber auch für Leo, der noch 1930 zur Polizei geht, aber später begreift, dass er auf der falschen Seite steht. In "Wird Zeit, dass wir leben" erzählt Christian Geissler mit "balladenhaft-lyrischer Präzision" (Heinrich Böll) vom Widerstand der Kommunisten gegen die Nazis in Hamburg. Als ob er mitten im Geschehen steckt, begleitet er seine Figuren durch die Kämpfe vor und nach 1933. Er erzählt von Gewalt von oben und Gegenwehr von unten, vom Spannungsverhältnis zwischen Kollektiv und Individuum, zwischen Disziplin und Eigensinn - und zieht den Leser in die immer noch aktuellen Debatten mit hinein. Geisslers Roman basiert auf einer wahren Geschichte: Das Vorbild für Leo war der Hamburger Polizist Bruno Meyer, der Anfang 1935 die Widerstandskämpfer Fiete Schulze und Etkar André aus dem Gefängnis befreien wollte. Detlef Grumbach recherchierte umfassend und erzählt in seinem Nachwort erstmals vom Schicksal Bruno Meyers.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 482
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christian Geissler
WIRD ZEIT, DASS WIR LEBEN
Geschichte einer exemplarischen Aktion
Mit einem Nachwort von Detlef Grumbach
INHALT
IDie nicht überraschende Gefangensetzung eines leitenden Genossen zum Zwecke seiner Vernichtung. Der Gefangene hat Durst. Sein Durst wird gestillt.
– Vorläufige Erinnerung
II Von verschiedenen Seiten her, aus elenden Jahren zurück, die allmähliche Anreise dreier Genossen an den Ausgangspunkt ihrer gemeinsamen Vorbereitungen zur Befreiung eines Gefangenen. Widerstände und Umwege. Es wird gelitten. Könner setzen auf Rot. Das führt zu Vernunft, Zärtlichkeiten und Faustfeuerwaffen. Viele bezahlen mit ihrem Leben. Deckadresse Speckstößergruben.
– Pferdehaarschlingen und Stadtparkmond
– Blinzeln
– Banditenleben
– Mündungsfeuer
– Aufschlag
– Hunger und Kränkung
– Ganterschatten
– Ruhe stiften
– Wachsam bleiben
– Atem an Atem
– Kampftänze
– Alles Verwandte
– Feuer frei
– Fäuste auf den Ohren
– Krieg
– Nicht hinlegen
– Friedensordnung
– Fallen stellen
III Ein Junker von Junkers landet für Junkers auf der Wiese im Grunde des Strudels. Wer das Gras zwar grün, die Wurzeln aber blutrot sieht, steht vorläufig noch allein. Das darf nicht lange so bleiben. Keiner von uns hat viel Zeit. Die Befreiung von Gefangenen wird vorbereitet. Wer Befreiung verhindern will, lebt gefährlich. Gelaber in Sachen Gewalt findet nicht statt. Die Zustände selbst sind Gewalt. Auch die Frage nach den Massen erweist sich als Müll. Sie verschüttet nur die Frage nach dir selbst. Manche möchten auf diese Frage lieber nicht antworten. Manche möchten lieber tot sein als leben. Manche freuen sich auf Weihnachten.
– Mörderwochen
– Trau schlau wem
IV Weihnachtslandschaft mit Menschen und Mördern. Kein Heiland reißt den Himmel auf. Nur Genossen befreien Genossen. Arbeitstakt der Befreiung. Schwarzer König ballt Thron aus Stühlen. Wo was los ist, da sind auch Matrosen im Bild. Kerzenflimmer und fliegende Messer. Die Orgelratte beißt gelb. Federchentod und ein Berg aus Licht. Genossen brechen zur Arbeit auf. Jetzt, sofort.
– Weihnachtslandschaft
– Frohes Fest
Zeit:zum Beispiel 1923–1933
Plätze:Hamburg, Holstein, Berlin
Leute,wie sie im Verlauf der Geschichte nach und nach auftreten:
Schlosser, geb. 1894, Parteiarbeiter
Leo Kantfisch, geb. 1911, Schüler, Polizist
Pudel, geb. 1912, Straßenmädchen
Herr Alex, geb. 1893, Gutsherr
Karo, geb. 1912, Knechtetochter, Büchsenmacherlehrling, Zeichenbürohilfskraft
Jonny (Großvater von Karo), geb. 1850, Fischerknecht
Baronin (Mutter von Herrn Alex), geb. 1870, Gutsherrin
Wächter, geb. 1880, Pastor
Rigo, geb. 1907, Bäckerlehrling, Hilfsarbeiter
Hanneken (Mutter von Karo), geb.1896, Küchenhilfe im Schloss von Herrn A.
Krischan Pietsch, geb. 1900, Lehrer
Theophil Schmüser, geb. 1890, Büchsenschmied, später Kirchendiener
Leutnant Ratjen, geb. 1895, Bandenchef
Opa Friedrich (Vater von Leo), geb. 1870, Arbeiter in einer Buchbinderei
Willi Kantfisch (»Meuterwilli«), geb. 1890, toter Bruder von Leo
Ella Kantfisch (Witwe von Willi), geb. 1893, Hausmeisterin in Weidenallee, später Jutearbeiterin
Ilona Witt, geb. 1920, Nachbarskind von Leo K.
[Markward Benthin , geb. ?, Buchhändler]
Schwarzen Hamburger (Roten Hamburger, Jesus), geb. 1907, arbeitsloser Seemann
Kuddel Mäuser, geb. 1897, Krankenpfleger
Jimmy, geb. 1904, Ire, Bankassistent
Krosanke (Vater von Schwarzen Hamburger), geb.1870, Kleinbauer
Fiete Krohn, geb. 1902, Dreher
Adelheit Witt (Mutter von Ilona), geb. 1902, Plättmädchen
Emmi, geb. 1904, Arbeiterin
Ole Olsen, geb. 1901, Polizeikollege von Leo K.
Balthasar, geb. 1910, Polizeikollege von Leo K.
Meier, geb. 1890, Polizeiausbilder
Schwalm-Böhnisch, geb. 1890, Lehrer auf der Polizeischule
Atsche, geb. 1910, Polizeikollege von Leo K.
Klinsch, geb. 1900, Zuhälter
Sophie Kasten (Mutter von Rigo), geb. 1877, Hilfsarbeiterin und Bedienung
Alma, geb. 1900, Wirtin in Altona
Alfons, geb. 1910, Arbeitsloser
Jupp, geb. 1910, Arbeitsloser
Evchen Rühmel (Frau von Krischan Pietsch), geb. 1910, Sekretärin im Untersuchungsgefängnis
Max, geb. 1900, Taxifahrer
Inge, geb. 1915, Buchladenangestellte
[Herr Moritz, geb. 1874?, Polizist]
[Frau Moritz, geb. 1878?, Frau von Herrn Moritz]
Maja, geb. 1913, Straßenmädchen
Pia Maria, geb. 1900, Straßenmädchen
Gerd, geb. 1900, Journalist
Richter, geb. 1900, Bandenchef
Gustav, geb. 1870, Arzt
Liesbeth (Frau von Schlosser), geb. 1897, Arbeiterin
Lottchen (Mutter von Schlosser), geb. 1868, Grünhökerfrau
Wachtel, geb. 1910, Schließerin im Untersuchungsgefängnis
Blondi, geb. 1900, Psychiater in den Altersdorfer Anstalten
Emo Krüger, geb. 1913, Koch
Ausgangspunkt:
In einer Veröffentlichung derVAN(Vereinigung der Antifaschisten und Verfolgten des Naziregimes) aus dem Jahr 1971 gibt es den Hinweis auf einen Hamburger Polizisten, der, 1933/34 eingesetzt als Wachmann für das Untersuchungsgefängnis, versucht hat, politische Gefangene zu befreien. Ich fand diesen Hinweis so wichtig, die Vorstellung von einem Schließer, der es lernt aufzuschließen, so beispielhaft, dass ich hier weiterarbeiten wollte.
C. G.
hohenholz dez 1974
I
Vorläufige Erinnerung
Als sie an jenem Ostermontag aus dem Schatten der Höfe, aus der Deckung all dieser Gesichter bewaffnet über ihn herfielen, war er nicht überrascht, hatte gegen sie aber nichts in der Hand. Er war ein Mann aus der Leitung, fast vierzig Jahre alt, zwanzig Arbeitsjahre als Schlosser im Dock, Arbeiterkampfjahre bis jetzt hierher, leere Hände, nach hinten gedreht, ins Eisen,für Arbeit und Brot*.
Er war nicht überrascht. Er kannte die Straßen. Sie fuhren zum Stadthaus. Er lief ihnen an der Kette die Stadthaustreppe hinauf, an der Kette durch kleine Büros, an der Kette bis an den Stuhl. Dort solle er, sagten sie, nachdenken »bis du tot bist«, und verließen die Zelle, in Eile, polternd.
Er horchte ihnen nach. Er war überrascht von ihrer Angst. Er hatte jetzt plötzlich Durst.
*
Schlosser war der aus derWeihnachtsgeschichte*am wassergekühlten Maschinengewehr, hinter Zeitungsballen und Pissbudeneck, mit pflaumigem Homburger auf, nur dass Berlin seine Stadt nicht war, sondern Hamburg, Türme und Masten, Arbeit und Kinder und Stehbier und Kampf: vom Arbeiterrathaus bewaffnet gegen denBullenförster aus Daressalam*, paar Jahre später ausHungerdachluken*gegen die Ordnungspanzer von ObertierDanner*, nicht unser Ober, nicht unser Panzer, nicht unsere Ordnung, bloß unser Hunger, und klar auch erst mal den Knast aufreißen, los komm, ja, du auch, aller Anfang ist Knast, also weg damit, lachen, endlich mal rot und nicht tot, in all diesem Krieg vonHolstenglacis*bisBillstedter Jute*, rede, Genosse Mauser*.
Er richtete sich streng auf. Er wusste aus seiner Kindheit, dass er nicht hatte einschlafen können, solange das Trinkgefäß im Kanarienbauer nicht regelrecht eingehängt saß, sondern achtlos, in Eile, verklemmt. Achtung, Richtung, Ordnung. Regel und Recht. Auch hatte er nur mit Widerwillen an seiner Schulaufgabe weitergearbeitet, sobald ein Fehler, auch nur ein Verschreiber passiert war. Auf einer neuen Seite sofort, am liebsten kariertes Papier, aber woher für Arbeiterschulkinder all das Geld, pass besser auf, »pass bloß auf!«: Ordnung als Drohung und als Beschämung noch überall hinter der Ordnung. Und irgendwann willst du das selbst. Wasser verschluckt dich, treibt weg, lockt dich runter in offene Arme, in alles verhextes Glück, fließt also nützlich nur zwischen Mauern nach Maß, aber nach wessen Maß.
Er war bemüht, für dieses letzte Stück Weg alles Fragliche abschließend klarzustellen, richtigzustellen, sicherzustellen, möglichst kühl festzustellen. Aber der brennende Durst, die leeren Hände im Rücken, die Beine im Gittermuster all dieser Fenster. Draußen waren Sonne, die Stadt, das Wasser. Die Stadt aber glatt und matt.
In der Hitze unter der Zellendecke glitten unhörbar Fliegen im Schwarm, wehten zart zueinander hin, stießen weg voneinander in rasendem Zickzack, wozu, und wie viele sind das, er suchte die richtige Zahl, er würde dann sicherer schweigen, nachdenken, bis du tot bist.
Wann fängt dein Sterben denn an?
*
»Unsern Tod bestimmen wir selbst.«
Das hatte ihm Schupofips*Leo gesagt. Der hatte die letzten Jahre, auf Zeit, mal Wachdienst im Stadtteil St. Georg gehabt, den mochten sie gern, trotz Schlagstock und Blaurock, den fanden sie alle so lieb und fein, und auch fuchsig gelernter Mann, der Rekrut, mit beinah schon mal Abitur gemacht, und selbergebauten Negertrommeln, »und kannst dich trotzdem auf ihn verlassen«, »mach klar, Leo, dass sie den Schlosser nicht fangen!«, und war ihm auch meistens geglückt.
Und Pudel lacht ihn sich an und legt ihn sichgriffigzurecht, kostenlos, sonst steht sie Hansaplatz, für meistens nur Bessergestellte. Und kommt bei ihm zärtlich ins Hemd. Und stolziert danach wippend um Schlosser. Aber Schlosser fasst Nutten nicht an.
Vielleicht auch nur wegen Bürobeschluss. Denn das Lachen von Pudel, der Schönsten vom Kiez, war der Leitung verdächtig gewesen, »unser Kampf ist kein Witz und bestimmt keine Zote«. Aber doch auch kein Schulstundentag mit Gradesitzen und Eckestehen, wenn du am liebsten mal lachst. Sie hatten sie in die Ecke gestellt. Und Pudel hatte zu ihnen gesagt, dass Genossen was mit Genießen zu tun hat, »sonst alles bald bloß nur noch Krampf. Klar kann man dem Kantfisch trauen«. Sie trauten ihr nun erst recht nicht mehr. Leo Kantfisch war Polizist. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser – als gar nichts. Also fast nur noch Kontrolle. Wo sind wir selbst? Da fängt dein Sterben schon an.
Schlosser hatte mit Leo unlängst noch nachts über Frauen gesprochen, im Hausflur Danziger Straße. Geruch aus den Abfalleimern, das Abstellen und das Spielen von Kindern der Eigentümer, die schwache Bewegung der Tabakglut. Draußen die Razzia nach Maß, nach wessen Maß, Waffenträger schlägt Zettelkleber, schlägt diesmal haarscharf daneben. Pudel hat lachend aufgepasst, trotz Verbot noch lange nicht tot, hat den Schlägertrupp rechtzeitig durchgepfiffen an alle, »sowas macht die aus Spielerei«, »lach du doch auch«, »das ist keine Frau«, »und wir hier bei Nagel und Blohm und Danner, ihr verkauft euch doch jeden Tag auch«, »aber nicht so«, »nur jeden Tag euer Leben«, »unser Leben ist die Partei«.
Schlosser hatte sich paar Stufen höher gesetzt als der Schupo, besseren Überblick durch die Flurfensterklappe, »bei der Frau muss man Angst haben, dass du dich ansteckst«, Leo drehte sich nach ihm um, »mitten im Dreck dein Stück saubere Ordnung. Hast Angst vor den Menschen, Schlosser«.
Da fängt dein Sterben dann an.
Er saß nun leer für sich selbst, aber wer, aber ich, aber was, aber nichts in der Hand, aber wir, aber wann, aber jetzt, aber alles entrissen, trocken und taub. Nicht mal mehr endlich noch Blut in deinen hängenden Fäusten. Was haben wir falsch gemacht?
*
»Mitten im Krieg dein Kampf ohne Waffen. Das darfst du nie machen.«
Das war vor sechs Jahren das Knechtemädchen im Gutswald derer von Zachun*, der Herr Alexander nannte sie Karo, zärtlich mit seiner Peitsche gegen den Hass dieses Kindes.
»Wir könnten ihn fangen. Die sagen, ich bin seine Tochter. Er soll uns alles bezahlen. Und dann paar Steine am Hals. Das Wasser dort draußen ist tief.«
»Wir sind keine Mörder.«
»Jonny sagt, ich bin ein Indianer. Wir sagen, im Schloss sind die Weißen.«
»Wer ist Jonny?«
»Der Vater von meiner Mutter. Die hilft in der Küche. Die könnte auch Feuer legen, wenn wir das wollen.«
»Wir dürfen nichts provozieren.«
»Rede nicht wie die Weißen. Dann versteh ich dich nicht.«
Das Mädchen hielt gegen ihn starr seinen Kopf gesenkt, aber die Hände als Fäuste.
Auf so einfachen Hass, auf die Schönheit einer so selbstständigen Gewalt war er nicht mehr gefasst, erst recht nicht hier oben in Herrschaftswäldern über all diesen Seen. Er war mit dem Fahrrad im Auftrag der Leitung für Tage und Nächte dort draußen in Scheunen und Hütten, trotz Regen im Hemd und Dreck an den Beinen und Hunger, die Augen scharf auf, den Kopf klipp und klar gegen Waffen gerichtet, die hier im Gelände der Eigentümer als Übungswaffen im Einsatz waren für deren Innere Sicherheit, für heimliche Truppen gegen die Stadt, Häuserkampf um Schafstallmauern, Vorhaltegrad zwischen Raps und Lupinen, die Ziegelei als rote Fabrik, die Baronin als Krankenschwester.
Er hatte alles notiert.
In der letzten Nacht saß er heimlich im Häuslerwinkel bei Karos Mutter und Jonny, »die drüben damals, die Roten gegen die States, die konnten nicht schreiben, die hatten nichts für Notizen und Zeitung, die haben niedergestochen und ausgebrannt und vernichtet«.
»Warst du selber dabei?«
»Nicht bei den Weißen. Und auch schon bald sechzig Jahre vorbei, inzwischen.«
»Und die Roten drüben sind jetzt an der Macht?«
»Alles vernichtet. Alles nie einig gewesen. Alles dann doch noch geglaubt, und Briefe geschrieben von weißen Agenten, und Verträge gemacht mit dem weißen Vater. So dumm bist du auch schon bald, sieht man.«
Der Alte stieß seine Tochter an, die junge krumme Mutter des Mädchens, »sag ihm mal, was er hier aufschreiben soll«.
»Dass wir sie in die Scheune treiben, und Steine vors Tor bis an den Hals, und dann lebendig verbrennen.« Sie kam um den Tisch an Schlosser ran, packte ihn mit ihren grauen Fäusten an beiden Ohren wie einen Sohn, sie war im Stehen vor ihm noch kleiner als er im Sitzen, »komm, Karo, bring ihm mal Schnaps, dann schreibt er nichts mehr und bleibt er bei uns, und morgen machen wir Feuerchen an, morgen ist Sonntag, den Wächter gleich mit, den Pastor, den kleinen, geputzten!«
Er fuhr noch nachts, mitten im Regen, dort weg. Das Mädchen, das besser die Wege kannte als er, kam am Dorfausgang stumm auf ihn zu. Es war so dunkel, dass man glauben konnte, er hätte sie nicht gesehen, so laut der Sturmregen in den Buchen gegen die elende Wut ihrer noch kindlichen Stimme.
*
Schlosser ließ den Kopf weit nach hinten sinken über die niedrige Lehne, über die leeren Hände, hing da mit offenem Mund, als könne er jetzt noch von irgendwoher Regenwasser auffangen. Aber saß schon viel früher gefangen. Neulich zuletzt doch schon auch, noch mitten unter Genossen.
Die andern hockten am Boden, den Rücken zur Wand, er selbst, als Leitungsmann, mittendrin auf dem einzigen Stuhl, den es gab, erst ein halbes Jahr war das her, in der Nacht nach dem zwölften Oktober, im Versteck am Kanal, Wasser fließt nützlich nur zwischen Mauern, wer hat was von Waffen gesagt, wir, wer seid ihr, so einer wie du, dann gelten für euch die Beschlüsse doch auch, wo macht ihr Beschlüsse, wer ihr, wer wir, wer wen, diese Frage als Riss durch all unsern Kampf, pass bloß auf.
Nämlich gleichzeitig in der Billstedter Jute Streik: gegen Spitzel und Waffen der Eigentümer im Firmengelände, gegen den Rausschmiss von Arbeiterposten, die diesen Dreck aufgedeckt hatten. Und die Posten, die sollen bleiben. Und sollen nicht wehrlos bleiben.
Die Leitung, vom Stadtkern her, hatte zur Unterstützung der streikenden Stadträndler aufgerufen. Ein Treffpunkt, halb nachts, war die Eilbektalhütte gewesen, drei Jungarbeiter im schwarzenFrühdunst der Wandseböschung*. Das Gebimmel von drüben Versöhnungskirche nützt aber niemandem mehr. Ein Polizist, der uns angreift, bleibt tot in der Nässe der Hecken. Die drei flüchten weg vor dem eigenen Schreck in den Schutz von Genossen. Aber »wo habt ihr das her, das ist Provokation, das stützt die Interessen des Gegners«.
Am schlimmsten für ihn, nach Schreck und Hecken und Dreck, war die Freude in ihren Gesichtern, dieser Schatten von Glück, »ihr seid doch nicht, was die oben gegen uns sagen und schreiben«.
»Doch, noch besser vielleicht, noch viel schlimmer am besten, sonst kommt unser Kampf ja nie durch!« Rigo hatte das langsam und finster runter zwischen die Knie gebrummt. Vom Stuhl her sah man nicht sein Gesicht.
»Rück die Walther raus, die muss weg aus der Stadt, mit Kurier, noch heute Nacht.«
»Die bleibt hier. Die ist gut. Die brauchen wir noch. Halt die Pfoten weg, Stuhlmann!«
Karl Ludwig Kasten nannten sie Rigo, zwei Zentner knochig groß, schon fünfundzwanzig in diesem Herbst, schon über drei Jahre arbeitslos, wer arbeiten will, der findet auch was, »ich hab was gefunden, das geb ich nicht her«, seine Boxcalfjacke hatte Gewicht, nicht nur vom Regen, mattschwarz innen links runter, die Waffe nah an der Haut. Sonst redete er nicht viel. Nur das Lachen vom Bullenbeißer, endgültig herrenlos.
Schlosser richtete sich streng auf, sagte, er sei jetzt bemüht, alles Fragliche möglichst klar richtigzustellen, sicherzustellen, kühl festzustellen. Die Jungen lachten ihn aus, »hier wird jetzt was locker gemacht, und fest steht bald nicht mal dein Küchensofa, lauf mal schnell hin, Mutti will ficken«, sie hörten ihm gar nicht mehr zu.
Aber eng, denn seine Trauer ließ er nicht zu, entschlossen, denn seine Fragen würden jetzt nur den Verfolgern nützen, und als ein Mann aus der Leitung, denn wer bist du selbst, sagte er ihnen dennoch all das, was sie als seine Genossen längst hätten nachlesen können: dass die Erschießung von Polizisten*nur freches Abenteurertum sei, nichts Verbindendes gäbe es da zur Gesamtpolitik der Partei, die vielmehr, in Einschätzung aller Faktoren, aufrufe zurproletarischen Einheit, Zusammenfassung der Kräfte von unten, im Kampf gegen Bourgeoisie, Agenten und Provokation, letztendlich also zu fordern sei Stärkstinitiative, Millionenfront, vorrangig Abwehrkampf Lohnraub, nach außen sie also zwar unauffällig, tatsächlich aber ganz klar nur Kämpfer zu sein hätten voll Selbstbeherrschung und Mut, eiserner Disziplin und Bescheidenheit, mühevoll in den Betrieben und Straßen die Kleinarbeit klug verrichtend, denn die Lage erfordere, schöpferisch neu, Taktik und Strategie, das Kräfteverhältnis im Auge, und in gleichzeitig unversöhnlicher Abrechnung mit den Sektierern das Bündnis der Fortschrittskräfte gewinnend, das Rundschreiben des Parteivorstandes, die Verhandlungen der Bezirksformation, die angeordneten Maßregeln, die Kongresskonferenzen von Delegierten der Einheitsausschüsse, die aktivsten Komiteemitglieder der antifaschistischen Front, die Delegierten und Delegationen des Reichseinheitsausschusses, deutlich mit Vorrang, den Auftaktakt für die antifaschistische Kampfwoche Rettet die Demokratie über Sichtbereich Arbeiterklasse hinaus, sich einzureihen, unablässig, mit Anträgen und Protesten. »Angesichts solcher Aufgabenfülle, Genossen, ist das Vorhandensein linker Strömungen gegen die Massenarbeit der Partei eine ernste Gefahr, das Entstehen von terroristischen Gruppen, die Praxis von Einzelterror, die Durchführung sinnloser Einzelaktionen unerträglich und falsch und überaus schädlich. Jede Duldung und etwa Verfechtung ist vollkommen unzulässig. Wer sich vom Feind das Verhalten diktieren, von seinerVerzweiflungsstimmungsich mitreißen lässt, ist des Namens eines Genossen unwürdig.« Er konnte die Schrift auf dem Handzettel kaum noch erkennen.
*
Er konnte im Rücken die festgeketteten Hände kaum noch bewegen. Es war dunkel. Er fand sich mit Rigo allein. Die anderen hatten das Zimmer verlassen.
»Komm, Schlosser, trink was, hast Durst.«
Er suchte noch immer die richtige Zahl.
»Das sind mehr, als du denkst.« Rigo bückte sich vorsichtig über den Stuhl, »willst das für alle fertig machen und leiten, aber wer sind die, was wollen wir selbst?«, rieb ihm die Haut an Gesicht und Hals, schlug mit den riesigen Händen den hängenden Kopf sanft hin und her, »was habt ihr vor denen Angst? Vielleicht sogar du vor dir selbst«.
Sie sahen sich an.
»Steh mal auf!«
Der Stuhl hing nun frei. Rigo versuchte, ihn zu zertreten. Aber »das hängt alles an dir dran. Mach das selbst!«. Das Holz brach über die Kanten, brach ihm beinah die Hand. Aber »das muss, weil bloß aus Leitung kriegst du nie richtigen Kampf. Aber aus richtigem Kampf kannst du jedes Mal auch mal die Leitung kriegen«.
Unten lag finster die Stadt, glatt und matt, aber auch Schweigen und Schrei. Er war nicht mehr überrascht von der Angst seiner Mörder, war aufgestanden, den Stuhl im Rücken an leeren Händen, das Gitter noch im Gesicht. Konnte aufstehen und Genossen erwarten, die er nicht kannte.
II
Pferdehaarschlingen und Stadtparkmond
»Mich fangen die nie!«
Aber wer war denn hinter ihr her?
Schon als sie acht war, der Ganter, der weiße.
Sie hatte fürs Gut die Gänse über die Stoppeln zu treiben, und seit sie nur immer sah, wie der Ganter die Gans plattdrückt und nie umgekehrt, schlug sie ihn heimlich mit Dornenstöcken, »das könnte doch auch mal andersrum, spritzt er nach oben, für Liebe geht alles«, ging aber alles nur platt ins Genick, von der Zuchtsau bis hin zur weißen Baronin, ächzend und schmatzend unter den Stößen der Herrschaft oder nur fein im Gebet, ihr war das schon damals der ganz gleiche Dreck, »bei mir wird gesungen, oder hau ab!« Die Dorfjungen lachten sie aus, fanden sich aber von ihr beschämt, wagten es nicht mit so einer, bloß »so war das doch gar nicht gemeint«. Karo fand alles verkehrt rum, macht aber nichts, »ich krieg euch schon noch«.
Schön runde Gegend rings um Zachun, Kiefern und Buchen mit Hallimasch und Milan, dicke Wolken im See mit Insel und Hecht und Boot, und im Boot ihr Großvater Jonny Wolf.
Als der achtzehn alt war und noch Hanne hieß, war sein Vater, Johann, schon Knecht beim Baron, aber kein Knecht, dem man trauen kann, wir alle schon, aber die nicht. Die hatten hier Baum und Fisch, Mädchen und Flinten und Recht, von jedem, eingekauft, Arm und Bein, deine Arbeit von nachts bis nachts, bis du endgültig kalt bist. Aber die beiden, Vater und Sohn, waren hier außerdem auch noch zu Haus, liebten nicht nur den runden Schwung unter Wolken und Feldbaum unten am Hang, sondern auch blankrunden Fisch, die runde Lunte vom Fuchs, das runde Stück Schwarzgeld für Zeug und Schnaps, den runden Mond überm blutigen Schnee, »holl wiss!«.
Aber Festhalten war dann nicht mehr. Die beiden Hände, die Arbeitshände, die Jagdhände für dein Recht, waren dem Vater abgefetzt worden mit einem einzigen Schuss, Baron Speckstößer hatte Ordnung gemacht. Hand Gottes gegen zwei Arbeiterhände, Unfall beim Unrechttun. Der verstümmelte Mann war noch weggelaufen, dann ausgelaufen, rund krumm gescharrt, im Schnee von Schlag Neun, dann eingeschaufelt vom Sohn, drei Tage danach, in Mustin, die Herrschaft mit Hutab und Spruch gleich dabei, gerechtigkeitshalber, die Würde des Menschen, fehlt bloß noch die Strecke blasen. Und bläst ihn auch richtig noch an, den Sohn, »nu Hanne, du sollst jetzt mein Jagdbursche werden, mit Hundefüttern und Waffenpflege. Du magst doch Waffen. Meine nicht auch?«
Hanne hat noch den Dreck an den Pfoten, den elenden Dreck vom elenden Grab, und knallt den der Herrschaft ans Fett, hakt hin und tritt nach, geht vorsichtig weg, kotzt hinter die Kirche und fährt in die States, mal sehn, alles Freiheit und Recht. Und offenes Land. Aber Land, das genauso Blut saufen muss wie noch überall hier, überall wessen Blut.
Selbst tief unten der Boden des Meeres. Es gab Luken nah über dem Wasser, und manche von denen, die für den Ausbruch nach drüben alles eingesetzt, alles verloren gegeben hatten für den Fluchtwinkel unter Deck, verloren dort unten in Pest und Dreck unter Flüchen ihr letztes, ihr liebes Leben, wurden rausgekippt, kalt, bei ruhiger See. Sackten ab in den schwarzen Grund, paar Stück Eisen in den vernähten Händen, Eisen für nichts, da hätten sie früher mal zupacken sollen, der Schiffseigentümer in Pöseldorf*hatte von solchen Eisenhänden nun nichts mehr zu fürchten, ihr todstarres Blut hielt ihm seins golden frisch.
Aber Gold war für Hanne nichts wert, nicht mal eigenes freies Land. Ihm war der Tod im Schnee von Schlag Neun allzu deutlich nahe gewesen. Er wollte nun niemanden töten, nicht dort in den roten Weiden und Wäldern. Er wollte nur in der offenen Sonne sein eigenes Leben haben, sonst nichts.
Nach einem Jahr Eisenbahnbau und Glück beim Würfeln und Trick hatte er seinen Wagen mit Pferden und Waffen und machte den rollenden Handelsmann für die Roten im Süden und Westen, Mangas, Eskiminzin und Captain Jack*. Ihn nannten sie Jonny, den leisen Freund. Und immer mal wieder konnte er Frieden stiften. Aber auch hier, die Stifte durch Hände und Herz, an Stiften blutest du aus, Frieden, auch hier, der hinstreckt bis nach Mustin. Das hatte er nicht gewollt.
Er musste das später in vielen Wintern seiner Enkelin Karo immer noch mal erzählen. Was er dort nicht gewollt, was er auch jetzt hier nicht wollte, war ihr die wichtigste Nachricht auch für sich selbst: dass sie für Frieden und Weiden und Lagerplätze die Waffen hingelegt, die Waffen jedes Mal zutraulich hingereicht hatten, sich selbst hingehalten und still gehalten als Friedensgeschenk an Herrschaft: Gib dich her, sonst bist du kein Freund. Die Weißen gaben nie her, manches unter Druck doch hier und da, aber niemals die Waffen, »das darfst du nie machen, mitten im Krieg«, mitten im Krieg von Zachun und Mustin bis an den Mimbres River.
Sie hatten Mangas, der dort zu Haus war und der, um über den Frieden zu reden, die Waffen hingelegt hatte, gefangen, mit glimmendem Holz gequält, ihn zu dritt erschossen, seinen Kopf gekocht für die Wissenschaft in New York. Und Eskiminzin, um Frieden zu kriegen für Maisbau und Mescal, hatten er und all seine Leute weggelegt, was sie noch hatten, hingereicht alles an Leutnant Whitman. Der tat ihnen nichts. Nur zwei Nächte später taten es andere Weißmänner mit ihrem Recht, ihrem Anspruch auf Land und Waffen. Und auch Captain Jack, der eigentlich Kintpuash hieß, den hängten sie auf in Fort Klamath, verraten von eigenen Leuten, die er in seiner Erschöpfung gebeten hatte, so wie die Weißen zu leben. Sie lebten wie sie, von Verrat, »viele wollen den weißen Frieden, Grund hast du immer, für jeden, dass er lieber nicht kämpft, aber pass auf, das ist schwarzer Grund, die sacken dich ein, da sackst du drin weg, bloß noch Dreckeisen in deine Hände genäht, das darfst du nie machen, Karo!«.
Und dann der Fischfängerstamm. Da hatte er an sich selbst denken müssen, an all seine Leute im Wald, am See, und wenn er nicht, denkt er entsetzt, alles hier draußen sofort verkauft und hinfährt, zurück, wo die schutzlos krumm unter wütigen Weißen leben, dann sind die bald, wie die Roten hier, in elenden Frieden gefickt, und nie wieder kommt einer hoch gegen Pack, gegen all dies schaumige, stickige Weiß, denn »wenn du nicht kämpfen willst, musst du bald angeln, guck doch mal Hafen und Alster, und ich hier, doch auch schon bald alles egal«, er sah Karo jammervoll an.
Scheinbar reumütig war er zurückgelaufen an Herrschaften, die er geschlagen hatte, die tückisch nachgiebig nun von ihm meinten, »so krank und missraten wird einer treu sein, der Schelm«. Sie dachten nicht, dass er sie täuscht, dass er noch gar nichts vergessen hat, von hier bis zum Mimbres River.
Der Stamm dort hatte sich auf seine leeren Hände gelegt, nur noch Messer und Schnaps und die Rente vom weißen Vater. So hatten sie nun viel Zeit für Geschicklichkeitsspiele, »fisch dir mal was mit Pferdehaarschlingen!«. Aber in Schlingen saßen sie selbst, Waffen der Weißen im Kreis von Hügel zu Hügel, Feierabend für Waffenträger, Treibjagd auf Rot, bei drei bist du tot. Männer und Kinder lagen bald stumm, Frauen nur erst mal verhöhnt, putz dich aus, zieh dich an, geh mit in die Stadt, da mach ich mit dir tausend Männer satt.
Das war der Vers, der Hohn doch auch von Mustin. Das hatte er nicht nur mal reden gehört. Das hatte Jonny auch nicht gelesen. Das war von ihm alles mit angesehen und erlitten. Da war er dabei, er selbst.
Aber wie denn erlitten, er war doch nicht rot.
Doch. Entweder oder. Rot oder Weiß. Da ist kein kluger friedlicher Platz zwischen Mündungsfeuer und Aufschlag.
*
Drum gab es für Jonny und seine Leute, seit er zurück war, hier heimlich Indianer und Weiße, für die Weißen das Schloss mit den Flinten, für die Roten Arbeit von nachts bis nachts, in Hitze und Schnee rund krumm gescharrt, friedlich von Schlag zu Schlag. Und schlägt sich oben gesund, die Pest, gegen Knechte und Bank und Handwerkerschulden, das Geld aus Arbeit ist leichter Dreck, aber Kuh und Weizen und Rübenacker hexen viel Gold ins Schloss, tricksen dem Gutsherrn die Schulden vom Hals, wer Sachwerte hat, hat bald immer mehr, und wer keine hat, nur noch sich selbst, dem hängt bald der rote Kopf, dem schlägt bald das Pack ins Genick.
»Und wer schlägt zurück?«
Karo war eben erst elf, Hirschschrei vom Bernstorffschen her übers Wasser, »in Hamburg sind sie jetzt gerade dabei, und wenn die Weißen aus Lübeck da Nachschub hinschicken, gehn bei Rahlstedt und Ahrensburg Schienen kaputt«, aber der Hamburger Aufstand war längst von der Leitung zurückgepfiffen.
*
»So will ich das gar nicht mal sagen.«
Rigo, Lehrling, Rumtreiber, wütender Rumtreiber, »ist hier nichts los?«, »hier soll jetzt mal endlich was los sein!«, zwei Billionen für zwei Kilo Brot, dann tausendmal lieber reichlich neun Gramm gegen die, die sich Zucker aus unserer Scheiße zaubern, Rigo hatte die Hamburger Kämpfe selbst mitgemacht, als Kurier zwischen Barmbek und Eppendorf, und so Spruch von Zurückpfeifen, Wut auf die Leitung, fiel ihm im Augenblick gar nicht so ein, »und guck auch mal, überall Orpo*und Panzer und Waffen bis an die Zähne, die Schweine, da kommst du bei Rückzug nie durch ohne Leitung, hat jeder doch Tipps gekriegt, wo er wegtauchen soll«, trotzdem, »da stimmt was nicht«, das fand er auch.
Er lief müde den Weg über Hinterhöfe, durch Stachelbeerbuden und Kellerküchen nach Winterhude zurück. Am Pfennigsbusch hatten sie ihn nicht gemocht, »musst du hier unbedingt Lieder brüllen?«, »wo hast du den Schirm deiner Mütze gelassen?«. Pfennigsbusch saß die Aufstandszentrale, den Mützenschirm hatte er abgerissen, sowieso viel lieber als Jungmaat nach Bali, wo was los ist, da sind auch Matrosen im Bild, »bloß wir spielen hier keine Oper, Genosse, los, ab, die Meldung muss durch!«. Rigo war nie in der Oper gewesen, will er auch gar nicht, was soll das, aber das wär ihm schon recht, alles Lieder und Pauke und Wimmerholz, wenn von Übertier Danner die Panzer ausbrennen und Orpos wegrennen.
Bloß am Pfennigsbusch kam so was leider nicht an, alles Ausgelernte, wie Vorarbeiter, gar nicht mal schlecht, und muss vielleicht auch, bloß irgendwas stimmte da nicht, »das läuft nämlich nicht auf kariertem Papier«, »für richtigen Kampf hast du nie Formulare«, sieht aber manchmal so aus. Er war mit sich nicht zufrieden. Er wollte es richtig machen, aber nicht grade sitzen. Er wollte sich freuen und war allein.
*
Rigo wollte mal Lehrer werden, bloß zu Haus alles immer schon ziemlich am Ende, Ewerführer und Näherin, beide besoffen, drei Kinder. Rigo war nachts oft allein mit den Kleinen, schrein alle rum und scheißen sich voll und kein Licht in der Wohnung, bloß Stadtparkmond, alles Angst und Wut und alles allein und die Treppen hoch Faustschläge von dem Vater, der rumlallt und in die Spüle pisst und gleich noch, wo er den Jammer zur Hand hat, die Mutter über den Küchentisch zieht, und Rigo kommt knapp noch mal hoch, neun Jahre alt, und schreit und weint und trampelt die beiden und steht dann starr: Das Schwein, beim Ficken, weint auch. »Alles immer so dreckig bei uns.« Er roch gern die Wäschehäuser.
Das war damals hier die Gegend, Himmelstraße bis Feldweg und Ulmen, alles noch reichlich die Bleicherwiesen, lauter Wäsche weiß und duftig gerackert für Herrschaften vom Rothenbaum, Waschweiber, Plättmädchen, Kutscher und Pferde, zu Haus war im Winter der Ofen meist kalt, da kroch er mit anderen Kindern ins Stroh, schön warm bei den Tieren, schön brummig still. »Los, Angriff!«, »Volltreffer!«, Schlacht bei Verdun, »zieh die Hose ruhig aus, ich bin Rotes Kreuz«, der Krieg war so weit ganz gemütlich gewesen, bloß dann.
Der Vater kam zwei Jahre vor Kriegsschluss zurück, Steckschuss im Knie, wird er Hilfspolizist, bis er im Suff seinen Säbel verliert, verliert er die Arbeit gleich auch, säuft sich aber noch immer nicht tot. Rigo hilft seiner Mutter, elf Jahre alt, beim Saubermachen Lichtspiele Roxy und Alsterdorf, morgens noch vor der Schule von sechs bis acht, und hinterher gleich noch bis Abendbrot, und nachts noch eben paar Filmrollen pendeln, Friedrichsberg-Alsterdorf. Harry Piel / sitzt am Nil / wäscht den Stiel / in Persil / seine Frau sitzt auch dabei / und schaukelt ihm das rechte Ei / – zweimal die Tour, Geld für ein halbes Brot.
Aber Schule klappt immer noch, Auswahlklasse, wenn ich Lehrer bin, bin ich hier raus, »alles Quatsch, du wirst Bäcker, halts Maul!« Der Lehrer kommt immerhin einmal vorbei und bittet die Eltern um Einsicht, »na, dann guck da mal rein!«, das Portemonnaie knallt auf den Küchentisch, der Kanari schreit golden durchs Gitter, der Lehrer ist machtlos, Rigo rennt raus, »für Saufen ist Geld da, bloß nie für Lernen«.
Aus der Backstube rennt er zum Pfennigsbusch, »hier soll jetzt mal endlich was los sein!«, aber irgendwas stimmte da nicht: Die Gewehre, die sie nach Plan und Karree von der Orpo sich rausgekämpft hatten, hingen zwar flott wie Taubenflinten, Mündung nach unten, den Genossen am Arsch, aber Rigo sah, dass die Schlösser fehlten, was soll das. Er fand die Genossen schwach, zu laut, auch sich selbst, wie in alles nur Masken, war nicht mit ihnen zufrieden, wollte es richtiger machen, ging zum Bäcker nicht mehr zurück, auch nicht zum Vater, wohl noch zur Mutter. Die nähte ihm wütend reißfeste Sackleinentaschen ins Futter und stieß ihm darein, fein sauber umstochen, das Loch für den Lauf, »da muss doch noch irgendwas kommen«, er nahm jede Arbeit, quer durch die Stadt.
Am Tag, als er zwanzig Jahre alt war, stahl er Dammtor ein Fahrrad, hat lange gebraucht, bis das geht, und tritt ab in die Gegend, irgendwohin, Mecklenburg soll ja ganz schön sein.
In Mustin traf er Jonny und Karo beim Bier, aber kannte die beiden noch nicht. Karo war jetzt knapp fünfzehn. Wenn sie lacht, sind die Augen klein weggekniffen hinter die blanken Backen. Alles schön braun und rot im Gesicht, wütend und leicht, mitten im Winter. Weiberkram, kennt man schon, weg hier.
*
Die beiden liefen in Kutschermänteln durch Dämmerschnee ohne Weg, quer durch stäubenden Wald, brechendes Feldeis in Ackersenken, beide schwarz zueinander gedrängt, beide gleich groß, schon rechts die paar Lichter von Butz, schon halbwegs zu Haus in den Häuslerbuden, Januarsonntag für Knechte, Ausflug zu Fuß krumm durch Holz und Frost für paar Gräber und Bier und Gedanken, »halt noch mal an, Jonny, hör noch mal zu«, »die lassen dich nie«, »aber du doch«, »nur alles dein Recht mit Gewalt, jedes Stück«. Karo half ihm sachte durch Dornenäste im Knick*, »Sonntag, wenn er aus Mölln hier zur Treibjagd rumläuft«, Krähen flogen den beiden nach über all diesen Schnee, »mit Pferdehaarschlingen«, flüsterte sie und bückte sich unter die Mütze vom Alten und fuhr ihm mit einer Hand voll Haar rasch zart über Mund und Kinn.
Als sie den Schnee von den Stiefeln traten, saß drinnen hinter dem niedrigen Fenster, am Herd, schon Krischan, der Dichter, Kaffee und Kuchen, Butterkuchen von Hanneken, von Jonnys Tochter, Karos krummkleiner Mutter, die war eben erst über die dreißig weg, schon was abgenutzt, hingerutscht, runtergestoßen, aber noch überall flink dabei, verschwiegen und hart, so ein rollendes Steinchen, »kommt, sonst frisst er euch alles weg«, der Kuchen stand warm auf dem Tisch, alles war gut, »und wird alles noch viel besser!«.
*
Nicht nur bei Kuchen und Karo schien Krischan Pietsch zuversichtlich. Wo er hinkam, da kam er aufs Erste gut an, zutraulich hilfsbereit, lustig und leidenschaftlich geduldig, aber auch plötzlich klar und kalt gegen Herrschaft, als sei er, er selbst schon, verfolgt. Nur erst wer ihn sehr gut kannte, fand Anhaltspunkte für Täuschung, für schwächliche, schwärzliche Furcht hinter all diesen Möglichkeiten.
War aber gar kein Dichter, sondern Lehrer für Hamburger Arbeiterabiturienten, und nur in den Ferien manchmal oder an Wochenenden, wenn er was durchzustudieren, vorzubereiten, auszuarbeiten hatte, kam er hier raus nach Zachun, mit dem Rad, ins Dachbalkenzimmer im Schloss, in die Stille, in der du das Blutbuchenblatt aufs Dach fallen hörst, das Bellen der Füchse in deinem Traum, den schneidenden Flug der Stockentenpaare, das Knacken und Biegen im Kirschgartenholz der weißen Baronin. Und hörst bei den Häuslern die Arbeit, den Mut, den Hass.
»Wenn ich Karo seh, fühl ich mich sichrer als sonst.«
»Warum wohnst du dann bei den Weißen und liest ihnen auch noch vor?«
Er kannte den Waldrandbaron, den Herrn Alexander, noch aus Gelehrtenschulzeiten in Ratzeburg, acht Klassen Unterschied zwischen den beiden, aber der Knirps Krischan Pietsch hat für die Großen damals in einem der Ruderbootrennen den Schreihals gemacht im Heck, den Antreiber, der den Kampfrhythmus schlägt, und hatte mit ihnen gewonnen, auch diesen Platz hier im Schloss, als Sohn eines Möllner Schusters.
Inzwischen verband die Weißen mit ihm nicht Freundschaft, aber Gewohnheit, und aus der Gewohnheit nun fast schon die Pflicht, dass er im Winter, am liebsten an Abenden nach einer Hatz, im Jagdzimmer, sesseltief unter Trophäen, unter Auerhahn, Kaiserhirsch, Schnepfenbein, der Herrschaft und ihren Gästen ein Stück aus Fritz Reuter vorlas, die Bitterkeit all dieser Leiden und Kämpfe auf Platt vor den Kachelofen geröhrt, in Zipfel und Schmiss geweint, in weiße Hände den Witz gemolken, den Fluch, die Frömmigkeit eines Mannes, den sie, das konnte er wissen, das brachte er seinen Stadtschülern bei, auch heute, noch rasch zum Tode verurteilen würden, käme er selbst jetzt mit seinen Freunden, mit seiner Hoffnung vors Haus. Sie übten ja, während sie lachten und lobten, hier längst schon im Feld wieder seinen Tod. »Wie liest er doch aber begabt!«, »wohl selber ein Roter!«, haha.
Krischan gab unbefangen das Lachen der Täter zurück, als sei hier niemand bedroht.
Karo glaubte ihm nicht, dass er sie alle nur auslacht, »machst dir nur deinen besten Weg«. Sie wartete seine Antwort nicht ab. Sie wusste, er sagt so viel, alles so gut studiert und weithin, und alles mit leeren Händen, und die Hände mochte sie gern. Sie hatte draußen den Entenhund klagen gehört und lief noch einmal zurück in den schwarzen Schnee.
*
An manchen tristen Winterjagdtagen, das wusste Karo recht gut, fuhr der Herr Alex gern heimlich fast, ganz für sich selbst, bei Herdkerzenlicht, mit der Hand, der Ringhand, ins tote Gefieder, ins warme, eben noch todweichwarme Brustfederdickicht der Frostgans unten vom Eislochrand, Lockentenschrotschuss abseits der Fährkatenböschung.
Sie lief ums Schloss, blies ein Loch in das Eis vom Küchenfenster und lachte ihn an. Im Kerzenlicht sah er krank und gemein aus, das machte ihr Mut. Er öffnete mit seinen blutig gefederten Händen die Tür für Eimer und Kannen, ließ sie wortlos ein, liebevoll über sie niedergebückt wie über ein Tier, das am Türholz gekratzt hat. »Mein Hundchen«, hatte er früher zu ihr gesagt, zärtlich mit seiner Peitsche gegen den Hass seines Kindes, daher der Name Karo.
Hanneken hatte sie damals in Trauer und Spott, Freude und Angst und Schmerzen heimlich so eintragen lassen und taufen, wie sonst hier nur Schlossweiber heißen, Melanie Caroline. Sie hatte schon damals dem jungen Herrn nicht sonderlich angehangen, wie sonst in all den Kalendergeschichten und Kirchenheftchen für Knechte, nur ihm gedient, nicht ohne Neugier, fünfzehn erst alt. Und dann dick und versteckt und verstockt, »das Kindchen, das zieh ich hier auf, und das nenn ich, dass jeder Bescheid weiß, weil das ist meins, und nicht zum Vergessen und Untertauchen«.
Aber Taufschein und Standesamt, alles Dreck, wie die Herrschaft dich jeden Tag arbeiten ruft, das bleibt. Bis du ihr in die Hände beißt, auch wenn sie dich streichelt und lockt.
Der verbotene Vater von Karo, der Waldrandbaron, war, als er sich ängstlich seinem Kind nähern wollte, noch auf der Uni in Kiel, Landwirtschaft und Gedichte, schrieb selber auch welche, in Angst, von Zungentieren in buschigen Höhlen, die ihn lauernd liebten und lechzend an seinen Traumwegen hockten, und kroch ihm das alles zierlich in Eisen und Fallen, die baut er sich nachts, wie tags er sich nach ihnen träumt.
Karo erkannte erst nach und nach seinen verspielten Schreck, merkte erst, als er sie schluchzend schlug, dass sie sein Traumtierchen werden sollte.
Er war damals bleich aus dem Krieg zu Besuch, kein Mensch für ihn mehr irgendwo, der nicht blutet und birst und würgt und schreit und zerreißt, keine Stille, auch hier nicht im Kraut am See, die ihn nicht schlägt und verhöhnt. Da klammert er sich an das Kind, das lauert, denkt er, und hockt und lockt, aber beißt ihm in seine Ringhand und flieht, und er trifft es mit einem Stein, dicht überm Fuß, der bricht.
Sie hatte nie einem Menschen gesagt, wer das war. Sie weiß selber nicht, was das soll. Weiß aber, wie er jetzt an ihr hängt. Sie auch an ihm. Paar Steine am Hals.
Seit ihr der Vater den Fersenknochen zerschlagen hatte, war ihr das Bein kaum merklich verkürzt. Sie hatte das winzige Hinken aber verändert zu einer frechen Bewegung des ganzen Körpers, vor allem der Schultern. Sie kam den Weg, auf Leute zu, gegen Schreck oder Schnee oder Dreck, wie der, der aus Neugierde Lust hat und losläuft, zwei Fäuste in seinen Taschen, aber was hat er da drin.
Die Mutter des Herrn, die alte Weiße oben im Schloss, sah das genauer als einstweilen Karo selbst, »die ist von Schlag Neun, nichtvon dir, red dir das Tierchen mal aus«, kannte aber das Tierchen nicht in ihm selbst, den Uferstein gegen sein Kind. Er sann nur schweigsam weiter auf Fallen, auf Prügel- und Quetsch- und Würgefallen, auf Steckdohnen, Dachshauben, Habichtskörbe, Otterneisen und Marderschläger, und Karo lernte bei ihm, wie man das über geebneten Weg, Schleppspur und giftigen Brocken anlockt und dann vernichtet, wer wen, das würde man später noch sehn, zum Beispiel mit Pferdehaarschlingen.
»Wenn ihr am Sonntag treiben lasst, geh ich mit dem.«
»Was willst du im Schnee?«
»So wie du.«
Sie hob die Flinte aus Federn vom Küchentisch auf, »die ist schön«. Der riesige Schatten der Waffe fiel flackernd über die Wand, »draußen der Park ist hell vom Schnee und vom Mond«.
Er hatte ihr heimlich in letzter Zeit beigebracht, wie mans macht, hochreißen, Anschlag, Ziel auffassen und Schuss, heimlich aus seiner Angst. Es stieß ihn inwendig an, wie ihr Körper sich an der Waffe streckt und hinwendet in sein Ziel.
Sie traten vors Haus auf das stille Stück Rasenrund vor dem Portal. Er warf über sie durch weißes Licht ein Stück blinkendes Blech. Karos Schuss ließ nur Fetzen davon im Schnee.
»Ich will nicht, dass du das tust«, sagte er mürrisch, plötzlich ganzhilflosermüdet.
»Aber als Treiber für Schmüser?«
»Bist jetzt kein Kind mehr.«
Sie warf ihm die Waffe zurück, »sondern was?«, und lief weg.
Er kroch gebückt ins Herdkerzenlicht an den Küchentisch, sah bekümmert die feinen Muster, die er, bevor ihn Karo durchs Eisfenster angelacht, aufs Tischholz gebreitet hatte, Ordnungsmuster aus rausgerissenen Federn und Augen und Kugeldottern vom Eierstock einer niedergeschossenen Gans. Auch ohne im Mondschnee Karos Lachen gesehen zu haben, schien er sich selbst jetzt uralt. Er würde sich endlich wehren müssen. Sie alle hier draußen in weißen Häusern würden sich wehren müssen, niedertreten das lachende Pack, das blöde, furchtbare Volk.
*
Die acht Jahre Dorfschule Dargow hatte Karo ohne Schwierigkeiten hinter sich gebracht, zu Haus gabs keine Angst vor dem Lehrer, waren Knechtsnachbarn rechts und links ihr vertraut, hatten Jonny im Boot und Hanneken bei ihren drei schwarzen Hühnern Neugier für sie und ehrliche Frechheit und lauter Geschichten von weißem Pack, das dir Stillhalten beiprügeln will und nie soll, und jeden Tag schwere Arbeit für alle, und meistens satt zu essen. Was soll dir die Schule da Kummer machen, der Lehrer mit seiner Holzhand von siebzig war ja auch schon bald mehr so Indianer wie sonst hier die meisten, guck ihn mal an, wie er krummpuckeln geht, wenn der Pastor reinkommt wegen hauptvollblut und wasistdas*.
Für den Lehrer war Jonny, als Karo neun Jahre alt war, sonntags sogar mal nach Dargow gestiefelt, Indianergeschichten kann keiner verbieten, »Kämpfe weit weg ist egal«, »erzähl mal, Alterchen, dass sie was lernen«, Adventsstunde andersrum: Wie die Roten in Utah sich heimlich ihr Kind geholt haben, zurückgeklaut aus den Hütten der Weißen. Die Mutter des Kindes war mit den Roten geritten, »gib dich her« bei den Weißen wollte sie nicht, die Weißen spuckten den Namen der Frau nur noch aus. Aber ihr Kind, das sie Halbblut nannten, fingen sie weg an der Biegung des Flusses, hielten es bei sich als Knecht, ein Mädchen, neun Jahre alt. Aber das brachte den Herren kein Glück, nur Abstechen und Verbrennen, bis das Kind wieder in den Zelten war, bei seiner lachenden Mutter.
Karo hing dieser wilden Geschichte damals oft träumerisch nach, plötzlich auch ungeduldig, mit stockendem Atem, hockend, nachts, der Überfall ihrer Leute aufs Schloss, für sie selbst, für das Kind bei den Weißen. Aber wann, aber wer.
Krischan Pietsch hatte freundlich gelacht, hatte sie damals noch auf seinem Schoß, hatte geredet, ihr zugeredet, ihr alles das wohlwissend zugeredet, alles studiert und weithin, ein Herumtreiber mit einem Käfigvogel, den er durch Stäbe nur immer sticht und den Leuten weithin erklärt, das las er ihr später mal aus einem alten Buch vor, das merkte sie sich gegen ihn, ohne es ihm zu sagen.
Ihr war alles mehr und mehr wortlos eng, wo sie sich selbst denken wollte. So wie Hanneken wollte sie nicht. So wie Jonny, den wütenden Traum vom einsamen Boot her gegen die Böschung geschleudert, die wütende Rede, den heimlichen Plan von Mann zu Mann, von Gutshof zu Gutshof, das sollte sie nicht, »das sind Männergeschichten«. Und wie die übrigen Gutsknechtemädchen, Hühnerhof, Nähstube, Plättmarie, Hausputzen, Milchmelken, Knechtekuss, ächzend und schmatzend unter den Stößen der Herrschaft oder nur platt im Gebet, ihr war das nur immer der gleiche Dreck, nichts frei, nichts du selbst, nichts gelernt und verstanden und vorwärts mit all unseren Händen.
Wenn aber nicht hier bei den eigenen Roten, wo denn dann sonst? »Allein bist du nur für die jedes Mal nichts.« Aber da sind doch noch irgendwo mehr so wie wir, und allein ist manchmal nur eben zuerst dein eigener nächster Schritt.
In diesen Zwangswochen nach ihrer Schulzeit, im Herrschaftshaus Kirschholzvitrinen abstauben, kam ihr der stoßende Gang, die rechte Schulter voran, gegen wen, gegen alle, »dich auch«, »das siehst du zu einfach«, »was fasst du den Dreck auch noch an!«. Krischan Pietsch hatte, zwischen Dachbalkenzimmerkampfestexten, sich vergnügt an das weiße Spinett gesetzt, »und wird alles noch viel besser!«.
Sie wollte hier weg, wollte von ihm nichts geredet, kein Gitterstechen und alles erklären. »Was hinkst du denn, bleib mal stehn!«.
Er als erster von allen hatte entdeckt, was sie selber nur bockig bisher übersprungen hatte. Sie sagte ihm nichts von den Ufersteinen, aber er war auch praktisch, wo es ihm eben so einfiel. Er nahm sie nach Mölln mit zum Schustervater, »das wird dir ein Schuhchen, dem keiner was ansieht«, und maß und baute und flickte und schnitt. Und den stoßenden frechen Schritt, den gab sie auch für den Zauberschuh nicht mehr her.
Sie hatten in Mölln viel Zeit, Jonny war noch nicht ganz vollgesoffen, er wollte nicht eher zur Herrschaft zurück, »dann komm, dann zeig ich dir was«. Krischan zog sie durch Fachwerkgassen bis zu Theophil Schmüsers Mühlgrabenwerkstatt, Waffenwerkstatt, verkauft und verraten, »da baut er ihnen das letzte Gefecht, der mag mich, der redet, der ist oft allein«, er hatte das lustig gemeint. Er wollte, dass Karo sieht, wie das Pack sich in Rüstung verkriecht, »so viel Angst vor den Kräften des Volkes«.
Bei Schmüser roch es nach schwarzem Stahl, nach süßem Öl, nach fein gemessener Arbeit, nach jeden Tag Kohl und kranken Pantoffelfüßen. Er bat sie, ihm nichts zu berühren, die Schalldämpfer, heimlich, und Zünduhrwerke, die Sprengsätze und Visierperfektionen, Spezialmunition »und Angst, nun sieh dir das alles mal an!«.
Karo besah sich sorgfältig Waffen und Werkzeug, und ernst und ganz wortlos den bösen Mann, sein faltiges Bäckergesichtchen, von unten her sacht den hohlen Blick an ihr auf und ab, diesen Mündungsblick ohne Blitz, dieses leere Auge vom kleinen Freund ihrer Feinde, diesen einsamen Feind. Es rührte sie alles das sehr. Sie fand sich zwischen den Männern plötzlich allein.
»Allein kann ich bald nicht mehr gegen an, drei Lehrjungs weg in zwei Jahren, die holn sich bei mir ne Mauser, und ab, da mag man schon bald gar nicht mehr.«
Sie merkte sich diesen Platz, die stahlgrauen Pfoten, den Blick. Noch zweimal danach sah sie ihm stumm bei seiner Arbeit zu. Die feinen Flächen und Schenkel und Bolzen des Tötens. Dann kam sie noch einmal, nur rasch, in Jonnys waldgrünem Hemd. Sonst alles schwarz, die Stiefel, der Rock, das Tuch. Aber die ganz weiße Haut unterm Hals unterm Hemd. Da wollte Schmüser gern hin.
*
Der Möllner Büchsenschmied Theophil Schmüser, ein fähiger faltiger halbjunger Mann, dumpf klug allein für sich selbst und von rattenhafter Zutunlichkeit gegen Herrschaften, die bei ihm arbeiten ließen, kam am Sonntag darauf, bei klirrendem rosa Frühlicht, und später durch schneidenden Glast, im Schlitten quer übers rundglatt geschneite Land, den Fahrweg her nach Zachun. Er hatte die kleine Nachricht bei sich im Pelz, auch einen zweiten Pelz hinter sich für die Rückfahrt heut nacht. Aber Karo ließ sich nicht blicken. Vor einer Wehe oben im Feld überm Herrschaftsdorf hielt er das Pferd zurück, nahm das Glas, suchte nach ihr in Waldrandhecken, den Dorfweg hinauf bis hierher, die Krümmung des Weges in Grubenschatten. Karo sah ihn sich an, den Schimmer auf seiner schwitzigen Haut, den Dampf von der Kruppe des Pferdes vor seinen Augen, den mutlosen Eifer, mit dem er das Tier um die Schneewehe trieb, hinab in den Herrenhauspark.
Sie sah ihm aus Grubenschatten angespannt nach, sah ihn jetzt auch mit Hass, aber ein winziger Ganter, den werf ich mir um, vorwärts, hier raus, weg aus Zachun. Und dann nicht mehr nur mit Pferdehaarschlingen.
*
Die Strecke war gut, das Treibevolk lag auf den leeren Händen und trank seinen Schnaps.
Die Jäger kamen aus Rotwildrevieren, Mansfeld und Barmbek und Castrop-Rauxel, Ruhe und Ordnung, Verständigung flüsternd, pausenlos, knapp gegen Treiberohren, aber sesseltief brüllend noch nachts, noch unter Trophäen, principiis obsta, die Weihnachtsgeschichten aus Bluthundehochzeitstänzen, haha, Krischans Lesekunst ist im Moment nicht gefragt, Karo bringt Wein und Zigarren, »ein glatt freches Hündchen, das spröde Ding«, ein Weißer, ein junger, der Leutnant Ratjen, fährt ihr mit Schlägerhand hinters Haar an den Hals, an die weiße Haut unterm Hals unterm Hemd, der Büchsenschmied fragt, »was wird mal aus dir?«, »ein Büchsenschmied«, lacht sie ihn an, »wie das?«.
Sie röhrten das einfach nur lustig weg, schickten sie raus, »du kannst gehn, gute Nacht«, Schmüser fand sich ertappt.
Sie redeten aber nicht lange mehr gegen ihn hin, zu verrückt war das Schwätzen von so einem Kind, obs in Mölln nicht auch Mannschaften gäbe. Er dächte wohl doch, aus Schützengilde und Feuerwehrhaus, und manchen demnächst auch aus Handwerkergassen und Stadtrandbetrieben, »so recht!«.
Die Jäger sprachen die Auswahl der künftigen Übungstruppen nun sorgfältig ab, auch das Lehrstundenpensum Häuserkampf, Raps und rote Fabrik, das Totschlägertraining im Herbst hier im Feld, Treibjagd auf Rot, bei drei bist du tot, »na mal sehn erst mal«, würde jetzt Pudel sagen, das Aas weiß mit hängenden Waldrandbaronen schon jetzt verdammt gut Bescheid, erstes Lehrjahr am Hansaplatz.
Auch Herr Alex hing diesen Tag still. Wohl war er, selbst als der Jagdherr noch, auf den stärksten Keiler zum Schuss gekommen,aber das Tier war ihm flüchtig geworden, und als er, die Treiber am Nachsuchen hindernd, er wollte für diesmal allein durch den Schnee, auch erhielt er von seiner Mutter den Rat, »viel Wild geht frech in die Töpfe der Treiber, pass auf!«, in der Dickung, im Eichhorst, südlich von Butz, in der Dämmrung endlich den Keiler fand, rund krumm gescharrt unter Fichtengrün, weidwund, schon kalt fast, in braunem Blut, lag unter schlingendem schwarzen Haar, gelb hingelehnt über das pestige Tier, der Büchsenschmied Theophil Schmüser, und über ihm Karo, stoßend und stumm. Sie merkten ihn nicht. Er wich weg. Sie schienen ihm ganz erstickt. Nun würgte er abendlang selbst, »wie Dreck sich auf Dreck stürzt im Dreck«. Der Uferstein, fand er, war ihm von ihr nuntrefflichzurückgeworfen, er wollte nichts weiter mehr reden, nichts, wollte sie hier aber nicht länger sehen, »nie wieder«, ein Vorteil für Karo.
Die hatte nun noch mit Jonny zu kämpfen, und Hanneken riss ihr in Angst an den Haaren, und die Weiße oben im Schloss, die Sau, schickte hastig die hübschesten Knechte nach ihr, »macht her, dass sie bleibt, wer lernen will, wird uns nicht arbeiten wollen, was hätt ich sie mir denn sonst aufgezogen fürs Haus«. Da sagte dann aber Hanneken später weinend und kalt, »das war ich, die dich aufgezogen hat, für dich selbst, und nicht zum Vergessen, geh weg hier, und komm, nein, nichts«.
Auch Jonny fand seine Hoffnung vertan, all seinen fernen Hass, »Weglaufen war bei mir auch, zusammen sind wir hier stärker als die«, »und für was? Du fluchst doch nur rum und heulst und säufst und wühlst dich hier elend durch. Da sind doch noch irgendwo mehr so wie ich, da muss doch noch irgendwas kommen, hier soll jetzt mal endlich was los sein, Jonny, und sonntags komm ich doch her, der alte Pietsch leiht mir bestimmt auch sein Rad«, sie meinte den Vater von Krischan.
Krischan fand den Plan gut, war zwar erstaunt über Schmüsers Mut, »was sagen in Mölln denn die Meisterkollegen, die Innungsschützen und Bierglasstrategen zu einem Lehrling in Tuch und Rock?«, wusste ja nichts von Theophils Wundbettgeflüster, »so tust du mir gut, so will ich dich alles das lehren«, und setzte sich zu seinem Schustervater, damit das nach Sitte und Ordnung läuft, »gib ihr mein Zimmer, und nimm ihr kein Geld ab, sie hat keins, sie will erst voran«, das mochte der Alte, das wusste der Sohn, gern hören, er war so einer mit Wissen ist Macht, »na dann los«.
Karo fuhr frühabends mit, auf dem Gummiwagen hinten mit drauf zwischen Milchkannenklappern und Buttergeruch, und unten, hinter den baumelnden Beinen, zwischen biegenden Achsen paar Holzgitterkästen für Hähnchen und Hühner, die Böschung hoch raus übers Feld Richtung Mölln, Richtung Schmüser und Waffen von Schmüser, die Saaten weit grün, die Drossel so schön in den Vogelbeerbäumen, das Dorf unten weit schon von Osten her in finsteren stillen Schatten.
Hanneken hatte mit Töpfen geschoben, dass gar keiner hört, was gar keiner sagt, und mit Kiefernastholz das Feuer gejagt, und alles lebendig verbrennen, »nein, nichts«, und kleines Stück letztes Geld.
Jonny hatte ihr Eisen ins Pappkofferzeug geschoben, aber anders Eisen als sonst nur in deine Hände genäht, »das darfst du nie machen, Karo«, den Mountainsrevolver, sechs mal neun Gramm, »sieh zu, was du lernst, der muss wieder flott«.
Die Gänse hatten geschrien.
Die Nachbarn hatten gewunken.
Aber die Mädchen, die Häuslermädchen, in Karos Alter die Mädchen unten im Dorf, die stummen Mädchen hinter den winzigen Fenstern, unter den Eutern und Fäusten und Müttern und Kirschbaumholztüchern und Tränen, Karo sah nur die Mädchen.
Kroch aber dann über Kannen und Säcke zum Kutscher und freute sich über die klaren Farben der untergehenden Sonne.
Blinzeln
Im gleichen schönen Möllner Jahr war Leo noch Aufbauschüler, flink leise lachend, am liebsten allein, durch sämtliche Gitter geschlängelt, Untersekunda, mit totem Bruder in Kiel, noch Rentiersteinsammler, Kolonialjugendpfeifer*, noch nicht Schupofips Leo, der Minilöwe, die Sonne steht hinter der Mauer, er will bald mal Afrikaforscher werden, raus hier, weit weg, und alles entdecken, und zeichnete gern, und lernte und saß oft ganz still, und sah sich alles ganz genau an, auch die Lastenschlepper aus Mörtel und Gips in der Hauswand unterm Balkon, Stein im Genick, wie nennt man die Dinger, Atlanten, Pilaster, Karyatiden, wie schreibt man das, schreib ich mir auf.
Der eine der beiden halbnackten Träger sah aus wie sein Vater, alles mit Bart, und auch nachgedacht über alles, aber gebückt und stumm, aber auch stolz und zärtlich und heimlich den Blick weit voraus, vielleicht nur zu weit voraus. Der steinerne Blick war tief niedergeschlagen. Das wollte er nicht. Auf Leos Zeichnung blinzelten sich die Balkonträger wohlwissend zu.
Leo Kantfisch war jüngster Sohn eines alten Vaters. Sein älterer Bruder wär jetzt schon siebenunddreißig, hatten den aber im Krieg in Kiel*als Meuterwilli ins Schraubenwasser gestoßen, Schießeisenin seinen Händen. Ella, die Witwe, mit Rita, der kleinen, hatte Weidenallee die Hausmeisterstelle behalten dürfen, Treppenschrubben für Zahnarztkinder, Rente für Kämpfer hast du noch nie. Leo war also mit sechzehn der Onkel von Rita mit acht und der Schülersohn von Opa Friedrich, jetzt schon bald sechzig alt, und freundlich alles und ohne viel Klagen durchgeschuftet die Zeit, und niemals und nirgends ein Schuft gewesen, Buchbinderei gleich am Markt, nie was Eigenes, bloß für den Chef, »dat geit nirgens bunter to as up de Welt«, von der kannte er hauptsächlich Winterhude und paar Plätze bis Hauptbahnhof, und viel Buntes war auch nicht gewesen.
Die Wohnung der drei hatte Schlafzimmer, Küche und Stube, die war aber nur für gut, für Besuch und Geburtstag und damals, wenn Willi sich einig war, und Ella schon ganz hübsch dick, mit Juchei und Aurora. Im Schlafzimmer hing das Brett mit den Büchern, wo Leo sich zwischen reinklemmt und liest, und aufschreibt und abschreibt und lernt und weint und hofft, weil die Schule, das ist was für später.
Am liebsten war ihm die Küche, Eimer mit Kohlen, Küchenschrank, Sofa und Herd, blauweiße Kacheln mit Gänsemarsch bis an die nächste Wand, und Foto von Bebel und Meuterwilli, Schirm ab und Fäuste noch leer, und der Trondheimfjord finster in Öl, und die Mutter schön immer dazwischen rum, »das hat sich gut angefühlt«, bloß wenn er alles mit links malt und schreibt, wird sie fühnsch, »fang das ordentlich an, oder lass!«.
Auch Ordnung mit Feierklimbim, wenn der Vater Glück hat mit seinen Uhren. Opa Friedrich war heimlich Uhrmachermeister, nie gelernt, aber kennt jedes Rad, jeden Schlag. Neun Uhren hat er in zwei Zimmern, Küche und Flur stehen und hängen und sitzen und laufen, alle mit Glockenschlag und Sekunde, eine mit uraltem Kuckuck. Und jede bastelt er rum und tüftelt er hin und fummelt er aus und pendelt er ein, damit alles immer genau so genau geht, wie er das will, wie er das für seine Meisterschaft braucht.
Von Hochbahn Hudtwalckerstraße bringt er abends die Zeit in der Tasche mit, auf Zeigerruck, knack, alles eingestellt und dann los, von Zimmer zu Zimmer zu Flur zu Küche, bis der Gong schon scheppert und Kuckuck schon meckert von allzu viel Wiederholung und Übung. Und die Bitterkeit dann plötzlich nachts, wenn der blöde Hahn dreimal kräht, und die Ziehuhr im Flur hat noch nicht mal kurz Luft geholt, »das muss alles zusammen in Harmonie!«, »morgen is auch noch ein Tag, schlaf man hin«, »ja ist gut«. Aber er steht dann doch leise auf, prüft nach, spannt an, biegt ab, kippt den einen Uhrkasten daumennageldick weit nach rechts, den anderen nach links, »das muss doch, irgendwann muss das doch mal«, auf Glockenschlag Harmonie.
Manchmal gelingt ihm der Schlag. Dann steht er bei sich, ganz allein, und horcht, und hat seine Faust am Kinn, und heimlich den Blick weit voraus. Das war Leo nie genug. Dem Vater wurde ganz weich, er war mit der Mutter zärtlich vergnügt, Becher Kaffee von ihm, für sie ganz allein.
Manchmal kam aus der Nachbarschaft Rigo dazwischengelaufen, Geschwister abschleppen, Mietgeld pumpen, und fand wütend und doppelt bitter, »alles so dreckig bei uns nebenan!«. Er wär bei der Mutter von Leo am liebsten gleich irgendwo reingekrochen, Klappe zu, Affe lebt, und wird mollig gepummelt und liebgehalten, aber war aus dem Alter längst raus, »hier soll jetzt mal endlich was los sein!«.
Leo war ihm zu brav.
Leo sah ihm ärgerlich nach. Er beneidete ihn um die tiefe Stimme, von der Rigo schon mit fünfzehneinhalb den Spitznamen Brumme hatte, und auch um die Größe und Kraft, »so groß werd ich nie, ein Scheiß!«.