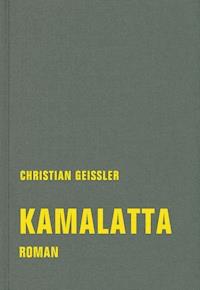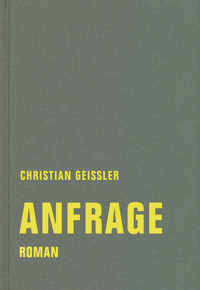
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verbrecher Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Herausgegeben und mit einem Nachwort von Detlef Grumbach Christian Geissler untersucht in seinem Romandebüt "Anfrage" (1960) die Schuld der Väter am Holocaust und greift die "Wir haben von allem nichts gewusst"-Haltung der Adenauer-Ära an. Das war neu und stieß nicht gerade auf Gegenliebe in der Nachkriegsgesellschaft. Der Roman erzählt vom Physiker Klaus Köhler, der herausfinden will, was mit der jüdischen Familie Valentin geschehen ist. Ihr hatte das Haus gehört, in dem das Institut untergebracht ist, in dem er arbeitet. Seine "Anfragen" fördern das Bild einer Gesellschaft zu Tage, in der alte Nazis unbehelligt weiterleben und die Opfer sich weiterhin verstecken müssen. Zudem sucht der Protagonist den einzigen überlebenden Sohn des Eigentümers, der – noch immer in Angst und Schrecken – unter falschem Namen in der Stadt wohnen soll. Köhlers mit der DDR sympathisierender Kollege Steinhoff interessiert dies nicht. Für ihn, der ein Bein im Krieg verloren hat und der traumatisiert wie zynisch stets davon erzählt, wie Menschen als Soldaten von Hitler zum Kriegsende verheizt wurden, zählt ein Einzelschicksal nicht. Schließlich begegnet Köhler einem entfernten Verwandten der jüdischen Familie, der in den USA lebt und während einer Europareise das Haus der Familie aufsucht. "Anfrage" wurde 1960 zum Bestsellererfolg. Große und kleine Zeitungen druckten Besprechungen, sorgten so für eine enorme Verbreitung. Marcel Reich-Ranicki sah in dem Buch den lang ersehnten Schrei des Schmerzes und der Verzweiflung, der Schande und der Empörung: "Ein heiserer Schrei, gewiß, doch ein erschütternder Schrei, dessen Ehrlichkeit nicht bezweifelt werden kann."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 440
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
»Wo war Ihr Herr Vater am 9. November 1938, nachts?« – so konkret stellt Klaus Köhler die Frage nach der Verantwortung des Einzelnen für die Verbrechen in der NS-Zeit. Christian Geissler erzählt in seinem Debüt aus dem Jahr 1960 von der Deportation einer jüdischen Familie, von ihrem Gärtner, der ihr Freund war und doch nur zugeschaut hat, vom Besuch eines Verwandten aus Amerika und von einem jungen Soldaten, der kurz vor Kriegsende noch sein Bein verloren hat. Im Zentrum steht Klaus Köhler, der wissen will, wer Verantwortung übernimmt und welche Lehren aus der Geschichte gezogen werden. Geissler betrachtet den Nationalsozialismus dabei nicht als Betriebsunfall 1933–1945, sondern schlägt den Bogen von 1923 bis in die Gegenwart des Jahres 1958. In einer von Fakten gesättigten Fiktion rückt Geissler die Strukturen in den Fokus, die Antisemitismus und Nationalismus hervorbringen, und trifft damit damals wie heute einen Nerv bei seinen Leser:innen.
Marcel Reich-Ranicki sah in dem Buch den lang ersehnten »Schrei des Schmerzes und der Verzweiflung, der Schande und der Empörung. Ein heiserer Schrei, gewiss, doch ein erschütternder Schrei, dessen Ehrlichkeit nicht bezweifelt werden kann.«
Christian Geissler (1928–2008) arbeitete seit 1956 als freier Schriftsteller, war Autor von Romanen, Hörspielen, Gedichten und Fernseharbeiten und wurde zum kritischen Begleiter des politischen Widerstands in der Bundesrepublik. Seine Arbeiten wurden u. a. mit dem Adolf-Grimme-Preis, dem Irmgard-Heilmann-Preis, dem Hörspielpreis der Kriegsblinden und dem Kunstpreis des Landes Niedersachsen ausgezeichnet. Neben »Anfrage« sind vor allem seine Romane »Das Brot mit der Feile« (1973) und »kamalatta« (1988) bekannt.
Im Verbrecher Verlag erschienen im Rahmen einer Werkschau bislang die Bände »Wird Zeit, dass wir leben«, »Schlachtvieh / Kalte Zeiten«, »Das Brot mit der Feile« und »kamalatta« und das Lesebuch »Ein Boot in der Wüste«.
CHRISTIAN GEISSLER
ANFRAGE
ROMAN
Mit einem Nachwortvon Detlef Grumbach
VERBRECHER VERLAG
PROLOG
Der Stolz der Kinder sind ihre Väter
Sprüche 17,6
Der Prozessverlauf brachte keine Höhepunkte und keine Sensationen. Das Leugnen und spätere Gestehen des Angeklagten gab zwar der Presse die gewünschte Gelegenheit, Spannung in die Prozessberichte zu bringen, für das Ergebnis des Prozesses jedoch war das Schlusswort des Angeklagten allein von Bedeutung.
Staatsanwaltschaft und Verteidigung hatten das ihre getan. Der Vorsitzende fragte den Angeklagten, ob er noch etwas zu sagen wünsche, bevor das Gericht zur Urteilsfindung sich zurückzöge. Der Angeklagte nickte, erhob sich und schwieg. Erst als er das Gesicht seines Sohnes, der unter den Leuten im Saal saß, gefunden hatte, sagte er:
»Ich bin schuldig. Ich bitte das Gericht, den Antrag der Verteidigung auf Zuerkennung des Paragrafen 51 abzulehnen. Ich bin damals voll zurechnungsfähig gewesen, und ich bin es heute. Ich bin schuldig.«
»Wollen Sie uns erklären, was Sie zu dieser Bitte veranlasst?«
Der Angeklagte nickte wiederum, schwieg, sah seinen Sohn an und sagte:
»Ich habe einen Sohn. Es ist besser für einen Sohn, er hat einen schuldigen Vater, der seine Schuld kennt, als er hat einen nicht zu rechnungsfähigen Vater. Einem Menschen, dem man die Möglichkeit abspricht, schuldig werden zu können, tut man keinen Gefallen. Es mag aussehen wie Güte und Nachsicht, aber man entwürdigt ihn. Man entzieht ihn der Gerechtigkeit, und also entzieht man ihn auch der Vergebung. Man nimmt ihm die Würde, Mensch zu sein. Es ist für einen Sohn wichtig zu wissen, dass sein Vater ein Mensch war. Es wird ihn verderben, wenn es heißt: dein Vater war ein Idiot. – Ich bitte das Gericht, den Antrag der Verteidigung auf Zuerkennung des Paragrafen 51 abzulehnen.«
Diese Szene, insbesondere der Vater, ist frei erfunden. Die folgenden Szenen, insbesondere die in ihnen auftretenden ›Väter‹, sind nicht frei erfunden.
Daraus ergibt sich die Anfrage.
ERSTER TEIL
Hinderlicherweise hatte er einen komplizierten Charakter. Gewiss, er hatte studiert, Physik, war wissenschaftlicher Assistent, neunundzwanzig, TOA III, aber ist das ein Grund zu lächeln, wenn alle anderen in ernstes Ergriffensein versetzt sind?
Klaus Köhler ging gewöhnlich abends in der Dunkelheit noch ein Stückchen hinab in die Straßen der Stadt. Er fand die Straßen angenehm laut und die Lichter anregend matt und verspielt. Man konnte nachdenken ohne Ziel, man konnte sehen, hören, Bewegungen ausstoßen, tasten, den Duft der Luft schmecken, ohne dabei seiner selbst schon gewiss zu sein. Man bewegt sich, hantiert, begrüßt alle Welt ohne Scheu, ohne Einwand und Aufwand und vor allem ganz ohne die Furcht, irgendwann irgendwo von irgendwem immer angepackt, angeschaut und etwa erkannt zu werden. Man lässt Gedanken kommen und gehen, lässt sie bunt, scheckig, fleckig, faul, leise, eitel, unverbunden und interruptiv durch Räume schaukeln, die man ihrem Maß nach nicht kennt und die zu kennen, so scheint es, niemand und nichts einen zwingen kann. Man gründelt, man treibt, man kräuselt so vor sich hin, um sich herum, gefällt sich, erweist sich Gefallen, schickt gelegentlich Grüße, Flaschenpost, Absender unbekannt – wie gleichfalls die Welt; wen geht sie an?
Was gingen sie ihn an, die Leute dort drüben unter den Schirmen dicht beieinander, Leute mit offenen Augen, die hinter das Glas der Schaufensterscheibe starrten wie hinter den vorletzten Schleier? Gab es ein Wunder? Das wäre wunderbar, mithin nicht möglich. Dennoch ging Köhler, vorsichtig, so als wünsche er nicht, als Teilnehmer jener lautlosen Feier verkannt zu werden, aus einem Hinterhalt rechts an die Gruppe von Leuten heran und blieb erst stehen, als er beides, links die Gesichter und rechts den Inhalt des Fensters, gut übersehen konnte. Was gab es? Er nahm eine Zigarette und lächelte nachsichtig, was jedoch nicht ganz gelingen wollte, denn es war schwer, den Schmerz zu verbergen, der einen, allem geübten Zeitsinn zuwider, beschleichen kann vor Dingen, die man nicht versteht, obwohl sie wirklich und allen Ernstes und in greifbarer Nähe sich abspielen: Hinter den riesigen Gläsern des Fensters, zuckend in wechselnden Farben beleuchtet, drehte sich still ein mit silbrigem Kunststoff verhängter Gegenstand. Oben hatte man ein Schild angebracht: Der vorletzte Tag. Und wenn das keine Drohung war, dann eine Verheißung. Was aber verhieß man denn? Eben das war von innen mit roten, bewegten Lettern gegen das Glas geschrieben: Der neue Ford Taunus de Luxe ab 1. September!
1. September: Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen.*
Richtig, Köhler erinnerte sich, es war heute der dreißigste, morgen musste er Miete zahlen, und er erinnerte sich weiter, erst heute, mittags, in einer Zeitung die Nachricht gelesen zu haben über die Eröffnung des Frankfurter Autosalons am 1. September. Man schien diesen Tag zu erwarten wie früher den Tag des Herrn; nicht eben wunderbar, aber doch fast; mindestens lag in den sagen wir zwölf mal zwei Augen der Leute vor dem Fenster etwas von dieser Erwartung, eine stumme Andacht von unermüdlichen Herzen, denen bis heute noch nicht die Hoffnung abhandengekommen ist, wenn auch sonst dieses und jenes. Köhler beobachtete, dass, nach der Kleidung der einzelnen Leute zu urteilen – übrigens waren es fast ausschließlich Männer, nur ein einziges Mädchen am Arm ihres Freundes –, dass kaum einer von ihnen die Chance haben würde, irgendwann einmal de Luxe zu reisen. Umso größer die Erwartung, umso wunderbarer der Traum. War es da in der Ordnung zu lächeln?
Klaus Köhler schritt von dannen, und als wäre das Maß noch nicht voll, ließ er es sich einfallen, ein weißes, hohes Kirchenschiff zu betreten, das seine Tore weit geöffnet zur Straße hin streckte.
Diese Kirche ist kein Museum. Besucher, die in unangemessener Kleidung angetroffen werden, insbesondere Frauen und Mädchen …
… also wie sonst. Frauen und Mädchen, meistens nicht so sehr angemessen, eine alte Geschichte, die älteste, auf einer kleinen braunen Tafel aus Holz: Für Besucher.
Links die Gottesdienstordnung, dreißig Zahlen; hinter den Säulen und in den Nischen etwa die gleiche Zahl Frauen, die beten, andächtig, beinah stumm.
Gegrüßet seist du Maria, der Herr du bist unter den Weibern und ist die Frucht Jesus der …
… der was? Die Worte waren schlecht zu verstehen, doch kam freundlicherweise gleich alles noch einmal:
Der für uns gelitten hat …
Köhler suchte nach einem Bild des Gekreuzigten. So etwas kann einem ja passieren. Man kommt nicht drum herum. Es liegt an den Wiederholungen.
Der für uns gelitten hat … der für uns gelitten hat …
So etwas kann einem ja passieren. Aber er fand kein Kreuz. Viele hübsche große Bilder, ja, aber ein Kreuz, ein kleines, ein ganz kleines, war nur vorn am Altar hinter übermannshohen Gittern, schamhaft vergoldet, diskret.
Er hätte jetzt gern geraucht, mäßigte jedoch klug sein Verlangen und sah einstweilen zur Decke hinauf. Es war angenehm trocken unter dem hohen alten Dach, vielleicht ein bisschen zu still, aber vorübergehend mochte es zuträglich sein, richtig, dort drüben stand es ja schwarz auf weiß:
Es wird um Ruhe gebeten,
daneben die Fastenverordnung, oberhirtliche, links ein Hinweis auf einen Vortrag:
Ehe unter dem Segen der Kirche,
und daselbst denn auch, schon ein wenig vergilbt, die Aufforderung zur Aschermittwochsandacht.
Bitt für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes.
Ohne Absicht flüsterte er mit den Frauen das Amen und ging leise rechts an das Bücherbrett.
Vertiefe dein religiöses Wissen!
war dort die Empfehlung. Man bot Bücher und Büchlein zum Kauf an, und es lachte vom Deckblatt eines der Heftchen ihm heiter ein Jüngling entgegen, ein Jungmann, so heißt das, sonnenäugig, gipfelkreuzsicher, schmiedeeisern im Willen, bienenwachsfleißig und körperfroh keusch; laute und auch lautere Innerlichkeit im Herzen, und von oben herab, einsamer nie*, wenn zur Laute einer nicht singen mag. Religiöses Wissen, das alles – Werbetheologie intramuskulär.
Köhler lächelte, entnahm einer Kapsel ein Stück Pfefferminz und bemerkte im unteren Fach der Auslage ein im Umschlag munter gehaltenes buntes Bändchen:
Der Mensch ohne Ich.
Bei der Anschauung solcher Vertiefung wandte er diskret den Blick noch einmal nach vorn zum Altar, weit, weit, über roten Teppich, über Stufen, durch kunstreich verziert’ und verschlossenes Gitter, noch einmal über Stufen, höher hinauf, bis zu den Lichtern, bis zu dem weißgekleideten, winzigen Mann, dem Priester.
Dominus vobiscum,
kam es da plötzlich aus nächster Nähe, nicht unfreundlich, aber zu laut. Köhler erschrak. Jemand hatte ohne sein Wissen, vermutlich auf Grund einer unmissverständlichen geistlichen Weisung, nachträglich, heimlich, das System der verborgenen Lautsprecher hinter den Säulen zum Einsatz gebracht. Oben über ihm saß so ein Kästchen im Rücken eines steinernen Heiligen. Er sah hinauf, um auf den nächsten Anruf besser gefasst zu sein. Er lächelte sogar dem Heiligen zu und wusste doch nicht einmal dessen verdienstliche Todesart: Man hatte ihn auf einem Rost gebraten, langsam, wie Hochwürden am Laurentiustage anlässlich der Predigt mit traurigem Genuss es zu schildern sich angewöhnt hatte. Der erwartete lautstarke Zuspruch blieb jedoch aus.
Köhler wollte soeben die Kirche wieder verlassen; an den Mänteln der Eintretenden konnte man sehen, dass es mit dem Regen so schlimm nicht mehr sein konnte; da sagte hinter ihm jemand: »Sie wollen schon gehen?«
Er wandte sich um.
»Es regnet nicht mehr, Hochwürden«, sagte er und lächelte mild.
»Gewiss, das ist ein Grund zu lächeln.«
»Darf man nicht lächeln?«
»Worüber freuen Sie sich?«
Klaus Köhler trat einen Schritt zurück.
Wenn alles gutging, würde auch dieser Mann dort sich mustern lassen wie ein Bild hinter Glas ohne Titel.
In Köhlers Bewusstsein dehnten sich die Sekunden auf eine höchst unangenehme Weise, und er entdeckte bei sich den Wunsch, im Rücken mindestens eine der Säulen zu haben. Also sagte er leichtfertig: »Es ist spät inzwischen, gestatten Sie …?«
Er trat auf die Straße.
Der Bursche hat Charme, erstaunlich. Köhler dachte beim Gehen draußen noch ein Weilchen darüber nach, doch dann, wie um bei dieser Gelegenheit gleich mehrere Gedanken auf einmal loszuwerden, murmelte er zuerst: alter Schlingel; und dann: frecher Gauner; und am Ende nannte er den Hochwürdigen Herrn gar einen blöden Hund, was nun gewiss am allerwenigsten zutraf, aber die zornigen jungen Männer, man kennt das ja von der Bühne, Geduld.
Klaus Köhler verlor erst die Geduld, als er vor sich an einer Hauswand, tausendkerzig angestrahlt, ein Filmplakat, riesenhaft groß, nicht übersehen konnte: Gorilla greift ein
– ein beinah nacktes Mädchen unter dem Zugriff haariger Arme. Als hätte man in eine überhitzte prallrote Beule gestochen, so floss es jetzt giftig und übelriechend, wenn dieses herbe Bild erlaubt ist, aus ihm heraus, andersherum, in ihn hinein: Gorilla und nacktes Mädchen, das gefällt, das ist Verschleiß, die Supermänner im Film genügen nicht mehr, Problemmännchen sind nicht gefragt, sagte das Mädchen und nahm den Heizer, denn sie war sich selbst ein Problem, doch darüber spricht man nicht, worüber spricht man, über die Sonne, die Sonne, die Sonne im Urlaub, den Mann in der Sonne, nicht im Mond, das ist Kitsch, über den Mann in der Sonne, den mit der Pfeife auf Segelbooten, in teuren Hotels, über den Mann im weißen Sportcoupé, sonst noch eine Frage, wer weiß, vielleicht sitzen bald Gorillas in den teuren Wagen, die Nachfrage wächst, und auf die Nachfrage kommt es an, Vater wusste Bescheid, die rechte Ware zur rechten Zeit am rechten Platz zum rechten Preis. Söhne sind Ware, die die Väter der Nachwelt anbieten, Angebote, Versöhnungsangebote, wenn Wechsel, die sie auf morgen gezogen haben, heute regresspflichtig werden, Söhne sollen die falsche Währung decken, wenn es sich zeigt, dass die Hypotheken, mit denen die Väter vorzüglich die Zukunft belastet hatten, fällig werden, und was für Söhne bietet man an, die auf den Illustriertenseiten, die vor den Additionsmaschinen, die antisemitischen Lehramtskandidaten in vollem Wichs oder am Ende die Restbestände von Auschwitz* und Plötzensee*, darf es stückweise sein – kein schöner Land*, ihr Lieben, das alles wird kein Geschäft, denn inzwischen sind Gorillas gefragt, sei’s drum, in den Urwald mit euch, die Mutation wird gelingen, sie muss gelingen, denn die Nachfrage wächst ungeheuer, warten wir also, warten auf die Mutationen, warten auf den machtlosen Sprung aus der eigenen Haut, und inzwischen, man lebt, man lebt so ein Stück vor sich hin, das andere strahlen die Wände hoffnungsvoll wider: Gorilla greift ein
Vater wäre wohl glücklich, der Übermensch kündigt sich an, Vater ist tot, ich wollte, er wär’s.
Das letzte war ohne Frage ein hässlicher Wunsch, aber Köhler tat ihn ohne Absicht, nicht einmal bewusst, mithin war es verzeihlich.
Da stieß ihn jemand an, lachte und ging davon, ein Mann und ein Mädchen.
Auch so einer, woher hat dieser Kerl seine Schultern, und einen Gang, unter dem ist der Boden sicher, und wenn nicht, und wenn’s mal an zu wanken fängt, wenn alles in Scherben fällt*, tut nichts, so einer steht im Nichts noch wie ein Klotz, das ist Gewohnheit, Schwerkraft, Struktur, das ist rassisch erstklassiges Erbgut, würde Vater sagen, heute nennt man das Handelsklasse A.
Er ließ die Arme hängen, ging ein paar Straßen weit, wartete auf die nächste Tram. Als sich die alten Wagen näherten, ging er als erster auf die Fahrbahn, zu früh, und sah dann, wie die anderen an der Station es ihm nachtaten, wie sie die Straße blockierten. Er hörte links den schrillen Ton von bremsenden Reifen, er hatte sie gezwungen zu bremsen, er, und er genoss seine kleine, unnütze Macht.
Nachts – mag sein, gleich darauf, mag sein, Wochen und Monate später; für den, dem die Zeit zerstiebt von irgendwo vorn nach irgendwo rückwärts, ist das ohne Bedeutung – irgendwann nachts traf Köhler im Treppenhaus einen Mann. Beide erschraken sie. Dass Köhler erschrak, war nicht weiter verwunderlich, denn wie es aussah, hatte der Mann schon in der Dunkelheit zwischen den Flurwänden gestanden, bevor noch das Licht aufflammte und die Schaltuhr leise zu ticken anfing. Warum aber erschrak der Mann? Ohne Gruß, die Augen hinter einer schweren grünen Brille verborgen, schob sich die große, hängende Gestalt hinter die Tür im Erdgeschoss, links, und ohne sichtlichen Anlass verriegelte dieser Mann dann von drinnen dreifach die Tür. In der Luft blieb ein Hauch Parfüm.
Köhler stieg die Treppen hinauf in sein Zimmer, und, als ekelten ihn plötzlich die schönen, verschlossenen Türen rechts und links, stieß er die Erinnerung an den Anblick dieses Mannes weit von sich. Er trat an ein offenes Flurfenster, sah hinunter in den Hof und warf etwas hinab wie einen Schlüssel in einen Brunnen. Das Treppenlicht erlosch, er ging die letzten Stufen im Dunkeln, er sah keine Tür mehr.
Das Haus in der Kronprinzenstraße 7 war ein Haus so gut wie andere: Vom Hausherrn weiß man den Namen und die Bankanschrift; sonst nichts.
Als er oben die Tür hinter sich zuzog, kam seine Wirtin ihm zaghaft entgegen, und also blieben sie beide noch in der Küche ein Weilchen sitzen. Erst viel später – nicht ohne zuvor bei einem Honigbrot der Frau mehr gezwungen als aus eigenem Wunsch von seinen nächtlichen Wegen erzählt zu haben; die alte Frau liebte es auf eine höchst hartnäckige Weise, teilzunehmen an den Wegen der Jugend, denn sie war allein, ihren Sohn hatte man ihr gelegentlich fortgenommen und ihn an unbekanntem Ort zerschossen – viel später also, nachdem er der Wirtin ein paar freundliche Dinge erzählt hatte, die in solch einem Fall zu erfinden er keine Mühe scheute – später, nachts, träumte er von Männern mit Sonnenbrillen in glänzenden Limousinen, die ohne Licht durch enge Gassen einen Weg suchen.
Im Übrigen aber wacht man selbst nach langen Träumen gelegentlich auf, und wenn alles gutgeht, freut man sich, dass die Sonne scheint.
Klaus Köhler wälzte sich auf den Rücken, sah gegen die Decke und fand die Sonnenbewegung im Stuck peinlich direkt und lähmend mit ihrer blöden Munterkeit.
Das war keine freundliche Art, die so viel besungene Morgensonne zu begrüßen, aber freundlich zu sein ohne Freund, mit so einem Traum unterm Kissen – ein monströser Akt, wo er gelingt.
Dazu das Zimmer.
Köhler brauchte, um sich daran zu erinnern, den spielenden Sonnenfleck an der Decke nicht erst aufzugeben: ein großer Raum, überlebensgroß und kaum möbliert. Früher mochte das anders gewesen sein, früher war das ein Raum, dessen Ausstattung – Plüsch, Spiegel, rechts das Gründerantlitz in Öl und über dem Schränkchen mit zierlichem Porzellan vielleicht das akademische Zaumzeug mit buntem Band – einen potentiellen Schwiegervater, sofern er den Künftigen hier zu empfangen geruhte, ermächtigen mochte, nach Einkommensstufe und nach Sicherheit aus gelagerten Aktien sich diskret zu erkundigen, bevor er, bedingungsweise, seinen Segen in Aussicht zu stellen gütig bereit war. Inzwischen hatte die Zeit, die ja bekanntermaßen immer dann herhalten muss, wenn sich die Schuldigen trösten wollen, diesen Raum gründlich entlastet, er war leer. Aber in der Leere zwischen den Wänden lebt es sich nicht so leicht, leichter, als man es wünscht, zu leicht, um noch der Schwerkraft, um noch dem Boden zu trauen, dass der einem den Halt und den Grund verbürgt, den zu suchen doch fast jeder unausweichlich gezwungen ist. Man schwebt nur so irgendwo zwischen den Wänden, und im Bett liegen zu bleiben, auch über die angemessene Zeit, wird zu einer Frage der Sicherheit.
Klaus Köhler blieb denn auch in dem fast leeren Raum noch ein Weilchen liegen; der Lehnstuhl, der große schadhafte Tisch mit den gehäuften Zeitungen, das Buchbrett unter dem Fenster über dem längst nicht mehr so sorgsam gepflegten Parkett, all das behielt auch so seinen Platz.
Das Buchbrett, gut, aber was sollte man davon denken? Neben den Lehrbüchern der Physik, die noch kein Hinweis sind, es sei denn, man nimmt sie für ein Zeichen aufmerksamen Eifers, neben den Lehrbüchern zwei Bände Lenin, die Bibel, Das Bonner Grundgesetz (DM 1,10 bei Reclam), Mein Kampf in Dünndruck und der Mythus in Volksausgabe (47.–48. Auflage, 1935); dazu drei Bände Logik, antiquarisch, sehr billig, wie das heute so geht, und am Ende mindestens fünfzig Comicstrips und ein einsamer Band Zur Phänomenologie des Verrates, und kein Goethe, kein Schiller, kein Walter Flex, geschweige denn ein Tornister.
Wer das so nebeneinander sah, dem waren plötzlich Friede und Stille nicht mehr geheuer, und der Blick die Wände entlang, sonst gern Aufhängevorrichtung einer zeitnahen Weltauffassung, versprach kaum Tröstung. Die Wände waren weiß, sofern das Weiß nicht von den Staubschatten längst versteigerter Gemälde entstellt war, und nur in einem Winkel im Dämmerlicht nahe der Tür waren Bilder so unübersichtlich gedrängt beieinander, dass man gezwungen war, näher zu treten, um dann mit Mühe und womöglich mit Fassung zu unterscheiden. Einem männlichen Beschauer mochte zuerst das entzückend große Aktfoto imponieren, nur wandte die Dame leider den Blick vom Beschauer fort. – Das Nachbarbild, darüberstehend, zeigte den schönen Kopf des einzigen deutschen Bundeskanzlers, und der alte Herr hatte es der kindlichen Laune von Köhler zu verdanken, dass ihm zu Häupten ein braunes Spruchband prangte: Solange du da bist, wohl der Rest einer Filmrevue. Als drittes war dann da noch die kreißende Negerin vor einem Mikrofon im Abendkleid auf Glanzfolienkaschierung – das Deckblatt einer Schallplattenhülle. Das war die eine Seite des Winkels, die rechte. Die linke war ernster gehalten, das fiel sogleich auf, denn dort trug eine Indianerfrau ihr freundliches Kind in einem Rückentuch, über ihr baumelte, von einer Zwecke lose gehalten, ein billiges Rosenkranzkruzifix an einem roten Gummiband, und gleich daneben, größer als die übrigen Bilder, sah man ein engumschlungenes, munteres Pärchen auf einem braunen Pferd leicht über Haus und Hof hinfliegen; rechts auf dem Bild, im Himmel, der Mond prall und mild wie eine Weißwurst, drunter ein Lattenzaun, ein Schweinchen, wie Kinder es malen, und eine Petroleumlampe auf einem Tisch. Das Pferd mit den beiden sprang über das alles hinweg mit zärtlichem Blick, scheu, aber mutig.
Gut, wo alles so drunter und drüber geht, geht am Ende auch das noch, nur ob es gut ausgehen würde, daran zweifelte von Tag zu Tag mehr auch die greise Wirtin, die Köhler von seinem Bett aus soeben den Flur hinunterschlurfen hörte, wohl im Zuge einer leiblichen Verrichtung. Er kannte die Gedanken der alten Frau. Die Schritte genügten, um ihm diese Gedanken ins Hirn zu jagen. Er drehte sich gegen die Wand, wollte weiterschlafen, fürchtete aber den Traum und stellte sich, für ein paar Augenblicke unschlüssiger noch als sonst, in den leeren Raum. Kein erfrischender Anblick für den, der ihn sah. Die Schultern hingen ihm breit in der Sonne, der Blick suchte den Punkt, den er an der Decke eben erst aufgegeben hatte, freundliche, stumme Augen, aber noch ungeschützt, denn die Brille fehlte. Erst als sie ihren Platz hatte, ging der Blick in den Bilderwinkel, und das Lächeln stieg aus dem Mund über Augen und Stirn und leuchtete wie ein künstliches weißes Licht.
Mit der Brille hatte es seine besondere Bewandtnis. Sobald er sie aufsetzte, stellte sich das angenehm bergende Gefühl der Distanz ein, das er einerseits unter gar keinen Umständen missen wollte, so als bestünde Gefahr, die Welt fiele über ihn her, das er andererseits jedoch derartig fürchtete, dass er schon hin und wieder einen kaum noch zu hindernden Zwang verspürt hatte, im Gespräch, vor diesem oder jenem, die Brille abzunehmen. Gottlob, bisher war es in Ernstfällen nicht dazu gekommen. Er kannte sich gut genug, um zu wissen, dass er einen offenen Anblick schlecht aushielt, dass er Gefahr lief, sich zu entsetzen, denn was er bei offenem Anblick sah, das schien ihm von einer so großen Bedürftigkeit zu sein, dass das Lächeln ausblieb, ohne dass sonst Trost sich eingestellt hätte. Hinter der Brille jedoch, wie gut, hinter der Brille war die Welt hinter Glas, und hinter Glas ist der Anspruch auf klare, dauerhafte Verständigung nicht mehr als ein interessantes Phänomen, wohlpräpariert, museumsreif, tot.
Doch zur Sache, es begann ja ein neuer Tag, die übliche Maskerade, und was da aus dem Bett kommt, gelb, mit Zahnbelag, Träume unter der Haut und drüber das Nachthemd, das alles verkleidet sich rasch, färbt sich, vergisst sich, und am Ende bei einer Tasse Kaffee sitzt da ein junger Mann, sauber und breit, der das Haar trägt, wie es die Zeit will: kurz, dass alles sich sträubt.
Es hatte Tage gegeben, da war es für Köhler wichtig gewesen, den Unterschied, der ihn von anderen trennte, zu betonen, etwa durch eine Eigenwilligkeit in der Kleidung oder durch Unordnung ganz allgemein, sei es in den Gedanken, sei es im äußeren Anzug. Doch hatte es sich später gezeigt, dass all diese trauten Verstöße, die schwarze Brille, der Bart, das enge Hosenbein, dass alle noch so geschickt versuchte Originalität immer schon längst genormt ist, ja, dass besonders die Leistung außergewöhnlicher Schlamperei das Erkennungssignal einer unüberschaubaren Gruppe von Leuten ist, deren Eigenart schließlich nur noch darin besteht, dass man Angst hat, normal und endlich auch älter zu werden als zwanzig. Die große Norm überflutet Weg und Steg, wie peinlich das ist, überspült jeden Schleichweg, auch noch den kleinsten, und so fand denn auch Klaus Köhler des Morgens das Ei bei üblicher Temperatur und innen, wie man es wünscht, wachsweich.
Um nichts weniger verbindlich zeigte sich ihm später auf dem Weg zum Institut die Welt: der Mann im Kiosk, das Morgenlicht über den Brücken am Fluss, die Fotokoffer an blassen Hälsen trauriger Amerikaner, auf immergrünen Bänken im Park die Pärchen, noch oder schon wieder, dritte Generation – und die Sonne, über allem die Sonne, dort drüben über dem Kinderkörbchen vielleicht gerade gut genug, einem Baby die gefürchtete Möglichkeit einer Rachitis rasch zu vertreiben, denn niemand schätzt krumme Beine.
Krumme Beine.
Nur ein Gedanke, wenn alles gutgeht, andernfalls Bilder aus Träumen. Klaus Köhler kam diesmal nicht so einfach davon. Krumme Nase – krumme Beine – krumme Seele: Juda verrecke!* Wie das auftaucht, steht es da und lebt.
Er hatte an der Hand seines Vaters das gelbe Plakat mit der schwarzen Gestalt lange betrachtet, und sein Vater hatte mit großem Ernst von Gefahr gesprochen, von Weltgefahr, von Weltgefahr Nr. 1 – seltsam, man hatte Gefahren nummeriert. Der Junge hatte geschwiegen und es behalten. Vater war mächtig, ein gläubiger Mann. Aber nicht mächtig genug zu schützen, wo wirklich Gefahr war, wo einen Schreck durchstach, weil man doch sah, was war!
Auf dem Schiff:
Man war unterwegs gewesen, aus grauer Städte Mauern, Schneefelder blinken, Lande versinken, doch es geht auch ohne Sonne, und lachen am Tod vorbei*. Man nannte das damals Freude und meinte Kraft. Ein paar Eingeweihte nannten es Steigerung der Nutzleistung, und wozu es nützen sollte, wussten auch nur die wenigen. Doch die waren nicht auf dem Schiff, der Vater war auf dem Schiff und der Junge, auf den er stolz sein wollte, wie er sollte. Möwen, Meer, oben die Sonne, am (weißen) Schornstein das Sonnenrad (rot), und im Schornstein (schwarzer) Rauch. Der Junge stand mit anderen Kindern backbord in Luv, und der Wind trieb feingesprüht Salzwasser in die kleinen blanken Gesichter.
Plötzlich schreit einer, schreit dafür, dass es ein Kind ist, mit ungeheuerlich geilem Vergnügen: »Da! Da! Da ist einer abgesoffen!«
Ein gestrandetes Kohlenschiff auf einer Sandbank; ein roter rostiger Schornstein und ein Mast, niedrig über dem Wasser.
Lachen, Rufen, Juchhei über so viel anschauliche Vernichtung. Alles freut sich und drängt, ein Junge schreit. Er hatte bisher noch nie Angst, darum schreit er jetzt, rennt über das leere Deck, findet seinen Vater und will sich bei dem in der Jacke verkriechen, mit sieben wagt man das noch. Aber der Vater nimmt den Kopf des Jungen: »Sieh mich an!«
Der Junge hat Angst, aber den Vater kann man ja ansehen.
»Du hast Angst, Bengel? Ich werde dir!«
Das Rückgrat brechen? Das war nicht die Absicht gewesen, aber so etwas kommt vor.
Der Vater hatte den schreienden Jungen an die Reling getragen.
»Sieh dir das an, die andern lachen, lach auch!«
…
»Augen auf, hörst du?!«
…
»Und ich sage dir, mach die Augen auf, Junge, oder…!«
Der Junge hatte das geborstene Schiff gesehen, ohne zu zittern, und der Vater hatte den Jungen noch höher gehoben, ohne zu zittern, den Jungen so hart wie Kruppstahl*.
Über dem Park lag der samtene Glanz, den es nur im Vorfrühling manchmal gibt, zartblau, silbern, duftig wie Schimmel. Bald, zwei Monate noch, kaum mehr, dann war schon Mai. Am Anfang der Feiertag, den keiner begreift, und in der Mitte der Maibaum, den erst recht nicht.
Man sagt das so leicht.
Aber der Junge hatte dem Vater versprochen, nach oben zu klettern und ein Taschenmesser zu greifen. Das war eine Sitte damals: Oben am Kranz des Maibaumes hingen begehrenswerte Kleinigkeiten, unten standen die Jungen in Uniform, der Maibaum selbst war glatt wie ein Schiffsmast.
Aber der Junge hatte dem Vater versprochen, nach oben zu klettern, diesmal bestimmt, und was man dem Vater verspricht, das verspricht man im Grunde sich selbst.
Der Junge, der das versprochen hatte, blieb dann ein Stückchen über dem Pfeifen, dem Ansporn, dem johlenden Spott derer, die unten standen, an der glatten Stange zwei Meter hoch hängen, rutschte zurück, rutschte in den lachenden Zuschauerhaufen zurück, und das Messer hing hoch hoch droben unter der Sonne. Alle Blicke waren damals lachend nach oben zur Sonne gerichtet.
Und schwören am Sonnenaltare, Deutsche zu sein …*
Alle hatten sie an diesem Tage Uniformen auf dem Leib, die Kleinen wie die Großen, Vater auch und auch der Junge; und auch der, der kurze Zeit später, geschickt wie ein Äffchen, den Maibaum hinaufglitt und das Messer erreichte. Das hatte der Junge gesehen und war mit dem Vater gegangen. Nun, wo er das Messer nicht hatte greifen können, wagte er es nicht mehr, nach der Hand des Vaters zu greifen, und der Vater hatte dem Jungen auch nicht geholfen, sondern geredet, niemand wusste, für wen: Der kleine Kerl war in Ordnung, das hat man gesehen, flink und geübt, flink wie ein Windhund, und hat auch nur zwei Arme und zwei Beine, aber Mut hat er, Mut und Willen, einen eisernen kleinen Willen!«
Der Vater war stehengeblieben: »Und du?«
Sein Blick war an dem Jungen heruntergeglitten und war kaum mitleidiger gewesen als der Blick eines Bauern, der ein missratenes Ferkel betrachtet. Der Junge hatte den Blick verstanden, und für den Bruchteil einer Sekunde war er mutig genug, einen eigenen, einen winzigen eigenen Gedanken zu denken: Verdammter, verrückter Hund! Ein scheußliches Wort, Hass, Mordhass; aber so etwas denkt sich wie eine Erleichterung, bis man den Rest spürt, den man nicht loswird. Es bleibt eine Spur, die keiner verschütten kann, der nachzugehen der größte Schreck einen nicht hindert.
Das Physikalische Institut der Universität, an welchem Köhler seine Dissertation endlich fertigzustellen sich vorgesetzt hatte, lag hinter vergitterten, hohen, doppeltverglasten Fenstern im Seitenflügel eines Hauses, das nach den schönen, prächtigen Maßen seiner Fassade gewiss einst zu einem freundlichen Zweck erbaut worden war. Es lag, umstanden von altem Ahorn, Kastanien und Buchen, am Nordrand der Stadt, dort wo vor Zeiten nur der sich ein Haus bauen ließ, der Wagen und Pferde besaß, um bequem die Stadt erreichen zu können, die Börse, den Arzt, den Geflügelmarkt, die Bibliothek, das Theater. Das Haus schien in der mutigen Absicht erbaut worden zu sein, in der Welt einen festen Platz zu umreißen, großzügig einen Raum zu schaffen, in dem keiner so leicht sich am anderen stößt, den gute Vernunft nach drinnen und draußen hin sichert und ehrt, und der einladen soll, Feste zu feiern, viele Kinder zu zeugen und nachzudenken, um zu begreifen. Vor achtzig Jahren etwa hatte man noch den Mut, solches zu planen, doch achtzig Jahre sind eine lange Zeit. Soweit inzwischen anhand von spärlichen Nachrichten bekannt geworden, war es dem Bauherrn des Hauses, auch seiner Frau, einer schönen Frau, vom Schicksal, wie sie es nannten, gütig vergönnt gewesen, rechtzeitig sanft zu entschlafen. Kinder und Kindeskinder hingegen wurden vergast, hierfür gibt es Beweise. Ein Rest konnte fliehen, starb aber draußen dann namenlos vor der Zeit, ohne Hoffnung, ohne Tränen, verbannt gegen innen und außen, jahrtausendealt. Oder es überlebt einer. Wen von uns kümmert das.
Indessen hatte das Haus nicht leer gestanden. Hausherr wurde über den Zeitraum von kaum vier Jahren ein uniformierter Mann, der, bevor er angesichts seiner fünf blonden Kinder und seiner tüchtigen, damals bereits mehrfach gekörten* Frau das Herdfeuer segnete, alles Nötige unternahm, um das Haus gründlich vom Dach bis hinunter zum Keller desinfizieren zu lassen, denn er hatte schon vor Jahrzehnten, als Junge daheim, in der Schule und später im Freikorps sagen hören:
Der Jude stinkt, und was stinkt, das ist giftig*.
Gewiss, es hätte nahegelegen für ihn wie für andere, doch einmal ruhig darüber nachzudenken, ob denn dem wirklich so sei. Doch wer gern fühlt, wem das Vaterland heilig* und die Fahne mehr als der Tod* ist, der, ja, weiß Gott, der ist namenlos munter, der fürchtet Gedanken wie Wanzenbiss, denn Gefühl ist nun einmal alles und Name ist Schall und Rauch. So verkürzt sich gefällig das eine, bläht und dehnt sich das andere, bis am Ende alles einen recht guten Sitz hat, und das Nachdenken nicht besser und schlechter gerät als für gewöhnlich das Zahnbein bei zu viel Weißbrot und Schokolade, es verklebt, riecht, wird brüchig und schließlich ersetzt durch eine Prothese, die jedem passt.
Das Haus also wurde desinfiziert, das Herdfeuer loderte altdeutsch, tags gab man harte Befehle, abends erklang nicht selten ein Stückchen Kammermusik, und die Restbestände eigenen Denkens krochen narkotisiert in die äußersten Winkel, geschwächt von wilden Wünschen und lastenden Ängsten, paralysiert von abergläubischer Hoffnung, von Hass und zuletzt von Ekel, denn die Stimme des Blutes* klingt süßlich. Was tut’s?
Meine Ehre heißt Treue*.
Das sollen übrigens die letzten Worte des neuen Hausherrn gewesen sein, versuchsweise die letzten, bevor er nach der Pistole griff. Doch warf er die Pistole dann draußen heimlich und leise in einen tiefen, tiefen Teich, Stunden vor Eintritt der Okkupation*, die Befreiung zu nennen vaterlandslose Gesellen im Lande sich schamloserweise nicht scheuten, verließ Weib und Kind und wurde später Drogist unter neuem Namen. Von der Frau und den Kindern fehlt jede Spur. Man wird aber annehmen dürfen, dass sie heute mithilfe von auskömmlichen Renten in die Lage versetzt sind, sich in Ehren zu halten.
Die Zeit deckt viele Sünden zu*, sagt man, die Zeit: das ist Arbeit, Erfolg und wieder ganzjährig blühende Kulturen; das ist alltags abends hinter der Zeitung und sonntags morgens unter der Kanzel wieder Weltgefahr Nr. 1, wieder wie einst die große Legitimation, in vertrauter Richtung gedankenlos heftig zu hassen, männlich, Mann in der Zeit, der Landser erzählt, im Auftrag der deutschen Bischöfe*. Die Zeit: das ist hinter allem die Weigerung, sich zu erinnern, und die Scham, sich zu schämen.
Die Zeit deckt viele Sünden zu, hofft man an allen Orten und zitiert ohne Zögern und ohne Scheu den heiligen Petrus – falsch.
Pit hieß der amerikanische Offizier, der es sich in den ersten kalten Jahren zur Aufgabe machte, im Hause unter den Buchen Bücher und Zeitschriften seines Landes kostenlos anzubieten und ebenso freundliche Vorträge über den Vorzug der Demokratie. Und er hatte Erfolg. Es kamen etliche junge Leute und hörten ihm aufmerksam zu, und alte Leute kamen und schliefen ein Stündchen, denn das Haus war geheizt.
In den Jahren danach, in den Jahren des Aufbaus, als für das schöne Haus sich in keinem Lande ein Erbe mehr finden wollte, da gab man es, nach einem von der Öffentlichkeit kaum beachteten Ratschluss des jüdischen Komitees, in die Verwaltung der Universität, wohl in der Hoffnung, es möchte dem Nachwuchs auf eine gute, verzeihliche Weise dienen. Und das tat es denn auch. Von den beiden weit auseinandergezogenen Flügeln des Hauses ging der eine zu Händen des Leiters des Physikalischen Institutes, der andere blieb unter der Obhut eines jungen Dozenten für Psychiatrie, der, ehrgeizig genug, den Plan gefasst hatte, für seine Forschungen einen zentralen Beobachtungsplatz zu schaffen, ein zeitnahes Vorhaben, welches ihn am Anfang auch zu der Hoffnung veranlasst hatte, das Haus in Gänze sich aneignen zu können, jedoch ohne Erfolg. Die physikalische Forschung hatte ihr Recht gefordert.
Immerhin waren vorsorglich die erst kürzlich montierten Fenstergitter nicht wieder entfernt worden.
Klaus Köhler hatte sich an die Gitter gewöhnt und gelächelt. Er hatte wie an jedem Morgen so auch heute pünktlich gegen neun Uhr die hellen, hohen Spiegel passiert, die unten im Haupthaus rechts und links einen Teil der Wände bedeckten. Die Frage, wen dieses Glas in den vergangenen Zeiten alles gespiegelt hatte, ohne fleckig zu werden, war nur eine der vielen Fragen, die sich die Insassen dieses Hauses hätten zur Beantwortung immer von neuem stellen können, zumal unten im Garten tagsüber ein Gärtner beschäftigt war, der die Geschichte des Judenhauses gut kannte. Aber es lässt sich Fragen ja aus dem Wege gehen, und von den jungen Physikkandidaten waren die einen vielleicht gefühlvoll genug, sich ganz von der Vorstellung tragen zu lassen, dass, wer Physik treibt, einst am Bau der Zukunft angenehm reichlichen Anteil haben wird; andere mochten, nicht eben nüchtern, aber freundlich und fleißig sich bei dem Gedanken trösten, dermaleinst für die zu erhoffenden Leistungen, gleichgültig zu welchem Ziel, reichlich bezahlt zu werden; wiederum gab es welche, die ein Hobby hatten, wie man es heute politischerseits gern empfiehlt, um abzulenken: eine Geige, ein Auto, ein Mädchen, einen Bibelkreis oder den Wunsch, Diskussionen zu leiten, Marionetten zu basteln oder die Kunst der Azteken nebenher zu studieren; freundliche junge Menschen, klug, verlässlich, gelegentlich seltsam verletzlich und fast in jedem Fall, heute wie einst, ganz und gar innerlich.
Schließlich gab es noch die, deren Gruppe Klaus Köhler nach einer langen gemeinsamen Zeit eben erst zu meiden anfing.
Seit er durch einen Zufall von der genauen Kenntnis des Gärtners gehört hatte, gelang ihm das Lächeln nicht mehr so sicher wie sonst, und es kam vor, dass er an seinen Vater dachte; dachte, wenn er das Haus betrat: an das gelbe Plakat, an die Uniform, an das Abendgebet, die männlichen Lieder, die rote Fahne im grünen Garten an Feiertagen. Was an Erinnerung bisher immer nur angeschwemmt worden war, wälzend, formlos und salzig wie Meerwasser über ein geborstenes Schiff, das stand jetzt hart gebaut um ihn her, in Wände gesetzt, Keller und Dach, Treppen, Eingang und Ausgang – ein Haus, das Judenhaus. Man konnte fluchen und fliehen, man konnte lächeln, aber das Haus stand da, würde stehen bleiben, hier auf der Erde: hier hatten Juden gewohnt.
Der Gärtner versorgt den Garten – wer das Haus?
Ihn fror. Er ging langsam über Stufen hinauf ins Institut, er zog sich zurück in den Tag, in den weißen Kittel, in die Kalendernotizen, die Telefonanrufe, die sich so angenehm einfach beantworten ließen; in die Kurven, Tabellen und Apparate, in den denkbaren Auftrag, bei dem es auf Sinn nicht ankam, sondern auf Kenntnis und Distanz.
Als gegen zehn Uhr dreißig die Sekretärin den Kaffee brachte, freute er sich und malte kleine Gesichter in das beschlagene Glas des Fensters. Draußen schien weiß die Sonne und taute den letzten Schnee.
»Am besten, Sie trinken den Kaffee, solange er heiß ist«, sagte das Mädchen so wie sonst auch. Sie tranken den Kaffee gewöhnlich zusammen und redeten dabei über dies und nichts.
Köhler sah gleichgültig weiter nach draußen und sagte: »Beschlagenes Glas ist eine Versuchung für mich, drauf zu malen, kennen Sie das?«
»Ich wollte Sie etwas fragen.«
Er wandte sich um, kam an den Tisch.
»Wussten Sie, dass hier früher Juden gewohnt haben?«
»Der Gärtner unten hat mir davon erzählt. Verschleppt, verhungert, et cetera.«
»Ist das sicher?«
»Vergast.«
»Glauben Sie das?«
»Es gibt Bilder und Bücher.«
»Schreiben kann man viel.«
»Könnte man. Ist aber kein Geschäft.«
»Ich denke immer: was die alles reden«, sagte das Mädchen vorsichtig.
»Reden viele? Ich kenne kaum einen.«
»Die Juden, meine ich.«
»Kennen Sie Juden?«
»Nein.«
»Haben Sie noch eine Zigarette?«
Sie rauchten, links an der Schalttafel tickte ein roter Zeiger, Pulsschlag hinter Glas, millimetergenau, empfindlich und spitz.
»Wie die wohl ausgesehen haben«, sagte das Mädchen. Köhler hob die Brauen: »Wie Teufel? Glauben Sie?«
»Nein, nicht die Juden – ich meine die, die es getan haben.«
»Die meine ich auch!«
»Wie Teufel?«, wiederholte das Mädchen nachdenklich.
»Nicht wie Teufel«, sagte er und zeigte ihr eine Fotografie. Sie sah sie sich aufmerksam an: »Wer ist das?«
»Mein Vater. Ich denke, man kann das sehen.«
»Jetzt, wo Sie’s sagen …«
»So haben sie ausgesehen, die es getan haben. So wie mein Vater, und wie Ihrer, wenn Sie erlauben.«
»Mein Vater war nicht bei der SS, wissen Sie«, sagte das Mädchen mit einer Art von beschämtem Respekt.
»Mein Vater war Kaufmann, wissen Sie«, sagte Klaus Köhler, wiederholte absichtlich den kleinen, vertraulichen Beisatz und beobachtete das Mädchen aus einem Winkel hinter der Brille, ohne sich zu bewegen, »katholischer Bankkaufmann, Vorsitzender von irgendeiner katholischen Unternehmervereinigung, Gesinnung, Kreuz und Kredit, erinnern Sie sich?«
»Ich bin nicht katholisch.«
»Aber Ihr Herr Vater ist sicherlich trotzdem ein guter und freundlicher Mensch, nicht wahr?«
»Warum lächeln Sie, wenn Sie das sagen«, antwortete das Mädchen und sah unruhig über den Tisch hin, »möchten Sie noch eine zweite Tasse?«
Sie sahen zu, wie sich das Pulver schäumend im kochenden Wasser löste. Köhler genoss den heißen, kräftigen Duft. Das Mädchen nahm den Gedanken noch einmal auf:
»Wenn ich jetzt die Treppe hinuntergehe, muss ich daran denken, wie es war, als man sie hier verhaftet hat.«
»Unter der Aufsicht von Buchhaltern bekommen Verbrechen den Stil, den wir lieben: Ordnung und Präzision. Da vertraut man gern.«
»Und keiner hat gewusst, wie es wirklich war«, fügte sie rasch hinzu.
Köhler stand auf, ging hinüber zur Tafel und zeichnete aus zwei gegeneinandergestellten Dreiecken einen großen Stern. Dann wandte er sich zurück ins Zimmer und fragte freundlich: »Kennen Sie das?«
Das Mädchen sah ihn verständnislos an. Er fragte sie: »Wo war Ihr Herr Vater am 9. November 1938, nachts?«
»Wie ›nachts‹? Was war damals nachts?«
»Meiner hat geschlafen. Er wollte frisch sein für seine Arbeit am nächsten Tag. Er schlief, und während er schlief, hat man zwei Häuser weiter ohne gesetzlichen oder sonst irgendeinen öffentlichen Einspruch einen Juden erschlagen.«
»Warum?«
»Warum schläft man! – Sind die Testbogen vom Labor gekommen?«
»Noch nicht.«
»Ich kann mich gut erinnern: Tags darauf war bei uns ein kleines Familienfest, Hochzeitstag meiner Eltern. Es war wie in jedem Jahr: mittags Ananas, nachmittags Kuchen, abends für jeden ein Ei und zum Abschluss bei einer Kerze ein Stück aus dem Andachtsbuch.«
»Kannte Ihr Vater den Juden von nebenan?«
»Er mochte ihn nicht.«
»Was war mit ihm?«
»Er war Jude.«
»Aber man braucht ihn deshalb ja nicht gleich totzuschlagen.«
»Sie meinen, es sollte, im Anfang mindestens, mildere Strafen geben? Machen wir ein Fenster auf.«
Das Mädchen setzte langsam die beiden Tassen ineinander, nahm die Kanne, die Kaffeedose, den Tauchsieder und sagte: »Vielleicht habe ich etwas nicht richtig gesagt. Aber ich meine, dass man damals nichts machen konnte.«
»Wer sagt das?«
»Mein Vater.«
»Meiner auch!«
Er sah sie angestrengt an, lächelte plötzlich, nahm den Mantel und sagte: »Das Leben ist komisch. Rein in die Gaskammer, Klappe zu, Jude tot. So was vergisst sich doch!«
Sie gingen schweigend den Flur hinunter; vielleicht um einen besseren Schluss zu finden, sagte das Mädchen: »Manchmal sind Sie seltsam.«
»Ich geh Zigaretten holen«, erwiderte er, »vielleicht sind Sie so gut und bringen mir gelegentlich die Aufstellung der Werte, die gestern gemessen wurden.«
»Die Werte waren falsch. Wir hatten eine Fehlerquelle und messen heute noch einmal.«
»Messen Sie. Und sagen Sie bitte Steinhoff, er soll mich anrufen, wenn er Lust hat.«
Wie es schien, hatte Steinhoff nicht Lust gehabt anzurufen, oder aber es war ihm der Gruß nicht bestellt worden – mag sein, mag nicht sein. Klaus Köhler verließ, ohne noch jemanden weiter gesprochen zu haben, nachmittags um fünf Uhr das Haus und blieb ein Weilchen im Garten unter den alten Kastanien. Steinhoff war ein Jahr älter als er, kleiner, schmal, zäh, beinamputiert seit April 45, Küstrin, Befehl ist Befehl. Steinhoff war damals, als er gehorchte, siebzehneinhalb.
Köhler sah einen glatten Stamm hinauf, der in der Nässe des Regens glänzte. Oben, mannshoch, hatte vor Jahrzehnten jemand die Rinde zerschnitten. Die Buchstaben waren inzwischen alt und zersprungen, dick vernarbt und verschlossen. Köhler schlug mit der flachen Hand sanft gegen den Stamm, perdu. Der Wind trieb Wolken wie Rauch durch die gesträubten Zweige und sprühte den Regen leicht und flach durch die Luft. Solange Wind blieb, würde es gut sein. Er machte sich auf den Weg nach Haus.
Um den Park bald zu erreichen, nahm er den kürzesten Weg und ging durch Seitenstraßen, in denen um diese Zeit Kinder spielen und kleine Friseurgeschäfte hinter Mülltonnen und Plakatwänden friedlich einmodern und verstauben. Drüben, jenseits der hohen Halden aus Trümmerschutt, Berge, die nun im Winter von Kindern mit Schlitten befahren werden und auf denen sommertags Unkraut blüht, Wegerich und Vergissmeinnicht, jenseits der Berge winkten stolz und kühn die Kasernen der Stadt. Klaus Köhler blieb stehen. Er sah hinüber zu den Kasernen, glaubte ein Lied zu hören, das der Wind vor sich her stieß, in Fetzen, laut, einsam, mutig; bis zum Park war es nicht mehr weit, doch schien es ihm plötzlich besser, den Park zu umgehen; die stillen Wege unter zarten, hängenden Zweigen, die verträumten Bänke zu zweit, das erste Gras, die Kinder, die Hunde, die alten Frauen, alles das war besser zu meiden, solange dort drüben Leute sangen, solange sie schrien: Wir fliegen, wir wissen zu sterben.
Solange dieses Lied in der Luft hing, war der Park ein Spuk, ein Traum, waren die Wege Auswege, es sei denn, man ging sie mit offenen Augen. Dann waren das alte Frauen, schwarz und krumm im Gedanken an Söhne, die auch einst gesungen hatten; dann waren das Bänke wie Dunkelkammern mit Rotlicht ohne Ausblick; dann waren auf Schaukeln Kinder, die starben und lachten.
Er ging, das Lied in den Ohren, zurück in die Stadt und hörte hinter den Güterschuppen am Bahnhof Schlachtvieh nach Wasser brüllen.
Steinhoff hätte anrufen sollen, man hätte schließlich darüber reden können, versuchsweise, man würde ja sehen, Steinhoff wäre gewiss – hätte, würde, wäre. Steinhoff unterbricht und sagt: Zu viel Konjunktiv, Nik.
Steinhoff ist Kommunist, hält sich dafür, möchte es sein, war seit Herbst 46 nicht mehr jenseits der Elbe. Steinhoff glaubt nicht an Konjunktive, er arbeitet, schweigt, verachtet die Tage und wartet auf morgen. Was etwa sein würde wenn, interessiert ihn nicht, denn er weiß, was ist. Manche, die ein Bein oder sonst was verloren haben, greifen mit scharfem Instinkt nach Ersatz, den so leicht niemand wieder zerstören kann und der deshalb mehr Halt verspricht als zwei lebendige Beine. Steinhoff lacht über Hoffnungen, denn er hat Hoffnung. Das ist viel wert. Nicht viel für Zuschauer. Immerhin, ein Anruf wäre trotz alldem eine freundliche Geste gewesen. Perdu, auch das. Jeder spricht seine eigene Sprache, wer schweigt, wird von allen verstanden. Köhler lächelte. An anderen Tagen war sein Weg nach Haus oft von innen her ein gefälliges Plauderstündchen. Man war der getanen Arbeit noch nicht allzu fern und fand seinen Weg aus der Ordnung des Tages noch ein Weilchen in Ordnung. Erst nach dem Abendessen gewöhnlich … aber das ist ja sattsam bekannt. Heute war es anders damit, heute hatte die kleine Sekretärin ohne Absicht und ohne Ahnung den Tag schon morgens zerbrochen, den schönen, glatten Tag. Und mit den Bruchstücken saß man jetzt da.
Er lief nicht mehr weit, fand ein Lokal, das er kannte, und bestellte reichlich und gut: am Anfang Salat, später würzigen Reis, Pilze in Butter und Banane auf feinem Filet, schließlich Käse, dazu Wein, und am Ende die Zigarette zu zwölfeinhalb. Es war eine liebe Gewohnheit, gut und ausgiebig zu essen stets und besonders dann, wenn es mit den Dingen des Geistes nicht eben zum Besten stand, lag doch in solch einer Übung die Chance, wenn auch nicht unbedingt freundlich, so doch locker und weich gebettet sich den Nebenmenschen verbunden zu fühlen.
Er betrachtete, ohne dabei das Spiel mit dem Zahnstocher aufzugeben, still die Gesichter ringsum, lobte den Koch und warf heimlich Fragen aus wie blitzende Häkchen, ließ die Opfer ein bisschen schnappen und zappeln und saß schließlich doch selbst am Haken fest. Aber er spielte das Spiel noch weiter, vielleicht dass am Ende doch noch ein Fisch, des Sprechens mächtig, Auskunft geben würde über verlorene Schätze wie der rote Fisch in den Märchen. Er hieß die Leute von ihren vollen Näpfen aufstehen und fragte: ›Wie alt sind Sie bitte?‹
›Jahrgang 89, Teilnehmer der Schlacht von Tannenberg.‹
›Das macht nichts. Am 24. Juni 1922 also waren Sie dreiunddreißig. Rathenau* war auf der Straße erschossen worden, erinnern Sie sich? Haben Sie den Prozess gegen seine Mörder zur Rechten* verfolgt? Ging man damals an deutschen Gerichten nicht merkwürdig milde vor?‹
›Juden haben in der deutschen Politik nichts zu suchen.‹
›Wer sagt das?‹
›Mein Vater.‹
›Danke, der Nächste bitte. Bleiben Sie ruhig sitzen, mein Herr, wenn Ihnen das Stehen schwerfallen sollte.‹
›Jahrgang 98.‹
›Fein, dann waren Sie also, wie man so sagt, in guten Mannesjahren, als im März 33 vierundvierzig Prozent der Wähler dem Führer ihr Vertrauen schenkten. Was waren damals Ihre Gedanken?‹
›Der marxistisch-jüdische Mob terrorisierte die Straße.‹
›Und den künftigen Terror fürchteten Sie nicht? Es stand doch damals schwarz auf weiß: Mein Kampf, Mythus, Stürmer, VB – erinnern Sie sich?‹
›Vornehmheit besteht nicht darin, sich von dem Gemeinen fernzuhalten oder es zu ignorieren; sie besteht darin, das Gemeine zu bekämpfen; wer nicht durch Schmutz waten kann, wird nie eine Schlacht gewinnen.‹*
›Wer sagt das?‹
›Handbuch der Judenfrage, 1907.‹
›Danke. Und Sie?‹
›Jahrgang 04, katholisch, Erzieher.‹
›Bleiben Sie trotzdem ruhig, hören Sie: als 1933 der Heilige Stuhl mit Hitler in Sachen des Konkordates zu verhandeln bereit war, haben Sie da protestiert?‹
›Wir katholischen Lehrer wissen um die Gefährdung des Menschen und plädieren deshalb seit eh und je für die bewusst christkatholische Schule zum Schutz unserer Jugend gegen den artfremden Einfluss wurzelloser Intellektueller.‹
›Sie haben gewiss gern Gertrud Bäumer gelesen?‹
›Groß!‹
›Benn?‹
›Manche Gedichte sind ohne Zweifel außerordentlich fein nachempfunden.‹
›Binding?‹
›Ungewöhnlich sauberer Charakter.‹
›Brecht?‹
›Ich bitt Sie!‹
›Buber?‹
›Wie?‹
›Bloch?‹
›Sind das nicht Juden?‹
›Danke. – Hallo, Sie, bitte bleiben Sie noch!‹
›Ich habe einen Termin, mein Herr.‹
›Dennoch, bleiben Sie bitte! Was haben Sie für ein bemerkenswertes Gesicht, die vielen Narben, sind Sie gefallen?‹
›Mensur, schwere Säbel. Ich sage Ihnen, junger Freund, deutsch sein, das hieß schon immer …‹
›Das ist sicherlich richtig. Und am 10. Mai 1933? Erinnern Sie sich, Heidelberg, Flamme empor? – Gegen Gesinnungslumperei und Verrat! Für Hingabe an Volk und Staat! Ich übergebe der Flamme die Schriften von Friedrich Wilhelm Foerster.* Hat sich da nicht etwas in Ihnen gesträubt, Herr Landgerichtsdirektor?‹
›Wir wollten ein Schrifttum, dem Familie und Heimat, Volk und Blut, dem das ganze Dasein der frommen Bindungen wieder heilig ist!‹*
›Sie mögen religiös veranlagt sein, das ehrt Sie, doch gestatten Sie, noch etwas, Sie sind doch Jurist. Ist Ihnen in den Tagen nach dem 30. Juni 1934 irgendetwas Besonderes aufgefallen?‹
›Das alles war damals sehr schwer zu übersehen.‹
›Konnten Sie nicht lesen?: Die zur Niederschlagung hoch- und landesverräterischer Angriffe am 30. Juni, 1. und 2. Juli 1934 vollzogenen Maßnahmen sind … rechtens.* Ist Ihnen dieses eigenartige Gesetz damals nicht bekannt geworden? Gut, andere Ereignisse erforderten nicht einmal die Kenntnis der Kunst des Lesens: Wo waren Sie in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938, Herr Rechtswahrer?‹
›Ich versichere hiermit an Eides Statt, dass ich mich an nichts mehr erinnern kann.‹
›Schade. Erlauben Sie mir bitte noch eine persönliche Frage. Haben Sie einen Sohn?‹
›Oberfähnrich. Gefallen. Raum Smolensk. September 1941.‹
›Smolensk? Wie kam Ihr Sohn dorthin?‹
›Getreu seinem Fahneneid.‹
›Danke. Dann trauern Sie am besten auch weiterhin dankbar und stolz!*‹
Es kam Köhler in diesem Augenblick zum ersten Mal deutlich der Gedanke, es möchte beneidenswert sein, im Raume Smolensk, Saloniki, St. Nazaire, gleichviel: im Raum diesseits der Väter beizeiten zu Tode gekommen zu sein. Ekel und Neid kamen ihm unter die Haut wie Pest und Giftgas, Scham, die einen verdirbt beim Anblick von Vätern, die versagt haben und die heute, anstatt zu bekennen und nachzudenken, sich brüsten, im Recht zu sein, oder schweigen. Keiner hält stand, keiner sieht mit offenen Augen zurück. Wo fänden sie sich sonst auch, diese Väter! Bei sich selbst, ohne Deckung, und mit der Auflage, endlich zu antworten, aber sie schweigen. Sie haben sich außer sich gebracht mit Heilsgeschrei, mit Fahnenschwenken, mit wilden Wünschen nach falschen Formaten, sie sind außer sich geraten in der Begierde nach Rückfall und Urschlamm, und jetzt finden sie nicht mehr zu sich zurück, jetzt schämen sie sich – kurzhosig, schlecht beraten, ertappt – und randalieren, schweigen oder flüchten in längst verlassene, geschleifte, ach so mürbe Bastionen, kriechen noch einmal und wieder und wieder in alte übelriechende Kleider (wer lügt, der schwitzt), oder aber sie sitzen da und trauern in schon längst nicht mehr glaubhaften Versen:
Wenn doch nur der Krieg nicht gekommen wäre!
Was soll das? Abgesehen davon, dass es gut war, dass er kam, denn sonst hätten wir ihn nicht verlieren können und wären nicht frei geworden, befreit worden, muss es genauer heißen … Kriege ›kommen‹ nicht über Nacht ins Land wie Schnee und Frühlingsrauschen, Kriege werden gemacht durch falsches Denken, so wie Freiheit nicht das Feuer ist*, sondern richtiges Denken.
Damals hatte die Jugend noch Ideale!
Was soll das? Es ist wichtig, dass zwei mal zwei vier ist, und es lohnt sich, und es beschäftigt einstweilen, darüber nachzudenken, warum das wichtig ist.
Einmal möchte ich noch jung sein!