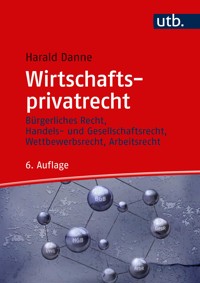
35,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: UTB GmbH
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Ein Einstiegsband für Studierende der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, die sich erstmals mit den rechtlichen Grundlagen des Wirtschaftsprivatrechts auseinandersetzen Dieses Lehrbuch behandelt das Bürgerliche Recht, das Handels- und Gesellschaftsrecht, das Wettbewerbs- und das Arbeitsrecht und ist sehr gut zur gezielten Klausur- und Prüfungsvorbereitung geeignet. Die notwendigen Kenntnisse werden einprägsam und anschaulich durch viele Fallbeispiele, Übersichten und Schaubilder vermittelt. Aufbau und Darstellungsstiel des Bandes erleichtern das Erlernen der Bearbeitung juristischer Fälle. Wertvolle Einstiegsliteratur für Studierende, die aber auch Praktikern im Rahmen einer Weiterbildung zum Wirtschaftsprivatrecht als wertvolle Hilfe dient.
Das E-Book können Sie in einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützt:
Veröffentlichungsjahr: 2017





























