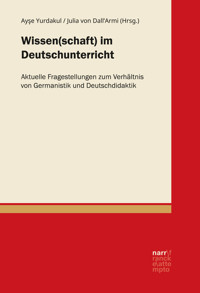
Wissen(schaft) im Deutschunterricht E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Sowohl die Deutschdidaktik als auch der Deutschunterricht nehmen vielfach Bezug auf germanistische Fragestellungen, was einen Blick auf die jeweiligen Referenzdisziplinen der Deutschen Philologie erfordert. Es lässt sich jedoch feststellen, dass fachliche Grundlagen in Vermittlungskontexten nicht immer hinreichend thematisiert oder vermittelt werden, weshalb ihre Potenziale für sprachliches, literar- und medienästhetisches Lernen oft ungenutzt bleiben. Ziel dieses Sammelbandes ist es, aktuelle Aspekte des Verhältnisses von Germanistik, Deutschdidaktik und -unterricht näher zu beleuchten und ihre inter- wie transdisziplinären Potenziale in den Vordergrund zu rücken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 628
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ayşe Yurdakul / Julia von Dall’Armi (Hrsg.)
Wissen(schaft) im Deutschunterricht
Aktuelle Fragestellungen zum Verhältnis von Germanistik und Deutschdidaktik
DOI: https://doi.org/10.24053/9783381119028
© 2025 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
ISBN 978-3-381-11901-1 (Print)
ISBN 978-3-381-11903-5 (ePub)
Inhalt
Einleitung1
1Der Deutschunterricht im Fokus der germanistischen Einzeldisziplinen
Als philologische Disziplin umfasst die Germanistik traditionell die fachwissenschaftlichen Einzeldisziplinen Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft, Mediävistik sowie die fachdidaktischen Einzeldisziplinen Sprachdidaktik und Literaturdidaktik (Rösch 2017: 5). Sie erforscht und lehrt mithin auf der einen Seite die deutsche Sprache und deutschsprachige bzw. ins Deutsche übersetzte Literatur im Hinblick auf synchrone und diachrone Aspekte und auf der anderen Seite die Vermittlung der deutschen Sprache und Literatur. Sämtliche oben aufgeführten fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Teildisziplinen bilden neben der (Schul-)Pädagogik und Psychologie die tragenden Säulen des Lehramtsstudiums und des späteren Lehrberufes, in deren Fokus der (erst-, zweit- oder fremdsprachliche) Deutschunterricht, damit einhergehend das auf die deutsche Sprache und Literatur bezogene und in diesem Kontext zu vermittelnde bzw. zu erwerbende Wissen und der hieraus ableitbare Kompetenzerwerb stehen.
Der bisherigen Fachliteratur mangelt es an einer (expliziten) Definition des Ausdrucks Deutschunterricht, der gewöhnlich als Unterricht im Schulfach Deutsch zu verstehen ist und den wir nach Sichtung verschiedener Arbeiten (s. u.) im Hinblick auf die Zielgruppe, Schulstufe, Inhalte und Lernziele als vielschichtig einschätzen. Die fraglichen Theorien führen in Bezug auf dieses Schulfach in einer Art Umfangsdefinition verschiedene Unterarten auf, die jene Vielschichtigkeit nahelegen. Erstens wird hinsichtlich der Zielgruppe zwischen erstsprachlichem Deutschunterricht (Deutsch als Erstsprache), zweitsprachlichem Deutschunterricht (Deutsch als Zweitsprache) und fremdsprachlichem Deutschunterricht (Deutsch als Fremdsprache) differenziert (Liedke/Riehl 2018: 7, Liedke 2018: 66). Zweitens ist in Bezug auf die Schulform bzw. -stufe zwischen Deutschunterricht in der Primarstufe, Sekundarstufe I und Sekundarstufe II (vgl. Jesch 2020: 2–3, Rösch 2017: 5) mit unterschiedlichen schulartspezifischen Anforderungen zu unterscheiden.1 Drittens kristallisieren sich den Unterrichtsgegenstand tangierend drei Formen des Deutschunterrichts heraus: Sprachunterricht, Literaturunterrricht und Medienunterricht (Rösch 2017: 2, Staiger 2018: 248), die zumeist integrativ, d. h. gegenstandsübergreifend unterrichtet werden (sollten) (vgl. hierzu etwa Pieper/Bredel 2015). Das Unterrichtsfach Deutsch ist somit auch als übergeordneter Terminus für verschiedene, einander nicht selten überschneidende bzw. miteinander systematisch verknüpfte sprach-, medien- wie literaturbezogene Unterrichtsgegenstände zu verstehen.
In allen drei Unterrichtsformen und in jeder Schulstufe steht der Erwerb von Kompetenzen bzw. Kompetenzbereichen im Vordergrund des Deutschunterrichts.2 In Bezug auf den Deutschunterricht wird hier zwischen domänenspezifischen Kompetenzbereichen (Sich mit Texten und anderen Medien auseinandersetzen in Bezug auf den Literaturunterricht und Sprache und Sprachgebrauch untersuchen in Bezug auf den Sprachunterricht), prozessbezogenen Kompetenzbereichen (Sprechen und Zuhören, Schreiben und Lesen) unterschieden (Kultusministerkonferenz 2022: 8, siehe auch Bleiker (2025) in diesem Sammelband).
Ausgehend von den Beiträgen des vorliegenden Sammelbandes (s. u.) vertreten wir ein sehr weites Deutschunterrichtskonzept, das sämtliche (oben erwähnten) Subarten umfasst. Auf der Basis der oben besprochenen Aspekte sowie unserer angestellten Überlegungen definieren wir Deutschunterricht in konkreter Weise als Schulfach, in dem die deutsche Sprache, Literatur und andere Medien unter Berücksichtigung verschiedener Kompetenzbereiche auf erstsprachlichem, zweitsprachlichem oder fremdsprachlichem Niveau in einer bestimmten Schulform vermittelt und erworben werden.
2Bezugswissenschaften der Deutschdidaktik
Das Wechselverhältnis von Deutschdidaktik und ihren Bezugswissenschaften hat eine lange Geschichte und ist bis heute umstritten (Brüggemann 2014: 143, Bräuer 2016). In der bisherigen Forschung werden hierzu vier verschiedene Ansichten diskutiert, von denen zwei konträre Theorien darstellen. Gerner (2014: 182) und Gailberger (2019: 335) erachten die Bildungswissenschaften (Pädagogik, Soziologie und Psychologie) als einschlägige Referenzwissenschaften, wohingegen Neuland (2012: 21)1, Graf (2021: 50), Paefgen (2006: VIII) oder auch Bogdal (2002: 13) zufolge die Deutschdidaktik mit der Fachwissenschaft (Sprachwissenschaft und Literaturwissenschaft) interagiert. Anders als diese Forscher vertreten Köhnen (2011: 87), Leubner et al. (2012: 12), Rothstein (2019b: 29), Bernhardt/Hardtke (2022: 10) und Goer (2023: 25) die differenzierte Auffassung, dass die Deutschdidaktik sowohl in einem innerfachlichen Verhältnis mit den germanistischen Fachwissenschaften (Sprachwissenschaften und Literaturwissenschaften) als auch in einem interdisziplinären Verhältnis v. a. mit der Pädagogik, Psychologie, Soziologie, Philosophie, Allgemeine Didaktik, Kommunikationstheorie und Geschichte steht.2 Schließlich findet sich auch die These, wonach die Literaturdidaktik „als eigenständige Disziplin“ auch eigene Untersuchungsgegenstände hat (Schultz-Pernice 2019: 1).3
Alle Positionen haben ihre Berechtigung (vgl. hierzu auch Brüggemann 2014: 158, Gerner 2014: 177). Da die überwältigende Mehrheit der Forschungszugänge für die Literaturdidaktik jedoch von mehreren Bezugsgrößen ausgeht, die Literaturdidaktik also nicht als unabhängig ansieht, muss eine Positionierung im Referenzrahmen dieser Bezugswissenschaften stattfinden; dies ist in Abhängigkeit vom zu verfolgenden Erkenntnisinteresse vonnöten. Blickt man auf den Deutschunterricht als ein dynamisches Gefüge aus Lehrplaninhalten, lehrkraftbezogener methodischer Vermittlung, allgemeinen akteursabhängigen erziehungswissenschaftlichen und psychologischen Classroom-Management-Fragen, Sozialformen und Medien (vgl. hierzu auch Leubner et al. 2012: 153), so wird deutlich, dass sich eine systematische Untersuchung von Fachlichkeit im Unterricht angesichts der wenig begrenzbaren wie häufig situationsabhängigen Variablen in Vermittlungsprozessen auf personen- wie situationsunabhängige Konstanten des Unterrichts beziehen sollte, wenn generalisierbare Aussagen getroffen werden sollen bzw. müssen. Deshalb rekurrieren wir auf die erstgenannte Positionierung und fokussieren uns auf eine innerfachliche Relation zwischen der Deutschdidaktik und den germanistischen Teildisziplinen. Verbunden ist mit dieser Einordnung die Vorstellung von einer intersubjektiven Überprüfbarkeit eines germanistisch beeinflussten Kompetenzerwerbs. Geht man davon aus, dass die Germanistik ein wesentlicher, wenn auch nicht der einzig relevante Vermittlungsgegenstand der Deutschdidaktik ist, so lässt sich fraglos überprüfen, wie und ob die zu vermittelnden Inhalte beim Adressaten abrufbar sind.4 Die intersubjektive Überprüfbarkeit von aus germanistischen Referenzwissenschaften ableitbaren Lernzielen stellt unseres Erachtens ein wesentliches Moment einer wissenschaftlichen Auffassung von Fachdidaktiken dar. Die im Zuge dieser Verortung vorgenommene notwendige Reduktion soll dabei nicht die Relevanz der Verortung der Deutschdidaktik im Bereich der Bildungswissenschaften schmälern, im Gegenteil: Die Zuordnung bietet Anschlussmöglichkeiten an diese, da Kompetenzbasierung auch eine empirische Überprüfung von Forschungsergebnissen erforderlich macht (vgl. hierzu auch Brüggemann 2014: 166–167) und sich in vielfältiger Hinsicht als anschlussfähig für Bildungsfragen (vgl. hierzu etwa Albrecht et al. 2025) erweist. Dabei ist die germanistische Kompetenzorientierung der Deutschdidaktik von unmittelbarem Belang für den Deutschunterricht selbst, der zum Erreichen der Ziele entsprechend modelliert werden muss: Zur Gestaltung eines kompetenzorientierten Deutschunterrichts werden verschiedene bzw. verschiedenartige Prinzipien thematisiert (vgl. Düsing/Köller 2023: 35). So stehen im Vordergrund des Deutschunterrichts die folgendenTeilgebiete: 1) Mündliche Kommunikation, 2) Schriftliche Kommunikation, 3) Lesen, 4) Text- bzw. Medienverständnis und 5) Sprachreflexion, die auch in den Kernlehrplänen innerhalb der Bundesländer verankert sind (Köhnen 2011: 94–95).5 Die Bereiche 1, 2, und 5 zielen dabei primär, wenn auch nicht ausschließlich auf die Sprachkompetenz (Krelle 2019d: 397–401) ab, also auf die „Fähigkeit von Menschen, kommunikative Situationen […] intentions- und adressatenspezifisch zu bewältigen“ (Krelle 2019d: 397) und über Sprache zu reflektieren. Die der Sprachkompetenz zuzuordnenden Unterkategorien Gesprächskompetenz (Krelle 2019a: 116–118), Rechtschreibkompetenz (Krelle 2019b: 311–313) und Schreibkompetenz (Krelle 2019c: 362–365) können sich dabei innerhalb der Sprachdidaktik auf einen breiten Konsens verlassen. Diese unumstrittene Kompetenzorientierung gilt auch für die Implementierung von Medien im Deutschunterricht (Frederking et al. 2012: 89), wie die dem gleichnamigen Einführungskapitel zugrundeliegende Definition als „Fähigkeit und Bereitschaft zum Sprechen und Zuhören, zum Schreiben und Lesen und zum Untersuchen von Sprache in und mit verschiedenen Medien“ (Maiwald 2022: 168) zeigt, die stellvertretend für andere Medienkompetenzmodelle im Deutschunterricht zitiert sei. Demgegenüber ist die Vorstellung der Erfassbarkeit literarischen Kompetenzerwerbs in der gegenwärtigen Literaturdidaktik äußerst umstritten:
„Im Kontext von literarischen Rezeptions- und Produktionsaufgaben ist eine solche Zieldefinition aber bekanntlich schwierig vorzunehmen. […] Der Literaturunterricht zielt […] auch auf Selbstkompetenz oder soziale und kulturelle Kompetenz. Völlig außen vor steht so etwas wie Genussfähigkeit, obwohl ästhetischer Genuss wohl die wichtigste Gratifikation ist, die zur literarischen Text- und Medienrezeption verlockt.“ (Kepser 2012: 74)
Legt man die elf Aspekte literarischen Lernens nach Spinner (2015) als erstrebenswertes Ziel literaturdidaktischer Bemühungen zugrunde, so wird in der Tat schnell offenkundig, dass sich die bei der Literaturrrezeption abspielenden kognitiven Prozesse nur schwer erfassen lassen (vgl. auch Schilcher/Pissarek 2013: 1), auch wenn es bereits erste Ansätze dazu gibt (vgl. etwa Albrecht 2022 oder Meier et al. 2012).6 Zudem ist regelrecht umstritten, ob überhaupt in allen Fällen der Kompetenzbegriff angewandt werden kann (Kammler 2012). Dabei sind die von Spinner (2015: 189) aufgeführten Aspekte bewusst nicht zur Überprüfung angelegt, denn es darf auch als Kompetenz gelten, „was wir empirisch (noch) nicht überprüfen können“ (Spinner 2015: 189). Neben dieser Auffassung finden sich ausgesprochen kompetenzorientierte Zugänge in der literaturdidaktischen Forschung wieder, die sich unter dem übergeordneten Terminus Texterschließungskompetenz (Ensberg 2005, Zabka 2007, Leubner et al. 2012: 34, Köster 2015) oder Literarische Textverstehenskompetenz (Meier et al. 2012) fassen lassen. Im Hinblick auf Kompetenzen sollen in der Deutschdidaktik also sowohl überprüfbare als auch nicht überprüfbare Möglichkeiten des Lern- und Leistungserwerbs integriert sein (vgl. hierzu etwa Spinner 2015: 189).
Doch inwiefern gehen diese Überlegungen nun in den Deutschunterricht selbst ein?
Grundsätzlich wird zwischen den germanistischen Teildisziplinen und der Deutschdidaktik ein Theorie-Praxis-Wechselverhältnis angenommen, von dem im realen Deutschunterricht des Öfteren wenig Gebrauch gemacht wird. Dieses Problem ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, die wir im anschließenden Kapitel diskutieren werden.
3Theorie-Praxis-Probleme zwischen der germanistischen Fachwissenschaft, der Deutsch- bzw. DaF-/DaZ-Didaktik und dem Deutschunterricht
Da sowohl die Deutsch- und DaF-/DaZ-Didaktik als auch der Deutschunterricht inhaltliche Schnittmengen mit den fachwissenschaftlichen Einzeldisziplinen der Germanistik offenbaren (Pieper/Wieser 2012, Rödel 2014b), erweist sich die reflektierte Auseinandersetzung mit dem wechselseitigen Einfluss von Fachwissenschaft und Fachdidaktik als unentbehrlich. Birk/Buffagni (2012: 7) betonen, dass die Theorie auf der Empirie der Praxis und im umgekehrten Fall die Praxis auf dem theoretischen Fundament der germanistischen Fachwissenschaft beruht und mithin eine enge Verzahnung von germanistischer Theorie und deutschdidaktischer Praxis besteht. Dennoch geht sowohl aus der einschlägigen Forschung als auch aus verschiedenen Bildungsmedien hervor, dass fachwissenschaftliche Grundlagen im Deutschunterricht nicht immer hinreichend und terminologisch konsistent vermittelt und fachspezifische Potenziale der Germanistik in Vermittlungsfragen nicht immer sinnvoll genutzt werden (können) (vgl. zur Differenz zwischen Germanistik und Fachdidaktik auch Abraham 2019). Um einen wissenschaftlich abgesicherten Deutschunterricht zu ermöglichen (vgl. Rothstein 2019b: 29), ist eine enge Zusammenarbeit zwischen der Fachdidaktik und der Fachwissenschaft unabdingbar. Zu den zentralen Schnittstellen von Fachwissenschaft und Fachdidaktik zählen in spezifischer Weise die Schnittstelle Sprachwissenschaft/Sprachdidaktik sowie die Schnittstelle Literaturwissenschaft/Literaturdidaktik, die unserer Meinung nach intensiver in den Dialog treten und kooperieren (müssen), um einen kognitiv aktivierenden Deutschunterricht gestalten zu können (vgl. hierzu auch Boyken 2016).
Ferner divergieren die germanistischen Fachwissenschaften, die Deutschdidaktik (auch die DaF- bzw. DaZ-Didaktik) und der Deutschunterricht im Hinblick auf die dialektische Verortung. Während die germanistische Fachwissenschaft den theoretischen Pol und der Deutschunterricht den praktischen Pol jenes dialektischen Verhältnisses darstellt, übernimmt die Deutschdidaktik diesbezüglich eine Zwischen- sowie Vermittlerrolle (in ähnlicher Formulierung auch in Berger 2018: 10). Aus diesem Grund operieren die germanistischen Disziplinen und der Deutschunterricht mit verschiedenen Methoden und setzen unterschiedliche Ziele an (vgl. hierzu auch Jagemann 2019).
Rothstein (2019a: 14–17) verweist darauf, dass der Deutschunterricht an curriculare Vorgaben gebunden ist, was der kritischen Auseinandersetzung mit Inhalten, die in der Fachwissenschaft gefordert wird, gegenübersteht. Eine weitere Differenz zwischen Deutschunterricht und Fachwissenschaft besteht darin, dass im Deutschunterricht kanonische und prototypische Unterrichtsinhalte und damit einhergehend (vermeintliche) unterrichtliche Fakten vermittelt werden. Hingegen intendiert die Fachwissenschaft in Bezug auf einen Untersuchungsgegenstand eine Theoriebildung (konzeptionelles Denken und Handeln), Abstraktion, Spezialisierung und Differenzierung (vgl. Goer 2023: 24). Die Deutschdidaktik sowie die DaF-/DaZ-Didaktik versuchen in diesem Kontext, den Spagat zwischen der germanistischen Fachwissenschaft und dem curricular gebundenen Deutschunterricht zu schaffen.
In Bezug auf das Verhältnis Sprachwissenschaft, Sprachdidaktik bzw. DaF-/DaZ-Didaktik und Sprachunterricht ist zu konstatieren und in exemplarischer Weise zu nennen, dass vornehmlich in Bezug auf den grammatischen Forschungs- bzw. Lerngegenstand (z. B. Lexem- bzw. Wortarten, Satzarten) und in Bezug auf den schriftsprachlichen Forschungs- bzw. Lerngegenstand wenig Kooperation zwischen Sprachwissenschaft und Sprachunterricht herrscht. Während in der Sprachwissenschaft eine Vielfalt an Grammatiktheorien (z. B. Weinrich 1993, Ágel 2017, Eisenberg 2020a, Eisenberg 2020b) existiert, wird im Grammatikunterricht oft immer noch eine kanonische und meist auch inkonsistente (längst überholte) Grammatik (z. B. keine Differenzierung zwischen Lexemarten und Wortarten oder bei der Klassifikation von Satzarten eine Vermischung von pragmalinguistischen und syntaktischen Kriterien) angesetzt, was Schüler und Schülerinnen oder Lernende beispielsweise zu (potentiellen) Zuordnungsfehlern im Rahmen einer Übungsaufgabe verleitet.1 Ein weiteres terminologisches Problem fällt im Orthographieunterricht auf, der auf einer präskriptiven Basis stattfindet und hierbei die deskriptive schriftlinguistische Teildisziplin Graphematik, die neben der orthographisch korrekten Schreibung (z. B. <Hund>) auch durch polyrelationale Phonem-Graphem-Korrespondenzen entstehende (graphematisch) lizenzierte Schreibvarianten (z. B. <Hunt>, <Hundt>) für ein Wort zulässt (vgl. Neef 2005: 8–10), ausblendet. Dabei könnte der Orthographieunterricht den Nutzen ziehen, potentielle Rechtschreibfehler von Schülern und Schülerinnen nicht per se als falsch zu erachten, sondern als graphematisch richtig zu tolerieren und auf einer graphematischen Basis die richtige Schreibung zu vermitteln. Bredel et al. (2010: 1–3) betonen, dass ein präskriptiver oder curricular gebundener Orthographieunterricht, der sich jeglicher Systematik entzieht, das Verständnis der Lernenden über die Schriftstruktur (und unserer Ansicht nach auch über das Schreibbewusstsein) erschwert bzw. gar verhindert. Um orthographische Lernschwierigkeiten von Schülern aufzudecken, empfehlen Bredel et al. (2010: 3) „eine angemessene Schriftspracherwerbstheorie“, auf der der Orthographieunterricht fußen müsste.
Auch die Trias Literaturwissenschaft, Literaturdidaktik und Literaturunterricht erweist sich als nicht unproblematisch, wenngleich hier die Konflikte anders gelagert sind:
„Wenn es beispielsweise um ein linguistisches Thema im Deutschunterricht geht, dann besteht die Didaktisierung darin, das Thema so aufzubereiten, dass es dem Kompetenzstand der Schüler*innen entspricht, sie fordert und fördert, kumulativ und exemplarisch sein kann. Im Literaturunterricht hingegen besteht das Vorgehen nicht darin, vorhandene Interpretationen aus dem literaturwissenschaftlichen Kontext herunterzubrechen, sodass diese quasi als didaktisch reduzierte Interpretationsprodukte in den Unterricht gelangen. Vielmehr besteht die Herausforderung der Vermittlungsinstanz – etwa der Lehrkraft oder der Autor*in einer didaktischen Handreichung – darin, eine didaktisch motivierte Interpretation anzustellen, auf deren Basis dann wiederum spezifische Aufgaben entwickelt werden, die wiederum Textarbeit und Interpretationen der Schüler*innen ermöglichen.“ (Bernhardt 2022: 15)
Diese Unterschiede zwischen Literatur- und Sprachdidaktik erklären das komplizierte Verhältnis der Literaturdidaktik zur Literaturwissenschaft. Nicht selten ist die Diskussion von wechselseitigen Vorwürfen geprägt: So verdränge die Literaturdidaktik die Literatur als Untersuchungsgegenstand; die Literaturwissenschaft verdrängt den Vermittlungsaspekt (Schultz-Pernice 2022: 57–58). Die Defizite dieser Entwicklung sind einigen Literaturdidaktikern bewusst, weshalb nicht wenige ein durchaus reges Interesse an der Literaturwissenschaft als Referenzwissenschaft zeigen: „Literaturwissenschaft wird definiert als Wissenschaft, deren Gegenstand die Literatur ist; die Literaturdidaktik ist eine der Teildisziplinen der Literaturwissenschaft, indem sie – als angewandte Literaturwissenschaft – diesen Gegenstand unter der Perspektive von Lehr- und Lernprozessen untersucht“ (Leubner et al. 2012: 12).2 Demgegenüber betonen zahlreiche Literaturdidaktiker ihre Eigenständigkeit, indem sie sich deutlich von der Literaturwissenschaft distanzieren (Abraham/Kepser 2005: 43) und die Nähe zu den Bildungs- oder Kulturwissenschaften (Kepser 2013) suchen oder Mischformen aus „Kultur- und Vermittlungswissenschaften“ vorschlagen (Rupp 2016: 196). Brüggemann fasst dieses Problem bündig:
„So entstehen Spannungen zwischen Fachwissenschaften und Fachdidaktik daraus, dass die Fachdidaktik einerseits als Teil des Wissenschaftssystems wahrgenommen werden will, andererseits aber nicht nur in ihrer Selbstbeschreibung, sondern auch funktionell an das Erziehungssystem angeschlossen ist.“ (Brüggemann 2014: 163)
Noch ein zweites Problem zeichnet sich ab: Das Verstehen der Literatur bildet in allen Fällen ein Referenzthema beider Wissenschaften. Der Verzicht auf eine Berücksichtigung der Literaturwissenschaft bei der Bearbeitung didaktischer Fragen muss damit notwendigerweise in eine Sackgasse führen:
„Will man erörtern, was es bedeutet, literarisches Verstehen und damit einen kompetenten Umgang mit einem literarischen Text auszuweisen, so muss man sich zuvorderst um den Gegenstand selbst bemühen. Das literarische Werk, das verstanden werden soll, muss einer literaturwissenschaftlichen und -didaktischen Analyse unterzogen werden.“ (Freudenberg 2012: 259)
Pieper legt einer erfolgreichen literaturdidaktischen Auseinandersetzung mit Texten die Notwendigkeit eines „konzeptuelle[n] Wissen[s] über Literatur“, „[von] Spezifika der Gattung und der Poetologie“ (Pieper 2016: 138) zugrunde und spricht von der „Wissensbasiertheit des literarischen Lesemodus“ (ebd.). Auch Wieser postuliert eine Wissensorientierung: „Betrachtet man zunächst die Wissenstypen, wäre beispielsweise zu klären, welches konzeptuelle literaturwissenschaftliche und linguistische Wissen für literarische Verstehensprozesse Relevanz gewinnen kann“ (Wieser 2016: 47). Auch das LUK-Projekt zur Ermittlung einer „literarästhetischen Verstehens- und Urteilskompetenz“ (Albrecht 2022: 158) basiert auf literaturwissenschaftlichen Überlegungen (Albrecht 2022: 159). Zudem lässt sich zeigen, dass das Abrufen geeigneten Fachwissens wesentlich zur Bearbeitung von Aufgaben im Literaturunterricht beiträgt (vgl. Meier et al. 2012).
Dennoch bleibt teilweise unklar, welches Wissen zur Grundlage der Literaturdidaktik gemacht werden soll:
„Solange sich die Fachdidaktik aber nicht auf ein wissenschaftlich geprüftes Wissen über den Nutzen von Handlungswissen respektive das Ge-/Misslingen von Vermittlungsvorschlägen berufen kann, bleibt diese Funktion eine Quelle für Zweifel an ihrer Wissenschaftlichkeit und damit für Konflikte mit der ,reinen‘ Fachwissenschaft.“ (Brüggemann 2014: 164)
Vielen theoretischen Konzepten literarischer Kompetenz (Schilcher/Pissarek 2013, Boelmann/König 2022, Sosna 2023, König 2020, Leubner et al. 2012: 23) und ihrer Messung (Frederking 2008, Boelmann/König 2022, Leubner et al. 2012) liegen Referenzrahmen literaturwissenschaftlichen Wissens zugrunde, eine Position, der wir uns ebenfalls anschließen möchten. Wenn – wie in unserem Band – die Fachwissenschaft ebenfalls für uns zum Ausgangspunkt für die Fachdidaktik genommen wird, so soll diese Referenzwissenschaft auch für die Unterrichtsgegenstände des Deutschunterrichts selbst gelten. Auch hier ergeben sich eigentlich recht vielfältige Anknüpfungspunkte für Literaturwissenschaft und -didaktik. Untersucht man die Lehrpläne im Hinblick auf die hier verorteten literaturwissenschaftlichen Wissensbestände, so stellt sich jedoch schnell heraus, dass auf veraltete und häufig inkonsistente Aspekte eines lange zurückliegenden Forschungsstandes zurückgegriffen werden dürfte.3 Freilich lässt sich dies auch in der Unterrichtsrealität feststellen. Lehrkräfte selbst reduzieren nach eigenen Angaben literaturanalytische Zugänge unverhältnismäßig, zumeist, ohne die literaturanalytischen wie interpretatorischen Konzepte in ihrer Komplexität zu sehen (Matz 2021: 591). Befragt man Referendare, so sehen diese weder die Literaturwissenschaft noch die Literaturdidaktik als Maxime für ihren Literaturunterricht, sondern vielmehr ihre eigenen Überzeugungen bzw. die biographischen Erfahrungen durch den eigenen, als Schüler und Schülerin erlebten Literaturunterricht (vgl. Wieser 2008: 260). Doch die Datenlage hierzu ist dürftig, ihre Reichweite begrenzt. Folgeuntersuchungen (u. a. in Form von Unterrichtsbeobachtungen) müssten eingesetzt werden, um zu überprüfen, ob diese lehrkraftseitigen Überzeugungen sich auch für konkrete Unterrichtssituationen verifizieren lassen bzw. welche fachwissenschaftlichen Inhalte von Lehrkräften tatsächlich genutzt werden.
Eine ähnliche Diskrepanz lässt sich auch für den Medienunterricht im Fach Deutsch erkennen. Die Hochschuldidaktik propagiert die „Fusion“ (Maiwald 2022: 167) von Deutschunterricht und Mediendidaktik, d. h. Medienarten und ihre Funktionsweisen müssen die Inhalte des Deutschunterrichts wesentlich bestimmen. Dem steht die Realität des Deutschunterrichts gegenüber. Frederking (2023) zeigt mit einer Untersuchung zu digitalen Kompetenzen von Lehrkräften vor und nach der Coronapandemie, dass sich bereits für eine „Integration“ (Maiwald 2022: 166) von Medien im Deutschunterricht großer Nachholbedarf abzeichnet (Montag 2021: 180). Kaum erforscht ist bislang jedoch, inwieweit die Medienwissenschaften Eingang in den Deutschunterricht gefunden haben, doch steht zu erwarten, dass die Referenzwissenschaften vor dem Hintergrund von Fragen der Medienkompetenz bislang wenig berücksichtigt wurden. Als handlungsleitende Fragestellungen können demnach für alle Teilgebiete der Deutschdidaktik die folgenden formuliert werden:
Welche fachwissenschaftlichen Inhalte müssen im Deutschunterricht erworben oder beherrscht werden, um erfolgreiche Lernprozesse bestreiten zu können?
Was davon wird bereits gewusst und angewandt?
Wie wird dieses Wissen vermittelt und wie könnte weiteres Wissen vermittelt werden?
Neben den oben skizzierten innerfachlichen Problemen, welche in der einschlägigen Forschungsliteratur thematisiert werden, gibt es noch weitere Motivatoren für die Entstehung des vorliegenden Sammelbandes: Der bisherigen Forschungsliteratur ermangelt es an einem Sammelwerk, das fachthemenspezifische Beiträge zum Deutschunterricht aus unterschiedlichen germanistischen Teilgebieten vereinigt. Stattdessen erfolgt entweder eine generische Erforschung des Theorie-Praxis-Problems in Bezug auf den Deutschunterricht (vgl. Didaktik Deutsch 2018, Didaktik Deutsch 2019) oder eine auf eine bestimmte oder zwei engverwandte germanistische Teildisziplinen zugeschnittene themenspezifische Betrachtung (z. B. eine auf die Sprachwissenschaft und Sprachdidaktik bezogene Untersuchung) (vgl. Bredel et al. 2010). In diesem Kontext stellen beispielsweise auch die fachlichen Schnittstellen Sprachdidaktik-Literaturwissenschaft sowie Literaturdidaktik-Sprachwissenschaft große Forschungsdesiderata dar, wohingegen sich innerhalb der Germanistik die Schnittstellen Sprachdidaktik-Sprachwissenschaft und Literaturdidaktik-Literaturwissenschaft als scheinbar intensiver bearbeitete Schnittstellen erweisen (vgl. Rödel 2014a, 2014b, Struve/Hethey 2024). Die fehlende Verknüpfung von Fachwissenschaften und Didaktiken innerhalb der Germanistik wird vielfach beklagt (vgl. Winkler/Schmidt 2016: 16). Überdies existieren bislang keine wissenschaftlichen Untersuchungen zur Mehrdimensionalität des Theorie-Praxis-Problems im Deutschunterricht: Zum einen werden das Wechselverhältnis zwischen der Fachwissenschaft und Deutschdidaktik und das Wechselverhältnis zwischen der Fachwissenschaft und dem Deutschunterricht nicht klar bzw. hinreichend voneinander dissoziiert und zum anderen wird das Theorie-Praxis-Problem im Deutschunterricht grundsätzlich auf das Wechselverhältnis zwischen (germanistischer) Fachwissenschaft und (germanistischer) Fachdidaktik reduziert und nicht auf das lineare Verhältnis von zwei Polen und einer Vermittlung (Germanistik-Deutschunterricht und Deutschdidaktik), auf das auch Rödel (2014a: 292) hinweist, ausgeweitet.
4Ziele und Beiträge des Sammelbandes
Ziel des Sammelbandes ist es, aktuelle Aspekte, verschiedene Perspektiven sowie Fragestellungen zum Verhältnis der germanistischen Fachwissenschaft, Deutschdidaktik bzw. DaF-/DaZ-Didaktik und des Deutschunterrichts aus sprachwissenschaftlicher, sprachhistorischer, sprachdidaktischer, literaturwissenschaftlicher, literaturdidaktischer sowie fremdsprachendidaktischer Perspektive kritisch zu beleuchten und ihre Chancen für den fruchtbaren Austausch in den Vordergrund zu rücken. Durch die Kompatibilität von Theorie und Praxis wird die Gestaltung eines kompetenzorientierten bzw. lernwirksamen Deutschunterrichts intendiert. Hierbei wird der Band sowohl empirische als auch theoretische Ansätze abdecken. Eingeteilt wird der Sammelband daher in die zwei Themenbereiche Sprache verstehen lernen und Literatur (mithilfe von Sprache oder Medien) verstehen lernen.
4.1Beiträge zum Themenfeld Sprache verstehen lernen
Mit dem Themenbereich Sprache verstehen lernen, der die Schnittstelle zwischen Sprachwissenschaft, -didaktik und -unterricht tangiert, befassen sich in diesem Sammelband neun Beiträge:
Johanna Bleiker beleuchtet in ihrem Aufsatz das komplexe Verhältnis zwischen Germanistik, Deutschdidaktik und Deutschunterricht an Volksschulen in Deutschland und der Schweiz. Hierbei widmet sich der Aufsatz der Fragestellung, warum im heutigen Deutschunterricht pragmalinguistische Konzepte keine bedeutendere Rolle spielen. Der Beitrag analysiert deshalb historische, institutionelle und fachspezifische Faktoren, die die Nutzbarmachung linguistischer Konzepte im Unterricht begünstigen oder begrenzen. Anhand einer Lehrveranstaltung für angehende Primarschullehrkräfte wird aber auch exemplarisch dargestellt, wie linguistische Konzepte innerhalb dieser Grenzen fruchtbar gemacht werden können.
Stephan Stein diskutiert in seinem Aufsatz die Schwierigkeiten bei der Umsetzung grammatiktheoretischen Wissens am Beispiel der Satzglieddefinition und Satzgliedanalyse im Sinne eines Problemaufrisses, der die Relevanz eines dezidierten Grammatikmodells für die angemessene Grammatikvermittlung verdeutlicht. Aus grammatiktheoretischer Perspektive thematisiert der Beitrag zum einen die Heterogenität in Extension und Definitionskriterien des Terminus Satz und zum anderen die Bestimmung des Satzgliedkonzeptes in den jüngeren Auflagen der Dudengrammatik und aus grammatikdidaktischer Perspektive das Verzeichnis grundlegender grammatischer Ausdrücke sowie ein exemplarisches Lehrwerk.
Dina Lüttenberg präsentiert in ihrem Beitrag Ergebnisse einer qualitativen Studie zur Thematisierung grammatischer Normen mit dem Fokus auf der terminologischen Einführung sowie den illokutiven Indikatoren der Normenthematisierungen in Schulbüchern für die Klassen 9 und 10. Hierbei handelt es sich um die exemplarische Analyse der vier in Niedersachsen bis 2025 zugelassenen Deutschbücher Praxis Sprache 9. Differenzierende Ausgabe, Praxis Sprache 10, P. A.U.L. D. 9 und P.A.U.L. D. 10. Differenzierende Ausgabe.
Martin Neef setzt sich in seiner Analyse kritisch mit dem Verzeichnis grundlegender grammatischer Fachausdrücke von 2019 auseinander, dessen Zielgruppe Schulbuchautoren und Lehrer sind, und prüft die in diesem Verzeichnis erarbeitete Wortartkonzeption (bestehend aus 15 Wortarten) aus linguistischer Perspektive auf ihre (terminologische) Konsistenz anhand eines kriterienbasierten Wortartmodells, das eine explizite, schlüssige, widerspruchsfreie und zum Forschungsgegenstand passende Klassifikation ermöglichen soll. Problematisiert wird in diesem Beitrag, dass das besagte Verzeichnis ohne Bezugsgrammatik konzipiert wurde und es zwei miteinander inkompatible und in sich inkonsistente Konzeptionen fusioniert.
Ayşe Yurdakul erarbeitet in ihrem Beitrag in kritischer Auseinandersetzung mit der einschlägigen Forschungsliteratur sowie mit einschlägigen didaktischen Beiträgen und exemplarischen Deutschbüchern eine topologisch fundierte Satztypologie bestehend aus Vorfeldsatz, vorfeldleerem Satz, Oberpositionssatz und Unterpositionssatz. Diese hebt sich von kanonischen (oberflächensyntaktischen) Einteilungen durch eine signifikant höhere Formalisiertheit sowie Konsistenz ab. Überdies wird in diesem Beitrag das Problem bisheriger Satzklassifikationen und im Vergleich dazu der didaktische Mehrwert des topologisch fundierten Satzmodells für die Deutschdidaktik und den Deutschunterricht anhand exemplarischer Satzbeispiele diskutiert.
Olga Aldinger thematisiert in ihrer Analyse die Relevanz der Erhöhung der Förderung von Lexembildungskompetenz bei monolingual deutschsprachigen sowie bei mehrsprachigen Lernenden, indem vorerst grundlegende fachwissenschaftliche Konzepte und Termini geklärt und zum anderen die in sich komplexe Lexembildungskompetenz anhand mehrerer Ebenen modelliert werden. Überdies werden konkrete lexembildungsdidaktische Überlegungen angestellt, die auf dem Mehrebenenmodell aufbauen und im Zusammenhang mit der einschlägigen Phasierung des Unterrichts mit dem lexembildungsdidaktischen Schwerpunkt vorgestellt werden.
Wenke Mückel beschäftigt sich mit der Forschungsfrage, welche Einsichten in das komplexe orthographische System des Deutschen bei Kindern ab dem sechsten Lebensjahr ausgebildet werden müssen, damit sie die geschriebene Sprache erwerben. Das Bindeglied zwischen Fachwissenschaft und Pädagogik hierfür bildet die Fachdidaktik, was am Beispiel des Orthographieerwerbs aufgezeigt und in den drei Aspekten ‚fachwissenschaftliche Dimension‘, ‚fachdidaktische Dimension‘ und ‚pädagogische Dimension‘ des Schriftspracherwerbs vom Anfangsunterricht über den Rechtschreibunterricht der Grundschule bis zum Erreichen einer altersgemäßen und den Bildungsstandards des Primarbereichs entsprechenden Rechtschreibkompetenz am Ende der vierten Klasse verdeutlicht und an die jeweiligen fachwissenschaftlichen Gegenstände geknüpft wird.
Irene Corvacho del Toro und Günther Thomé befassen sich in ihrem Beitrag mit der Fragestellung, inwiefern ein solides sprachwissenschaftliches Wissen bei der Förderung von Schülern und Schülerinnen mit großen Rechtschreibschwierigkeiten (Rechtschreibstörung, Rechtschreibschwäche) ein wichtiges Fundament darstellt. Der Beitrag fokussiert sich auf Rechtschreibfehler, die phonologisch motiviert sind, auf die die Lehrkräfte aufmerksam gemacht werden sollten, um sie in diesem Bereich identifizieren und hierfür individuelle, schriftsystematische, lernförderliche Lernangebote erstellen zu können.
Katharina Böhnert und Ilka Lemke zeigen in ihrem Aufsatz auf, wie sich das vermittelte Bild von Sprachgeschichte innerhalb der Fachdidaktik Deutsch im Laufe der Jahre verändert hat. Anhand einer diachronen Studie im Sinne einer Lehrwerkanalyse, auf deren Grundlage evaluiert wird, welche Inhalte im Deutschunterricht als relevant eingeschätzt werden, soll im Rückgriff auf die fachgeschichtliche Entwicklung verdeutlicht werden, dass der traditionelle Kanon sprachgeschichtlicher Inhalte zugunsten gegenwartssprachlicher Konzepte umstrukturiert wurde.
4.2Beiträge zum Themenfeld Literatur (mithilfe von Sprache oder Medien) verstehen lernen
Dem Themenfeld Literatur (mithilfe von Sprache oder Medien) verstehen lernen widmen sich in dem vorliegenden Sammelband sechs Beiträge:
Lennart Bentler erörtert in seinem Beitrag, dass und inwiefern sich literaturtheoretische Aporien, d. h. der Disziplin eingeschriebene, unauflösliche Grundfragen, die das Verstehen von Literatur betreffen, in der Literaturdidaktik fortsetzen und dort zu neuen Problemkonstellationen mit Blick auf lernzielorientierte Perspektivierungen von Literatur führen. Hierbei wird in Bezug auf Theoreme Hamachers die Literaturwissenschaft als Wissenschaft zur Disposition gestellt, um herauszuarbeiten, dass die Fraglichkeit der Generierung positiven Wissens im Bemessen empirisch beschreibbarer Sachverhalte folglich auch die Literaturdidaktik vor Integrationsprobleme stellt.
In ihrem Aufsatz behandelt Nadine Bieker die Perspektiven einer Textlinguistik am literarischen Text für den Deutschunterricht der Sekundarstufe I. Eine Gegenüberstellung linguistischer Parameter mit narratologischen sowie eine solche mit Aspekten, die den Mehrwert der Rezeption literarischer Texte aufzeigt, verdeutlicht die Parallelen der Teilfächer und wie sie miteinander in Verbindung gesetzt werden können, um ein breiteres Spektrum an Zugängen zum literarischen Text zu ermöglichen. Eine exemplarische Analyse des Textes „Hannas Regen“ von Susan Kreller zeigt die Anwendbarkeit des Modells, und die darauffolgende Anknüpfung an die Bildungsstandards unterstreicht die unterrichtspraktische Möglichkeit der Umsetzung.
Der Beitrag von Peter Klotz stellt sich der Diskussion um das Gewicht germanistischer Fachlichkeit in der Deutschdidaktik und im Deutschunterricht in Form eines fachlichen Impulses, der die linguistische Pragmatik in einen Bezug zu Literaturwissenschaft und zu Literaturdidaktik setzt und dafür vornehmlich ebenfalls das Sprachwissen zu aktivieren vorschlägt. Dieser Zugang wird am Beispiel von drei literarischen Texten (Der Löwe und die Maus, die sich als dankbar erweist von Aesop, Maßnahmen gegen die Gewalt von Brecht und Die Bürgschaft von Schiller) erprobt.
Julia von Dall’Armi untersucht in ihrem Aufsatz anhand eines Unterrichtsgesprächs zu Thomas Manns Novelle „Der Tod in Venedig“ (1911/13) den Einfluss literaturwissenschaftlicher Ansätze auf den Literaturunterricht. Zur Charakterisierung von Wissensaneignungs-, -anwendungs- und -evaluationsprozessen literaturwissenschaftlicher Interpretamente im Gespräch wird ein sequenz- und diskursanalytisches Vorgehen genutzt und mit inhaltlichen Bezügen verknüpft. Anhand einer qualitativen Datenauswahl (aus den Transkriptdaten zu diversen Deutschstunden des an der Universität Göttingen angesiedelten Projektes RICHTIK Deutsch) wird versucht, die wechselseitige Dynamik inhaltsbezogener Fragen und den Gesprächsverlauf zu Thomas Manns Novelle „Der Tod in Venedig“ nachzuzeichnen.
Dennis Tark widmet sich in seinem Beitrag aus theoretischer Perspektive der Bedeutung von Klangfiguren, Wortfiguren und Tropen für den DaZ-Unterricht in der Grundschule sowie in der Ausbildung angehender Lehrkräfte. In diesem Beitrag wird gezeigt, dass rhetorische Mittel wie Metaphern, Anaphern und Alliterationen für den Ausbau literarischer und sprachlicher Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern mit DaZ förderlich sein können. Im Fokus des Beitrags steht das kreative und generative Schreiben eigener Texte im Studium, bei dem zukünftige Lehrkräfte rhetorische Mittel bewusst einsetzen und dadurch ein tieferes Verständnis hierfür entwickeln, wobei sich der Vergleich der Verwendung rhetorischer Mittel in der Erstsprache der Schüler und Schülerinnen mit denen in der Zweitsprache Deutsch für den sprachlichen Transfer als bereichernd erweisen könnte.
Erweitert wird die Thematik des Verhältnisses von germanistischer Fachwissenschaft und Deutschdidaktik in diesem Sammelband durch den Beitrag von Nina Holzschuh, der sich mit der Integration der Digital Humanities in den Deutschunterricht befasst, um Emergenzen aus der integrativen Verbindung fachlichen, pädagogischen und technischen Wissens, wie sie aus dem TPACK-Modell hervorgehen, didaktisch nutzbar zu machen. Die Schwerpunkte der Bestandsaufnahme liegen dabei auf Annotationen als Einstiegsmethode in die Digital Humanities und deren Potentialen für Lesestrategien und Texterschließungskompetenzen sowie auf einem Gedankenspiel zur digitalen Textauswertung am Beispiel von Emilia Galotti von Gotthold Ephraim Lessing.
5Abschließende Überlegungen
Insgesamt spiegelt der vorliegende Sammelband eine Diskussion zum Verhältnis von germanistischer Fachwissenschaft, -didaktik und -unterricht wider und unternimmt einen Versuch, anhand von Fallbeispielen Antworten auf die aktuelle Fragestellung zu finden, wie die entsprechenden Einzeldisziplinen interagieren können, um einen fruchtbaren Wissensaustausch zu ermöglichen, denn
„[d]ie Germanistik als Fachwissenschaft gewährleistet die Professionalität des Schulfachs Deutsch. Denn Lehrerinnen sind immer Fachlehrerinnen. Die Fachlichkeit ist kein der Lehrtätigkeit nachgeordneter Aspekt. Sie gehört primär zu diesem Beruf. Die Wissenschaft ist die zuständige Instanz, Fachkompetenz zu entwickeln, zu definieren und zu sichern.“ (Köster/Matuschek 2019: 23)
In diesem Kontext möchten wir (als Herausgeberinnen) die Vielschichtigkeit und Komplexität dieser Debatte zeigen. Wir hoffen, dass dieser Sammelband hierzu beitragen kann, und bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich bei den einzelnen Beitragenden.
Die vorliegende Publikation, die sowohl disziplinär, thematisch als auch methodisch breit angelegt ist, richtet sich an eine heterogene Zielgruppe, nämlich an Fachwissenschaftler und -wissenschaftlerinnen, Fachdidaktiker und -didaktikerinnen der Germanistik sowie an Deutschlehrkräfte. Daher geht ein Dankeschön ebenfalls an den Narr Francke Attempto-Verlag für die kompetente Betreuung.
Braunschweig, Greifswald, im Frühjahr 2025 Ayşe Yurdakul und Julia von Dall´Armi
Literaturverzeichnis
Albrecht, Christian (2022). Literarästhetische Erfahrung und literarästhetisches Verstehen. Stuttgart. Metzler.
Albrecht, Christian et al. (Hrsg.) (2025). Personale und funktionale Bildung im Deutschunterricht. Theoretische, empirische und praxisbezogene Perspektiven. Stuttgart. Metzler.
Abraham, Ulf (2019). Die Germanistik und das Schulfach Deutsch, oder: keine einfache Beschreibung eines komplexen Verhältnisses! Didaktik Deutsch: Halbjahresschrift für die Didaktik der deutschen Sprache und Literatur 24:46, 6–12.
Abraham, Ulf/Kepser, Matthis (2005). Literaturdidaktik Deutsch: eine Einführung. 1. Aufl. Berlin. Erich Schmidt.
Ágel, Vilmos (2017). Grammatische Textanalyse: Textglieder, Satzglieder, Wortgruppenglieder. Berlin, Boston. De Gruyter.
Berger, Thomas (2018). Mehr Praxis wagen! Anmerkungen zum Theorie-Praxis-Problem in der Deutschdidaktik. Didaktik Deutsch: Halbjahresschrift für die Didaktik der deutschen Sprache und Literatur 23:44, 10–14.
Bernhardt, Sebastian/Hardtke, Thomas (2022). Interpretation – Literaturdidaktische Perspektiven. In: Bernhardt, Sebastian/Hardtke, Thomas (Hrsg.). Interpretation. Literaturdidaktische Perspektiven. Marburg. Frank & Timme, 7–24.
Birk, Andrea M./Buffagni, Claudia (2012). Einleitung. In: Birk, Andrea M./Buffagni, Claudia (Hrsg.). Linguistik und Sprachdidaktik im universitäten DaF-Unterricht. Münster et al. Waxmann, 7–13.
Bleiker, Johanna (2025). Linguistische Konzepte für kompetenzorientierten Deutschunterricht in der Volksschule? Potenziale – Grenzen – Folgerungen. In: Yurdakul, Ayşe/von Dall’Armi, Julia (Hrsg.). Wissen(schaft) im Deutschunterricht: aktuelle Fragestellungen zum Verhältnis von Germanistik und Deutschdidaktik. Tübingen. Narr Francke Attempto, 33–60.
Boelmann, Jan M./König, Lisa (2022). Literarische Kompetenz messen, literarische Bildung fördern. Das BOLIVE-Modell. Baltmannsweiler. Schneider Verlag Hohengehren.
Bogdal, Klaus-Michael (2002). Grundzüge der Literaturdidaktik. München. Dt. Taschenbuch-Verlag.
Boyken, Thomas (2016). Über wissenschaftliche Verwandtschaftsverhältnisse. Versuch einer Einordnung der aktuellen Entwicklungen innerhalb der Deutschdidaktik aus literaturwissenschaftlicher Sicht. In: Winkler, Iris et al. (Hrsg.). Interdisziplinäre Forschung in der Deutschdidaktik. “Fremde Schwestern“ im Dialog. Berlin. Peter Lang, 23–42.
Bräuer, Christoph (2016). Denkrahmen der Deutschdidaktik. Die Identität der Disziplin in der Diskussion. Frankfurt am Main u. a. Peter Lang.
Bredel, Ursula et al. (2010). Einleitung. In: Bredel, Ursula et al. (Hrsg.). Schriftsystem und Schrifterwerb: linguistisch – didaktisch – empirisch. Berlin, Boston. De Gruyter, 1–8.
Bredel, Ursula et al. (Hrsg.) (2010). Schriftsystem und Schrifterwerb: linguistisch – didaktisch – empirisch. Berlin, Boston. De Gruyter.
Brüggemann, Jörn (2014). Deutschdidaktik und Germanistik. Analyse einer umstrittenen Beziehung. In: Frederking, Volker/Krommer, Axel (Hrsg.). Taschenbuch des Deutschunterrichts. Aktuelle Fragen der Deutschdidaktik. Band 3. Baltmannsweiler. Schneider Verlag Hohengehren, 143–176.
Didaktik Deutsch (2018). Halbjahresschrift für die Didaktik der deutschen Sprache und Literatur 23 (44).
Didaktik Deutsch (2019). Halbjahresschrift für die Didaktik der deutschen Sprache und Literatur 24 (46).
Düsing, Elke/Köller, Katharina (2023). Bestimmungsmomente und Prinzipien des Deutschunterrichts. In: Goer, Charis/Köller, Katharina (Hrsg.). Fachdidaktik Deutsch. Grundzüge der Sprach- und Literaturdidaktik. 4. Aufl. Paderborn. Wilhelm Fink, 29–50.
Eisenberg, Peter (2020a). Grundriss der deutschen Grammatik. Band 1. Das Wort. 5. Aufl. Berlin. J.B. Metzler.
Eisenberg, Peter (2020b). Grundriss der deutschen Grammatik. Band 2. Der Satz. 5. Aufl. Berlin. J.B. Metzler.
Ensberg, Claus (2005). Primat der Texte. Grundzüge einer Didaktik literarischen Verstehens. Baltmannsweiler. Schneider Verlag Hohengehren.
Frederking, Volker (2008). Literarische bzw. (literar-)ästhetische Kompetenz. Möglichkeiten und Probleme der empirischen Erhebung eines Kernbereichs des Deutschunterrichts In: Frederking, Volker (Hrsg.). Schwer messbare Kompetenzen. Herausforderungen für die empirische Fachdidaktik. Baltmannsweiler. Schneider Verlag Hohengehren, 36–64.
Frederking, Volker (2023). Deutschlehrkräfte und ihre Vertrautheit mit, Nutzung von und Einstellung zu digitalen Medien während und vor der Corona-Pandemie in Deutschland. Medien im Deutschunterricht 5:1, 1–18.
Frederking, Volker et al. (2012). Mediendidaktik Deutsch: eine Einführung. 2. Aufl. Berlin. Erich Schmidt.
Freudenberg, Ricarda (2012). Wer mehr weiß, ist klar im Vorteil? Der Einfluss domänenspezifischen Vorwissens auf das Erschließen literarischer Texte. In: Pieper, Irene et al. (Hrsg.). Fachliches Wissen und literarisches Verstehen. Studien zu einer brisanten Relation. Frankfurt am Main u. a. Peter Lang.
Gailberger, Steffen (2019). Modellierung von Lesekompetenz. In: von Kämper-van den Boogaart, Michael/Spinner, Kaspar H. (Hrsg.). Lese- und Literaturunterricht. Teil 1: Geschichte und Entwicklung, Konzeptionelle und empirische Grundlagen. 3. Aufl. Baltmannsweiler. Schneider Verlag Hohengehren, 273–346.
Gehrig, Anna (2014). Wortarten. Ein Vergleich von Schulbuch und Grammatik. Baltmannsweiler. Schneider Verlag Hohengehren.
Gerner, Volker (2014). Die Didaktikwissenschaft Deutsch und ihre Bezüge zur Bildungswissenschaft/Erziehungswissenschaft/Pädagogik. In: Frederking, Volker/Krommer, Axel (Hrsg.). Taschenbuch des Deutschunterrichts. Aktuelle Fragen der Deutschdidaktik. Band 3. Baltmannsweiler. Schneider Verlag Hohengehren, 177–196.
Goer, Charis (2023). Fachdidaktik, Wissenschaft und Deutschunterricht. In: Goer, Charis/Köller, Katharina (Hrsg.). Fachdidaktik Deutsch. Grundzüge der Sprach- und Literaturdidaktik. 4. Aufl. Paderborn. Wilhelm Fink, 21–28.
Graf, Günther (2021). Gemeinsamer Denkstil und Normbegriff. In: Graf, Günther et al. (Hrsg.). Gemeinsamer Denkstil – ein Desiderat der Deutschdidaktik: Bedeutsame Normen des Deutschunterrichts. Baltmannsweiler. Schneider Verlag Hohengehren, 1–51.
Jagemann, Sarah (2019). Über die Reproduktion eines fachlichen Vakuums – oder: Warum sich Germanistik und Deutschdidaktik nicht zu sehr vom Deutschunterricht abgrenzen sollten. Didaktik Deutsch: Halbjahresschrift für die Didaktik der deutschen Sprache und Literatur 24:47, 16–22.
Jesch, Tatjana (2020). Fachdidaktik Deutsch: Eine Einführung. Tübingen. Narr Francke Attempto.
Kammler, Clemens (2012). Interpretationskompetenz und ihre Überprüfung. Anmerkungen zu einem Grundproblem der Literaturdidaktik. In: Frickel et al., Daniela A. (Hrsg.). Literaturdidaktik im Zeichen von Kompetenzorientierung und Empirie: Perspektiven und Probleme. Freiburg. Fillibach, 235–252.
Kepser, Matthis (2012). Anmerkungen zur Kompetenzorientierung in der Literaturdidaktik. In: Frickel, Daniela A.et al. (Hrsg.). Literaturdidaktik im Zeichen von Kompetenzorientierung und Empirie: Perspektiven und Probleme. Freiburg. Fillibach, 67–84.
Kepser, Matthis (2013). Deutschdidaktik als eingreifende Kulturwissenschaft. Ein Positionierungsversuch im wissenschaftlichen Feld. Didaktik Deutsch: Halbjahresschrift für die Didaktik der deutschen Sprache und Literatur 18:34, 52–68.
Köhnen, Ralph (Hrsg.) (2011). Einführung in die Deutschdidaktik. Stuttgart. Springer.
König, Lisa (2020). Fiktionswahrnehmung als Grundlage literarischen Verstehens. Eine empirische Studie über den Zusammenhang von Fiktionsverstehen und literarischer Grundkompetenz. Bielefeld. wbv Publikation.
Köster, Juliane (2015). Die Tagung aus literaturdidaktischer Beobachtungsperspektive. In: Lessing-Sattari, Marie et al. (Hrsg.). Interpretationskulturen. Literaturdidaktik und Literaturwissenschaft im Dialog über Theorie und Praxis des Interpretierens. Frankfurt am Main u. a. Peter Lang, 11–35.
Köster, Juliane/Matuschek, Stefan (2019). Elf Thesen zum Literaturunterricht. Didaktik Deutsch; Halbjahresschrift für die Didaktik der deutschen Sprache und Literatur 24:47, 23–27.
Krelle, Michael (2019a). Gesprächskompetenz. In: Rothstein, Björn/Müller-Brauers, Claudia (Hrsg.). Kernbegriffe der Sprachdidaktik Deutsch. Ein Handbuch. 3. Aufl. Baltmannsweiler. Schneider Verlag Hohengehren, 116–118.
Krelle, Michael (2019b). Rechtschreibkompetenz. In: Rothstein, Björn/Müller-Brauers, Claudia (Hrsg.). Kernbegriffe der Sprachdidaktik Deutsch. Ein Handbuch. 3. Aufl. Baltmannsweiler. Schneider Verlag Hohengehren, 311–313.
Krelle, Michael (2019c). Schreibkompetenz. In: Rothstein, Björn/Müller-Brauers, Claudia (Hrsg.). Kernbegriffe der Sprachdidaktik Deutsch. Ein Handbuch. 3. Aufl. Baltmannsweiler. Schneider Verlag Hohengehren, 362–365.
Krelle, Michael (2019d). Sprachkompetenz. In: Rothstein, Björn/Müller-Brauers, Claudia (Hrsg.). Kernbegriffe der Sprachdidaktik Deutsch. Ein Handbuch. 3. Aufl. Baltmannsweiler. Schneider Verlag Hohengehren, 397–401.
Kultusministerkonferenz (2022). Bildungsstandards für das Fach Deutsch. Primarbereich. Berlin. Abrufbar unter: https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2022/2022_06_23-Bista-Primarbereich-Deutsch.pdf (Stand: 04/03.25)
Leubner, Martin et al. (2012). Literaturdidaktik. 2. Aufl. Berlin. Akademie Verlag.
Liedke, Martina (2018). Die Vermittlung sprachlicher Kompetenzen. In: Harr, Anne-Katharina et al. (Hrsg.). Deutsch als Zweitsprache. Migration – Spracherwerb – Unterricht. Stuttgart. J.B. Metzler, 61–94.
Liedke, Martina/Riehl, Claudia M. (2018). Migration und Spracherwerb. In: Harr, Anne-Katharina et al. (Hrsg.). Deutsch als Zweitsprache. Migration – Spracherwerb – Unterricht. Stuttgart. J.B. Metzler, 1–26.
Maiwald, Klaus (2022). Medienkompetenz. In: von Brand, Tilman et al. (Hrsg.). Basiswissen Lehrerbildung: Deutsch unterrichten. Stuttgart. Klett, 156–175.
Martínez, Matías/Scheffel, Michael (2019). Einführung in die Erzähltheorie. 11. Aufl. Berlin. C. H. Beck.
Matz, Daniela (2021). Interpretationskonzepte bei Deutschlehrkräften und ihren Schüler*innen. Eine explorative Studie. Bamberg. University of Bamberg Press.
Meier, Christel et al. (2012). Literarästhetische Textverstehenskompetenz und fachliches Wissen. Möglichkeiten und Probleme domäenspezifischer Kompetenzforschung. In: Pieper, Irene/Wieser, Dorothee (Hrsg.). Fachliches Wissen und literarisches Verstehen. Studien zu einer brisanten Relation. Frankfurt am Main u. a. Peter Lang, 237–258.
Montag, Annegret (2021). Videospiele als Teil der Lehramtsausbildung für das Unterrichtsfach Deutsch. Ein Seminarbericht. In: Möring, Sebastian et al. (Hrsg.). Didaktik des digitalen Spielens. Potsdam. Universitätsverlag Potsdam, 178–207.
Neef, Martin (2005). Die Graphematik des Deutschen. Tübingen. Niemeyer.
Neuland, Eva (2012). DaF-Didaktik in der AuslandsgermanistikProbleme – Positionen – Perspektiven. In: Birk, Andrea M./ Buffagni, Claudia (Hrsg.). Linguistik und Sprachdidaktik im universitäten DaF-Unterricht. Münster et al. Waxmann, 15–32.
Paefgen, Elisabeth K. (2006). Einführung in die Literaturdidaktik. 2. Aufl. Stuttgart. Springer.
Pieper, Irene (2016). Wissen im Zwischenraum. Zur Spezifik der Frage nach verstehensrelevantem Wissen im literaturdidaktischen Reflexionsraum. In: Möbius, Thomas/Steinmetz, Michael (Hrsg.). Wissen und literarisches Lernen. Grundlegende theoretische und didaktische Aspekte. Frankfurt am Main u. a. Peter Lang, 129–154.
Pieper, Irene/Wieser, Dorothee (Hrsg.) (2012). Fachliches Wissen und literarisches Verstehen. Studien zu einer brisanten Relation. Frankfurt am Main u. a. Peter Lang.
Pieper, Irene/Bredel, Ursula (2015). Integrative Deutschdidaktik. Paderborn. UTB.
Rödel, Michael (2014a). Aktuelles Forum: Was können Sprachwissenschaft und Sprachdidaktik leisten? Perspektiven für den Deutschunterricht. Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes 3:61, 292–312.
Rödel, Michael (2014b). Deutschunterricht am Gymnasium: Was kann die Sprachwissenschaft leisten? In: Rödel, Michael (Hrsg.). Deutschunterricht am Gymnasium: Was kann die Sprachwissenschaft leisten? Baltmannsweiler. Schneider Verlag Hohengehren, 1–16.
Rösch, Heidi (2017). Deutschunterricht in der Migrationsgesellschaft. Eine Einführung. Stuttgart. J.B. Metzler Springer.
Rothstein, Björn (2019a). Allein gelassen? Lehramtsstudierende zwischen fachwissenschaftlicher germanistischer Ausdifferenzierung und integrativem Deutschunterricht. Didaktik Deutsch: Halbjahresschrift für die Didaktik der deutschen Sprache und Literatur 24:46, 13–18.
Rothstein, Björn (2019b). Bezugswissenschaften. In: Rothstein, Björn/Müller-Bauers, Claudia (Hrsg.). Kernbegriffe der Sprachdidaktik Deutsch: Ein Handbuch. 3. Aufl. Baltmannsweiler. Schneider Verlag Hohengehren, 29–31.
Rupp, Gerhard (2016). Deutschdidaktik – eine eingreifende Kultur- und kompetenzorientierte Vermitttlungswissenschaft. In: Bräuer, Christoph (Hrsg.). Denkrahmen der Deutschdidaktik. Die Identität der Disziplin in der Diskussion. Frankfurt. Peter Lang, 187–212.
Schilcher, Anita/Pissarek, Markus (Hrsg.) (2013). Auf dem Weg zur literarischen Kompetenz. Ein Modell literarischen Lernens auf semiotischer Grundlage. Baltmannsweiler. Schneider Verlag Hohengehren.
Schultz-Pernice, Florian (2019). Die Literatur der Literaturdidaktik. Grundlegung und Entwurf einer literaturdidaktischen Objektkonstitution aus deutschdidaktischer Perspektive. Stuttgart. Metzler.
Schultz-Pernice, Florian (2022). „Widerstand“ und „Verdrängung“. Beziehungsprobleme von Literaturdidaktik und Literaturwissenschaft, ihre Voraussetzungen und Ansätze zu ihrer produktiven Bearbeitung. In: Bernhardt, Sebastian/Hardtke, Thomas (Hrsg.). Interpretation. Literaturdidaktische Perspektiven. Marburg. Frank & Timme, 53–70.
Sosna, Anette (2023). Interpretieren als metakognitiver Prozess im Deutschunterricht. Interpretationskompetenz fördern in den Sekundarstufe I und II. Weinheim. Beltz Juventa.
Spinner, Kaspar (2015). Elf Aspekte auf dem Prüfstand. Verbirgt sich in den elf Aspekten literarischen Lernens eine Systematik? Leseräume 2:2, 188–194.
Staiger, Michael (2018). Audiovisuelle Medien im Deutschunterricht. In: Frederking, Volker et al. (Hrsg.). Digitale Medien im Deutschunterricht. 2. Aufl. Baltmannsweiler. Schneider Verlag Hohengehren, 236–268.
Struve, Karen/Hethey, Meike (2024). Literatur vermitteln: Prozesse literarischer Rezeption zwischen Literaturwissenschaft und Literaturdidaktik. Bielefeld. transcript.
Weinrich, Harald (1993). Textgrammatik der deutschen Sprache. Mannheim. Dudenverlag.
Wieser, Dorothee (2008). Literaturunterricht aus Sicht der Lehrenden. Eine qualitative Interviewstudie. Wiesbaden. Verlag für Sozialwissenschaften.
Wieser, Dorothee (2016). Wissen und literarisches Lernen – zwischen Takt und Merkkästen. In: Möbius, Thomas/Steinmetz, Michael (Hrsg.). Wissen und literarisches Lernen. Grundlegende theoretische und didaktische Aspekte. Frankfurt am Main u. a. Peter Lang, 43–60.
Winkler, Iris/Schmidt, Frederike (2016). Interdisziplinäre Forschung in der Deutschdidaktik. Eine Zwischenbilanz. In: Winkler, Iris et al. (Hrsg). Interdisziplinäre Forschung in der Deutschdidaktik. “Fremde Schwestern“ im Dialog. Berlin. Peter Lang, 7–22.
Zabka, Thomas (2007). Diskursive und poetische Aufgaben zur Texterschließung. In: Willenberg, Heiner (Hrsg.). Kompetenzhandbuch für den Deutschunterricht. Baltmannsweiler. Schneider Verlag Hohengehren, 199–209.
I Sprache verstehen lernen
Linguistische Konzepte für kompetenzorientierten Deutschunterricht in der Volksschule? Potenziale – Grenzen – Folgerungen
Abstract: Der Beitrag beleuchtet das komplexe Verhältnis zwischen Germanistik, Deutschdidaktik und Deutschunterricht an Volksschulen in Deutschland und der Schweiz. Ausgangspunkt ist die Kompetenzorientierung aktueller Deutsch-Lehrpläne, die sprachliches Handeln in den Vordergrund stellen. Angesichts dessen, dass die linguistische Teildisziplin, die sich mit Sprachhandeln befasst, die Pragmatik ist, stellt sich die Frage, warum im heutigen Deutschunterricht pragmalinguistische Konzepte keine bedeutendere Rolle spielen. Der Beitrag analysiert deshalb historische, institutionelle und fachspezifische Faktoren, die die Nutzbarmachung linguistischer Konzepte im Unterricht begünstigen oder begrenzen. Begrenzungen ergeben sich (1) aus der Relevanz weiterer Bezugsdisziplinen für den Deutschunterricht und (2) aus seiner Einbettung in das System Schule. Anhand einer Lehrveranstaltung für angehende Primarschullehrkräfte wird aber auch exemplarisch dargestellt, wie linguistische Konzepte innerhalb dieser Grenzen fruchtbar gemacht werden können. Den Abschluss bildet die aus dem Dargelegten abgeleitete Folgerung, dass ein bidirektionaler Austausch zwischen (Sprach- und Bildungs-)Wissenschaft und Schulpraxis notwendig ist, um die Relevanz linguistischer Konzepte im Deutschunterricht zu erhöhen.
Keywords: Pragmalinguistik, Kompetenzorientierung, Lehrpläne, Funktionen des Deutschunterrichts, Bezugsdisziplinen, Bildungswissenschaften, Bildungssystem
1Einleitung
Aktuelle Volksschullehrpläne im deutschsprachigen Raum sind sich einig: Unterricht soll kompetenzorientiert sein. Kompetenzorientierter Unterricht strebt danach, „Lernprozesse in der Schule so zu gestalten, dass das vermittelte Wissen im Alltag auch situationsgerecht zur Anwendung kommt. Kompetenz stellt also in Handlung umgesetztes Wissen dar“ (Joller-Graf et al. 2014: 6). Das gilt auch für den Deutschunterricht: „Das sinnvolle sprachliche Handeln der Schülerinnen und Schüler und der angemessene Umgang mit Sprache stehen im Mittelpunkt“ (KMK 2005: 8) bzw. „Die Befähigung zur bewussten und verantwortungsvollen sprachlichen Kommunikation stellt somit eines der Hauptziele schulischer Bildung dar“ (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz D-EDK 2016: 3).
Nun ist die Teildisziplin der Sprachwissenschaft1, die sich mit sprachlichem Handeln befasst, die Pragmatik. Also wäre zu erwarten, dass seit dem Paradigmenwechsel von der Stoff- zur Kompetenzorientierung in Lehrplänen Konzepte der linguistischen Pragmatik eine zentrale Rolle im Deutschunterricht spielen würden. Dem ist jedoch bisher nicht so (Liedtke/Wassermann 2019, Börjesson/Laser 2022). Der vorliegende Beitrag widmet sich deshalb der Frage, welche Faktoren das Verhältnis zwischen Germanistik und Deutschunterricht beeinflussen und welche Möglichkeiten und Grenzen sich daraus für die Nutzbarmachung linguistischer Konzepte im Deutschunterricht ergeben.
Zu diesem Zweck wird zunächst dargelegt, welche historischen, institutionellen, fachspezifischen, alters- und schultypenabhängigen Bedingungen das Verhältnis zwischen Germanistik und Deutschunterricht (bzw. Deutschdidaktik als der wissenschaftlichen Disziplin, die sich mit dem Lehren und Lernen der deutschen Sprache befasst) beeinflussen. Dabei wird sichtbar, wo die Grenzen des Einflusses der Germanistik auf den Deutschunterricht der Volksschule liegen. Diese ergeben sich erstens aus der Relevanz weiterer Bezugsdisziplinen für den Deutschunterricht und zweitens aus seiner Einbettung in das System Schule (Kap. 2). Anschließend wird jedoch exemplarisch anhand einer konkreten Deutschdidaktik-Lehrveranstaltung eines Studiengangs für künftige Primarschullehrkräfte aufgezeigt, welches Potenzial innerhalb dieser Grenzen nichtsdestotrotz liegt und wie es sich nutzen lässt (Kap. 3). Den Abschluss des Beitrags bilden Folgerungen aus Kapitel 2 und 3 (Kap. 4).
2Zum Verhältnis zwischen Germanistik, Deutschdidaktik und Deutschunterricht
Wie entstehen Inhalte für den Deutschunterricht? Sind Unterrichtsinhalte im Fach Deutsch das, was aus der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft (wie das Studienfach Germanistik an vielen Universitäten heißt) als unterrichtstauglich oder unterrichtsrelevant betrachtet wird? Liest man die Beschreibung des „‚Genesewegs‘ von Inhalten des Deutschunterrichts“ von Liedtke/Wassermann (2019: 5), dann scheint es so zu sein:
„Wie dieser [i.e. der Geneseweg] aussieht, ist dem Prinzip nach offenkundig: Er läuft von den Bezugswissenschaften, deren erklärtes Ziel es ist, fachliche Erkenntnisse zu generieren, über die Fachdidaktik Deutsch, die als ‚Mittlerin zwischen Linguistik und Schule‘ (Rödel 2016: 14) diese Ergebnisse prüft und aufbereitet, in die Schulen, denen die Aufgabe zukommt, die vorselektierten Inhalte angemessen zu vermitteln (vgl. Rothstein 2016).“ (Liedtke/Wassermann 2019: 5)
Die „Bezugswissenschaften“ werden in einer Fußnote explizit aufgeführt: „Für den Deutschunterricht sind das mindestens die Literatur-, Sprach-, Kommunikations- und Medienwissenschaft“ (ebd.: 5). Bildungswissenschaftliche Disziplinen werden nicht genannt. Das überrascht insofern, als der Deutschunterricht ein Bestandteil der Institution Schule und damit des Bildungssystems ist, dessen Funktion für das gesellschaftliche Gesamtsystem darin besteht, jungen Menschen die nötigen Kompetenzen zu vermitteln, um am gesellschaftlichen (d. h. politischen, ökonomischen, kulturellen, sozialen etc.) Leben partizipieren zu können. Die Beziehung zwischen Germanistik und Deutschdidaktik wird daher immer auch definiert durch das sich stetig verändernde Gefüge der Gesamtgesellschaft und des (nationalen und lokalen) Bildungssystems. Einige zentrale Aspekte davon werden im Folgenden dargestellt: Die Bedeutung verschiedener Bezugsdisziplinen der Deutschdidaktik (Kap. 2.1), Einflüsse institutioneller Rahmenbedingungen (Kap. 2.2), Unterschiede zwischen einzelnen Kompetenzbereichen des Deutschunterrichts (Kap. 2.3) und Unterschiede zwischen Deutschlernenden verschiedener Altersstufen und Schultypen (Kap. 2.4). Dabei besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit: Weder soll im vorliegenden Beitrag die Geschichte des Unterrichtsfachs Deutsch nachgezeichnet werden, noch können bspw. alle Kompetenzbereiche umfassend dargestellt werden. Vielmehr wird je nach Aspekt der eine oder andere Kompetenzbereich herangezogen oder ausführlicher dargestellt.
2.1Bezugsdisziplinen der Deutschdidaktik: Veränderungen unter historischer Perspektive
Historisch betrachtet erweist sich die Vorstellung, dass Inhalte des Deutschunterrichts den Weg von der Germanistik über die Deutschdidaktik in den Deutschunterricht nähmen, für die Volksschule schon deshalb als fragwürdig, weil das Schulfach Deutsch älter ist als die Hochschuldisziplin Germanistik: Als ab etwa 1800 ein Schulfach für den muttersprachlichen Unterricht entsteht (Beisbart 2014), existiert die Germanistik als etablierte, institutionalisierte akademische Disziplin an Universitäten noch nicht (Lindauer et al. im Druck: 5, Abraham 2019: 6). Zu Zeiten der frühen Germanistik entstand zwar dadurch, dass die Universitäten ihre Germanistik-Lehrstühle vor allem mit Personen aus dem Gymnasiallehrer-Pool besetzten (Lindauer et al. im Druck: 6), eine enge Verbindung zwischen dem Gymnasialfach Deutsch und der akademischen Disziplin Germanistik. Für den Deutschunterricht auf Volksschulstufe war die sich etablierende Germanistik jedoch irrelevant. Das gilt auch darum, weil die Germanistik wie alle an den Universitäten entstehenden philologischen Fächer dem „prinzipiell historischen Zugriff des 19. Jahrhunderts auf Sprache“ (Linke et al. 2020 [2004]: 420) folgte. Dem Volksschulfach Deutsch jedoch wurden folgende Funktionen zugeschrieben (Frank 1973, Schneuwly et al. 2016, Lindauer et al. im Druck):
Vermittlung von sprachlichen Fertigkeiten und Fähigkeiten, insbesondere Lesen und Schreiben
Herausbildung einer nationalen Identität
moralisch-ethische Gesinnungsbildung
Begriffs- und Gedankenschulung, u. a. durch Wortschatzarbeit
Zugang zu kulturellem literarischem Erbe und humanistischem Menschenbild
Zu den meisten dieser Funktionen konnte eine historisch ausgerichtete Germanistik wenig beitragen. Der Breite des Spektrums an Funktionen entsprechend, die dem Unterrichtsfach Deutsch zugeschrieben wurden und werden, muss auch das Spektrum an Bezugsdisziplinen breiter sein.
Für Funktion (1) sind die Lehr-Lernforschung (z. B. die pädagogische Psychologie) in Bezug auf Sprache sowie die Psycholinguistik zentral. Funktionen (2) und (3) hatten als Konsequenz, dass die Wahl der Lesestoffe oft nicht nach literaturästhetischen Kriterien erfolgte (und erfolgt), also konnte (und kann) die Literaturwissenschaft auch nicht die wichtigste Bezugsdisziplin sein, viel eher eine normativ (vs. deskriptiv-empirisch) ausgerichtete Pädagogik. Diese betrachtet „Schreiben wie Lesen mehr unter den Kriterien von Personbildung als denen von Sprachbildung“ (Ossner 2021: 14). Hinter Funktion (4) steckt die Erwartung, dass die Beschäftigung mit der Sprache nicht nur dazu führt, dass die Schüler:innen Sprache genauer verstehen und sich sprachlich präziser ausdrücken können, sondern der Arbeit an und mit der Sprache werden kognitive Funktionen zugeschrieben. Damit gerät die Kognitionspsychologie ins Blickfeld. Sogar für Funktion (5), wo der Bezug zur Literaturwissenschaft eigentlich erwartbar wäre, muss festgestellt werden: Zwar hat sich ein eigener Forschungsbereich Kinder- und Jugendliteratur herausgebildet, aber dieser wird „nur im Ausnahmefall von der germanistischen Literaturwissenschaft bespielt, häufiger von fachdidaktischer und erziehungswissenschaftlicher Seite“ (Abraham 2019: 7).
Im historischen Verlauf wurden die Funktionen (1) bis (5) unterschiedlich gewichtet, sodass auch die Relevanz der Bezugsdisziplinen nicht konstant blieb. Heute kann die Deutschdidaktik als eine heterogene Fachdidaktik bezeichnet werden, die sich „analog zum Unterrichtsfach Deutsch in verschiedene Domänen [auffächert] und domänenspezifisches wie auch domänenübergreifendes Lehren und Lernen über alle Jahrgangsstufen hinweg [untersucht]“ (Sturm 2022: 1061). Entsprechend hat sich in den letzten Jahren das Spektrum ihrer Bezugsdisziplinen erweitert: Zur Germanistik kamen Kognitionspsychologie, pädagogische Psychologie, Motivationspsychologie, Bildungssoziologie etc. hinzu.
Welche Rolle aber spielte die Germanistik? Nachdem sie sich jahrzehntelang v. a. mit der Erschließung alt- und mittelhochdeutscher Literatur beschäftigt hatte und deshalb für den Deutschunterricht auf der Volksschule irrelevant war, führte Ferdinand de Saussures „Cours de linguistique général“ (2005 [1916]) eine Wende herbei:1 Nun wandte sich die deutsche Sprachwissenschaft (auch) einer synchronen Perspektive zu. Die Germanistik diversifizierte sich in verschiedene Teilbereiche (diachrone und synchrone Linguistik, ältere und neuere Literaturwissenschaft). Das war eine wichtige Voraussetzung, um für die Volksschule relevant zu werden.
Einen weiteren wichtigen Wendepunkt in Richtung Relevanz für die Volksschule nahm die deutsche Sprachwissenschaft unter dem Einfluss der 1968er-Bewegungen: Studierende und jüngere Dozent:innen forderten, die Linguistik solle sich nicht länger nur dem Sprachsystem widmen, sondern ihr Interesse auf den Sprachgebrauch richten, um eine sozial nützliche Wissenschaft zu werden (Linke et al. 2020 [2004]: 194). Diese „pragmatische Wende“ (ebd.) bereicherte den Gegenstandsbereich der Linguistik erheblich. Die synchrone germanistische Linguistik rezipierte nun auch Autoren aus den USA und interessierte sich für die dort aufkommenden Teildisziplinen wie Soziolinguistik, Psycholinguistik, Textlinguistik (Lindauer et al. im Druck: 14). Das erhöhte die Relevanz der Linguistik für Deutschunterricht und Deutschdidaktik außerhalb des Gymnasiums: „Im Zuge der ‚kommunikativen Wende‘, der Etablierung einer synchronen, modernen Linguistik in den 1970er Jahren und der damit einhergehenden Beschäftigung mit Sprachgebrauch und Sprachlernen, wurde das universitäre Wissen zunehmend auch relevant für die Volksschule“ (ebd.: 15).
Als weiterer Faktor kam hinzu: Ab Mitte des 20. Jahrhunderts engagierten sich erstmals namhafte Universitätsprofessoren wie der an der RWTH Aachen lehrende Schweizer Linguist und Sprachdidaktiker Hans Glinz und später sein Schüler Horst Sitta, von 1976 bis 2001 Professor an der Universität Zürich und Mitautor der Duden-Grammatik, für den Transfer linguistischer Erkenntnisse in den Deutschunterricht (Lindauer et al. im Druck: 15). Im Konzept des operationalen Grammatikunterrichts gelang ihnen eine Annäherung von Sprachwissenschaft und Deutschunterricht (ebd.: 14). So finden sich in Volksschullehrplänen heute Kompetenzziele wie „Die Schülerinnen und Schüler können den Gebrauch und die Wirkung von Sprache untersuchen“ (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz D-EDK 2016: D.5.B.1)
Als Bezugsdisziplin der Deutschdidaktik und des Deutschunterrichts erhielt die Germanistik in den letzten Jahrzehnten jedoch zunehmend Konkurrenz von den empirisch ausgerichteten Bildungswissenschaften, insbesondere von der psychologischen Lehr-Lernforschung: Mit der Kompetenzorientierung und der Formulierung von Bildungsstandards veränderte sich der fachwissenschaftliche Bezug dahingehend, dass „die fachdidaktische Forschung in methodischer und methodologischer Hinsicht immer stärkere verhaltenswissenschaftliche Züge trägt“ (Grabowski 2014: 19). Leuders (2015) sieht Fachdidaktiken heute überwiegend als Teil der empirischen Bildungsforschung im weiteren Sinn, obschon sie auch Bezüge zur jeweiligen Fachwissenschaft, zur geisteswissenschaftlichen Pädagogik und zum Praxisfeld aufweise (vgl. Abb. 1).
Bezüge der Fachdidaktik zu benachbarten Disziplinen (Leuders 2015: 219)
Diese Tendenz wird an aktuellen Forschungsprojekten sichtbar, wie bspw. dem vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) geförderten Projekt „Lernwirksame Klassengespräche führen – eine Interventionsstudie zur Förderung der Gesprächskompetenz von Lehrpersonen“ unter der Leitung von zwei Erziehungswissenschaftler:innen (Pauli/Reusser 2017–2021). Die Untersuchung von Unterrichtsgesprächen könnte auch mit Konzepten und Methoden der inzwischen weit entwickelten Methodik und Methodologie der linguistischen Gesprächsanalyse erfolgen. Doch diese verpflichtet sich entsprechend ihrer Genese aus der Konversationsanalyse dem Prinzip der ethnomethodologischen Indifferenz (vgl. bspw. Breidenstein/Tyagunova 2012). Das stellt für das Untersuchungsinteresse an Gesprächskompetenz ein Problem dar: Kompetenz ist ein normativer Begriff, der sich einer ethnomethodologisch orientierten Gesprächsforschung entgegenstellt (Bleiker 2013: 84, Deppermann 2004: 19). Auch mit dem Ziel, etwas zu fördern, ist die Position einer ethnomethodologisch ausgerichteten Gesprächsanalyse nicht kompatibel: Eine Verbesserung des Bestehenden anzustreben beinhaltet Bewertungen. Eine wichtigere Rolle spielen im besagten Projekt deshalb ursprünglich erziehungswissenschaftliche Konzepte wie das Konzept des „dialogic teaching“ (Alexander 2008) oder jenes der „Bildungssprache“, das von Erziehungswissenschaftler:innen (u. a. Gogolin 2008) in den sprachdidaktischen Diskurs eingeführt und dann von Linguist:innen (u. a. Feilke 2012, Morek/Heller 2012) aufgegriffen und weiterentwickelt wurde.
Durch ihre konstitutive Orientierung am Praxisfeld und an wissenschaftlichen Bezugsdisziplinen befindet sich die Deutschdidaktik wie alle Fachdidaktiken in einem Spannungsfeld: „Während ihr seitens der Fachwissenschaft zuweilen zu wenig Wissenschaftlichkeit unterstellt wird, wird ihr von Schulpraktikern mitunter eine zu geringe Praxisrelevanz attestiert, wenngleich diese Schwebelage gerade das Charakteristikum der Fachdidaktiken sein mag“ (Cramer 2019: 280). Auf diesem Schwebebalken gilt es stets von Neuem, die Balance zu suchen und die Ziele des Deutschunterrichts nicht aus den Augen zu verlieren. Diese werden von verschiedenen Akteuren im Bildungssystem ausgehandelt und unterscheiden sich entsprechend in verschiedenen Bildungssystemen. Darauf geht der folgende Abschnitt ein.
2.2Institutionelle Rahmenbedingungen: Unterschiede zwischen Deutschland und der Schweiz
Schule ist in Deutschland und der Schweiz staatlich organisiert, größtenteils auf Ebene der Bundesländer bzw. kantonal (Lehrpläne, obligatorische Lehrmittel etc.), zu kleineren Teilen auch national (z. B. nationale Bildungsstandards), aber nicht übergreifend nach Sprachräumen. Es gibt (abgesehen von der amtlichen Regelung der Rechtschreibung) keine Vorgaben für den Deutschunterricht, die in allen deutschsprachigen Staaten oder Gebieten gelten. Auch die gesetzlichen Rahmenbedingen und die institutionelle Ausgestaltung der Aus- und Weiterbildung von (Deutsch-)Lehrkräften unterscheiden sich zwischen Deutschland und der Schweiz erheblich. Solche Faktoren tragen dazu bei, dass sich das Verhältnis von Germanistik, Deutschdidaktik und Deutschunterricht in Deutschland und der Schweiz unterschiedlich gestaltet. Im Folgenden wird die unterschiedliche institutionelle Ausgestaltung der Lehrerinnen- und Lehrerbildung in Deutschland und der Schweiz skizziert und anschließend am Beispiel des Teilbereichs Grammatik aufgezeigt, welche Folgen sich aus länderspezifischen Umständen ergeben können.
In Deutschland absolvieren Lehrkräfte ein Masterstudium an einer Universität (außer in Baden-Württemberg), und sie werden mehrheitlich in zwei bis drei Fächern ausgebildet. In der Schweiz dagegen sind Primarlehrkräfte in sechs bis acht, Lehrkräfte für Sekundarstufe I in vier Fächern ausgebildet und studieren (mit Ausnahme der Gymnasiallehrkräfte) überwiegend an Pädagogischen Hochschulen. „Eine fachspezifische Fokussierung ist damit in den deutschen Lehramtsstudiengängen stärker ausgeprägt als in den schweizerischen (ohne Gymnasium)“ (Keller-Schneider et al. 2018: 220–221). Außerdem dauert das Lehramtsstudium in der Schweiz für die Vorschul- und Primarstufe sechs Semester Vollzeit (Bachelor), und in diesen drei Jahren ist die berufspraktische Ausbildung bereits integriert. Für das Lehrdiplom Sekundarstufe I ist ein Masterabschluss (neun bis zehn Semester Vollzeit), ebenfalls mit bereits integrierter berufspraktischer Ausbildung, zu erwerben (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz D-EDK 2024). Die für fachwissenschaftliche und fachdidaktische Inhalte zur Verfügung stehende Zeit ist in der Schweiz also knapper. Das hat Folgen bezüglich der Frage nach linguistischen Konzepten im Deutschunterricht: Die Selektion der Studieninhalte ist rigoroser und ein reflektiert eklektischer Umgang mit theoretischen Konzepten unumgänglich (vgl. Kap. 3.1).
Welche Folgen unterschiedliche Rahmenbedingungen haben können, zeigt sich bspw. im Bereich der Grammatik resp. der grammatischen Terminologie. 1982 veröffentlichte die KMK ein Verzeichnis grammatischer Fachausdrücke, das ca. 146 Termini umfasste (Ossner 2021: 18). Das rund 40 Jahre später verabschiedete, neue Verzeichnis beinhaltet 277 Termini. Zu beiden Verzeichnissen entwickelte sich eine kontroverse Debatte, die sich im Fall des Verzeichnisses von 2019 in der wichtigsten deutschdidaktischen Fachzeitschrift über mehrere Heftnummern hinweg erstreckte (vgl. exemplarisch Hennig/Langlotz 2020, Bredel 2021, Kruse 2021, Lindauer/Schmellentin 2021, Unterholzner et al. 2022). Bedeutsam ist, dass sich die Debatte auf die Termini und deren Darstellung bezieht, nicht auf die – eigentlich wichtigeren, da umfassenderen – Formulierungen der Bildungsstandards. Die Inhalte der Debatte können an dieser Stelle nicht nachgezeichnet werden. Für den vorliegenden Beitrag interessiert stattdessen, wie es möglich ist, dass sich die Situation in einem benachbarten deutschsprachigen Land wie der Schweiz so anders präsentiert. Anders als in Deutschland wurde in der Schweiz keine isolierte Liste mit grammatischen Termini erstellt. Vielmehr finden sich die zu erarbeitenden Grammatikbegriffe in den Volksschullehrplan integriert. Im Kompetenzbereich „Sprache(n) im Fokus“ (zur Gliederung des Unterrichtsfachs Deutsch im Schweizer Lehrplan (vgl. Abb. 3) lautet eines der Kompetenzziele: „Die Schülerinnen und Schüler können Grammatikbegriffe für die Analyse von Sprachstrukturen anwenden“ (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz D-EDK 2016: D.5.D.1). Anschließend wird explizit aufgeführt, welche Termini auf welcher Schulstufe in welcher Form im Unterricht thematisiert werden sollen. Das ordnet den Stellenwert grammatischer Termini innerhalb des Deutschunterrichts ein: Ihre Beherrschung ist kein Selbstzweck und wird über die Schulstufen hinweg curricular aufgebaut.





























