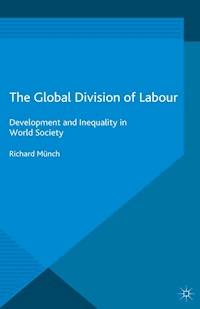Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Universitäten stehen seit gut zwei Jahrzehnten in einem verschärften Wettbewerb um Exzellenz. Sie konkurrieren um Forschungsmittel, erfolgreiche Forschende, begabte Studierende und Machtpositionen, mit denen sie sich Vorteile in diesem Wettbewerb verschaffen können. Dieser institutionelle Wettbewerb überlagert den individuellen Wettbewerb zwischen den Forschenden um Erkenntnisfortschritt und Anerkennung durch die wissenschaftliche Gemeinschaft. Die Universität wird so zur treibenden Kraft eines akademischen Kapitalismus, der auf die zirkuläre Akkumulation von ökonomischem und symbolischem Kapital zielt. Richard Münch untersucht in diesem Buch drei Wesenszüge der Universität im akademischen Kapitalismus und ihre Wirkung auf die wissenschaftliche Praxis sowie die Offenheit der Wissensevolution: die nach Wettbewerbsvorteilen strebende unternehmerische Universität, die auf Drittmitteleinwerbung im großen Stil ausgerichtete strategisch planende Universität und die auf betriebswirtschaftliches Qualitätsmanagement fokussierte Audit-Universität.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 557
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Richard Münch
Wissenschaft im Wettbewerb
Die Universität im akademischen Kapitalismus
Campus VerlagFrankfurt/New York
Über das Buch
Die Universitäten stehen seit gut zwei Jahrzehnten in einem verschärften Wettbewerb um Exzellenz. Sie konkurrieren um Forschungsmittel, erfolgreiche Forschende, begabte Studierende und Machtpositionen, mit denen sie sich Vorteile in diesem Wettbewerb verschaffen können. Dieser institutionelle Wettbewerb überlagert den individuellen Wettbewerb zwischen den Forschenden um Erkenntnisfortschritt und Anerkennung durch die wissenschaftliche Gemeinschaft. Die Universität wird so zur treibenden Kraft eines akademischen Kapitalismus, der auf die zirkuläre Akkumulation von ökonomischem und symbolischem Kapital zielt. Richard Münch untersucht in diesem Buch drei Wesenszüge der Universität im akademischen Kapitalismus und ihre Wirkung auf die wissenschaftliche Praxis sowie die Offenheit der Wissensevolution: die nach Wettbewerbsvorteilen strebende unternehmerische Universität, die auf Drittmitteleinwerbung im großen Stil ausgerichtete strategisch planende Universität und die auf betriebswirtschaftliches Qualitätsmanagement fokussierte Audit-Universität.
Vita
Richard Münch ist Seniorprofessor für Gesellschaftstheorie und komparative Makrosoziologie an der Zeppelin Universität Friedrichshafen und Emeritus of Excellence an der Universität Bamberg.
Übersicht
Cover
Titel
Über das Buch
Vita
Inhalt
Impressum
Inhalt
Vorwort
1.
Was ist und wie entsteht wissenschaftliche Exzellenz?
I.
Die unternehmerische Universität
2.
Die Universität im Wettbewerb um Exzellenz
2.1
Vom wissenschaftlichen zum ökonomischen Wettbewerb um Exzellenz: die unternehmerische Universität
2.2
Von der Einzelforschung zum Forschungsverbund: die strategisch planende Universität
2.3
Von der internen zur externen Qualitätssicherung: die Audit-Universität
2.4
Fazit
3.
Die List der Vernunft in den Händen der strategiefähigen Hochschule?
3.1
Die Hegemonie des ökonomischen Wettbewerbsparadigmas
3.2
Wettbewerb auf dem Fundament erneuerungsfeindlicher Strukturen
3.3
Die strategiefähige Hochschule als Agent eines natürlichen Ausleseprozesses
3.4
Die Universität im Wettbewerb um Bildungsrenditen
3.5
Schlussbemerkungen
II.
Die strategisch planende Universität
4.
Wissenschaft in den Händen des strategischen Managements
4.1
Strategisch planendes Management von Universitäten: USA und Deutschland
4.2
Universitäres Qualitätsmanagement im deutschen Kontext
4.3
Weshalb die Wissenschaft die Freiheit braucht, Fehler machen zu dürfen, um neues Wissen zu generieren
4.4
Schlussbemerkungen
5.
Universität in der Profilneurose: Niklas Luhmanns Sonderforschungsbereich zum Nulltarif
5.1
Die Universität in ihrem organisationalen Feld
5.2
Die Fakultät in ihrem organisationalen Feld
5.3
Die Forschung in ihrem organisationalen Feld
5.4
Welche Organisation für die Forschung?
5.5
Schlussbemerkungen
III.
Die Audit-Universität
6.
Die Kolonisierung der Wissenschaft durch Rankings
6.1
Helfen Rankings bei der Wahl des Studienortes?
6.2
Rankings als Self-fulfilling Prophecies
6.3
Schlussbemerkungen
7.
Alle Macht den Zahlen! Zur Soziologie des Zitationsindexes
7.1
Selektivität
7.2
Reaktivität
7.3
Fatalität
7.4
Schlussbemerkungen
8.
Die Macht der Zahlen in der Evaluation wissenschaftlicher Forschung. Eine soziologische Erklärung
8.1
Primäre wissenschaftsinterne Qualitätssicherung
8.2
Sekundäre wissenschaftsexterne Qualitätssicherung
8.3
Against Method! Zur Aktualität von Paul Feyerabend in der total administrierten Universität
8.4
Expansion der sekundären Qualitätssicherung trotz massiver Kritik. Auf der Suche nach einer soziologischen Erklärung
8.5
Schlussbemerkungen
IV.
Akademischer Kapitalismus
9.
Akademischer Kapitalismus: Harmloser oder gefährlicher Hybrid?
9.1
Der systemtheoretische Blick
9.2
Der feldtheoretische Blick
9.3
Eine Art kapitalistischer Landnahme der Wissenschaft
9.4
Die akademische Dreiklassengesellschaft
9.5
Überausstattung in der Spitze, Unterausstattung in der Breite
9.6
Schlussbemerkungen
10.
Kapital und Arbeit im akademischen Shareholder-Kapitalismus
10.1
Vier Entwicklungstrends
10.2
Zwei Faktoren zur Erklärung der Entwicklungstrends
10.3
Die amerikanische Universität: Entwicklungsdynamik jenseits der Differenzierung in Elite und Masse
10.4
Schlussbemerkungen
11.
Akademische Feldstrukturen, Netzwerke, Paradigmen und Karrieren. Ein Forschungsprogramm
11.1
Das akademische Feld
11.2
Feld, Netzwerke, Paradigmen und Karrieren
11.3
Theoretische Annahmen
11.4
Daten und Methoden
11.5
Erste Ergebnisse
Literatur
Abbildungen
Tabellen
Veröffentlichungsnachweise
Vorwort
Die Universität ist die tragende Säule der sogenannten Wissensgesellschaft. Von ihrer Leistungsfähigkeit hängt die Entwicklung des wissenschaftlichen Wissens und dessen Vermittlung an die nachfolgenden Generationen ab. Mit der Aufnahme des Lehr- und Forschungsbetriebs der nach dem Organisationsplan von Wilhelm von Humboldt neugegründeten Berliner Universität im Jahre 1810 sind die Autonomie und die Integration von Forschung und Lehre weltweit die zentralen Merkmale einer jeden Universität geworden. Wie die Universitäten dieses Leitbild verwirklichen, variiert stark nach nationalen Kulturen und ist immer einem historischen Wandel unterworfen. Gegenwärtig erlebt die Universität einen Wandel, der durch die globale Verbreitung von internationalen und nationalen Rankings sowie durch neue Konzepte der Governance von Forschung und Lehre nach den Leitlinien von New Public Management (NPM) geprägt ist. Die stark gewachsene Bedeutung internationaler und nationaler Universitätsrankings und die dadurch geschaffene akademische Champions League führen zusammen mit der globalen Verbreitung von New Public Management im Zeichen des Neoliberalismus zu einer Überlagerung des individuellen wissenschaftlichen Wettbewerbs um Erkenntnisfortschritt und Anerkennung durch die wissenschaftliche Gemeinschaft durch den institutionellen ökonomischen Wettbewerb von Universitäten um Forschungsmittel, erfolgreiche Forscher, begabte Studierende und Machtpositionen, mit denen sie sich Wettbewerbsvorteile verschaffen können. Die von Robert K. Merton identifizierten Spielregeln guter wissenschaftlicher Praxis – Universalismus, organisierter Skeptizismus, intellektueller Kommunismus und Uneigennützigkeit – in der Obhut der wissenschaftlichen Gemeinschaft und der einzelnen Fachgesellschaften werden durch die ökonomischen Spielregeln des Strebens nach Monopolrenten aus Wettbewerbsvorteilen und Marktmacht verdrängt. In diesem Buch werden drei Wesenszüge der Universität in diesem Wettbewerb und ihre Wirkung auf die wissenschaftliche Praxis und die Offenheit der Wissensevolution untersucht: die nach Wettbewerbsvorteilen strebende unternehmerische Universität, die auf Drittmitteleinwerbung im großen Stil ausgerichtete strategisch planende Universität und die auf betriebswirtschaftliches Qualitätsmanagement zielende Audit-Universität. Daran anschließend wird der Fokus auf das Ganze gerichtet, in dem diese drei Wesenszüge der Universität in unserer Gegenwart zusammenkommen. Das ist der sogenannte akademische Kapitalismus. Abschließend wird eine Forschungsagenda skizziert, die den Blick auf akademische Feldstrukturen, Netzwerke, Paradigmen und Karrieren im akademischen Kapitalismus richtet. Die Universität im akademischen Kapitalismus ist ein höchst bedeutsames und vielgestaltiges Phänomen, das noch weit in die Zukunft hinein das Interesse der soziologischen Wissenschafts- und Hochschulforschung auf sich ziehen wird. Dafür soll die Forschungsagenda einige Leitlinien bereitstellen.
Die soziologische Erforschung der Universität im akademischen Kapitalismus beschäftigt mich nun schon seit zwanzig Jahren. Den Anstoß dazu haben das Elitenetzwerk Bayern und die Exzellenzinitiative von Bund und Ländern zur Stärkung der universitären Spitzenforschung gegeben. Beide Programme wurden im Jahr 2005 ins Leben gerufen. Aus der Beschäftigung mit diesen Programmen ist dann schnell das generelle Interesse an dem grundlegenden Wandel der Universitäten im Kontext der Entwicklung eines akademischen Kapitalismus erwachsen. In rascher Abfolge sind daraus drei Bücher hervorgegangen: Die akademische Elite (Suhrkamp, 2007), Globale Eliten, lokale Autoritäten (Suhrkamp, 2009) und Akademischer Kapitalismus (Suhrkamp, 2011). Eine englische Weiterbearbeitung des letztgenannten Buches ist dann 2014 unter dem Titel Academic Capitalism erschienen (Routledge, 2014). Dazu gesellte sich 2016 und in überarbeiteter sowie erweiterter Fassung 2020 ein größerer Artikel zum Thema »Academic Capitalism« in der Oxford Research Encyclopedia Politics. Im weiteren Verlauf haben sich weit verstreute Aufsätze unterschiedlichen Facetten der Universität im akademischen Kapitalismus gewidmet. Diese Aufsätze habe ich hier in überarbeiteter Form, teilweise gekürzt, teilweise verlängert und neu geordnet zusammengefügt, um ein möglichst facettenreiches Gesamtbild dieses tiefgreifenden Wandels der Universität zu zeichnen. Aus dem Zusammenfügen verschiedener Aufsätze ergibt sich zwangsläufig, dass wesentliche Aspekte des akademischen Kapitalismus in unterschiedlichen Kontexten wiederholt beleuchtet werden, um jeweils die Interpretation bestimmter Phänomene anzuleiten. Bestimmte Beispiele dienen außerdem an unterschiedlichen Stellen der konkreten Veranschaulichung allgemeiner Aussagen. Die Kontexte sollten jedoch unterschiedlich genug sein, um trotz derartiger Redundanzen neue Aspekte der Universität im akademischen Kapitalismus zum Vorschein kommen zu lassen. In das Buch sind schließlich die Forschungsagenda und erste Ergebnisse eines von der Deutschen Forschungsgemeinschaft von 2020 bis 2024 geförderten, zusammen mit Andreas Schmitz, Christian Schmidt-Wellenburg, Jonas Volle und Oliver Wieczorek durchgeführten Projektes über Netzwerke, Paradigmen und Karrieren im akademischen Feld im Vergleich zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten am Beispiel der Soziologie eingegangen (DFG Nr. 429041218). Ich danke ihnen allen für viele wertvolle Anregungen. Schließlich ein Hinweis: Aus Gründen der Lesbarkeit des Textes wird in der Regel das generische Maskulinum verwendet, gelegentlich wird auch das männliche und das weibliche Geschlecht genannt, gemeint sind immer alle Geschlechter.
1.Was ist und wie entsteht wissenschaftliche Exzellenz?
Im Kontext der Agenden der OECD und der EU, die auf den Aufbau der sogenannten wissensbasierten Wirtschaft – oder allgemein: der Wissensgesellschaft – abzielen, wurde die Wissenschaft zur wesentlichen Quelle für Innovation und Wirtschaftswachstum. Die Universität wurde zu einer tragenden Säule der Wissensgesellschaft (Berman 2012; Stehr 2022, 2023; Frank und Meyer 2020). Die theoretische Grundlage dafür ist die Rolle von Wissen und Humankapital in der neuen ökonomischen Wachstumstheorie (vgl. Becker 1964/2009; Acemoglu 2008; Lewis 2013). Im Zuge dieser gewachsenen wirtschaftlichen Bedeutung der wissenschaftlichen Forschung wurden die Gesetze des wirtschaftlichen Wettbewerbs auch der wissenschaftlichen Suche nach Wahrheit übergestülpt. Das gilt insbesondere für die Suche nach Exzellenz in der Wissenschaft. Diese Suche folgt dem Skript einer erfolgsversprechenden Wettbewerbsstrategie von Unternehmen. Die hier versammelten Texte konzentrieren sich auf die Veränderungen der wissenschaftlichen Praxis, die aus der Übertragung des Wettbewerbs um Exzellenz zwischen Unternehmen auf die Wissenschaft resultieren. Aus diesem Blickwinkel sind der Wandel von Universitäten in strategisch operierende Unternehmen, ihr externes Streben nach Wettbewerbsvorteilen und ihre interne Konzentration auf totales Qualitätsmanagement im Kontext einer Art von akademischem Kapitalismus von entscheidender Bedeutung (Münch 2007a; 2011, 2014; 2020a; Wieczorek und Muench 2023). Die Frage, die es hier zu untersuchen gilt, richtet sich auf den Wandel der Erkenntnisproduktion im Wettbewerb zwischen unternehmerisch agierenden Universitäten, wie weit dieser Wettbewerb den Erkenntnisfortschritt befördert, die Evolution des wissenschaftlichen Wissens offenhält und für dessen stetige Erneuerung sorgt (vgl. Jessop 2017; Reitz 2017; Schulze-Cleven 2020; Schulze-Cleven und Olson 2017; Schulze-Cleven et al. 2017).
Wissenschaft zwischen Diversität und Uniformität
Wie wird in der wissenschaftlichen Praxis gewährleistet, dass ein stetiger Erkenntnisfortschritt stattfindet, Irrtümer aufgedeckt und neue Erkenntnisse gewonnen werden? Die alltägliche Arbeit in der Wissenschaft besteht in einem hohen Maße in Routinen. Das vorhandene Wissen wird rezipiert, neu geordnet, durchdacht und dokumentiert. Es werden Gedanken entwickelt und geordnet. Experimente werden durchgeführt, um zu prüfen, ob das vorhandene Wissen auch bestätigt werden kann. In diesen Routinen kommt das zum Ausdruck, was Thomas Kuhn (1962) in seiner Studie über die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen als Normalwissenschaft bezeichnet hat. Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass diese wissenschaftliche Praxis große Bedeutung für die Sicherung des Bestandes an wissenschaftlichem Wissen hat. Diese Arbeit ist mit besonderer Sorgfalt zu erledigen. Es ist das, was wir von jedem Wissenschaftler und jeder Wissenschaftlerin erwarten. Das sichert die »Qualität« wissenschaftlicher Erkenntnis. Niemand käme aber auf den Gedanken, besondere Sorgfalt schon als exzellent und damit preiswürdig zu bezeichnen. Das gilt schon für die Auszeichnung von Dissertationen mit dem Prädikat »summa cum laude«. Um diese Auszeichnung zu verdienen, muss eine Dissertation aus der Reihe üblicher Leistungen herausragen. Das wird auch von allen anderen wissenschaftlichen Arbeiten erwartet. Sie müssen etwas Besonderes hervorbringen, zu neuen Erkenntnissen führen. Das ist die »Originalität« wissenschaftlicher Erkenntnisse. Dabei gibt es zwischen den unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Verständnis von Originalität (vgl. Barlösius 2019).
Weil neue Erkenntnisse besondere Anerkennung mit sich bringen, gibt es immer auch einen Wettlauf um die Generierung neuer Erkenntnisse. Die ersten Forscher, die eine Entdeckung gemacht haben, erlangen größte Anerkennung, während alle nachfolgenden Forscher leer ausgehen. Das impliziert, dass es immer wieder Prioritätsstreitigkeiten hinsichtlich wissenschaftlicher Entdeckungen gegeben hat (Merton 1957). Neue Erkenntnisse hervorbringen zu müssen, um den Erwartungen an die Rolle des Wissenschaftlers gerecht zu werden, setzt hohe Ziele, die nicht von allen in gleicher Weise und zu jeder Zeit erreicht werden können. In der Wissenschaft ist deshalb die Diskrepanz zwischen gesetzten Zielen und verfügbaren Mitteln zu ihrer Erreichung ein Dauerzustand, den Robert Merton (1949/1968d) als Anomie bezeichnet hat. Nur wenige Wissenschaftler erlangen Elitestatus, indem sie die Mittel haben, um die hohen Ziele zu erreichen und für neue Erkenntnisse bekannt zu werden. Die meisten von ihnen leisten mit den ihnen zugänglichen Mitteln kleine Beiträge zur Verbesserung des Erkenntnisstandes und betreiben »Ritualismus«, d. h. Normalwissenschaft. Einige geben auf und ziehen sich zurück. Andere versuchen es mit illegitimen Mitteln und täuschen die Kollegenschaft mittels Plagiats oder gefälschter experimenteller Befunde. Und es gibt auch das Phänomen der Rebellion derjenigen, die sich gegen die Vormachtstellung der Wissenschaft oder bestimmter Paradigmen auflehnen und alternativen Formen der Wissensgenerierung zum Durchbruch verhelfen wollen. Das sind die von Merton (1949/1968d, 1957: 649-658) identifizierten Typen des abweichenden Verhaltens.
Neues hervorzubringen, verlangt schöpferische Kraft. Es ist also besondere Kreativität, die wir auszeichnen, wenn wir für wissenschaftliche Leistungen Preise vergeben. Was bedeutet aber Kreativität in der Wissenschaft? Kreativität verlangt immer, ausgetretene Pfade zu verlassen und neue Pfade zu erschließen. Das können neue Entdeckungen sein, neue theoretische Sichtweisen, neue Methoden, neue Instrumente und Durchbrüche in einem Forschungsfeld, neue Kombinationen von Ideen und Methoden, die neue Perspektiven für die Forschung eröffnen (Heinze und Münch 2012). Es ist das, was Joseph Schumpeter als »schöpferische Zerstörung« bezeichnet hat (vgl. Schumpeter 1942/1980; Uzzi et al. 2013; Wang et al. 2017; Koppman und Leahey 2019; Fontana et al. 2020; Leahey et al. 2023; Falkenberg und Fochler 2024). Um Exzellenz in der Wissenschaft zu fördern, bedarf es also eines möglichst großen Spielraums für die Entfaltung von Kreativität. Kontrollen, die auf Qualitätssicherung zielen, können dabei hinderlich sein. Diese für den Erkenntnisfortschritt hinderliche Seite der Qualitätssicherung in der Wissenschaft hat insbesondere Paul Feyerabend (1976) in seiner fulminanten Kritik an der methodischen Uniformität der wissenschaftlichen Praxis beleuchtet. Dieser Praxis hat er das Credo »Wider den Methodenzwang« entgegengestellt. Nach diesem Credo ist theoretischer und methodischer Pluralismus die Voraussetzung für Fortschritte der Erkenntnis.
Würde sich die gesamte wissenschaftliche Praxis nach den Vorstellungen von Paul Feyerabend vollziehen, dann wäre Chaos das Alltägliche in der Wissenschaft. Niemand wüsste, was wahr ist und was nicht wahr ist. Das ist sicherlich auch kein für den Erkenntnisfortschritt förderlicher Zustand der Wissenschaft. Um Fortschritte der Erkenntnis bestimmen zu können, müssen wir zwischen Wahrheit und Unwahrheit unterscheiden können. Diese Aufgabe fällt der Qualitätssicherung zu. Wir können deshalb sagen, dass sich Wissenschaft zwischen zwei Polen entwickelt. Auf der einen Seite ist der Pol der Kreativität und des theoretischen und methodischen Pluralismus, auf der anderen Seite der Pol der Qualitätssicherung und der Uniformität. Die genuin wissenschaftliche Qualitätssicherung besteht in der allgegenwärtigen Kritik, der jede wissenschaftliche Arbeit ausgesetzt ist. Voraussetzung dafür, dass es dabei zu keinen Verzerrungen kommt, ist die ideale Sprechsituation nach Jürgen Habermas (1971). Es muss Gleichberechtigung herrschen, jeder und jede kann Behauptungen aufstellen, jeder und jede kann Behauptungen kritisieren, und es gilt nur das bessere Argument. Die Beseitigung von Irrtümern durch Kritik ist der entscheidende Antrieb des wissenschaftlichen Fortschritts auf der Seite der Qualitätssicherung (Popper 1934/1966, 1963). Kritik ist deshalb allgegenwärtig in der wissenschaftlichen Praxis. Nichts kann behauptet werden, ohne dass von irgendeiner Seite Widerspruch eingelegt wird. Nur diejenigen Behauptungen, die der Kritik standhalten, bleiben im Bestand des wissenschaftlichen Wissens erhalten. Diese Art der Qualitätssicherung findet in der Wissenschaft immer und überall statt. Sie beginnt in der Diskussion im Seminar, geht weiter in der Arbeit des Forscherteams und in der Vorstellung von Forschungsergebnissen auf einer Konferenz. Bevor Forschungsergebnisse in Fachzeitschriften oder in Büchern angesehener Verlage zur Veröffentlichung gelangen, werden sie einer eingehenden Prüfung und Kritik durch Gutachter im sogenannten Peer Review unterworfen. Sind sie veröffentlicht, treffen sie weiterhin auf Kritik, die auf die Entdeckung von Irrtümern zielt. (Hirschauer 2004; Bornmann 2010; vgl. Vanderstraeten 2021 zur historischen Entwicklung am Beispiel der Erziehungswissenschaft).
Qualitätssicherung in diesem Sinne ist demgemäß ein fest institutionalisierter, ganz wesentlicher Bestandteil der wissenschaftlichen Praxis. Wir müssen uns aber darüber im Klaren sein, dass wir uns dabei am Pol der Uniformität in der Wissenschaft befinden und dass wir Gefahr laufen, den Spielraum der Kreativität, der für die Förderung des Erkenntnisfortschritts benötigt wird, zu weit einzuschränken, wenn wir alles auf die Karte der Qualitätssicherung setzen. Dabei ist immer zu berücksichtigen, dass reale wissenschaftliche Diskurse niemals vollständig unter der Bedingung einer idealen Sprechsituation stattfinden, sondern im Sinne von Foucaults (1991) Ordnung des Diskurses mehr oder weniger durch elitäre Oligopole der Wissensproduktion und Machtkartelle der Verteilung von Forschungsmitteln verzerrt sind (vgl. Münch 2007b: 316-372; Young et al. 2008). Genau diese Gefahr birgt die gegenwärtig herrschende Reformagenda in sich, Wissenschaft in zunehmendem Maße der Beobachtung und Kontrolle von außen zu unterwerfen. Das umfasst die wissenschaftliche Qualitätssicherung im engeren Sinn, zunehmend aber auch politisch motivierte externe Kontrolle im Sinne der sogenannten politischen Korrektheit. Auch Exzellenzwettbewerbe, mit denen man der Wissenschaft eine besondere Förderung angedeihen lassen will, erhöhen das Maß an äußerer Kontrolle über die Wissenschaft, mit der dann eine stärkere Betonung der inneren Kontrolle und Qualitätssicherung einhergeht (vgl. Münch 2007b; Leibfried 2010; Reitz et al. 2016). Das geht zu Lasten des Spielraums für Kreativität (Marginson 2008a). Das Verhältnis zwischen Pluralismus und Uniformität gerät aus dem Gleichgewicht. Der Pol der Uniformität erhält ein Übergewicht über den Pol des Pluralismus. Exzellenzwettbewerbe zwingen dann paradoxerweise die wissenschaftliche Praxis in die Bahnen der Normalwissenschaft. Das damit verbundene verstärkte Monitoring engt den Spielraum für das Verlassen ausgetretener Forschungspfade ein. Die Wissenschaft verliert an paradigmatischer Diversität und damit an Chancen für Erkenntnisfortschritt. Genau das bestätigt zum Beispiel eine Studie von Whitley, Gläser und Laudel (2018) zu Innovationen in Physik, Biologie und Erziehungswissenschaft in Deutschland, den Niederlanden, der Schweiz und Schweden. Um mehr Spielraum für Kreativität zu schaffen, wird deshalb verstärkt über neue Verfahren bei der Entscheidung über die Förderung von Forschungsprojekten diskutiert, so insbesondere über Lotterieverfahren (vgl. Osterloh und Frey 2020; Frey et al. 2023; Barlösius und Blem 2021; Barlösius und Philipps 2022; Barlösius et al. 2023).
Kreativität in der Wissenschaft. Was sagt die Wissenschaftsforschung dazu?
Wenn wir nach den Voraussetzungen dafür fragen, dass sich Kreativität in der Wissenschaft entfalten kann, dann müssen wir uns im Klaren darüber sein, dass wir auf den einen Pol der Wissenschaft, die Pluralität, schauen und den anderen Pol, die Uniformität und Qualitätssicherung, in den Hintergrund rücken. Es kommt dabei alles auf den Spielraum für die unkontrollierte Neugierde auf Entdeckungen an, auf das Streben nach Neuem, das Spiel mit den Gedanken und die Exploration von unerforschtem Gelände. All das ist höchst riskant und leicht zum Scheitern verurteilt. Die Entfaltung von Kreativität benötigt deshalb ein hohes Maß der Risikobereitschaft und der Fehlertoleranz, bis hin zur Bereitschaft, auch mit dem Scheitern eines Projektes leben zu können, sowohl auf der Seite der Forschenden als auch auf der Seite ihrer Geldgeber. Beide müssen Spielernaturen sein. Es versteht sich von selbst, dass Spielernaturen dazu neigen, Geld zu verzocken, die einen, weil es ihnen nicht wichtig ist, die anderen, weil sie zu viel davon haben. So ist es wenig überraschend, dass in einem Land wie den Vereinigten Staaten, in dem viel Reichtum vorhanden ist und der Staat nur in bescheidenem Maße den Reichtum besteuert und dem schon von den ersten Einwanderern an in die Wiege gelegt wurde, von Ost nach West zu neuen Ufern, Reichtum und Glück zu streben, viel Risikokapital zur Verfügung steht. Das ist in Ländern weniger der Fall, in denen es weder diesen Reichtum noch den Pioniergeist der ersten Siedler gibt und in denen es in erster Linie dem Staat obliegt, in Forschung und Technologie zu investieren und dafür gegenüber dem Steuerzahler geradezustehen.
Im Zuge der verstärkten Beobachtung der Staatstätigkeit und der gesunkenen Bereitschaft, diese Tätigkeit mit Steuerzahlungen zu ermöglichen – beides ein Ergebnis der weltweiten, von den Vereinigten Staaten und Großbritannien ausgehenden Verbreitung der neoliberalen Reformagenda – steht die jeweilige Regierung unter erhöhtem Druck, die Erfolge von Investitionen auch kurzfristig innerhalb einer Legislaturperiode nachweisen zu müssen. So haben wir das paradoxe Ergebnis, dass staatliches Kapital ungeduldiger ist als privates. Mehr als private Sponsoren, die sich schon mit dem Prestige begnügen, dass eine Professur, ein Institut, ein Forschungszentrum, ein Labor oder eine Bibliothek einer prestigereichen Universität ihren Namen trägt, muss die Regierung in einer Zeit gesunkener Loyalität der Wähler und Steuerzahler darauf schauen, dass ihre Investitionen in die Forschung auch sichtbare Erträge erbringen. Die Erträge müssen berechenbar sein. Die gewachsene Abhängigkeit der Regierungen von der Unterstützung durch die Wähler arbeitet genau in diese Richtung. Die auf Kurzfristigkeit eingestellte Berichterstattung durch die Medien trägt ihren Teil dazu bei, dass Erfolge berechenbar und nachweisbar sein müssen. Genauer gesagt: Weil sie nicht wirklich berechenbar sind, richtet sich die staatliche Förderung der Wissenschaft in erster Linie nach den herrschenden Vorstellungen von erfolgsträchtiger Forschung. In der Perspektive des soziologischen Neoinstitutionalismus dominiert das risikoaverse Streben nach der Legitimität von Investitionen im Umfeld herrschender Paradigmen über die risikofreudige Erforschung von Neuland, die immer mit den herrschenden Paradigmen brechen muss (Meyer und Rowan 1977). Statt des offenen Wettbewerbs um Problemlösungen im Sinne von Friedrich von Hayek (1969) herrschen dann Oligopole der Wissensproduktion. Das wird von dem neuen Glauben an die staatliche Weitsicht bei der Investition in den technologischen Fortschritt einer Mariana Mazzucato (2015, 2021) verkannt.
Als Erstes können wir demnach festhalten, dass Kreativität dort einen größeren Spielraum in der Wissenschaft hat, wo mehr Risikokapital vorhanden ist und wo Spielertypen leicht Geld in die Hand bekommen, um es in große Gewinne oder auch herbe Verluste umzusetzen. Das finden wir in den Vereinigten Staaten in höherem Maße als in allen anderen Ländern der Welt, so auch in Deutschland, nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der Wissenschaft. Diese Tatsache trägt neben der schieren Größe des Wissenschaftssystems und dessen Zentralität im globalen Wettbewerb um Erkenntnisfortschritt einen maßgeblichen Baustein dazu bei, dass in den Vereinigten Staaten mehr nobelpreiswürdige Entdeckungen gemacht werden als im Rest der Welt (vgl. Zuckerman 1967, 1977; zu österreichischen Nobelpreisträgern vgl. Haller et al. 2002).
Neben der Verfügbarkeit von Risikokapital bestimmen institutionelle und organisationale Strukturen, welchen Spielraum es für die Entfaltung von Kreativität gibt und auch – was ebenso wichtig ist – wie rezeptionsfähig die Wissenschaft für Neuerungen ist, sodass sie auch beachtet werden und Anstöße für weitere Forschung geben (Heinze und Münch 2012). Mit Thomas Kuhns (1962) Studie zur Struktur wissenschaftlicher Revolutionen können wir sagen, dass sich in der Forschung zumindest für eine gewisse Zeit herrschende Paradigmen durchsetzen, denen die alltägliche Forschungspraxis zuarbeitet. Das ist die o. g. Praxis der Normalwissenschaft, die in der Regel institutionell dadurch abgesichert ist, dass ihre Hauptvertreter in den großen Zentren der Forschung sitzen, an den führenden Institutionen forschen und lehren, die Akademien beherrschen, die Herausgeberschaft der dominanten Fachzeitschriften und die Ausschüsse der zentralen Förderorganisationen besetzen (vgl. Hodgson und Rothman 1999; Münch 2007b: 316-372; Young et al. 2008). Ein spezieller Fall der möglichen Verzerrung des wissenschaftlichen Diskurses zugunsten eines herrschenden Paradigmas zeigt sich gegenwärtig in der Klimaforschung, deren Ergebnisse regelmäßig vom gemischt aus Wissenschafts- und Regierungsvertretern zusammengesetzten Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) zusammengetragen werden. Das Executive Summary der Berichte des IPCC spitzt zwangsläufig die im umfassenden Bericht wesentlich heterogeneren Befunde zu, sodass die Politik daraus eine konsistente Agenda ableiten kann. Das hat wiederum Rückwirkungen auf die Verteilung von Fördermitteln, die vorzugsweise in solche Projekte fließen, die der herrschenden Agenda folgen. Auch dann, wenn der herrschende Konsens nach allem, was bislang an Wissen vorhanden ist, richtig liegt, vermindert das die Chancen auf neue Erkenntnisse durch alternative Sichtweisen. Bei allem Konsens gilt auch für die Klimaforschung wie für jede Forschung, dass der Konsens über das vorhandene Wissen immer nur vorläufig und bis auf Widerruf gilt (vgl. Stehr und Machin 2019; Stehr und von Storch 2023).
Nach Kuhns Studie wird der Paradigmenwandel erst durch den Wechsel der Generationen vollzogen, wenn also die Vertreter der alten Welt aus dem akademischen Leben ausscheiden. Neue Generationen von Forschern können sich aber auch durch den Sturz der alten Fürsten und Könige profilieren. Das kann im Großen und Kleinen geschehen, kann eine ganze Disziplin erfassen, aber auch nur ein kleines Forschungsgebiet oder sogar nur eine spezielle Richtung in diesem Gebiet. Man kann daraus lernen, dass die Wissenschaft umso mehr Spielraum für die Entfaltung von Kreativität bietet und umso schneller Neues rezipiert und weiterentwickelt, je rascher die Generationen aufeinander folgen und je früher neue Generationen ans Ruder kommen, zumindest probeweise. Frühzeitig ein eigenes Forschungsprogramm zu entwickeln und darin nicht durch äußere Zwänge behindert zu werden, ist von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung von Kreativität in der Wissenschaft, wie etwa Laudel und Bielick (2018) am Beispiel deutscher Nachwuchswissenschaftler in der Pflanzenbiologie, Experimentalphysik und frühmodernen Geschichte beobachten. Auch dafür bieten die Vereinigten Staaten bessere Chancen als andere Länder, gerade auch im Vergleich zu Deutschland. Das hat schon Joseph Ben-David (1971/1984) in seiner Studie The Scientist’s Role in Society deutlich gemacht. Zwei institutionelle Vorteile zeichnen die Situation in den Vereinigten Staaten im Vergleich zu Deutschland aus: Erstens findet Forschung ganz überwiegend an Universitäten eng verzahnt mit der Lehre im Graduiertenstudium statt. Zweitens ist die zentrale Organisationseinheit für Forschung und Lehre das Department mit 30 bis 40 Professoren bzw. Professorinnen, denen in der Regel keine festen Mitarbeiterstäbe zugeordnet sind. In Deutschland vollzieht sich stattdessen ein großer Teil der Forschung an außeruniversitären Instituten, die ca. 40 Prozent der öffentlichen Forschungsmittel verausgaben. Und die zentrale Organisationseinheit von Forschung und Lehre an den Universitäten ist der Lehrstuhl mit dem Lehrstuhlinhaber bzw. der Lehrstuhlinhaberin und einer geringeren oder größeren Zahl von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. In einem Fach (korrespondierend zum amerikanischen Department) lehren nicht 30 bis 40 Professoren ohne etatmäßige Mitarbeiter, sondern sechs bis zwölf Professoren mit jeweils zwei bis zehn Mitarbeitern.
Die Integration von Forschung und Lehre im Graduiertenstudium hat für die Förderung von Kreativität und Rezeption von Neuem den Vorteil, dass an der vordersten Front der Forschung gelehrt wird, an der die Doktoranden und Doktorandinnen unmittelbar mitwirken, in der Regel im Team mit einem Professor bzw. einer Professorin. Im Unterschied zum Lehrstuhlsystem, in dem die Doktoranden in der Regel als Mitarbeiter in die Forschung eines einzigen Professors eingebunden sind, besteht im amerikanischen Graduiertenstudium in dieser Phase der Sozialisation des wissenschaftlichen Nachwuchses ein breiteres Lern- und Experimentierfeld, das sowohl im Austausch untereinander als auch im Austausch mit verschiedenen Professoren erkundet wird. Das erhöht den Spielraum für paradigmatische Diversität und bietet mehr Anregungspotential für neue Ideen. Zugleich wird gewährleistet, dass neue Ansätze der Forschung ein breiteres Rezeptionsfeld unter den Doktorandinnen und Doktoranden finden als im Lehrstuhlsystem, in dem der Austausch auf den Lehrstuhlinhaber und seine Mitarbeiter begrenzt ist. Das Departmentsystem erlaubt es, neue Forschungsgebiete und –richtungen in größerer Zahl auf Professorenebene zu repräsentieren. Bei 30 bis 40 Professoren im amerikanischen Department sind viel mehr Spezialisierungen, auch im Grenzgebiet zu anderen Disziplinen, möglich als in einem deutschen Fachbereich mit sechs bis zwölf Professoren, in dem die Spezialisierungen den Mitarbeitern und Privatdozenten ohne feste Anstellung überlassen bleiben und damit nicht auf Dauer und mit entsprechend erhöhten Chancen der Weiterentwicklung und interdisziplinären Kooperation institutionalisiert werden können.
Das Department und seine Unterteilung in Senior und Junior Faculty ermöglicht, dass Nachwuchswissenschaftler schon nach der Promotion mit Tenure-Track, d.h. mit Aussicht auf Aufstieg und Verstetigung der Anstellung (Tenure), auf Professuren berufen werden. Das impliziert frühere Selbständigkeit als das deutsche Lehrstuhlsystem, in dem bis ins 40. Lebensjahr und noch darüber hinaus in abhängiger Stellung geforscht und gelehrt wird, bis endlich – wenn überhaupt – die Berufung auf eine Professur bzw. einen Lehrstuhl erfolgt. Dazu gehört auch, dass das Lehrstuhlsystem mit seiner oligarchischen Struktur mehr als das Departmentsystem den männlichen Habitus favorisiert (vgl. Bourdieu 2005; Hark und Hofbauer 2018, 2023; Striedinger et al. 2016). Das bedeutet, dass die sogenannte Leaky Pipeline, der Verlust an weiblichem Personal mit aufsteigenden Karrierestufen, in Deutschland stärker wirksam wird als in den Vereinigten Staaten (vgl. Clark Blickenstaff 2005; Huang et al. 2020; Osterloh und Rost 2024). In den Vereinigten Staaten waren 1991 schon 32 Prozent der Hochschulprofessoren Frauen, 2018 dann 47 Prozent (AAUP 2020; Spoon et al. 2023). In Deutschland lag dieser Prozentsatz 2000 bei erst 10 und 2023 dann bei 30 (Statista 2024). Neben der größeren Verfügbarkeit von Risikokapital tragen auch diese institutionellen Vorteile ihren Teil dazu bei, dass seit dem Zweiten Weltkrieg der weitaus größte Teil der Nobelpreise für gewiss ein hohes Maß an Kreativität verlangende bahnbrechende Forschung in die Vereinigten Staaten gegangen ist (Münch 2014a: 32, Tab. 1.4; 2014b).
Die neuere Wissenschaftsforschung hat weitere organisatorische und institutionelle Eigenheiten bahnbrechender Forschung ausgemacht (vgl. Heinze und Münch 2016; Laudel und Gläser 2014; Gläser und Laudel 2021). Hollingsworth (2006) hat herausgefunden, dass die von ihm untersuchten 291 Durchbrüche in der Biomedizin von kleineren Forschergruppen erzielt wurden. Heinze et al. (2009) haben Fallstudien zu 20 preisgekrönten, hochkarätigen Wissenschaftlern in der Nanotechnologie und der Humangenetik durchgeführt, die aus einer Gesamtzahl von insgesamt 600 als kreativ identifizierten Wissenschaftlern ausgewählt wurden. In organisationaler Hinsicht haben die genauer betrachteten Wissenschaftler durchwegs in kleinen Forscherteams mit sechs bis acht Mitgliedern gearbeitet, die in einem vielfältigen Umfeld mit viel Anregungspotential lokalisiert waren und weitreichend nach außen, über die Grenzen ihrer Institution hinaus vernetzt waren. Sie verfügten über ein langfristig gesichertes, flexibel einsetzbares Budget und waren nur wenig von der Einwerbung von Drittmitteln abhängig. Sie entschieden autonom über ihre Forschungsagenda, waren nur geringer externer Kontrolle unterworfen und pflegten einen egalitären Umgang untereinander. Der Teamleiter forschte selbst und war unmittelbar, alltäglich und intensiv in die Forschung involviert. In institutioneller Hinsicht zeigte sich, dass die Teamleiter sehr früh zu selbständiger Forschung gekommen waren, das heißt bald nach der Promotion, dass sie ein hohes Maß an Mobilität über institutionelle und disziplinäre Grenzen hinweg auszeichnete und sie nur geringer Rechenschaftspflicht gegenüber Förderorganisationen unterworfen waren (vgl. auch Heinze et al. 2020).
Zu diesen Ergebnissen passt auch ein Befund von Wu, Wang und Evans (2017), die mehr als 50 Millionen im Zeitraum von 1954 bis 2014 veröffentlichte Aufsätze, Patente und Softwareprodukte ausgewertet haben. Die Autoren haben herausgefunden, dass Umbrüche (disruptive work) in der Forschung eher von kleinen Teams erzielt wurden, die Weiterentwicklung vorhandener Forschungslinien (developing work) eher von großen Teams. Was die Reichweite von Kollaborationen betrifft, sind im Sinne der auf Granovetter (1973) zurückgehenden Unterscheidung von weak und strong ties für die Entdeckung neuer Forschungsmöglichkeiten eine Vielzahl schwacher Bindungen förderlich, für die tiefergehende Ausarbeitung vorhandener Forschungsprogramme und dauerhaft hohe Produktivität dagegen eine begrenzte Zahl starker und stabiler Bindungen in Gestalt von Ko-Autorenschaften (vgl. Hansen 1999; Dahlander und McFarland 2013). Zentrale Netzwerkpositionen, speziell Betweenness-Zentralität in Gestalt einer Vielzahl kürzester Wege zu anderen Autoren, und Ko-Autorenschaften mit produktiven Wissenschaftlern garantieren hohe Zitationsraten (Li et al. 2013). Es gibt aber auch Studien, die zwar Vorteile weitreichender, lokale Grenzen überschreitender Ko-Autorenschaften vor allem in experimentellen, weniger in theoretischen Fächern ermitteln, aber keine Vorteile von Betweenness-Zentralität und Eigenvektor-Zentralität in Gestalt von Ko-Autorenschaften mit gut vernetzten Autoren (Bordons et al. 2015). Für die Erschließung neuer Forschungsideen sind Vermittler (Broker) zwischen Netzwerken wichtig, die durch ein strukturelles Loch im Sinne von Burt (2004) voneinander getrennt sind. Sie dienen als Brücke, über die Wissen von einem Netzwerk zu einem anderen Netzwerk transportiert werden kann. Die Beschränkung auf kleine Netzwerke und die seltene Besetzung von Mittlerpositionen zur Überbrückung struktureller Löcher scheint speziell die akademischen Karrierechancen von Frauen zu beeinträchtigen (vgl. Jadidi et al. 2018; Cainelli et al. 2015; Abbasi et al. 2018; Abramo et al. 2019).
Die Förderung interdisziplinärer Forschung hilft, strukturelle Löcher zu überbrücken und durch neue Kombinationen von Theorien und Methoden zu neuen Erkenntnissen zu gelangen. Dabei scheint die Übertragung von Theorien von einem Forschungsfeld in ein anderes eher zur Weiterentwicklung und Konsolidierung der Theorien zu führen, was darin zum Ausdruck kommt, dass in neuen Publikationen umfangreiche Rückbezüge auf die Herkunft der Theorien zu finden sind. Das ist bei der Übertragung von Methoden weniger der Fall. Hier spielt die Anpassung der Methoden an das jeweilige neue Forschungsfeld mit neuen Forschungsfragen eine größere Rolle. Leahey et al. (2023) spekulieren deshalb, dass die Übertragung von Theorien eher die Konsolidierung von Forschungsprogrammen mit sich bringt, während die Übertragung von Methoden eher disruptiven Charakter hat. Dabei muss allerdings berücksichtigt werden, dass Theorien per se immer eine Entwicklungsgeschichte mit sich führen, während es bei Methoden mehr auf den Anwendungsfall als auf ihre Herkunft ankommt. Disruption im Bereich von Theorien ist eine Revolution und bedeutet Paradigmenwechsel, ist viel umkämpfter, verlangt mehr Begründungsaufwand und kommt deshalb seltener vor. Dagegen kann die Übertragung von Methoden von einem in ein anderes Forschungsfeld im Alltagsgeschäft betrieben werden, ist dementsprechend weniger umkämpft, impliziert aber in der Regel dann auch nicht unbedingt einen tiefgreifenden, also disruptiven Wandel (vgl. Falkenberg und Fochler 2024). Infolgedessen scheint es nicht zu passen, generell anzunehmen, dass Theorieübertragung zur Konsolidierung, Methodenübertragung dagegen zur Disruption führt. Die Spekulation von Leahey et al. ist vermutlich einem statistischen Artefakt geschuldet, der darin besteht, dass sie den disruptiven Charakter einer Übertragung an der Zahl von Zitationen festmachen, die sich auf frühere Publikationen zu einer Theorie bzw. Methode beziehen. Der Rückbezug auf Denktraditionen ist genuiner Bestandteil der Arbeit an Theorien. Das gilt jedoch nicht für die Anwendung von Methoden. Sie ist viel mehr auf die jeweilige Untersuchung eines Gegenstands bezogen.
Neue Kombinationen von Forschungsansätzen gehen immer auch größere Risiken des Scheiterns ein, wofür ausreichend Toleranz vorhanden sein muss. Das schließt mit ein, dass nicht jede neue Kombination von Ideen auch tatsächlich zu wissenschaftlichen Durchbrüchen führt und es auch nicht ausgeschlossen ist, dass gelegentlich auch monodisziplinäre Forschung neue Erkenntnisse hervorbringt. Fehlt es an Toleranz und herrscht das Monitoring anhand bibliometrischer Kennzahlen vor, dann gehen die Forscher allerdings auf Nummer sicher und generieren nicht mehr als weitere Beiträge zur Normalwissenschaft. Dazu gehört auch, dass die Publikation in High-Impact Journals nicht zwangsläufig neue Erkenntnisse gebiert, nicht selten sogar neue Erkenntnisse in weniger impactstarken Journals publiziert werden (vgl. Young et al. 2008; Uzzi et al. 2013; Wang et al. 2017; Fontana et al. 2020).
Auch diese organisationalen und institutionellen Faktoren finden wir an amerikanischen Forschungsuniversitäten am weitgehendsten ausgeprägt. So ist die Forschungsförderung der National Science Foundation ganz überwiegend auf die Förderung kleiner Teams ausgerichtet, die sich im Department auch leicht zwischen Professoren und Postdocs sowie Docs bilden lassen. Neben dem disziplinär breit ausdifferenzierten Department bieten interdisziplinäre Forschungszentren weiteres Anregungspotential. Egalitäre Kommunikation und forschungsnahe, kommunikative Führung kennzeichnen die Forschungskultur in Department und Forschungszentren. Dazu kommen noch die frühere Selbständigkeit und die größeren Mobilitätschancen im Departmentsystem aufgrund von dessen breiterer disziplinärer Ausdifferenzierung und die größere Bereitschaft zur Bereitstellung von Risikokapital. Die Kultur der Finanzierung von riskanten Projekten kann auch mit sich bringen, dass die Förderung durch Industriegelder eher erlaubt, Neuland zu betreten, als wenn dem strengen Antragsverfahren der öffentlichen Forschungsförderung im Peer Review Genüge getan werden muss, wie James Evans (2010) in einer interessanten Studie herausgefunden hat. Er gelangt zu der Feststellung, dass Industriegelder erlauben, in größerer Häufigkeit Neuland zu betreten, das aber nicht bis in alle Tiefen hinein erforscht wird, während öffentliche Gelder eher dazu führen, die vorhandenen Forschungsgebiete im Sinne der normalwissenschaftlichen Rätsellösung immer tiefgehender zu durchdringen.
Wenn wir vor diesem Hintergrund die gegenwärtigen Reformbemühungen betrachten, die auf die Förderung von Exzellenz zielen, dann gilt es genau zu prüfen, wie weit diese Reformbemühungen in der Tat Exzellenz in der Wissenschaft hervorbringen. Wie wir gesehen haben, bedarf es dafür eines großen Spielraums für paradigmatische Diversität und Kreativität und eines von externen Kontrollen freien Forschungsraumes. Im Folgenden sollen drei miteinander zusammenhängende Reformstrategien daraufhin untersucht werden. Es handelt sich um den institutionellen Wettbewerb um Exzellenz, zu dessen Intensivierung Universitäten in Unternehmen umgewandelt werden. Die unternehmerische Universität muss sich im Wettbewerb nach außen als strategiefähig erweisen und nach innen über Governancestrukturen verfügen, die ein umfassendes und durchgreifendes Qualitätsmanagement in Forschung und Lehre ermöglichen. Darauf zielt der deutsche Wissenschaftsrat (2013) in seinen Empfehlungen zu den Perspektiven des deutschen Wissenschaftssystems vom Juli 2013 ab. Ein wesentliches Element der unternehmerischen Universität ist die Einwerbung von Drittmitteln im großen Stil der Verbundforschung und ihre Konzentration auf profilbildende Forschungscluster. Sie ist demnach auch eine strategisch planende Drittmittel-Universität. Aufgrund der gewachsenen Bedeutung des inneren Qualitätsmanagements kann man mit Michael Power (1997) sagen, dass die unternehmerische Universität auch durch die Audit-Universität ergänzt wird (vgl. Musselin 2021). Diesen drei Universitäten und ihrer Wirkung auf wissenschaftliche Exzellenz im Sinne von Kreativität und erzielten Erkenntnisfortschritten, die sich aus paradigmatischer Vielfalt speisen, wollen wir uns im Folgenden zuwenden.
I.Die unternehmerische Universität
2.Die Universität im Wettbewerb um Exzellenz
Die in Kapitel 1 skizzierte Transformation der Universität verorten wir im Anschluss an Pierre Bourdieu (1992) in einem akademischen Feld, das durch zwei Achsen bestimmt wird. In der Horizontalen stehen der Pol der Autonomie (links) und der Pol der Heteronomie (rechts) einander gegenüber, in der Vertikalen der Pol der Verfügung über viel Kapital (oben) und der Pol der Verfügung über wenig Kapital (unten). Feldspezifisches Kapital sind wissenschaftliches Kapital (Publikationen, Zitationen, Einladungen, Fellowships, Anerkennungen, Preise, Herausgeberschaften) auf der Seite der Autonomie und institutionelles Kapital (Mitgliedschaften in Ausschüssen der Wissenschaftsorganisationen, der Universität, der Hochschulrektorenkonferenz, des Wissenschaftsrats, der Förderorganisationen) auf der Seite der Heteronomie. Die zentrale Konsekrationsinstanz auf der Seite des autonomen Pols ist die wissenschaftliche Gemeinschaft, repräsentiert durch die einzelnen Fachgemeinschaften, international und national, wie z.B. die International Sociological Association (ISA), die European Sociological Association (ESA), die American Sociological Association (ASA) und die Deutsche Gesellschaft für Soziologie (DGS). Die Wissenschaftler tragen untereinander materielle Kämpfe um Erkenntnisfortschritt und symbolische Kämpfe um die Anerkennung ihrer Beiträge dazu durch die wissenschaftliche Gemeinschaft aus. Die Konkurrenz um Erkenntnisfortschritt und Anerkennung bildet auf der autonomen Seite des gesamten Feldes in der Horizontalen wiederum den heteronomen Pol, dem die Kollegialität unter den Wissenschaftlern als autonomer Pol gegenübersteht. Alle wissenschaftliche Praxis bewegt sich im Spannungsfeld zwischen diesen beiden Polen. Die Konkurrenz führt zu unterschiedlichen Erfolgen und einer entsprechenden Leistungsdifferenzierung, die mehr oder weniger Anerkennung mit sich bringen, erkennbar in Zitationen, Einladungen, Fellowships, Herausgeberschaften und Preisen. Diese Differenzierung von Reputation nach Leistung wird durch das Prinzip der Kollegialität in Grenzen gehalten (Parsons und Platt 1990: 197–201). Kollegialität bedeutet das Teilen von Ressourcen und Wissen und die Respektierung der Beiträge eines jeden Kollegen und einer jeden Kollegin, unabhängig von deren bislang gesammelten Erfolgen und Anerkennungen. Dadurch wird gewährleistet, dass wissenschaftliches Wissen ein kollektiv geteiltes Gut ist, zu dem alle einen Teil beitragen und das allen in gleicher Weise zugänglich ist (Callon 1994). Das bedeutet, dass es auf die Beiträge aller ankommt, und nicht nur auf die Beiträge weniger Stars. Auf den Jahreskongressen der Fachgesellschaften sprechen alle mit gleicher Berechtigung, es gibt kein vorgängiges Recht auf Wahrheit. Das alltäglich zu vollbringende Kunststück der Fachgesellschaften besteht darin, dass die Balance zwischen Kollegialität und Differenzierung von Anerkennung nach Leistung gehalten wird. Auf jeder Jahrestagung werden Preise für außergewöhnliche Leistungen vergeben. Solange sie nur außergewöhnlichen Leistungen vorbehalten sind und in der Zahl nicht zu sehr zunehmen, können sie nicht als Leistungsentgelt missverstanden werden, und es gibt genug Platz für die kleinen Anerkennungen, die mit der Aufnahme in ein Panel einer Sitzung beim Kongress beginnen und mit der Anerkennung des Vortrags durch Nachfragen nicht enden (vgl. Frey 2006; Frey und Gallus 2017).
Der gesamte Forschungsprozess baut auf einer eigenartigen Gleichzeitigkeit von Kollegialität und Konkurrenz auf. Wer Behauptungen aufstellt, braucht den kollegialen Akt eines anderen, der Kritik übt, um im Erkenntnisprozess voranzukommen, der in einer endlosen Abfolge von These und Antithese, Behauptung und Kritik besteht. Am Ende kann das Forschungsergebnis gar nicht mehr voll und ganz einer einzelnen Person zugerechnet werden. Auf jeden Fall haben auch die Kritiker ihren Anteil an der Produktion eines Forschungsergebnisses gehabt, das vorläufig weiterer Kritik standhält. Weil das so ist, gibt es hier keine Sieger und keine Besiegten. Wer sich mit seiner Erkenntnis durchsetzt, hat das nicht allein getan, sondern in kollegialer Kooperation mit den Disputationsgegnern. Am Ende können sich alle an einem Erkenntnisfortschritt erfreuen, der ein kollektives Gut darstellt (Callon 1994; Van Dalen und Klamer 2005). Robert K. Merton (1942/1973) hat diese Eigenart der wissenschaftlichen Praxis durch vier normative Prinzipien eingefangen: der Universalismus verlangt, dass wissenschaftliches Wissen überall gilt und für alle nachvollziehbar begründet sein muss, das heißt, jeder Kritik standhalten muss. Der organisierte Skeptizismus bedeutet, dass alles Wissen in Frage zu stellen ist und niemand einen privilegierten Wahrheitsanspruch stellen kann. Die Uneigennützigkeit fordert, dass kein anderes Interesse den Erkenntnisprozess leitet als die Neugierde und das Streben nach Wahrheit, auch nicht das Streben nach Belohnung für erbrachte Forschungsleistungen. Der intellektuelle Kommunismus macht klar, dass wissenschaftliche Ressourcen und wissenschaftliches Wissen ein Kollektivgut darstellen, von dem niemand ausgeschlossen werden darf. Natürlich handelt es sich dabei um regulative Ideen für die Forschungspraxis, die niemals ganz den Ideen entspricht, sondern mehr oder weniger davon abweicht (vgl. Hallonsten 2022). Soweit die regulativen Ideen in der wissenschaftlichen Gemeinschaft verankert sind, geben Abweichungen davon Anlass für Korrekturen.
2.1Vom wissenschaftlichen zum ökonomischen Wettbewerb um Exzellenz: die unternehmerische Universität
Wenn wir vor dem Hintergrund der wissenschaftlichen Praxis am autonomen Pol des akademischen Feldes nun den institutionellen Wettbewerb zwischen strategisch handelnden unternehmerischen Universitäten betrachten (Clark 1998; Marginson und Considine 2000; Prognos AG 2007; Rothaermel et al. 2007; Guerrero et al. 2024)), dann ist zunächst einmal festzustellen, dass sich dieser Wettbewerb am heteronomen Pol des Feldes abspielt und dass er eine neue Dynamik in das Verhältnis zwischen den Universitäten bringt. Hier finden materielle und symbolische Kämpfe mit Hilfe von institutionellem Kapital und zum Zweck der Mehrung dieses Kapitals statt. Materiell geht es um die Verfügung über Entscheidungsmacht in den Wissenschaftsorganisationen und innerhalb der Universitäten, symbolisch um die Definition von institutioneller Exzellenz und die Steigerung des Prestiges einer Universität. Die politisch induzierte Durchführung von Exzellenzwettbewerben richtet sich – wie etwa die Exzellenzinitiative bzw. Exzellenzstrategie von Bund und Ländern in Deutschland – insbesondere auf die Zuteilung von Forschungsmitteln zur Einrichtung von Forschungszentren, die fortan über mehr Geld als andere verfügen, sich mit dem Zuschlag auch als »exzellent« verstehen und sich mit dieser Auszeichnung der Öffentlichkeit präsentieren können. Sie erzielen einen enormen materiellen und symbolischen Gewinn. Der Wettbewerb um Exzellenz kann dazu beitragen, dass den Universitäten insgesamt mehr Ressourcen zufließen und dass sie als eine wesentliche Quelle des gesellschaftlichen Wohlstands betrachtet werden und demgemäß die Legitimität ihres Tuns gesteigert wird, erst recht in einer Gesellschaft, die sich als Wissensgesellschaft versteht (Frank und Meyer 2020, 2024). Ein Blick auf die Entwicklung der Budgets schwedischer Universitäten zeigt zum Beispiel, dass in den letzten 20 Jahren insgesamt ein Wachstum nicht nur der Drittmittel, sondern auch der Grundmittel zu verzeichnen ist (Hallonsten 2024).
Es gilt allerdings zu beachten, dass der institutionelle Wettbewerb um Exzellenz am heteronomen Pol des akademischen Feldes anderen Regeln folgt als der Wettbewerb um Exzellenz zwischen Wissenschaftlern am autonomen Pol. Vor allem kennt er nicht die Balance von Kollegialität und Konkurrenz, vielmehr ist hier Konkurrenz das uneingeschränkt herrschende Prinzip. Diese Konkurrenz bezieht sich auch nicht unmittelbar auf Erkenntnisfortschritt und Anerkennung durch die wissenschaftliche Gemeinschaft. Die Objekte der Konkurrenz sind herausragende Wissenschaftler, begabte Studierende und Finanzmittel. Über den Erfolg in diesem Wettbewerb entscheidet das Volumen des einsetzbaren institutionellen Kapitals, das sich auf der autonomen Seite aus dem wissenschaftlichen Kapital der Wissenschaftler der Universität und auf der heteronomen Seite aus ökonomischem Kapital (Geld), sozialem Kapital (Mitgliedschaften in wissenschaftlichen Vereinigungen) und kulturellem Kapital (Alter der Institution) speist. Beide Seiten können sich in einer zirkulären Akkumulation wechselseitig in Volumen und Wert steigern. Mit dem Volumen an institutionellem Kapital wachsen die Chancen, die besten Wissenschaftler und die begabtesten Studierenden zu rekrutieren sowie die größten Summen an Forschungsgeldern einzuwerben und damit auch wissenschaftliches Kapital durch größere Beiträge zum Erkenntnisfortschritt zu akkumulieren.
Anders als die Wissenschaftler am autonomen Pol teilen unternehmerisch agierende Universitäten Personal und Ressourcen nicht kollegial, sondern nur selektiv in strategischen Allianzen. Je mehr sie in das Patentgeschäft investieren, umso mehr behandeln sie auch das generierte wissenschaftliche Wissen nicht als Kollektivgut, sondern als Privatgut. In dieser Hinsicht sind unternehmerische Universitäten eine Gefahr für den freien Austausch von Ressourcen und Wissen als wesentliche Quelle der Offenheit der Wissensevolution. Eine Untersuchung in den Bereichen der Lebens- und Materialwissenschaften zeigt, dass sich dieses spezifisch unternehmerische Denken auch in den Habitus der Wissenschaftler selbst einpflanzt, je mehr in ihrem Feld das Leitbild der Konkurrenz um knappe Ressourcen vorherrscht (Shibayama et al. 2012). Unternehmerische Universitäten müssen Wettbewerbsvorteile schaffen, die sie in die Lage versetzen, Monopolrenten zu erzielen. Wettbewerbsvorteile sind zum Beispiel weltweit sichtbare Forschungszentren, mit denen sie Spitzenforscher und begabte Studierende an sich ziehen können, die wiederum ihre Sichtbarkeit und internationale Vernetzung steigern. Monopolrenten sind größere Chancen, allein aufgrund der gegebenen Sichtbarkeit und Vernetzung für Forschungsergebnisse mehr Aufmerksamkeit zu erzielen, gemessen an ihrer Zitationsrate, mehr Gutachterpositionen zu besetzen und mehr Preise zu gewinnen als mit weniger sichtbaren Forschungszentren im Allgemeinen erreicht werden (vgl. Siivonen et al. 2024).
Eine wachsende Bedeutung für den institutionellen Wettbewerb kommt heutzutage den Massenmedien zu. Dieser Wettbewerb ist ganz wesentlich auch ein Kampf um mediale Aufmerksamkeit, der von allen Akteuren im akademischen Feld verlangt, sich mittels Marketings in Szene zu setzen (vgl. Franzen 2011, 2014, 2015). Die Massenmedien wirken als Transmissionsriemen des ausgehend von den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich seit den 1980er Jahren global diffundierten neoliberalen Credos, dass alle öffentlichen Einrichtungen dazu neigen, Steuergelder zu verschwenden und deshalb der öffentliche Sektor zu schrumpfen hat und das, was davon übrig bleibt, einer verschärften Beobachtung und Kontrolle im Hinblick auf die Frage zu unterwerfen ist, wie weit die zugewiesenen Steuergelder auch zum Vorteil der Nutzer der öffentlichen Einrichtungen und der weiteren Öffentlichkeit eingesetzt werden (Mirowski und Plehwe 2009). Im Vereinigten Königreich hat sich dafür der Begriff »Value for Money« eingebürgert. Im Extremfall bedeutet das die vollkommene Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen, die dann von den tatsächlichen Nutzern im vollen Umfang zu bezahlen sind. So rechtfertigt sich zum Beispiel die Finanzierung der Hochschulbildung durch Studiengebühren. Je weiter dabei gegangen wird, umso mehr wird Hochschulbildung nicht mehr als Kollektivgut, sondern als Privatgut gehandelt. Über das Angebot entscheidet dann allein die Nachfrage, die wiederum an der auf dem Arbeitsmarkt zu erwartenden Rendite orientiert ist (vgl. Marginson 2024; Marginson und Yang 2024). Wo sich diese weitgehende Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen nicht realisieren lässt, wird auf die Zuteilung von Geldern im Wettbewerbsverfahren gesetzt. Dementsprechend wurde in der Forschungsfinanzierung überall der Anteil der Grundmittel verringert und der Anteil der Drittmittel erhöht. Es wird dabei immer unterstellt, dass dann die Mittel nicht mehr nach dem Gießkannenprinzip, sondern nach dem Leistungsprinzip verteilt werden. Dabei wird in der Regel darüber hinweggesehen, dass der Wettbewerb um Drittmittel nicht unter Bedingungen der Chancengleichheit stattfindet. Vielmehr begeben sich die Universitäten und Fachbereiche mit sehr ungleich verteilter Grundausstattung in diesen Wettbewerb und gehen in der Regel mit noch ungleicherer Ausstattung aus ihm hervor, weil sich nach dem Matthäus-Prinzip »Wer hat, dem wird gegeben« Startvorteile auch in besseren Resultaten der Mittelverteilung auszahlen (Merton 1968b).
Die Startvorteile wirken wie Monopolrenten, weil sie unabhängig von der tatsächlichen Performanz Renditen in Gestalt der Einwerbung von Forschungsgeldern abwerfen. Mit den Startvorteilen in der Grundausstattung mit ökonomischem Kapital verbinden sich weitere Vorteile der Verfügung über mehr Professoren und Mitarbeiter als andere Universitäten bzw. Fachbereiche, die ein größeres Netzwerk mit anderen Wissenschaftlern und der Industrie knüpfen können, mehr Mitglieder in den Akademien und in den Ausschüssen sowie Gutachtergremien des Wissenschaftsrats und der Deutschen Forschungsgemeinschaft stellen und mehr ausländische Fellows der Alexander von Humboldt-Stiftung beherbergen können. Sehr oft handelt es sich dabei um Universitäten mit einer weit in die Geschichte zurückreichenden Tradition und einer entsprechend größeren Zahl von ehemaligen Mitgliedern, die es zu hohem Ansehen bis hin zum Nobelpreis gebracht haben. So ergibt sich ein hohes Maß der Konzentration von ökonomischem, sozialem und kulturellem Kapital, das von den Universitäten am heteronomen Pol des akademischen Feldes aus dem umgebenden Feld der Macht gewonnen und in unmittelbar zur Positionierung im Feld genutztes institutionelles Kapital umgemünzt werden kann. Die durch den Wettbewerb um Drittmittel, insbesondere durch Exzellenzwettbewerbe erzeugte Sichtbarkeit von institutionellen Leuchttürmen, die ein hohes Maß an institutionellem Kapital auf sich konzentrieren, kommt dem Bedürfnis der Medien entgegen, möglichst leicht erkennen und der Öffentlichkeit präsentieren zu können, wo Forschung an der vordersten Front betrieben wird. Große, leicht erkennbare Forschungszentren erhalten dadurch über die bloß materiellen Vorteile hinaus noch eine symbolische Aufladung, eine Weihung als Einrichtungen der Spitzenforschung.
Die mediale Aufmerksamkeit für diese Spitzeneinrichtungen bleibt in der Tendenz nicht nur ein mediales Ereignis im Feld der Medien, sondern wirkt in das akademische Feld hinein, verleiht den nun als exzellent definierten Einrichtungen weitere symbolische Startvorteile über die materiellen hinaus, die als Monopolrenten wirken und weitere Erfolge in der Mittelverteilung mit sich bringen. Je mehr die Mittelverteilung und die Aufmerksamkeit für Forschung von diesem Einwirken der Medienlogik auf das akademische Feld erfasst werden, umso mehr greifen die Vorteile der einen und die Nachteile der anderen auch in den wissenschaftlichen Wettbewerb am autonomen Pol des akademischen Feldes ein. Forscherinnen und Forscher außerhalb der medial herausgehobenen Institutionen verlieren an Sichtbarkeit und auch an Geldern, symbolischem und materiellem Kapital, und haben dann auch im wissenschaftlichen Wettbewerb die schlechteren Karten. Die jenseits der medialen Aufmerksamkeit breitere Streuung von Spitzenforschern über Institutionen hinweg wird noch weniger sichtbar und verliert an Wirksamkeit. Je weiter dieser Prozess reicht, umso mehr kann von einer Kolonisierung des akademischen Feldes durch das Feld der Medien und der Politik gesprochen werden. Die Politik ist unter dem vergrößerten Einfluss der Medien sowie im Gefolge der neoliberalen Programmatik »Value for Money« gezwungen, Forschungsförderung so zu betreiben, dass sie medial sichtbare Erfolge nachweisen kann. So ist es ganz auf dieser Linie das erklärte Ziel der Exzellenzinitiative bzw. Exzellenzstrategie von Bund und Ländern gewesen, die Forschung an den deutschen Hochschulen international sichtbarer zu machen, was zwangsläufig heißen muss, große, eben für die Medien und davon abgeleitet auch für die wissenschaftliche Öffentlichkeit gut sichtbare Forschungszentren in Gestalt von »Exzellenzuniversitäten« und »Exzellenzclustern« zu schaffen (Münch 2007b; Leibfried 2010; Reitz et al. 2016; Seidenschnur et al. 2024).
Auf diesem Wege findet innerhalb des akademischen Feldes eine Überlagerung des wissenschaftlichen Wettbewerbs am autonomen Pol durch den institutionellen Wettbewerb am heteronomen Pol statt. Die Folge ist eine noch größere Ungleichheit in der Verteilung von wissenschaftlichem und institutionellem Kapital auf Universitäten bzw. Fachbereiche als zuvor schon gegeben. So hat die Exzellenzinitiative dazu geführt, dass die zehn ersten Universitäten im Förder-Ranking der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), ausgehend von einer um den Faktor 4,25 höheren Bewilligungssumme als die zehn zwischen Platz 41 und 50 platzierten Universitäten in den Jahren 1999–2001, schließlich ihren Vorteil auf den Faktor 6,37 gesteigert haben. In den Geistes- und Sozialwissenschaften zeigt sich eine Steigerung vom Faktor 7,62 auf den Faktor 13,41. Die größte Ungleichheit besteht merkwürdigerweise in den Geisteswissenschaften, bei denen die schon in den Jahren 2002 – 2004 hohe Ungleichheit mit dem Faktor 13,78 in den Jahren 2005–2007 auf den Faktor 24,3 gesteigert wurde (DFG 2003: 166–167; 2006: 152–153; 2009: 158–159; Münch 2009b, 2011a: 306). Spätestens bei diesen Disziplinen ergibt sich großer Erklärungsbedarf bei der Frage, ob diese ungleiche Verteilung der Forschungsmittel dem Erkenntnisfortschritt dienlich ist, weil in diesen Disziplinen nach wie vor das Leitbild des einzelnen Gelehrten vorherrscht und größere Forschungsverbünde nur als Ausnahmefälle gelten.
Der unter ungleichen Bedingungen stattfindende Wettbewerb um Drittmittel befördert kartellartige Strukturen in den Akademien, Förderorganisationen und Stiftungen sowie im Wissenschaftsrat. So vereinigen nur 17 bis 20 Universitäten die Mehrheit der Mitgliedschaften in diesen Vereinigungen auf sich (Münch 2007b: 316-372; 2011a: 288–296). Daraus ergibt sich ein relativ geschlossener Kreis von Personen mit gleichrangiger institutioneller Herkunft, die in den Akademien zusammenarbeiten, in der DFG über das Förderprogramm entscheiden und Bewilligungsentscheidungen treffen, in der Alexander von Humboldt-Stiftung Fellows aus dem Ausland auf die Universitäten verteilen und im Wissenschaftsrat Empfehlungen zur Entwicklung des Wissenschaftssystems erarbeiten. Es liegt nahe, dass sich in diesem relativ geschlossenen Netzwerk größeres Vertrauen bildet, was weniger Vertrauen in Personen und Institutionen außerhalb des Netzwerks impliziert. Es entsteht eine gemeinsame Sicht auf die Wissenschaft und die richtigen Maßnahmen zu ihrer Förderung, die wiederum aus der Machtstellung der beteiligten Universitäten hervorgeht. Dazu gehört z.B., dass die involvierten großen Universitäten über die kritische Masse verfügen, um große Forschungsverbünde zu formen, für die wiederum der große Anteil von 57 bis 59 Prozent des gesamten Fördervolumens der DFG besonders geeignet ist, der für die dazu passenden koordinierten Programme (Forschungszentren, Sonderforschungsbereiche, Graduiertenkollegs, Forschungsgruppen, Exzellenzcluster, Graduiertenschulen, Zukunftskonzepte) verausgabt wird (DFG 2012: 37; 2021: 28, Tabelle 2–3). Kartellartige Strukturen bringen den Mitgliedern Vorteile, die den Nichtmitgliedern nicht zugänglich sind. Sie beinhalten keine expliziten Absprachen, sondern werden schon aufgrund des in relativ geschlossenen Netzwerken entstehenden stillschweigenden Einverständnisses über den richtigen Kurs der Forschungsförderung und die Qualität von Standorten wirksam.
Den kartellartigen Strukturen in der Forschungsförderung entsprechen oligopolistische Strukturen in der Produktion und Distribution von Forschungsergebnissen sowie von Nachwuchskräften. Große Forschungszentren bringen allein aufgrund ihrer schieren Größe mehr Publikationen hervor, was ihnen größere Sichtbarkeit verleiht und größere Chancen, dass ihre Publikationen rezipiert und zitiert werden (Münch 2011a: 296–310). Ebenso bilden sie mehr Nachwuchswissenschaftler als kleinere Standorte aus, die innerhalb ihres Kreises und darüber hinaus auf Professuren berufen werden. Das heißt, dass ihre Forschung allein schon über die Platzierung ihrer Nachwuchskräfte im gesamten Wissenschaftssystem präsenter ist als die Forschung kleinerer Standorte (vgl. Baier und Münch 2013). Ein Oligopol bedeutet, dass eine größere Zahl von Rezipienten von einer kleineren Zahl von Produzenten abhängig ist, die Produzenten deshalb in der Lage sind, zu bestimmen, was gute Wissenschaft ist, was die Rezipienten, so wie es definiert wird, hinnehmen müssen. Es fehlt den Rezipienten die Kapitalkraft, Gegenpositionen wirksam ins Spiel zu bringen. Die neue Programmatik der Exzellenzförderung hat zur Folge, dass die an sich latenten Kartellstrukturen, die eigentlich dem offenen Wettbewerb am autonomen Pol entgegenstehen und deshalb aus dieser Sicht illegitim sind, offengelegt und mit der Weihe der Exzellenz versehen werden. Der nächste Schritt ist dann die Herstellung von strategischen Allianzen zwischen den Universitäten des Kartells, die sich damit offen vom Rest der Universitäten absetzen. So haben sich die führenden Universitäten in England in der Russel Group zusammengetan, in Deutschland in der TU9 (die neun größten Technischen Universitäten) und der U15 (15 der größten Universitäten). Die Reaktion der dadurch ins zweite Glied gesetzten Universitäten, eine Allianz mittelgroßer Universitäten zu bilden, ist schon das Eingeständnis der Unterordnung unter die herrschenden Allianzen der TU9 und U15. Aus einem latenten Kartell wird auf diesem Weg eine offene strategische Allianz mit dem offenen Ziel der Erlangung einer Elitestellung, mit der man sich dauerhaft aus der Masse der restlichen Universitäten herausheben kann.
Was am autonomen Pol als illegitim erscheint, das erreicht auf diesem Weg am heteronomen Pol den Status der Legitimität. Da auf dieser Seite das umgreifende Feld der Macht und das spezielle Feld der Wirtschaft direkt in das akademische Feld hineinwirken und die Spielregeln für das Verständnis von Universitäten als Unternehmen vorgeben, hat der von den Spielregeln des autonomen Pols gespeiste Widerstand gegen diese Feldveränderung wenig Erfolgschancen. Im übergreifenden Feld der Macht bestimmen die maßgeblichen gesellschaftlichen Akteure die Spielregeln der Machtverteilung und des Einflusses auf die einzelnen Teilfelder der Gesellschaft (vgl. Schneickert, Schmitz und Witte 2020). Der institutionelle Wettbewerb zwischen den unternehmerisch geführten Universitäten setzt sich durch und führt zur Ausdifferenzierung der international vernetzten Eliteinstitutionen aus der Masse der abgehängten Universitäten. Die Eliteinstitutionen verfügen zugleich über die potenteren Wirtschaftspartner global und vor Ort (vgl. Taylor et al. 2022). Ohne starke internationale Vernetzung sehen sich die restlichen Universitäten auf den Status einer allein in ihrer Region vernetzten Institution reduziert, aus dem sie nicht mehr herauskommen. Das entspricht der Logik des wirtschaftlichen Wettbewerbs, jedoch nicht den Anforderungen des wissenschaftlichen Wettbewerbs mit dem Ziel der offenen Wissensevolution, für die eine möglichst breite Streuung von konkurrierenden Forschungsteams und eine große paradigmatische Diversität erforderlich ist. Letztere wird eher von kleinen, an vielen Standorten möglichen Teams vorangetrieben als von großen, nur an großen Standorten ohne interne Verdrängungseffekte möglichen Forschungsverbünden.
Es wird hier erkennbar, was Mathias Binswanger (2010: 44–66) die Marktillusion nennt. Bei der Umstellung öffentlicher Dienstleistungen auf Wettbewerb entstehen in der Regel keine Märkte im idealen Sinn. Auch in der Privatwirtschaft werden Märkte durch Kartelle, Monopole und Oligopole verzerrt. Bei der Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen ist das sehr leicht möglich, weil sich hier besser ausgestattete Anbieter einen privilegierten Zugang zum zentralen öffentlichen Nachfrager von Dienstleistungen verschaffen können und dadurch eine beherrschende Stellung im Wettbewerb einnehmen. Das trifft genau auf die großen Universitäten in den Ausschüssen der DFG sowie ihren Einfluss auf die Förderprogramme und die Verteilung der Forschungsmittel zu (vgl. Münch 2007b: 205–263).
Eine nicht nur in wissenschaftlicher, sondern auch in ökonomischer Hinsicht kontraproduktive Folge der zunehmenden Konzentration von Forschungsmitteln auf Eliteinstitutionen ist die Tendenz zur Überinvestition in der Spitze und zur Unterinvestition in der Breite. Zwischen Investition und Ertrag im Sinne von Publikationen besteht ein kurvilinearer, umgekehrt u-förmiger Zusammenhang. Dabei wird in wenig kapitalintensiven Fächern wie der Mikroökonomik die kritische Masse der Ausstattung am optimalen Punkt viel früher erreicht als in besonders kapitalintensiven Fächern wie der Teilchenphysik (Jansen et al. 2007). Der optimale Punkt der Investition wird umso früher getroffen, je schärfer der Output relativiert wird im Hinblick auf die Investitionen, am spätesten beim absoluten Output, in mittlerer Position beim Output pro Wissenschaftler und ganz früh beim Output pro einer Million Euro Forschungsgelder. Jenseits des optimalen Punktes wird das Gesetz des sinkenden Grenznutzens wirksam. Jede weitere Einheit an Investitionen wirft immer weniger ab. Andeutungsweise lässt sich das anhand von Streudiagrammen und einer multiplen Regression mit einfachen und quadrierten Summen für die Chemie in Deutschland zeigen (Münch 2014a: 223–228; 231–233; vgl. auch Wieczorek, Beyer und Münch 2017). Unter der Bedingung eines kurvilinearen, umgekehrt u-förmigen Zusammenhangs zwischen Investition und Ertrag lässt sich also festhalten, dass die zunehmende Konzentration von Forschungsmitteln auf Eliteinstitutionen dazu führt, dass viele Institutionen unterhalb der optimalen Ausstattung verharren, die Eliteinstitutionen aber jenseits der optimalen Ausstattung operieren. Das ergibt eine schlechtere wissenschaftliche Gesamtleistung und auch eine schlechtere ökonomische Effizienz als die Ausstattung einer größeren Zahl von Institutionen genau am kritischen Punkt der Optimalität. Man kann mit den Variablen des institutionellen Kapitals zwar den absoluten Publikationsoutput erklären, aber nicht den relativen Publikationsoutput pro Wissenschaftler oder pro eine Einheit der investierten Geldsumme (Abbildung 1).
Abbildung 1:Investitionen und Ertrag in der Chemie in Deutschland
Eigene Berechnungen. Die Drittmittel wurden in tausend Euro gemessen.
Quellen: Münch 2014a, Abb. 7.2–7.4, S. 224–225; Daten aus Berghoff et al. 2006, S. 69–70; Berghoff et al. 2009, S. 68–69.
Zieht man Daten des Forschungsratings Chemie heran, das 2008 vom deutschen Wissenschaftsrat (2008b) veröffentlicht wurde, dann zeigt sich ein Feld mit einigen dominanten Fachbereichen, die durch Größe, ein damit zusammenhängendes hohes Publikationsvolumen und die Entsendung einer großen Zahl von Nachwuchswissenschaftlern auf ihre erste Professorenstelle hervorstechen, dagegen weniger durch besondere Effizienz in den Publikationen pro Wissenschaftler und Zitationen pro Publikation. Die dominierten Fachbereiche sind weniger groß, erreichen dementsprechend ein geringeres Publikationsvolumen und entsenden weniger Nachwuchswissenschaftler auf ihre erste Professorenstelle. In den Publikationen pro Wissenschaftler können sie teilweise bessere Werte erreichen als die dominanten Fachbereiche (Baier 2017: 126–138; Münch und Baier 2012).
Nun ist es aber so, dass Gegenkräfte noch nicht völlig zur Seite geräumt sind, die den Konzentrationsprozessen von Elitewettbewerben Einhalt gebieten. In Deutschland ist der Föderalismus eine solche Kraft. Der Eifer von 16 Bundesländern, sich durch herausragende Universitäten hervorzutun, sorgt für eine breitere Streuung von zumindest gut ausgestatteten Universitäten als z.B. in Frankreich und Großbritannien, die sich dann auch als konkurrenzfähig im Wettbewerb um Wissenschaftler, Studierende und Drittmittel erweisen. Das hat das Forschungsrating des deutschen Wissenschaftsrats (2008b) zu den Fächern Chemie und Soziologie bewiesen. An nicht weniger als 34 von 57 universitären und 14 von 20 außeruniversitären Forschungseinrichtungen der Chemie fand sich mindestens eine als sehr gut oder exzellent bewertete Forschungseinheit mit internationaler Sichtbarkeit. In der Soziologie waren es 34 von 54 universitären und drei außeruniversitären Standorten.
Eine Netzwerkanalyse zu den Erstberufungen in der Chemie zeigt, dass in Deutschland anders als in den USA Nachwuchswissenschaftler an kleineren Standorten durchaus Chancen auf die Berufung auf eine Professur haben, sowohl an kleineren und mittleren als auch an größeren Standorten. Allerdings ist auch zu erkennen, dass die großen Standorte in recht großem Umfang das gesamte System mit erstberufenen Professoren versorgen. In Deutschland ist hier der große Umfang der außeruniversitären Forschungseinrichtungen zu berücksichtigen, die 40 Prozent des öffentlichen Forschungsbudgets verausgaben. Auch sie bringen eine große Zahl von erstberufenen Professoren hervor. Eine kombinierte Korrespondenz- und Netzwerkanalyse lässt erkennen, dass das Feld der Chemie von zwei Achsen bestimmt wird. Auf der Horizontalen sehen wir am linken, rein wissenschaftlichen Pol die außeruniversitären Einrichtungen, insbesondere die Max-Planck-Institute, und am rechten, heteronomen Pol die Universitäten. In der Vertikalen ordnen sich die Institutionen nach Kapitalvolumen ein. Rein wissenschaftliches Kapital zeigt sich in Publikationen pro Professor, Zitationen pro Publikationen sowie in Erstberufungen des eigenen Nachwuchses. Diese Faktoren sind am stärksten auf der linken, autonomen Seite oben bei den gewichtigsten Max-Planck-Instituten ausgeprägt. Institutionelles Kapital äußert sich in der Zahl der Professoren, der Zahl von erhaltenen Preisen der chemischen Industrie und der Zahl von Gastwissenschaftlern der Alexander von Humboldt Stiftung (AvH-Fellows). Diese Faktoren sind am stärksten oben rechts am heteronomen Pol bei den großen Traditionsuniversitäten und den großen Technischen Universitäten zu finden (Baier und Münch 2013: 137, Abb. 1; 146, Abb. 5).