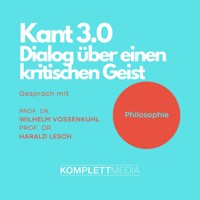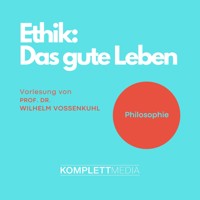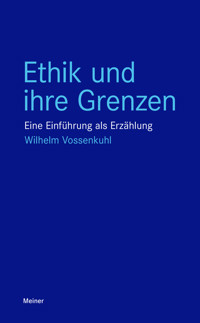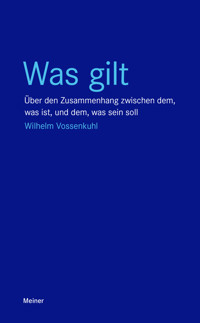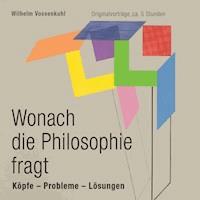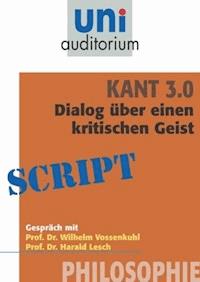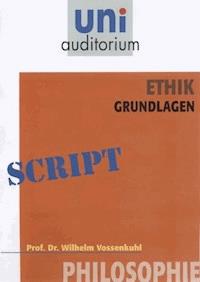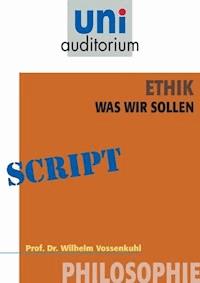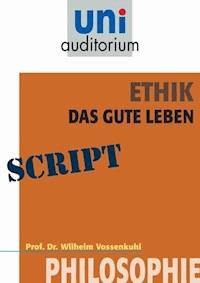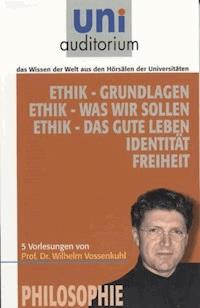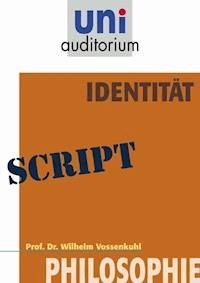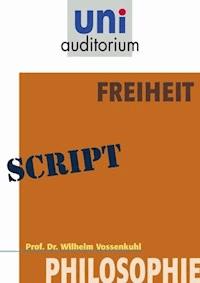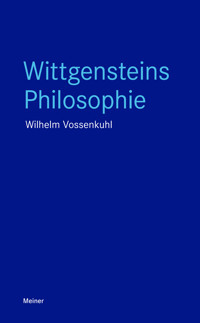
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Felix Meiner Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Blaue Reihe
- Sprache: Deutsch
In zehn Kapiteln beschäftigt sich Wilhelm Vossenkuhl mit Wittgensteins Werk, das für ihn vor allem ein Werk im Werden ist: Für uns Leserinnen und Leser ist es nie abgeschlossen, wir können immer wieder Neues entdecken. Deswegen sollten wir zurückhaltend mit abschließenden Urteilen und Interpretationen und offen für Revisionen und Ergänzungen sein. Wittgensteins Nachlass wurde erst ab 2000 mit der »Bergen Electronic Edition« erschlossen. Viele Aspekte seiner Philosophie wurden dadurch erst sichtbar und werden es immer noch. Die »Wiener Ausgabe« macht Wittgensteins Werk ab 1929, dem Jahr seiner Rückkehr nach Cambridge, zugänglich. Beide Quellen gehen weit über die Werkausgabe, die zu seinem 100. Geburtstag erschien, hinaus. Von dieser Lage geht Vossenkuhl aus, indem er vieles, was ihm in seiner früheren Beschäftigung mit Wittgenstein als klar erschien, kritisch überprüft und revidiert. Die philosophische Auseinandersetzung mit Wittgensteins Denken ist vom philologischen Umgang mit seinem Nachlass nicht zu trennen. Es zeigen sich immer wieder neue Erkenntnisse, wie etwa Wittgensteins Orientierung an Anton Bruckners Kompositionen oder die Bedeutung der vielen, von ihm sehr ernst genommenen Wiederholungen, die in früheren Editionen nicht zu finden sind. Die immer wieder neu ansetzenden Gedanken zum Sehen von Aspekten oder zum Solipsismus kommen zu keinem Ende. Die Herausforderung der Auseinandersetzung mit Wittgensteins Werk ist in jedem Fall lohnend.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 454
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliographie ; detaillierte bibliographische
Daten sind im Internet über ‹http://portal.dnb.de› abrufbar.
isbn 978-3-7873-4659-2
eBook (PDF) 978-3-7873-4660-8
EPUB 978-3-7873-4661-5
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung:
Felix Meiner Verlag GmbH, Richardstraße 47, 22081 [email protected]
© Felix Meiner Verlag Hamburg 2025. Alle Rechte vorbehalten. Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings (§ 44 b UrhG) vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen. Satz: mittelstadt 21, Vogtsburg-Burkheim. Druck: Stückle, Ettenheim. Gedruckt auf alterungsbeständigem Werkdruckpapier. Printed in Germany
Für Anja, Katharina, Olivia und Cosima
Inhalt
Vorwort
I. Werk im Werden
II. Farben und die Grenze des Denkbaren
1. Die Farbrätsel
1.1 Die Grenze von Empirie und Logik
1.2 Das Problem der Farbrätsel
2. Der Status der Farbrätsel
2.1 Notwendigkeit a posteriori?
2.2 Synthetisch apriori?
2.3 Subjektiv a priori?
2.4 Präsuppositionen
2.5 Praktische Bestätigung
3. Das Wissen von Farben
4. Die Grenze des Denkbaren
III. Sagen und Zeigen – Wittgensteins Hauptproblem
1. Das Hauptproblem – entdeckt oder erfunden?
1.1 Was ist das Problem?
1.2 Scheinaussagen vermeiden
2. Kritik an Russells Typentheorie
3. Metaphysik der Abbildung
4. Zeigen
5. Zeigen ohne Subjekt
6. Zeigen jenseits der Wirklichkeit
7. Das System des Sagens
8. Nicht-Reflexivität und Sprachkritik
IV. Solipsismus und Solipsisten
1. Das ausdehnungslose Ich
1.1 Grenzen der Realität und der Sprache
1.2 Der Schlüssel zum Solipsismus
1.3 Aktives und passives Ich
2. Solipsisten
2.1 Inneres und Äußeres
V. Lebensformen, Vorstellungen, fremde Kulturen
1. Lebensformen als Systeme sozialer Regeln
2. Vorstellungen sind keine inneren Bilder
3. Vorstellen und Verstehen
4. Lebensform und Lebensformen
5. Relativität und Relativismus
6. James Frazer und fremde Kulturen
VI. Wissenschaftskritik, Bedeutung und Erfahrung
1. Wissenschaftlicher Aberglaube
2. Wörter, Bedeutungen und Erfahrungen
3. Farben, Farbwörter und Farbwahrnehmung
VII. Vom Unsinn zum Sinn
1. Sinnesdaten und Privatsprache
2. Solipsistische Methode und Unsinns-Devise
3. Sinnesdaten
4. Unsinn mit Unsinn nachweisen
5. Die Grammatik von Schmerzäußerungen
6. Sinn, nicht Wahrheit. Grammatik als Metapsychologie
VIII. Architectural Grammars and Their Changes
1. Self-expression and Mimesis
2. Wittgenstein and Architecture
3. Grammar
4. Architectural Grammars
5. The Liberal versus the Protective Stance
6. Lifeworld and the Change of Grammars
7. Authenticity as a Turning Point
8. Language and Architecture as Media
IX. The Practice of Following Rules
1. Wittgenstein on some »unobvious and obvious nonsense«
2. The Practice of Understanding
3. McDowell’s Monsters
4. »Unobvious and obvious nonsense«
5. The Paradox Again
6. ›Practice‹ from Two Perspectives
X. »Das Ethische ist kein Sachverhalt«. Wittgensteins ethisches Paradox
1. Der »Vortrag über Ethik«
2. Eine Zwischenbetrachtung
3. Drei private Erlebnisse und das ethische Paradox
4. Transzendent und transzendental
5. Dokumentationen des Übergangs (Waismann, Rhees, Moore)
6. Die Auflösung von Paradoxien
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Abkürzungen
1. Quellen und Primärtexte
2. Sekundärtexte
Personenregister
Vorwort
Vor einiger Zeit veröffentlichte ich meine damaligen Beiträge zu Wittgenstein in einem kleinen Band.1 Spätere Beiträge erschienen verstreut an unterschiedlichen Orten. Dem Felix Meiner Verlag bin ich dankbar für die Möglichkeit, alle meine Beiträge zu Wittgenstein gemeinsam im vorliegenden Band publizieren zu können. Sie sind nicht identisch mit den früheren Veröffentlichungen, sondern neu bearbeitet. In der Einführung versuche ich, die Editionslage der Werke Wittgensteins, seines Nachlasses, darzustellen.
Die Editionslage ist nicht leicht zu durchschauen und kann nur philologisch erschlossen werden. Eine der Grundlagen für deren Erschließung ist der seit 2000 elektronisch zugängliche gesamte Nachlass Wittgensteins, der durch die Wittgenstein Archives der Universität Bergen (WAB) in Gestalt der Bergen Electronic Edition (BEE) und einiger anderer Formate angeboten wird.2 Eine weitere Grundlage ist die Wiener Ausgabe der Werke, die Michael Nedo herausgibt. Zu Wittgensteins einhundertstem Geburtstag 1989 erschien die achtbändige Werkausgabe. Sie schien damals in den Augen der meisten die authentische Gestalt seines Werkes darzustellen. Dieser Eindruck muss im Licht des Nachlasses korrigiert werden. Die Werkausgabe ist ein Einstieg in Wittgensteins Werk. Das Werk selbst aber ist der Nachlass. Er ist noch nicht vollständig erschlossen. Im ersten Kapitel dieses Buches versuche ich, den gegenwärtig zugänglichen Bestand von Wittgensteins Nachlass zu beschreiben.
Für Ratschläge, Kritik und Kommentare danke ich Josef G. F. Rothhaupt, Michael Nedo, Alois Pichler, Thomas Oehl, Axel Hecker, Erasmus Mayr, Winfried Nerdinger, Benedikt Grothe, Matthias Lüdeking, Daphne Bielefeld und Hartmut Schick.
München, Frühjahr 2025
I. Werk im Werden
Wittgenstein wurde am 26. April 1889 in Wien geboren. Sein Leben ist vielfach und ausführlich erzählt und dokumentiert worden.1 Das einzige von ihm selbst veröffentlichte philosophische Werk ist der Tractatus logico-philosophicus, die Logisch-philosophische Abhandlung, wie er sie meist nannte. Sein Nachlass wurde, seinem Testament gemäß, nach seinem Tod am 29. April 1951 in Cambridge von seinen Erben Elizabeth Anscombe, Rush Rhees und Georg Henrik von Wright verwaltet und nach deren Auswahl in Teilen veröffentlicht.2 Der Nachlass ist auf verschiedene Orte verteilt.3 Von Wright stellte 1969 einen Nachlasskatalog zusammen, der die Hauptgruppen und deren Nummerierungen enthält und seitdem – allerdings in verschiedenen Versionen – gültig ist.4 Die drei Nachlassverwalter waren sich selten einig, was und wie der Nachlass veröffentlicht werden sollte.5 Umstritten sind u. a. die von Rush Rhees herausgegebene Philosophische Grammatik und der zweite Teil der Philosophischen Untersuchungen.6 Die Herausgabe der Philosophischen Grammatik durch Rush Rhees war von einer Auseinandersetzung mit Anthony Kenny begleitet, der die philosophisch motivierte Auswahl der Bemerkungen Wittgensteins durch Rhees ablehnte.7
Die Grenzen zwischen den von den Erben herausgegebenen Werken, dem Nachlass und den Wittgenstein zugeordneten Nachlässen anderer – etwa von Friedrich Waismann, Moritz Schlick und Francis Skinner8 – sind fließend.9 Eine Reihe von Ausgaben sind mittlerweile textkritisch herausgegeben worden.10 Durchgängig textkritisch sind die Ausgaben, die in Bergen unter Leitung von Alois Pichler erarbeitet werden, und die Wiener Ausgabe von Michael Nedo. Er will alle »Gedankenbewegungen« Wittgensteins, seine lückenlose denkerische Entwicklung zwischen 1929 und 1934 auf dem Weg zu dem von ihm geplanten, aber von ihm selbst nicht vollendeten Werk, das nach seinem Tod unter dem Titel Philosophische Untersuchungen erschien, nachvollziehbar machen. Michael Nedo beruft sich auf Wittgensteins Hinweis, erwähnt im Vorwort der Philosophischen Untersuchungen in der Werkausgabe, dass seine »Gedanken von einem Gegenstand zum andern in einer natürlichen und lückenlosen Folge fortschreiten sollten«.11 Nedo erklärt in seinen Einleitungen der WA die Bedeutung der vielen Wiederholungen von Bemerkungen mit Wittgensteins Arbeitsmethode. Auch in dieser Hinsicht kann er sich auf Wittgensteins eigene Erläuterung der Wiederholungen berufen.12 Nedos Hinweise auf die Nähe der textlichen Struktur von Wittgensteins wiederholten Bemerkungen zu musikalischen Notationen und Partituren, einschließlich der keineswegs überflüssigen Wiederholungen von identischen Passagen, sind für das Verständnis der Texte wichtig.13
Sowohl die Lückenlosigkeit der Gedankengänge als auch die Bedeutung der Wiederholungen sind dem editorischen Konzept der Bände der Werkausgabe von 1989 nicht zu entnehmen.14 Anhand der beiden von Rush Rhees herausgegebenen Bände der Philosophischen Bemerkungen (1964) und der Philosophischen Grammatik (1969) erläutert Nedo, dass es sich in beiden Fällen nicht um Editionen von Wittgensteins Werken, sondern eher um interpretierende Kompilationen von Ausschnitten aus Wittgensteins Werk handelt.15 Nedo billigt Rhees das »beste Verständnis von Wittgensteins Werk«16 zu und stellt auch nicht den Wert der Editionen als Hinführungen zu Wittensteins Denken in Frage. Zwei der in der Werkausgabe vorliegenden Texte, das Blaue und das Braune Buch,17 bilden eine Ausnahme. Beide Texte wurden zunächst in Englisch von Wittgenstein selbst für seine Studenten als Grundlage des Unterrichts konzipiert.18
Diese einleitende Beschreibung der Editionslage von Wittgensteins Werk soll zeigen, dass im Umgang mit dem Nachlass Wittgensteins die Philologie nicht von der Philosophie getrennt werden darf. Philosophie und Philologie sind aufgrund der komplexen, vielschichtigen Struktur des Nachlasses eng und unauflöslich miteinander verwoben. Diese Prämisse der philosophischen Interpretation von Wittgensteins Denken wurde lange von wenigen beachtet, mittlerweile wird sie aber von vielen Interpreten ernst genommen.19 In diesem besonderen, vielleicht einmaligen Fall des Nachlasses eines bedeutenden Philosophen ist die philologische Arbeit kein technisches Beiwerk und nicht nur eine Ergänzung, sondern ein integraler Teil der philosophischen Arbeit mit dem Nachlass.
Unabhängig von den erwähnten, im Buchdruck vorliegenden Ausgaben oder dem elektronisch zugänglichen Nachlass gibt es Editionen von kleineren Texten und Briefen Wittgensteins20 und von umfangreichen Vorlesungsmitschriften.21 Die bisher nicht veröffentlichten Mitschriften von Wittgensteins Vorlesungen sollen, wie Alois Pichler plant, auf Wittgenstein Source, zu der auch die Bergen Nachlass Edition (BNE) gehört, zugänglich werden. Sowohl die Wiener Ausgabe von Michael Nedo als auch die BNE wollen den umfangreichen Nachlass nicht nur zugänglich machen, sondern mit der Fülle des Materials möglichst nahe an Wittgensteins Gedankenentwicklung heranführen. Dabei stellt sich die Frage, wie diese Materialfülle, besonders die Transkriptionen der Handschriften mit ihren wechselnden Schreibgeräten, der variablen Typografie und der Chronologie im herkömmlichen Buchdruck zugänglich gemacht werden kann.
Hans Walter Gabler, vertraut mit den digitalen Geisteswissenschaften (sog. digital humanities), weist darauf hin, dass die zweidimensionale Buchseite für einen zweidimensionalen linear lesbaren Text geeignet sei. Für die »Raumanordnung der Handschriften« und ihre »manifeste Dreidimensionalität« und die zusätzlich zu berücksichtigende zeitliche Abfolge, die eine Art »implizite vierte Dimension« darstelle, sei eine simultane Anschauung durch den Buchdruck nicht möglich.22 Gabler spricht von einer Edition als einem »integralen Diskursgeflecht« und einer »neu anbrechenden Ära der Editorik, in der es möglich wird, Editionsgegenstand und editorische Darstellung medial zu trennen«.23 Was an Texten mit ihrer jeweiligen Geschichte herausgegeben wird, bleibt papiergebunden. Im Unterschied dazu wird die wissenschaftliche Edition im digitalen Medium dargestellt und auch digital genutzt. Fraglich ist allerdings, ob die digitale Nutzung angesichts der anhaltenden Veränderungen der digitalen Programme, der Software, aber auch der Hardware, auf Dauer sichergestellt werden kann.24
Michael Nedo argumentiert, dass die Lesbarkeit von gedruckten Texten unvergleichlich viel besser ist als diejenige der digitalen Formate; ähnliches gelte für die Kollationierbarkeit zwischen gedruckten Texten. Auch die Langlebigkeit gedruckter Texte sei sehr viel höher als die zwanzig Jahre Lebensdauer heutiger digitaler Editionen. Nedo ist überzeugt, dass die Digital Humanities ihr erhofftes Ziel nicht erreichen. Die sog. Text Encoding Initiative (TEI), der Versuch, digitalisierte Texte durch eine Standardisierung der Annotationen zu harmonisieren, um sie auf der Textebene kollationierbar zu machen, sei gescheitert. Ebenso gescheitert sei der Versuch, mit dem Datenmodell XML die Langlebigkeit der Daten zu sichern. Dennoch ist sich Nedo sicher, dass auch eine gedruckte Edition durch eine elektronische ergänzt und erweitert werden sollte. Eine textgemäße gedruckte Edition sei nur auf der Basis einer elektronischen möglich. Nur in der Verbindung von gedruckter und elektronischer Edition sei der Zugang zu den Gedankenbewegungen eines Autors möglich. Ähnliches gelte für die Einbettung eines Werkes in seinen kulturhistorischen Kontext.25 Die Druck-Edition der Wiener Ausgabe beruht auf einer elektronischen Edition. Worauf sich die Referenzen auf der Vorderseite der Blätter der Faksimiles etwa des Big Typescripts beziehen, kann, so Nedo, erst mit Hilfe eines elektronischen Apparats entschlüsselt werden. Ziel sei eine digitale Archivierung des gesamten Textkorpus, mit der die topologische Struktur der Texte mit ihren Einschüben, Streichungen, Varianten und Transkriptionen erkennbar und lesbar gemacht werden könne.
Alois Pichler ist anders als Michael Nedo davon überzeugt, dass TEI ein gutes Instrument bei der Bewältigung editorischer Probleme ist, etwa wenn es darum geht, Transkriptionen von der Präsentation von editorischen Materialien zu trennen. Er nutzt das Datenmodell XML in der Interactive Dynamic Presentation (IDP) des Nachlasses. XML sei für die Erstellung, Benutzung und Wartung, aber auch für die Migration der Edition in das nächste Auszeichnungssystem geeignet.26 Die Nutzung von XML sei voll kompatibel mit dem ontologischen Status des Textes. Was ein Text eigentlich ist, sei die Frage. Mit dem Konzept ›Text‹ können Gegenstände wie Dokumente, Eigenschaften wie Geschriebenes und Ereignisse wie Schreiben und Lesen gemeint sein. Pichler führt das Wort »texting« ein und meint damit Schreiben und Lesen als Handlungen von mehr als einem Akteur ohne abgeschlossenes Ergebnis. Texting sei ein potenziell kontinuierlicher Prozess mit einem zeitlich festgelegten Beginn, aber einem nicht festgelegten Ende, dessen Ergebnisse Texte seien. Er wendet Wittgensteins Unterscheidung zwischen Oberflächen- und Tiefengrammatik27 auf das Verständnis von ›Text‹ an und argumentiert, dass uns erstere darin täusche zu glauben, dass es dabei um ein Objekt gehe. Es ist eben sehr viel mehr. Texte sind, wie Pichler zeigen will, Ereignisse und Handlungen, etwas Unabgeschlossenes, für dessen Darstellung und Präsentation sich XML sehr gut eigne.
Es ist hier nicht der Ort für eine detaillierte Darlegung und Beurteilung der technischen Fragen der Edition von Wittgensteins Nachlass. Offensichtlich ist der Dissens zwischen Michael Nedo und Alois Pichler bei der Einschätzung der technischen Mittel der Kodierung der Texte des Nachlasses. Offensichtlich ist aber auch, dass das Verständnis von Wittgensteins Denken von der Edition des Nachlasses abhängig ist. Sie ist in keiner der verfügbaren Editionen abgeschlossen. Dies gilt sowohl für die Formate auf der Grundlage von Wittgenstein Source in Bergen als auch für die Wiener Ausgabe. Pichlers ontologische Analyse der Bedeutung dessen, was ›Text‹ bedeutet, impliziert die Unabgeschlossenheit, für deren Darstellung XML geeignet ist.
Dagegen vermittelt die Werkausgabe den Eindruck der editorischen Abgeschlossenheit. Dieser Eindruck trügt, weil die Auswahl von Wittgensteins Bemerkungen aus den Manuskripten und Typoskripten des Nachlasses durch die Erben und Herausgeber eine Interpretation seiner Bemerkungen ist. Was den Editoren wichtig erschien, wurde aufgenommen, auf anderes, u. a. auf Wiederholungen, wurde verzichtet. Dies scheint auch für Editionen wie die ursprünglich von Georg Henrik von Wright und Heikki Nyman ausgewählten und dann von Alois Pichler neu bearbeiteten Vermischten Bemerkungen28 zu gelten. Wittgensteins Gedanken in den Bemerkungen scheinen erratisch und wie aus einem Kontext gerissen zu sein und nicht seiner erklärten Absicht zu entsprechen, dass seine »Gedanken von einem Gegenstand zum anderen in einer natürlichen und lückenlosen Folge fortschreiten sollten«.29 Die Auswahl ist Manuskripten aus den Jahren 1929 bis 1951 entnommen.30 Alois Pichler hat sie textkritisch bearbeitet. Für das Verständnis der Bemerkungen ist dies sehr nützlich. Die Sprunghaftigkeit der Bemerkungen in von Wrights Auswahl bleibt dennoch bestehen. Es empfiehlt sich, die Texte in den Editionen der Wittgenstein Archives Bergen (WAB) nachzulesen. Es wäre allerdings verfehlt, von Wright einen Vorwurf für die Sprunghaftigkeit der Bemerkungen zu machen, denn die Auswahl der Philosophischen Bemerkungen basiert auf den Bemerkungen, die Wittgenstein selbst zusammengestellt hat.31
Die Wiener Ausgabe präsentiert die ganzen Manuskripte der Philosophischen Bemerkungen auf textkritische Weise, allerdings nur für die ersten Jahre nach 1929. Die thematischen Zusammenhänge und die Entwicklungen von Wittgensteins Denken werden mit dieser Edition verständlich. Wer die unterschiedlichen Editionen nicht kennt, wird sich vielleicht an die leicht verfügbare Werkausgabe von 1989 halten, ohne die Überarbeitung von Alois Pichler und ohne die Wiener Ausgabe Michael Nedos zu kennen. Ein solcher textlich eingeschränkter Zugang zu Wittgensteins Nachlass schränkt das Verständnis seines Denkens erheblich ein.
Wer die bisherigen philologischen Analysen der Texte von Wittgensteins Nachlass verfolgt hat, wird erkennen, dass der erste Teil der Philosophischen Untersuchungen, den die Werkausgabe anbietet, das Typoskript 227 ist. Dieses Typoskript entstand aus den Typoskripten 228 und 230.32 Die Arbeitsweise Wittgensteins wird an diesem Beispiel gut erkennbar. Er benutzte die von ihm diktierten Typoskripte, indem er einzelne Bemerkungen und Gruppen von Bemerkungen herausschnitt und neu zusammenfügte. Sein Ziel war, seine Gedanken möglichst klar verständlich zu machen. Mit den jeweiligen Resultaten war er aber nie wirklich zufrieden. Diese kritische Einstellung zu den Ergebnissen seiner Arbeit sollte nicht durch die Editionen von Teilen des Nachlasses kaschiert und überspielt werden. Wittgenstein hat mit seiner Selbstkritik einer orthodoxen Interpretation seines Denkens von vornherein den Boden entzogen. Da die editorischen Bearbeitungen, etwa die Transkriptionen der Manuskripte des Nachlasses in den Editionen des WAB, aber auch die Wiener Ausgabe noch nicht abgeschlossen sind, ist Wittgensteins Werk editorisch noch im Entstehen. Daher sollte auch dessen philosophische Interpretation nicht von der editorischen Genese abgekoppelt werden, sondern offen für alternative Interpretationen und Perspektiven bleiben.
Seit 2000 sind die Bergen Electronic Edition und nach und nach die weiterentwickelten Formate der WAB als Zugänge zum Nachlass Wittgensteins eine unverzichtbare Grundlage der Forschung. Seitdem wurden, wie erwähnt, neue Zugänge zu den Manuskripten, Faksimiles und Typoskripten entwickelt, die von vielen Forscherinnen und Forschern genutzt werden.33 Die Forschung bietet inzwischen Beispiele für den philologisch vorbereiteten Zugang zu wichtigen philosophischen Einsichten Wittgensteins. Ein Beispiel dafür sind die C-Markierungen in den Manuskripten 136, 137 und 138.34 Das Aspekt-Sehen und das Moore’sche Paradox sind ausführlich behandelte Themen der mit ›C‹ markierten Bemerkungen.35 Die bisher in der Werkausgabe veröffentlichten Bemerkungen zu diesen Themen sind zu knapp und entsprechen nicht ihrem Gewicht. Die Bedeutung der beiden erwähnten Themen in Wittgensteins Denken werden damit nicht verständlich. Über die C-Markierungen hinaus ist das Manuskript 137 für die Beurteilung der großen Bedeutung des für Wittgenstein so wichtigen Aspekt-Sehens sehr aufschlussreich.
Ein weiteres Beispiel für den besonderen Wert des philologischen Zugangs zu Wittgensteins Nachlass ist die vertiefte Einsicht in die Bedeutung musikalischer Werke, insbesondere die Bedeutung der Notenschrift für die Komposition von Wittgensteins eigenen Texten.36 Anton Bruckner37 war ein von Wittgenstein besonders geschätzter Komponist, in gewisser Weise auch ein Vorbild für seine eigenen Textkompositionen. Die Musiknotation hat Wittgenstein als eine Ergänzung der geschrieben Wortsprache verstanden, um das auszudrücken, was an Bedeutungen, die Menschen verstehen können, über die Wortsprache hinausgeht, das Außersprachliche, in gewisser Weise das Unaussprechliche.38 Die musikalische Notation drückt etwas aus, was sich anders, vor allem wortsprachlich, nicht ausdrücken lässt. Ähnliches gilt für die Gestik des Dirigierens.
Wittgenstein war ein großer Musikliebhaber,39 aber kein Musikwissenschaftler. Er kannte sehr viele musikalische Werke auswendig. Seine Beurteilung der Werke und Komponisten beruht nicht auf musikwissenschaftlichen Kenntnissen und sollte auch nicht musikwissenschaftlich verstanden werden.40 Seine Urteile über Komponisten41 sind entschieden und nicht immer nachvollziehbar. Unzutreffend ist etwa seine Auffassung, dass es drei mögliche Kompositionsweisen gibt, eine mit Unterstützung eines Instruments, eine ohne und eine mit der eigenen Vorstellungskraft.42 Tatsächlich gibt es aber nur die ersten beiden. Die Vorstellungskraft, also das innere Ohr, ist bei beiden unverzichtbar. Deswegen ist es sicher unzutreffend, wenn Wittgenstein meint, dass Brahms im Gegensatz zu Bruckner ohne das innere Ohr und nur »mit der Feder« komponiert habe. Sowohl Bruckner als auch Brahms und Mahler haben mit dem inneren Ohr komponiert.43 Freihändig und falsch ist seine Bemerkung im Anschluss an sein Musik-Notat unter der Bezeichnung »Leidenschaftlich«, es sei das »Ende eines Themas, das ich nicht weiß«.44 Tatsächlich ist es, wie der Musikwissenschaftler Hartmut Schick feststellt, »nach allen Regeln des Komponierens ein typischer Themenbeginn«.45
Die Hinweise auf Wittgensteins musikwissenschaftliche Fehlurteile beleuchten seinen Charakter als Urteilender und sprechen nicht gegen seine Auffassung, dass das Aspekt-Sehen in der Notation musikalischer Werke beispielhaft ist. Sie schmälern vor allem nicht die sehr große, geradezu existentielle Bedeutung, welche die Musik für ihn hatte. In einem Gespräch mit Drury sagt er im Blick auf sein künftiges Buch, die Philosophischen Untersuchungen, es sei unmöglich für ihn, in diesem Buch ein Wort über alles das, was die Musik ihm in seinem Leben bedeutet habe, zu sagen. »Wie kann ich dann hoffen verstanden zu werden?«46 Tatsächlich schreibt er dann auch kaum mehr Bemerkungen über seine Auffassungen von Musik, von Kompositionen und Komponisten.
Wittgenstein war sich selbst nicht darüber im Klaren, dass er sich möglicherweise in seinen Urteilen über Komponisten und musikalische Werke irrte.47 Es lag ihm auch fern, apodiktisch zu urteilen, wie er in einem Entwurf eines Vorworts für ein künftiges, sein als zweites geplantes Buch schreibt. Er gesteht, dass ihm der Geist des Faschismus und Sozialismus, der in der modernen Architektur und Musik zum Ausdruck komme, fremd und unsympathisch sei. Dann schreibt er: »Nicht als ob ich nicht wüßte daß … (sc. der Verfasser) dem, was moderne Musik heißt (ohne ihre Sprache zu verstehen) nicht das größte Mißtrauen entgegenbrächte …«48 Er brachte Brahms und Bruckner zwar kein Misstrauen entgegen, aber doch eine Entschiedenheit, wie sie auch dem Misstrauen eigen ist.
Die Überlegungen Wittgensteins zur Musiknotation sind bei aller Kritik an seinen mangelnden musikwissenschaftlichen Kenntnissen für das Verständnis seiner Denk- und Arbeitsweise aufschlussreich. Es ist nicht verwunderlich, dass er Bruckners Kompositionen besonders schätzte. Dessen Kompositionen folgen einer ähnlichen Formbildung wie Wittgensteins Bemerkungen. Sie sind parataktisch nebeneinandergestellt und kaum miteinander verfugt.49 Sowohl Wittgenstein wie Bruckner folgen über längere Passagen großen Themen, die aber immer wieder von anderen, mit ihnen nicht verbundenen Themen unterbrochen werden.50 Man kann in dieser Hinsicht von einer Wesensverwandtschaft Wittgensteins mit Bruckner sprechen.51 Bruckners Symphonien lassen sich ähnlich wie Wittgensteins Bemerkungen als Fortsetzungen von Themen verstehen, die keinen Abschluss und kein Ende finden. Diese Unabgeschlossenheit seiner Gedankengänge, gepaart mit der großen Entschiedenheit seines Urteils zeigt sich besonders in Wittgensteins Bemerkungen zur Musik. An keiner Stelle seiner Urteile über musikalische Werke nimmt er auf Urteile anderer Bezug. Er lässt sich nicht von musikwissenschaftlichen Kennern eines Besseren belehren, zieht sie nicht zurate. Der undialogische, sich selbst zugewandte, selten von anderen Autoren52 beeinflusste, häufig abgeschottet erscheinende Charakter seines Denkens wird in den Bemerkungen zur Musik und Musiknotation besonders sichtbar.53
Wittgenstein fand in den ihm bekannten musikalischen Werken über das Hören von Motiven und Themen einen vertieften Zugang zum Sehen und Verstehen von Aspekten. Das Außersprachliche zeigt gerade in musikalischen Beispielen des Aspekt-Sehens eine vom Sprachlichen getrennte und unterscheidbare, aber dennoch nicht völlig verschiedene Ausdrucksstruktur. In einer Fülle von Bemerkungen, die er mit Gedankenstrichen vor oder nach den Bemerkungen markiert, denkt er über die Grenzen des wortsprachlich Ausdrückbaren und damit auch über die Grenzen der Sprachspiele nach. Dieses Nachdenken wird in seinem Verständnis der Musiknotation evident. Es ist unmittelbar mit dem Sehen von Aspekten verbunden.54 Die Musiknotation versteht Wittgenstein als wichtiges Beispiel für den Zusammenhang und den Vergleich von Hören und Sehen. Er fragt, wie sich »Gesichtseindrücke von Gehörseindrücken« 55 unterscheiden. Es geht ihm um die Frage, »was das Bündel der ›Sinneseindrücke‹ zusammenhält«. Das sind, wie er meint, »ihre Relationen zueinander«.56
Wittgenstein vergleicht Sinneseindrücke miteinander und diese in ihren Beziehungen zu Gedanken. Er hält es für falsch, »Gesichtseindrücke« und »Gehörseindrücke« als identisch zu verstehen. Beide Sinneseindrücke unterscheiden sich, sind aber miteinander verbunden. Sie sind ihrerseits jeweils unmittelbar mit dem Verstehen verbunden. Den Unterschied der Sinneseindrücke testet Wittgenstein mit dem Vergleich eines Eindrucks »durchs Auge« und »durchs Ohr«,57 um zu zeigen, dass sie nicht identisch, sondern unterschiedliche »Affektionen der Seele«58 sind. Er führt diesen Gedanken weiter und verbindet mit den Sinneseindrücken das Verstehen ihres Inhalts. Es sei irreführend, ja falsch, »das Verstehen einen Vorgang zu nennen, der das Hören begleitet«.59 Er denkt dabei wieder an das Verständnis von Musik und fügt an: »Man könnte ja auch die Äußerung davon, das ausdrucksvolle Spiel, nicht eine Begleitung des Hörens nennen.« Das ausdrucksvolle Spiel selbst ist, wie er dann schreibt, nicht »etwas, was das Spiel begleitet«. Zum ausdrucksvollen Spiel gehöre eine Kultur,60 es ist eingebettet in das größere Ganze einer Kultur. Er nennt das »Verständnis der Musik« eine »Lebensäußerung des Menschen«.61
Wittgensteins Unterscheidungen zwischen Empfindungen, Verstehen und Erlebnissen sind noch wenig erschlossen. Das Hören von Musik ist besonders geeignet, um diese Unterscheidungen zu klären. Das Hören ist als Empfindung vom Verstehen nicht zu trennen, aber das eine ist mit dem anderen dennoch nicht identisch. Er schreibt dazu: »Das Verstehen eines Themas ist weder eine Empfindung noch eine Summe von Empfindungen. Es ein Erlebnis zu nennen ist insofern richtig …, als dieser Begriff des Verstehens manche Verwandtschaften mit anderen Erlebnisbegriffen hat.«62
Die Analogie des Musikverstehens zum Verstehen einer Sprache wird in Wittgensteins Nachlass offensichtlich. Das »Verstehen einer musikalischen Phrase« sei »das Verstehen einer Sprache«.63 Diese Analogie zeigt die große, bisher wenig beachtete Bedeutung des Hörens und Verstehens von Musik für Wittgensteins Denken. Wenn die Musik eine Sprache ist, dann gelten für sie auch die Bedingungen des Verstehens der Sprachspiele einer Wortsprache. Dann ist das Verstehen von Musik nicht vom Sehen der Noten vermittelt und das Lesen der Partitur nicht mit dem Hören identisch. Ähnliches gilt für das Lesen von Texten einer Wortsprache. Wir können zwar beim Lesen einer Partitur ähnlich wie beim Lesen eines Textes erkennen, um welches Stück und um welchen Text es sich handelt. In beiden Fällen bleibt der Unterschied zwischen den Sinneseindrücken und dem Verstehen aber bestehen. Was wir sehen, wenn wir die Partitur anschauen, und das, was wir hören, ist nicht dasselbe. Das eine ist mit dem anderen aber eng verbunden. Wir können deswegen hören, wenn die musikalische Darbietung von der Partitur abweicht, indem wir das Gehörte mit der Partitur vergleichen.
Das Lesen einer Partitur und das Hören des Musikstücks, das sie darstellt, sind ähnlich getrennt und verbunden wie das Lesen eines Textes und das Hören einer Äußerung auf der einen und das Verstehen des Gelesenen und Gehörten auf der anderen Seite. In beiden Hinsichten können wir Wittgensteins Urteil nachvollziehen, dass das Verstehen des Musikstücks, eines Textes oder einer Äußerung das Lesen und Hören nicht begleitet. Das Verstehen ist dem Lesen und Hören nichts äußerlich Hinzukommendes, nicht vom Lesen und Hören getrennt. Wir verstehen beim Hören und Lesen das, was wir hören und lesen, deswegen können wir das Verstandene dann nachträglich mit dem Geschriebenen oder Gesagten vergleichen. Häufig werden wir feststellen, dass wir zwar den einen oder anderen Gedanken verstanden, aber nicht den von einer Autorin oder einem Autor gemeinten oder nicht den für ein Gespräch entscheidenden.
An Beispielen wie der Musiknotation und den dafür relevanten Bemerkungen in Wittgensteins Nachlass wird erkennbar, wie eng – dies sei erneut betont – der philosophische Zugang zu seinem Denken mit dem dafür nötigen philologischen Instrumentarium verbunden ist. Ohne die Kenntnis und Nutzung des philologischen Instrumentariums bleibt der philosophische Zugang eingeschränkt oder irreführend. Die Bedeutung der Musik für Wittgenstein erkennen wir im Nachlass, aber nicht in der Werkausgabe.
Ähnliches gilt für einige thematische Anregungen, die Wittgenstein von anderen Autoren aufnahm. Eine dieser Anregungen, die für seinen Vergleich der Sinneseindrücke wichtig ist, findet Wittgenstein bei Goethe. Er zitiert die erste Zeile von Goethes Gedicht »Wär nicht das Auge sonnenhaft …«64 und er zitiert aus dessen Maximen und Reflexionen: »Man suche nichts hinter den Phänomenen: sie selbst sind die Lehre«.65 Was Goethe im Anschluss an diesen Satz schreibt, können wir als eine Art Leitmotiv für Wittgensteins eigene Reflexionen verstehen: »Was ist das Allgemeine? Der einzelne Fall. Was ist das Besondere? Millionen Fälle.« Und weiter: »Das Allgemeine und Besondere fallen zusammen: das Besondere ist das Allgemeine, unter verschiedenen Bedingungen erscheinend.«66 Goethe sagt zwar nichts über das Aspekt-Sehen, wir dürfen das Aspekt-Sehen aber so verstehen, als ob das Allgemeine und das Besondere zusammenfallen.
Wittgenstein hat bei den wiederholten Überarbeitungen seiner Manuskripte und Typoskripte, wie erwähnt, einzelne Bemerkungen mit Symbolen und Nummern markiert.67 Sie sind in der Forschung lange kaum wahrgenommen und häufig missverstanden worden. Bei den Symbolen handelt es sich u. a. um Gedankenstriche,68 um Kringel, um Anfangs- und Endstriche und um den Buchstaben ›C‹.69 Josef G. F. Rothhaupt hat die mit Kringeln markierten Bemerkungen zu einer Proto-Edition zusammengestellt und mit einem umfassenden Apparat aufgeschlüsselt und zugänglich gemacht.70 Diese Sammlung enthält philosophische, anthropologische, ethnologische, autobiographische und kulturelle Bemerkungen, die ein lebensweltliches Spektrum seines Denkens vermitteln, welches die bisher edierten Werke ergänzt. Im Einzelnen geht es um Bemerkungen zur Diskontinuität seines Denkens zwischen der Logisch-Philosophischen Abhandlung, dem Tractatus und seinem Denken nach 1929, zur Nahtstelle zwischen Sagen und Zeigen, zur Philosophie der Psychologie und der Mathematik, zur Zivilisations- und Wissenschaftskritik.71 Die Diskontinuität zwischen seinem frühen und seinem späteren Denken relativiert Wittgenstein selbst, wenn er im Vorwort zu den Philosophischen Untersuchungen 1945 schreibt: »Da schien es mir plötzlich, daß ich jene alten Gedanken und die neuen zusammen veröffentlichen sollte: daß diese nur durch den Gegensatz und auf dem Hintergrund meiner älteren Denkweise ihre rechte Beleuchtung erhalten könnten.«72
Wittgensteins Arbeitsweise, seine Bemerkungen immer wieder zu überarbeiten und zu versuchen, die Gedanken sprachlich zu schärfen und inhaltlich zu verbessern, ist – wie erwähnt – an seinem Gebrauch der verschiedenen Symbole erkennbar. Was er genau mit welchem Symbol zum Ausdruck bringen wollte, hat er nicht vermerkt. Wir wissen aber, dass die Symbole nicht bedeutungslos sind. Deswegen sollten wir die markierten Bemerkungen in ihrer jeweiligen Verbindung quer durch die Manuskripte beachten und ernst nehmen. Sie sind ein integraler Teil der Entwicklung von Wittgensteins Denken; sie zeigen, dass er von so gut wie keinem Aspekt seiner Auffassungen über Schmerzen, innere Erlebnisse und Zustände, Zweifel, Irrtum, Wissen und Gewissheit so überzeugt war, dass er einen dieser Aspekte generalisieren und als allgemeingültig für alle anderen Aspekte ansehen wollte.
Seine dauerhafte Zurückhaltung, die Resultate seiner Arbeit als endgültig zu betrachten, vermischt mit Selbstzweifeln, sind in den publizierten Werken, etwa der Werkausgabe, nicht zu erkennen. Im Gegenteil, die Werkausgabe vermittelt ein ganz anderes Bild von Wittgensteins Denken. Die Bemerkungen in den Bänden der Werkausgabe stehen wie dezidierte und endgültige Aussagen da und nicht wie offenbleibende Zwischenergebnisse seines Nachdenkens. Es entsteht der irreführende Eindruck, dass Wittgenstein doch endgültige Antworten auf die Fragen hatte, über die er ständig weiter ohne Abschluss nachdachte. Dieser Eindruck wird von seinem in den Manuskripten und Typoskripten, also nur im Nachlass, nachvollziehbaren, eindringlichen und immer wieder neuen Nachdenken über dieselben Fragen widerlegt. Warum hätte er beständig und unermüdlich über dieselben und verwandte Fragen nachdenken müssen, wenn er mit seinen Antworten zufrieden gewesen wäre und sie als endgültig betrachtet hätte?
Wittgensteins Unzufriedenheit mit den Zwischenergebnissen seines Nachdenkens dürfen wir nicht so verstehen, als ob die Bemerkungen, die er schrieb und immer wieder ergänzte, unklar gedacht und unverständlich formuliert wären. Er war der Klarheit seiner Formulierungen und Gedanken in jeder Phase seiner Arbeit verpflichtet, dies zeigen die vielen sprachlichen Korrekturen und Überarbeitungen der Bemerkungen. Seine Unzufriedenheit war nicht der Unklarheit, sondern der Unvollständigkeit seines Denkens geschuldet. Er glaubte, nicht alle Aspekte der Probleme und Fragen, die ihm wichtig waren, hinreichend und umfassend bedacht zu haben. Er wollte nicht bestimmte Aspekte generalisieren oder anderen vorziehen und für wichtiger halten.
Damit entzog er einer Orthodoxie bei der Interpretation seines Denkens den Boden. Ihm ist jedenfalls nicht vorzuwerfen, dass eine Wittgenstein-Orthodoxie entstand, die Definitionen von Begriffen, die er gebrauchte, anbietet und den Eindruck erweckt, als könnten wir endlich entschiedene Urteile über die Resultate seines Denkens fällen, die ihm selbst fernlagen oder ihm nicht gelangen. Der offene Zugang zu Wittgensteins Denken wird durch die Theoretisierung seines Denkens und dessen orthodoxe Interpretation nicht gefördert, sondern versperrt. Der einzig zuverlässige und empfehlenswerte Zugang zu Wittgensteins Denken ist sein Nachlass. Er ist in seiner Gesamtheit als sein authentisches philosophisches Werk ernst zu nehmen, zu verstehen und zu interpretieren. Die Werkausgabe ist dafür ein Einstieg, aber kein Ersatz. Die Wiener Ausgabe ermöglicht es, die Entwicklungen von Wittgensteins Denken nach seiner Rückkehr nach Cambridge 1929 minutiös nachzuvollziehen. Die WAB-Editionen ermöglichen dies auch; sie sind für die Bearbeitung des Nachlasses die zuverlässige Grundlage.
Die Zugänge zum Nachlass in den Editionen der WAB sind unverzichtbar für die Forschung und für eine umsichtige Interpretation der denkerischen Entwicklung Wittgensteins. Die Mittel der digitalen Geisteswissenschaften sind für die Edition des Nachlasses Wittgensteins aufgrund von dessen vielen textlichen Dimensionen eine wesentliche Hilfe. Der Diskurs über die Ergebnisse der Forschungen mit dem Nachlass bleibt am Ende aber auf die herkömmliche Veröffentlichung von Büchern und Aufsätzen angewiesen.
Die Interpretation von Wittgensteins Werken wird aufgrund der Forschungen zum Nachlass immer wieder korrigiert werden. Die Wiener Ausgabe und die Wittgenstein Archives Bergen mit ihren Werkzeugen zeigen, dass die Periodisierung der Werkentwicklung nach 1929 in zwei oder drei unterscheidbare Phasen nicht haltbar ist. Die Periodisierung entsprach der Auswahl der Herausgeber aus den Manuskripten und Typoskripten. Die Periodisierung ist eine doppelte Interpretation; sie interpretiert die Interpretation, die bereits mit der Edition der Werkausgabe gegeben war. Diese doppelte Interpretation verstellt den Zugang zu Wittgenstein Denken. Die Periodisierung sollte nicht aufrechterhalten werden.
Die einzig sinnvolle Periodisierung ist die Unterscheidung zwischen der Logisch-philosophischen Abhandlung, dem Tractatus, und der philosophischen Entwicklung nach 1929. Die Logisch-Philosophische Abhandlung, das Wörterbuch für Volksschulen und »Some Remarks on Logical Form«73 sind die einzigen Texte, die Wittgenstein selbst veröffentlicht hat, Werke letzter Hand. Die Genese des Tractatus ist mittlerweile, vor allem durch Martin Pilch, gut erforscht.74 Die zeitlich gegliederte thematische Entwicklung ist aufschlussreich, weil damit die allmähliche Erweiterung von Wittgensteins Interesse an Fragen erkennbar wird, die zunächst keine Bedeutung für die philosophische Logik, die er in seiner Auseinandersetzung mit Frege und Russell entwickeln wollte, zu haben schienen.
Die Logik ist für den frühen Wittgenstein die Grundlage der Philosophie. Die Metaphysik gehört im Übrigen dazu.75 Die Einbeziehung der Metaphysik in die Logik überrascht, da sich Wittgensteins Auffassung der Logik in seiner Auseinandersetzung mit Frege und Russell entwickelt, die beide der Metaphysik kritisch gegenüberstanden. Die Kritik des jungen Wittgenstein an Frege und Russell ist fundamental und angesichts seiner Jugend erstaunlich. Die philosophische Differenz zwischen der Logisch-Philosophischen Abhandlung und dem späteren Werk zeigt sich im unterschiedlichen Gebrauch von Begriffen und Urteilen. Er beschreibt diese Differenz selbst so: »Das Grundübel der Russellschen Logik sowie der meinen in der L. Ph. Abh. ist, daß, was ein Satz ist, mit ein paar gemeinplätzigen Beispielen illustriert, und dann als allgemein verstanden vorausgesetzt wird.«76
Während Wittgenstein in seinem Erstlingswerk entschieden und mit endgültigem Anspruch urteilt, stellt er nach 1929 Fragen zum Gebrauch von Wörtern und Begriffen, diskutiert Aspekte ihres Gebrauchs und will keinen der vielen Aspekte, die ihm nach und nach zu diesem Gebrauch in den Sinn kommen, verallgemeinern. In gewisser Weise hielt er die Fragen der Philosophie in seinem Erstling für endgültig abgeschlossen, in seinem späteren Denken für unabschließbar.77 Im Hinblick auf diese grundlegende Differenz, aber auch im Hinblick auf das, was Alois Pichler zur Ontologie von Texten schrieb, können wir den Nachlass als nicht abgeschlossenes Werk, als »Werk im Werden« verstehen. Es ist in mehrfacher Hinsicht ein Werk im Werden. Zum einen sind, wie erwähnt, die Transkriptionen für die Editionen der WAB und für die Wiener Ausgabe nicht abgeschlossen, zum anderen werden auch beim Verstehen und Interpretieren des Nachlasses immer wieder neue, bisher übersehene oder vernachlässigte Aspekte erkennbar. Schließlich wäre es wünschenswert, wenn nach dem Beispiel der Wiener Ausgabe weitere Editionen von Manuskripten und Typoskripten als bleibende Grundlage des philosophischen Diskurses über Wittgensteins Denken im Buchdruck verfügbar würden.
Wittgenstein hat sich nach 1929 weder als Person noch als Philosoph neu erfunden. Er denkt in vielem so wie davor und ist trotz der Erfahrungen des Krieges und der erfolglosen Suche nach einem neuen Leben als Lehrer seinem Charakter und denkerischen Gestus nach derselbe geblieben. Er hat zwar immer wieder auf die Unterschiede zwischen seinem frühen und späteren Denken hingewiesen und auch von früheren Irrtümern78 gesprochen, aber verleugnet hat er seine früheren Überzeugungen nicht. Auf die Bemerkung Drurys in einem ihrer vielen Gespräche, dass Kant seine grundlegenden Ideen erst in seinem mittleren Alter entwickelt habe, meinte Wittgenstein, er selbst habe im Unterschied dazu seine grundlegenden Ideen sehr früh in seinem Leben gefunden.79 Wenn er damit das meinte, was er in seinem Erstling zur logischen Form, zu den Elementarsätzen und zur allgemeinen Satzform sagt, wäre das verwunderlich, denn davon ist später nicht mehr die Rede. Drury berichtet von einem Gespräch, in dem Wittgenstein C. D. Broads Urteil über den Tractatus erwähnte. Broad habe recht gehabt, dass der Tractatus »hochgradig verkürzt« (»highly syncopated«) gewesen sei. Jeder Satz hätte als Überschrift eines Kapitels mit weiteren Darlegungen betrachtet werden sollen. Sein gegenwärtiger Stil sei ganz anders. »Ich versuche jenen Irrtum zu vermeiden«, sagte er, nachdem er – 1947/48 – seine Professur in Cambridge aufgegeben hatte.80
Die Rigidität, Unnachgiebigkeit und Entschiedenheit, mit der er bereits als Student Russells Urteilstheorie kritisiert, ist ein bleibender Charakterzug von Wittgensteins Denken. Er bleibt auch im Übergang zu seinem Denken nach 1929 erhalten, obwohl seine Gedankenbewegungen dann bewusst unabgeschlossen bleiben, eine paradox erscheinende Verbindung von Entschiedenheit und Offenheit. Auf dem Weg zur Logisch-Philosophischen Abhandlung hatte Wittgenstein einen Symbolismus gefordert, der einer »richtigen logischen Auffassung« entsprechen würde. Mit der gleichen Entschiedenheit fordert er auch 1929 in »Some Remarks on Logical Form« einen angemessenen Symbolismus.81 Der Unterscheidung zwischen Sagen und Zeigen, die Wittgenstein, wie Martin Pilch82 rekonstruiert, in Norwegen entwickelte, bleibt er treu, während er nach 1929 das Interesse am Symbolismus allmählich und an den formalen Elementen der Logik und an der Bildtheorie im Verhältnis zwischen Sprache und Wirklichkeit ganz aufgibt. Dennoch bleiben Bilder für ihn im Zusammenhang mit dem Aspekt-Sehen sehr bedeutsam.83 Selbst die Musik, die »Notensprache« und die Ähnlichkeit »so ganz verschiedener Gebilde« wie die Partitur einer Symphonie und das, was über die »Grammophonplatte« hörbar ist, hat ihn schon früh und nicht erst nach 1929 beschäftigt.84 Die Entschiedenheit im Urteil, zunächst über Frege und Russell, später über Mahler und andere, ist sein bleibender Charakterzug.85 Dasselbe gilt für sein entschiedenes, bohrendes Fragen und sein unnachgiebiges Abwägen zwischen Aspekten des Sehens, Hörens, Erlebens und Denkens. Weder seine Fragen noch seine Abwägungen kommen an ein Ende.
Seine abwägenden Überlegungen zum Denken und die differenzierenden Charakterisierungen der Sinneswahrnehmungen schreibt Wittgenstein, ohne auf andere Autoren einzugehen, die sich mit diesen oder ähnlichen Themen beschäftigten. Die Gründe dafür nennt er nicht. Er führt aber dennoch vereinzelte Diskurse mit anderen Philosophen und deren Werken, unter anderen mit Russell, Frege, Schopenhauer, James und Köhler.86 Er denkt dabei undialogisch, spricht mit sich selbst und markiert die Äußerungen seines Alter Ego nach 1929 mit Anführungszeichen; er ist sich als Gesprächspartner scheinbar genug. In der Logisch-Philosophischen Abhandlung denkt er im Ansatz noch dialogisch. Er erwähnt häufig Frege und Russell87 und weist anfänglich zustimmend, später kritisch oder ablehnend auf einige ihrer Thesen hin. Er führt aber kein argumentatives Gespräch mit ihnen, sondern konstatiert nur, was sie seiner Ansicht nach sagten. Mit dem Beginn seiner metaphysischen Überlegungen zu den Grenzen der Sprache (ab Satz 5.6) erwähnt er Russell (6.123, 6.1232) und Frege (6.232) kritisch und ablehnend. Die Erwähnungen dieser beiden Autoren können wir so verstehen, dass er sich selbst in deren Tradition sieht und mit seiner eigenen Theorie der Logik deren Ansätze weiterentwickeln will. Er ordnet sich damit zumindest in seiner Logisch-Philosophischen Abhandlung in eine damals entstehende neue philosophische Entwicklung ein, die später das Etikett ›Analytische Philosophie‹ erhielt. Mit dieser Etikettierung hat sich Wittgenstein zu keinem Zeitpunkt identifiziert.88
Wittgenstein erwähnt nach 1929 da und dort Autoren, die ihn beeinflussten. »So haben mich Boltzmann, Hertz, Schopenhauer, Frege, Russell, Kraus, Loos, Weininger, Spengler, Sraffa beeinflußt.«89 Diese Namen nennt er nicht alphabetisch im Zusammenhang mit seiner Selbsteinschätzung, dass das, was er »erfinde … neue Gleichnisse« seien; dass seine Arbeit »die des Klärens« sei, dass dies »mit Mut betrieben werden muß« und dass er in Norwegen 1913–14 »eigene Gedanken« hatte und »neue Denkbewegungen geboren« habe.90 Die immer wieder neu zusammengestellten und überarbeiteten Bemerkungen sind Denkbewegungen, und es sind Wittgensteins eigene Gedanken. Er beschäftigt sich mit dem, was er selbst denkt, und er bewegt sich in seinem eigenen Denken. Dies bedeutet nicht, dass er sich nicht mit anderen Autoren beschäftigt oder ihre Texte gelesen hat.
Hans Biesenbach91 hat, gestützt auf die Bergen Electronic Edition, das Suchprogramm WittFind und seine eigenen Recherchen zur Herkunft von Zitaten, die Wittgenstein meist aus seiner Erinnerung notierte, beinahe 170 Namen von Autoren gefunden, die er offenbar las und erwähnte. Russells Name kommt in der Sammlung nicht vor, weil er von Wittgenstein zu häufig erwähnt wird. Es ist interessant, die fachliche Zuordnung der Namen anzusehen. Philosophen sind mit etwa 29 Namen in der Minderheit. Die überwiegende Mehrheit bilden die Namen von Dichtern und Schriftstellern. Von der bloßen Nennung von Namen abgesehen, sind lediglich die Einträge92 weniger Philosophen gut, Mathematiker und Physiker besser und Dichter und Schriftsteller sehr gut in der Sammlung Biesenbachs vertreten. Offenbar bedeuteten die Dichter und Schriftsteller Wittgenstein sehr viel, zumindest suchte er bei ihnen mehr und intensiver gedankliche Orientierungen und Anregungen als bei den Philosophen, abgesehen von Augustinus und Platon. Das Beispiel Paul Ernst (1866–1933), eines kaum mehr bekannten Dramatikers und Zeitkritikers, mag die Bedeutung von Schriftstellern für Wittgensteins Denken illustrieren. Im Blick auf das noch in weiter Ferne stehende zweite Buch, die späteren Philosophischen Untersuchungen, schreibt Wittgenstein: »Wenn mein Buch je veröffentlicht wird so muß in seiner Vorrede der Vorrede Paul Ernst’s zu den Grimmschen Märchen gedacht werden die ich schon in der Log. Phil. Abhandlung als Quelle des Ausdrucks ›Mißverstehen‹ der Sprachlogik hätte erwähnen müssen.«93
Wittgensteins Persönlichkeit, seine Eigenarten und Charakterzüge mit seinem Werk zu verbinden, entspricht nicht der geläufigen Maxime, Werk und Autor zu trennen. Es wäre verfehlt, die Inhalte von Wittgensteins Gedankenentwicklung biographisch und psychologisch zu erklären. Werk und Autor sollten auch in seinem Fall unterschieden werden, getrennt werden aber können sie nicht. Sie sind miteinander verbunden und voller tiefgehender Wechselwirkungen. Wittgensteins Charakter hat seine Haltung zu allem geprägt, was ihm wichtig war, und die Eigenarten seines Charakters haben sein Leben und Denken durchwirkt. Sein undialogisches Denken, das auch von engen Freunden als idiosynkratisch bezeichnet wurde, und die starre Entschiedenheit seiner Urteile sind in seiner Persönlichkeit verankert. Sein Schüler und Freund Drury berichtet darüber ausführlich von seinen Gesprächen mit Wittgenstein.94 Sie drehen sich um Fragen der Religion, der Lebensführung, der Ethik und die Bedeutung anderer Autoren, deren Denken er tief oder oberflächlich fand.95 Drury schreibt, dass Wittgenstein bei ihren privaten Begegnungen nicht über Philosophie sprechen wollte.96 Wittgenstein antwortete in den Gesprächen auf Fragen Drurys, wenn es um Philosophie ging, belehrend, ohne Rückfragen und ohne erkennbar positives oder zustimmendes Interesse an dessen Ansichten. Sehr freundschaftlich, offen und einfühlsam sprach er mit Drury über alle persönlichen, religiösen, lebenspraktischen und gesundheitlichen Fragen. Drury hat diese Gespräche sehr geschätzt. Er beschreibt Wittgenstein als freundlich, großzügig, leicht erregbar und mit eigenen Verschrobenheiten.97 Den Charakterzug, den Fania Pascal »aggressiv« nannte, bezeichnete Drury als »leicht erregbar«.
Wenn wir das offene, zu keinem Abschluss kommende Fragen, Abwägen und Denken als Ausdruck seiner Persönlichkeit verstehen, werden wir Wittgenstein als Person und Denker nicht endgültig beurteilen wollen. Wir werden ihn und sein Denken dann so verstehen, wie er sich in seinem Nachlass und in seinen persönlichen Äußerungen Freunden gegenüber zeigt.98 Eine Selbstauskunft ist bemerkenswert: »Ich glaube meine Stellung zur Philosophie dadurch zusammengefaßt zu haben indem ich sagte: Philosophie … dürfte man eigentlich nur dichten. Daraus muß sich, scheint mir, ergeben, wie weit mein Denken der Gegenwart Zukunft oder der Vergangenheit angehört. Denn ich habe mich damit auch als einen bekannt, der nicht ganz kann was er zu können wünscht.«99