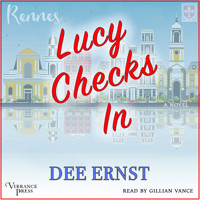8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wo, wenn nicht in Paris, findet man die Liebe?
Maggie ist eine gestandene Autorin – mit der Schreibkrise ihres Lebens. Zur besseren Inspiration wird sie von ihrem Literaturagenten ins frühlingshafte Paris geschickt. Ausgerechnet hier muss sie sich mit all den Konflikten auseinandersetzen, die man als Frau Ende vierzig mit einer Tochter mit Asperger-Syndrom, einem Exmann und vielen gescheiterten Interimsbeziehungen so mit sich rumschleppt. Mitten im Ex-Freund-Ex-Familien-Chaos begegnet sie dann ihrer leibhaftigen Muse – dem überaus reizenden Franzosen Max, der sie zu noch viel mehr inspiriert, als nur ihren Roman zu Ende zu bringen. Doch Maggie hat keine Ahnung, wie sie dieser Geschichte zu einem Happy End verhelfen soll ….
Besser spät als nie: eine charmante Lovestory in der Stadt der Liebe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 384
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über das Buch
Maggie ist eine gestandene Autorin – und hat den Ärger ihres Lebens. Ihre Beziehung zu ihrem Freund Greg steckt in einer tiefen Krise, weshalb es ihr einfach nicht gelingen will, den letzten Teil ihrer romantischen Trilogie zu schreiben. Dann schickt sie ihr Literaturagent zur besseren Inspiration ins frühlingshafte Paris, doch hier wird sie mit all dem konfrontiert, was man als Frau in ihrem Alter so im Schlepptau hat: mit ihrer Tochter Nicole, die das Asperger-Syndrom hat, ihrem Exmann und schließlich der Frage, was sie nach Jahren der Kompromisse eigentlich will. Bis Maggie ihre Muse findet – verkörpert von dem überaus reizenden Franzosen Max, der sie zu noch viel mehr inspiriert, als nur ihren Roman zu schreiben. Doch wie um Himmels willen bringt sie diese Geschichte zu einem Happy End?
»Voll amüsanter Figuren mit einem großartigen Plot und köstlichen Beschreibungen der Pariser Küche.« KIRKUS REVIEWS
Über Dee Ernst
Dee Ernst wollte schon immer schreiben. Doch erst diverse Jobs, zwei Ehemänner und zwei Töchter später war sie so weit, es ernsthaft anzugehen. Trotz ihrer Vorliebe für Liebesromane gefiel es ihr jedoch nicht, ständig von Frauen unter dreißig zu lesen. Also fing sie an, über Frauen wie sie selbst zu schreiben – Frauen, die nicht mehr ganz jung sind, dafür aber schon ein paar Dinge erlebt haben, und die dennoch auf der Suche sind – nach sich selbst oder der Liebe. Christine und Anna Julia Strüh sind Mutter und Tochter und übersetzen gemeinsam aus dem Englischen. Christine Strüh übertrug u. a. Kristin Hannah, Gillian Flynn und Cecelia Ahern ins Deutsche. Anna Julia Strüh übersetzte ihr erstes Buch mit fünfzehn und überträgt auch Lyrik.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Dee Ernst
Wo, wenn nicht hier
Roman
Aus dem Amerikanischen von Christine Strüh und Anna Julia Strüh
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
Kapitel 1 — In dem ich in Panik gerate und mich allen unnützen Wirrwarrs entledige
Kapitel 2 — In dem ich in Paris ankomme und es gar nicht so schrecklich finde
Kapitel 3 — In dem ich einen unbekleideten Mann in der Badewanne vorfinde
Kapitel 4 — Ein Umstyling, ein Exmann und die Offenbarung einer großen Leidenschaft
Kapitel 5 — In dem ein teuflischer Plan aufgedeckt wird und ich eine Wasserfallszene epischen Ausmaßes schreibe
Kapitel 6 — Eine Diskussion über Liebe, Reue … und die Entdeckung der Muse
Kapitel 7 — In dem eine gefährliche Rettung nötig wird
Kapitel 8 — Meditationen über Verlust, Liebe, die Vergangenheit und noch mehr Liebe
Kapitel 9 — Eine Offenbarung. Oder vielleicht sogar drei.
Kapitel 10 — Noch ein teuflischer Plan
Kapitel 11 — In dem die Sonne heller scheint, die Vögel lauter singen und mit der Welt alles in Ordnung ist
Kapitel 12 — Der Schreibmarathon, oder: wie ich ohne Butter und ohne Wein achtundvierzig Stunden ununterbrochen schrieb
Kapitel 13 — In dem wir alle unseren verdienten Nachtisch bekommen
Dank
Impressum
Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...
Für Gene …
mit dir bin ich glücklich bis ans Ende meiner Tage
Kapitel 1
In dem ich in Panik gerate und mich allen unnützen Wirrwarrs entledige
Hier liegt Maggie Bliss, die langsam und qualvoll am Hochstapler-Syndrom starb, weil es ihr um keinen Preis gelingen wollte, den letzten Band ihrer Trilogie zu schreiben.
Nachdem ich diese Zeilen verfasst hatte, starrte ich sie eine Weile an. Die perfekte Inschrift für meinen Grabstein, diese Sätze sollte ich unbedingt aufheben, man konnte ja nie wissen. Aber wo? Sollte ich sie meiner Tochter schicken? Wohl besser nicht. Das Letzte, was sie brauchte, war eine weitere Konfrontation mit Therapiebedürftigkeit, selbst wenn es nur um ihre Mutter ging. Oder meinem Exmann? Er war immer gut im Umgang mit Papierkram gewesen, aber wir waren seit dreiundzwanzig Jahren geschieden, also … nein. Mein Agent wäre die logische Wahl gewesen, aber damit riskierte ich, folgenreiche Alarmglocken zu läuten. Schließlich ging er davon aus, dass ich mit dem Schreiben gut vorankäme.
Vielleicht könnte ich es ausdrucken und einrahmen, mit ausführlichen Anweisungen für den Fall der Fälle.
Wo immer es auch landen würde, die gute Nachricht war, dass ich, wenn meine Lektorin Ellen mich das nächste Mal fragte, ob ich auch fleißig an meinem Buch arbeitete – das tat sie nämlich im Stundentakt –, zum ersten Mal seit sechs Monaten wahrheitsgetreu mit Ja antworten konnte.
Während ich mir die Sätze noch einmal laut vorlas, war ich allein in meinem Büro, und das war auch gut so. Jeder Autor auf der ganzen Welt weiß im Grunde seines Herzens, dass wir trotz aller Erfolge, Auszeichnungen und hingebungsvoller Follower die Fähigkeit, auch nur den einfachsten Satz zu Papier zu bringen, jederzeit komplett einbüßen können. Wenn mich eine andere Autorin gehört hätte, hätte sie verständnisvoll die Ärmel hochgekrempelt, uns beiden Kaffee eingeschenkt und mir mit der Zeichensetzung geholfen.
Hätte mich jedoch irgendjemand anderes gehört, wäre er oder sie wohl ziemlich enttäuscht gewesen. Wahrscheinlich sogar wütend. Es gab Millionen von Lesern, die keine Ahnung hatten vom Hochstapler-Syndrom und den massiven Selbstzweifeln und Blockaden, die damit einhergingen – oder denen es völlig schnurz war. Sie wussten nur, dass sie den ersten Band der Delania-Trilogie gelesen hatten und voller Spannung auf den nächsten warteten. Für sie stand ohne jeden Zweifel fest, dass es einen dritten Band geben würde. Schließlich war es eine Trilogie. Diese Leser hatten Fragen. Erwartungen. Sie wollten wissen, wie es weiterginge. Sie wollten ein rundum großartiges ENDE, das all ihre Fragen in befriedigender Weise beantwortete. Unvorstellbar, was mit mir passieren würde, wenn ich nichts davon zustande brächte.
Und dann waren da auch noch mein Agent und meine Lektorin, die beide der Überzeugung waren, dass mich dieser dritte Band auf die nächste Stufe der Erfolgsleiter katapultieren würde. Sie hatten über die Jahre eine Menge Zeit, Energie und Geld in meine Arbeit investiert, und nun war der Moment gekommen, den Lohn dafür einzuheimsen. Auch sie würden wütend sein, definitiv.
Es war nicht so, als wüsste ich nicht, wie die Trilogie enden würde. Natürlich wusste ich das. Bellacore (nenn mich Bella) – sechsundzwanzig, eins achtundsiebzig, grün gefleckte Augen – hatte der Liebe den Rücken gekehrt und war schon lange nicht mehr auf der Suche nach einem Mann. Kein Mann vermochte ihr Herz zu erobern, so großartig er auch sein mochte. Nicht einmal …
Lance. Sergeant David Rupert Lancaster – vierunddreißig, eins neunundachtzig, stahlharte Muskeln und trotz permanenter Stoppeln am markanten, oft vor Frustration verkrampften Kiefer überraschend zarte Haut. Er wusste, dass Bella die Eine für ihn war, und war bereit, alles zu tun, um es ihr zu beweisen. Ihre Liebe hätte niemals sein dürfen. Ihre Leidenschaft ließ sich nicht leugnen. Ihre Geschichte war dazu bestimmt, den Lesern Freudentränen, Herzschmerz und schlussendlich ein Happy End zu bescheren.
Ich musste sie nur fertigschreiben.
Und darin lag das Problem. Trotz all meiner Notizen und Tabellen, Mind-Maps und guten Absichten hatte ich zweieinhalb Monate vor dem Abgabetermin noch kein einziges Wort geschrieben.
Jeder hat mal eine Schreibblockade. Und normalerweise waren Schreibblockaden für mich keine große Sache, weil ich mir zwischen zwei Büchern immer etwas Zeit nahm. Doch ich hatte den größten Auftrag meiner über zwanzigjährigen Karriere angenommen und mich dazu verpflichtet, eine Trilogie zu schreiben, die der gepeinigten Liebe zwischen einer wunderschönen Einsatzhelferin und einem hartgesottenen Ex-Soldaten, der sie im kriegsgeschundenen, frei erfundenen Delania zu beschützen versuchte, Leben einhauchte. Es hätte eigentlich nicht so schwer sein dürfen. War es aber doch.
Der erste Band hatte keinen guten Start gehabt, aber durch begeisterte Leserinnenstimmen waren die Verkaufszahlen schließlich in die Höhe geschossen. Der zweite Band der Trilogie sollte Anfang Juni veröffentlicht werden, also in nicht einmal ganz zwei Monaten. Schon jetzt war die Aufregung groß. Allein die Vorbestellungen hatten mir den dritten Platz auf der Beste-Bücher-des-Sommers-Liste der People, einen geplanten Auftritt bei Good Morning America und Lesereisen quer durchs Land eingebracht.
Ein Erfolg, wie ihn solche Maßnahmen in Aussicht stellten, würde es mir ermöglichen, mit den Creative-Writing-Kursen aufzuhören, die ich ohnehin nur deshalb gab, weil ich vom Schreiben allein nicht leben konnte. Ich weiß … Autoren sollten eigentlich von Haus aus reich sein. Tatsächlich aber standen die meisten von uns nicht ständig ganz oben auf der Bestsellerliste und befanden sich nicht in derselben Steuerklasse wie Stephen King. Wenn ich nicht ausgerechnet im Norden von New Jersey wohnen würde, könnte ich von den Tantiemen vielleicht gerade so leben, aber ich hatte nicht die Absicht, nur wegen der angemesseneren Lebenskosten nach Iowa zu ziehen.
Und dann war da noch die mögliche Fernsehadaption. Ich hatte das Angebot erhalten, die Trilogie von einem äußerst wichtigen Produzenten als Miniserie mit mindestens ebenso wichtigen Schauspielern in den Hauptrollen verfilmen zu lassen. Dieses Angebot würde mir nicht nur genug Geld einbringen, um endlich meinen Nebenjob zu kündigen, sondern auch – ich wage kaum, es auszusprechen – ein Strandhaus.
Schon seit ich zum allerersten Mal mit den winzigen Füßen einer Zweijährigen ins Meer gewatet war, wünsche ich mir ein Strandhaus. Bis heute erinnere ich mich genau, wie herrlich frisch sich das Wasser anfühlte, an den intensiven Salzgeruch der Luft, den kribbelnden Sand unter meinen Zehen. Genau das will ich, dachte ich damals. Hier will ich leben.
In den letzten vierzig Jahren hatte nichts an meinem Traum rütteln können. Und die Buchverfilmung sollte ihn endlich Wirklichkeit werden lassen. Aber niemand würde irgendetwas unterzeichnen, bevor nicht das Finale der Trilogie auf dem Tisch meiner Lektorin lag.
Alles, worauf ich als Autorin je gehofft hatte, war in greifbare Nähe gerückt.
Ich musste nur das verdammte Buch zu Ende bringen.
Nein, ich korrigiere: Ich musste das verdammte Buch anfangen.
Es war sieben Jahre her, dass ich Greg Howard kennengelernt hatte. Auf einer Cocktailparty der Drew University, an der ich jahrelang meinen Creative-Writing-Kurs unterrichtete, waren wir uns begegnet. Er schrieb politische Sachbücher und würde im Frühjahr sein erstes Schreibseminar geben, und mit der Party hieß man ihn offiziell an der Universität willkommen. Als wir uns näher kamen, ließ ich mir Zeit und wog die Risiken einer Beziehung zu ihm gründlich ab. Denn er war jünger als ich und ehrlich gesagt ziemlich anspruchsvoll.
Dennoch konnte ich kaum anders, als mich mit ihm einzulassen, weil er in jeder Hinsicht meiner Vorstellung des perfekten Lebensabschnittsbegleiters entsprach: männlich, erotisch anziehend, umgeben von einer aufregenden Aura der Gefahr. Im Lauf seiner Karriere als politischer Autor war er mit einer Pistole bedroht worden, mitten im Amazonas gestrandet und von einer kleinen, aber entschlossenen Gruppe Guerillakämpfer irgendwo in Afrika als Geisel genommen worden. Außerdem war er charismatisch, intelligent, lustig und … ich gebe es zu … unglaublich leidenschaftlich. Die bloße Berührung seiner Lippen an meinem Hals reichte aus, mir die Knie weich werden zu lassen. Einer der Gründe, warum ich in meinen Büchern so gute Sexszenen schrieb, bestand darin, dass ich sie mit Greg erlebte, und zwar so ziemlich immer, wenn ich es wollte. Machte das meine Gefühle für ihn zu etwas Oberflächlichem? Nein. Denn außerhalb des Betts verbrachten wir sogar noch mehr Zeit miteinander. Aber ich muss zugeben, dass es vor allem die Gedanken an seine Finger und seinen Mund waren, die mich – fast – seinen größten und fatalsten Fehler vergessen ließen:
Sein Ego.
Greg hatte einen Haufen renommierter Preise gewonnen und schon Reden vor den wichtigsten politischen Foren gehalten. Er hatte Groupies. Und er liebte es. In all den Jahren, die wir uns kannten, hatte er kein einziges Mal auch nur die geringsten Selbstzweifel gezeigt. Er traf all seine Entscheidungen voller Überzeugung.
So etwas konnte sehr sexy wirken.
Aber es hatte unzweifelhaft negative Auswirkungen auf unsere Beziehung. Und in letzter Zeit war ich es leid geworden, immer die zweitwichtigste Person im Raum zu sein, sobald ich mit ihm allein war.
Seit fast vier Jahren wohnten wir schon zusammen – zumindest, wenn er gerade in New Jersey war, um seine Seminare zu halten. Was lediglich sechs Monate im Jahr waren. Den Rest seiner Zeit verbrachte er mit Reisen in irgendwelche grässlichen Länder und recherchierte für seine Bücher. Und wenn er mit der Recherche fertig war, zog er sich in seine abgelegene Hütte in Maine zurück, um zu schreiben. Allein.
Da sein Schreibseminar jedes Frühjahr stattfand, war er zurzeit bei mir in New Jersey. An dem Tag, an dem ich meine Grabinschrift verfasste, kam er irgendwann nachmittags nach Hause, während ich aus dem Fenster starrte, im Internet surfte oder sonst irgendetwas tat, das nichts mit Schreiben zu tun hatte. Als ich die Treppe hinunterstieg, plünderte er gerade den Kühlschrank.
Schreiben ist eine so einsame Tätigkeit, dass ich froh war, Greg wieder in meiner Nähe zu haben und mit ihm über meine Probleme reden zu können. Zwar war ich noch nicht so verzweifelt, dass ich vorhatte, mich ihm in die Arme zu werfen, vor Frust in Tränen auszubrechen und ihn um Hilfe anzuflehen, aber fast.
»Hey, wie war dein Tag?«, erkundigte ich mich und wollte ihm einen Kuss geben.
Er wich vor mir zurück. »Du hast noch deine Schreibklamotten an.«
Da hatte er recht. Ich trug eine Schlabberhose und mein Schlaf-Shirt und hatte es womöglich nicht für nötig befunden, die Zähne zu putzen. Immerhin hatte ich mir die Haare gekämmt.
»Ich habe versucht zu arbeiten«, erklärte ich.
Er blickte sich missmutig um. »Wo ist das Essen?«
Irritiert deutete ich auf den Kühlschrank. »Da ist doch jede Menge Essen drin. Könntest du etwas genauer sein?«
Seine Augen wurden schmal. »Das Essen für heute Abend.«
Oh … Mist. »Ähm … das ist heute?«, fragte ich. Jedes Semester lud er all seine Studenten zum Abendessen ein, und anscheinend war das für heute geplant. »Das hab ich ganz vergessen, entschuldige. Du weißt ja, dass ich mit meinem Buch beschäftigt bin, und darüber muss ich dringend mit dir reden. Ich weiß, dass es ungünstig ist, aber könntest du das Treffen vielleicht auf nächste Woche verschieben?«
»Nein, ich kann es nicht verschieben. In vier Stunden werden die Leute hier sein. Was willst du ihnen vorsetzen?«
»Moment … was ich ihnen vorsetzen werde? Es sind deine Gäste, nicht meine. Lad sie doch in ein Restaurant ein. Oder sag ihnen, es gibt ein Büffet und jeder muss was mitbringen. Du hast einen Doktortitel, Greg. Du bist aus einem Gefängnis am Ende der Welt und vor allen möglichen Warlords geflohen. Dir wird schon was einfallen.« Aufgebracht fuhr ich mir durch die Haare, blieb hängen und hatte Mühe, meine Finger wieder zu befreien. Offensichtlich hatte ich mir die Haare nicht sehr gründlich gekämmt. »Ich muss wirklich dringend mit dir über mein Buch reden.«
Doch er schüttelte nur verächtlich den Kopf und erinnerte mich dabei an meinen Vater, wenn ich mit einem schlechten Zeugnis nach Hause gekommen war. »Maggie, jedes Jahr vertraue ich dir dieses Essen an. Hast du meine Mail nicht gekriegt? Ich hab dir heute Morgen geschrieben und dich daran erinnert.«
Ich schloss einen Moment die Augen. »Du hast mir eine Mail geschickt? Ich bin deine Partnerin, nicht deine Sekretärin.«
»Wenn du meine Partnerin wärst, hättest du daran gedacht.«
»Wenn du mein Partner wärst, wäre dir aufgefallen, dass ich seit geraumer Zeit total durch den Wind bin. Du weißt doch, wie dringend ich das dritte Buch fertig bekommen muss, oder etwa nicht?«
Er nickte.
»Und normalerweise versuche ich nicht, mit dir über Handlungsstränge, die sich als Sackgasse erweisen, zu reden, oder etwa doch?«
Er nickte erneut. Er machte kaum je Kommentare, wenn ich von meiner Arbeit erzählte. Genau genommen war ich mir ziemlich sicher, dass er sowieso nicht richtig zuhörte. Aber er setzte immer sein Du-hast-meine-volle-Aufmerksamkeit-Gesicht auf.
»Wann habe ich dich das letzte Mal irgendetwas zu meinem neuen Buch gefragt?«
Nachdenklich runzelte er die Stirn, kam jedoch zu keinem Ergebnis.
»Ganz genau«, sagte ich. »Ich habe noch kein Wort geschrieben. Kein einziges. Seit Monaten. Ist dir das nicht aufgefallen? Ist es dir je in den Sinn gekommen, dass ich mein Buch schreiben sollte, es aber nicht tue, und du mich vielleicht – nur vielleicht – fragen könntest, warum und wie es mir überhaupt geht?«
Er fuhr sich durch seine kurzen blonden Haare. »Ich war auch ziemlich durch den Wind, Maggie. Das weißt du.«
»Und ich weiß auch, warum – weil ich dich nämlich liebe und mich für deine Arbeit interessiere. Ich weiß, dass dein Abgabetermin vorgezogen wurde, dass dein Fachbereich schon wieder umstrukturiert wird und dass du Probleme hast, ein Visum für wo auch immer du als Nächstes hinfährst zu kriegen. Das weiß ich alles, weil ich dich jeden Tag frage, wie es bei dir läuft.«
»Willst du damit andeuten, dass ich mich nicht für dein Leben interessiere?«
»Es ist mehr als eine Andeutung, Greg.« Ich seufzte. »Hast du überhaupt irgendeine Ahnung, was bei mir los ist? Das versuche ich dir nämlich gerade zu erklären, aber anscheinend interessiert es dich nicht.«
»Hör mal, Maggie, das kann man wirklich nicht vergleichen«, erwiderte er und vergrub die Hände in den Hosentaschen. »Meine Arbeit und … na ja …«
Wochen, nein: Monate, vielleicht sogar Jahre angestauter Wut wallten in mir auf. »Ja, deine Arbeit. Reden wir doch über deine Arbeit, Greg. Wegen deiner Arbeit bist du das halbe Jahr über weg, und die andere Hälfte hältst du Vorträge, sagst vor dem Kongress aus und gibst zusätzlich zu deinen heißgeliebten Kursen noch irgendwelche Seminare, so dass du ohnehin kaum Zeit für mich hast. Und wenn du mal hier bist, erwartest du ganz selbstverständlich von mir, dass ich für deine gesellschaftlichen Verpflichtungen bereitstehe. Während ich meine Seminare, Autogrammstunden und alles, was sonst noch so ansteht, um deinen Terminplan herum plane.«
Er verdrehte die Augen. »Ich kann doch nicht …«
»Doch, Greg, das könntest du. Du könntest hin und wieder Nein sagen. Du könntest mich zu deinen Konferenzen und Tagungen mitnehmen. Ich würde dich sehr gern begleiten. Und deine Zeit in Maine … Weißt du eigentlich, dass ich deine Hütte nie von innen gesehen habe?«
»Weil ich dort arbeite.«
»Und ich arbeite hier. Und trotzdem schaffe ich es, mich mit allem, was du gerade tust, zu arrangieren, egal, wie sehr es mich ablenkt, weil du nie auch nur versuchst, bei all deinen Aktivitäten Rücksicht auf die Tatsache zu nehmen, dass auch ich arbeiten muss.« Ich trat einen Schritt auf ihn zu. »Bloß, dass ich nicht gearbeitet habe, Greg. Kein bisschen. Ich habe noch zweieinhalb Monate bis zum Abgabetermin und bin inzwischen nur noch im Panikmodus, aber warum kümmert dich das nicht?«
Er schüttelte den Kopf. »Maggie, seien wir ehrlich: Meine Arbeit ist einfach wichtiger als deine.«
Da war es endlich raus. Das, was mich schon so lange innerlich zur Weißglut brachte, dass ich überhaupt nicht mehr wusste, wann ich zuletzt nicht vor Wut gekocht hatte. »Ernsthaft, Greg? Deine Arbeit ist wichtiger? Warum bezahlst du dann keine einzige Rechnung?« Ich konnte hören, wie meine Stimme immer lauter wurde.
»Geld ist nicht alles, Maggie«, entgegnete Greg ruhig.
»Stimmt, ist es nicht. Aber wir brauchten Geld, um der Schule in Kolumbien die Lehrbücher zu schicken, die du ihnen versprochen hast. Nur dank meiner Arbeit konnten wir uns das leisten. Und der schicke BMW, den du fährst?« Wir standen uns nun Auge in Auge gegenüber, und womöglich brüllte ich Greg inzwischen an. »Wenn deine Arbeit so verdammt wichtig ist, wo ist dann das verdammte Geld, das sie einbringt, Greg?«
Er trat zurück, und ich konnte ein gelassenes Bedauern in seinen Augen erkennen. »Es gibt so viele andere Möglichkeiten, den Wert einer Sache zu bemessen, Maggie. Es enttäuscht mich, dass du dich so oberflächlich zeigst.«
»Und ich bin enttäuscht, dass ich so lange mit einem Mann zusammengelebt habe, der sich nur zu gern nimmt, was ich ihm gebe, ohne sich je klarzumachen, wie viel Zeit und Mühe ich darin investiert habe.«
Eine Weile starrten wir einander wortlos an. Er wirkte fast verlegen. Doch dann …
»Aber das löst nicht das Problem, was wir meinen Studenten heute Abend zu essen vorsetzen könnten.«
Das brachte das Fass zum Überlaufen. »Es kümmert mich einen Scheiß, was deine Studenten heute Abend essen. Und was du heute Abend isst. Heute Abend oder sonst wann. Ich habe eine ernsthafte Krise, und du denkst nur darüber nach, wie du dein Problem lösen kannst.«
»Wir bekommen Besuch, Maggie!«, rief er und schlug frustriert die Hände über dem Kopf zusammen.
Doch ich kam erst richtig in Fahrt. »Unsere Beziehung basiert darauf, dass es immer nur um dich geht. Ich habe mir das gefallen lassen, weil ich dachte, wenn ich irgendwann ein echtes Problem hätte, würdest du deine eigenen Bedürfnisse zurückstellen, um mir zu helfen. Und dieser Moment ist jetzt gekommen, aber du lässt mich hängen. Also ist es wohl das Beste, wenn du deine Sachen packst und verschwindest.«
Ich hörte seine Antwort nicht. Ich sah nicht, ob sein Gesicht Verwunderung, Wut oder einfach wehmütige Akzeptanz ausdrückte. Ohne ein weiteres Wort wandte ich mich ab, ging in mein Arbeitszimmer und knallte die Tür zu.
In meinem ganzen Leben hatte ich mich selten so geärgert. Ich war wütend, stinkwütend. Verbittert, frustriert, zutiefst enttäuscht. Nicht nur seinetwegen, weil er nicht der Mann war, den ich wollte und brauchte, sondern auch, weil ich zu blind gewesen war, um zu erkennen, dass er nie dieser Mann gewesen war und auch nie sein würde.
Ich liebte Greg. Oder hatte ihn zumindest geliebt, aber in den letzten Monaten hatte sich unsere anfangs so leidenschaftliche Beziehung definitiv abgekühlt, nicht nur körperlich. Ich hatte mich immer weiter und weiter von ihm distanziert, bis ich kaum noch wusste, was ich überhaupt fühlte. Deshalb empfand ich in diesem Moment trotz allen Ärgers auch Erleichterung. Denn Liebe allein war nicht genug. Das hatte ich von meinem Exmann Alan gelernt. Ich stand so kurz davor, mir einen Lebenstraum zu erfüllen, und wenn Greg sich nicht wenigstens bemühte, mich zu verstehen, dann wäre ich auch nicht länger bereit zu versuchen, unsere Beziehung zu retten.
Ein leises Klopfen an der Tür riss mich aus meinen Gedanken. »Geh weg, Greg«, knurrte ich. Das Letzte, was ich jetzt brauchte, waren sein Hundeblick, seine erkundungsfreudigen Hände und sein heißer Atem in meinem Ohr …
»Maggie, können wir nicht wenigstens darüber reden?«
»Dann rede.«
»Durch die Tür?«
»Warum nicht? Ich kann dich gut hören.«
Er seufzte. Für gewöhnlich gewann er fast jeden Streit, indem er seine Hände unter meine Klamotten schob, aber mit einer soliden Tür zwischen uns hatte er keinen Trumpf im Ärmel, und das wusste auch er. »Sobald dir morgen früh klar wird, wie albern du dich benimmst, wirst du anders darüber denken.«
Etwas Falscheres hätte er kaum sagen können. Wutentbrannt nahm ich eine meiner Messingbuchstützen und schleuderte sie gegen die Tür.
Greg war ein kluger Mann, also verzog er sich. Keine Ahnung, was er seinen Studenten erzählte, und es war mir auch egal. Als er viel später zurückkam, übernachtete er im Gästezimmer. Und als ich am nächsten Morgen aufwachte, war er fort.
Wenn eine der Hauptfiguren meiner Bücher mit ihrem Partner Schluss macht, hat sie immer schlaflose, von Reue geplagte Nächte. Ich dagegen schlief wie ein Baby. Oder wie jemand, der es endlich geschafft hat, aus einem viel zu langen, dunklen Schatten herauszutreten.
Am nächsten Morgen rief ich meinen Agenten Lee Newcomb an.
»Du hast was?«, schrie er fast, und er schrie sonst nie. »Du hast noch nichts geschrieben? Mein Gott, Maggie, wir haben den Abgabetermin schon zweimal verschoben. Du weißt doch, wie straff unser Zeitplan ist. Den ersten Entwurf musst du in knapp zehn Wochen abgeben, sonst kann das Buch nicht rechtzeitig erscheinen, und das wäre tödlich. Wir müssen uns ranhalten.«
Ja, wir. Lee und ich waren ein Team, deshalb konnte ich mich immer an ihn wenden, wenn ich Probleme mit einem Buch hatte.
»Ich weiß, Lee. Aber ich muss irgendwie mein Gehirn wieder in Gang bringen. Und dabei musst du mir helfen.«
Ich konnte ihn mir genau in seinem Büro vorstellen – im obersten Stock seines kunstvoll dekorierten Stadthauses in Hoboken, New Jersey. Das Büro war ebenso schlicht und elegant wie Lee selbst. Bei seinen oft stundenlangen Telefonaten stand er stets auf und tigerte rastlos auf und ab – angeblich seine einzige sportliche Betätigung.
»Weiß Ellen Bescheid?«, fragte er.
»Machst du Witze? Ellen hat keine Ahnung«, erwiderte ich ungehalten. »Ich lüge sie natürlich seit Monaten an.«
»Du hättest wirklich ein bisschen früher um Hilfe bitten können, das weißt du, oder? Vor vier oder fünf Monaten. Himmel, Maggie, was ist denn los?«
Ich war in meinem Arbeitszimmer, früher einmal das kleinste Schlafzimmer der Welt, inzwischen jedoch ausgestattet mit raumhohen Bücherregalen, einem gemütlichen Sofa für ernsthaftes Nachdenken und einem antiken Schreibtisch, der eines Hemingway würdig gewesen wäre.
»Ich weiß auch nicht, Lee. Ich hänge fest, ich sehe den Weg, wie meine beiden Helden zueinander finden können, einfach nicht vor mir.«
»Eine Art Midlife-Crisis?«
Ich schnaubte. »Schön wär’s. Ich befürchte, dass ich meine Lebensmitte schon eine Weile hinter mir gelassen habe. Und meine romantischen Höhepunkte wohl auch.«
»Papperlapapp.«
»Nein, wirklich. Ich bin achtundvierzig. Wie viele Leute werden schon sechsundneunzig?«
»Mehr, als du denkst. Aber zurück zu deinem Buch. Was kann ich tun? Was brauchst du?«
»O Gott, warum hat mein Freund das nicht gesagt, als ich ihn um Hilfe gebeten habe?«, stöhnte ich. Auf dem Sofa zusammengekauert, schlürfte ich meinen Tee und starrte aus dem Fenster auf den großen Teich direkt gegenüber. Es war Ende April, und der Frühling zeigte sich in seiner ganzen Pracht – Enten watschelten fröhlich umher, die Vögel zwitscherten sorglos in der milden Luft, irgendwo im tiefen Wasser schwammen Fische. Alle verbrachten eine absolut wundervolle Zeit. Außer mir.
»Was ist mit Greg?«, fragte Lee.
»Wir sind nicht mehr zusammen. Also, streng genommen sind wir es noch, aber nur, bis er sein Zeug packt und auszieht, was Wochen dauern könnte, und es wird eine Menge Spannungen und Unruhe geben, und du weißt, wie sehr ich Spannungen und Unruhe hasse … Wie soll ich nur dieses Buch schreiben, Lee?«
»Komm mit mir und Martin nach Paris.«
Das war das Letzte, womit ich gerechnet hätte. »Aber ist euer Ausflug nach Paris nicht so eine Art Pilgerreise durch deine Familiengeschichte? Wartet dort nicht ein alter Verwandter auf euch? Und ein Weingut?«
»Der alte Verwandte ist schon vor Jahren gestorben, und ja, wir besuchen auch das Weingut, aber unsere Reise beginnt und endet in Paris. In unserem Apartment in Paris haben wir eine Haushälterin, Solange, die dich lieben und exzellent für dich sorgen wird, während Martin und ich unterwegs sind. Die Wohnung ist riesig, vier Schlafzimmer. Zwar gibt es nur ein Bad, aber so ist das eben in Paris. Du wirst mit zwei schwulen Männern in der romantischsten Stadt der Welt sein. Und ist nicht sogar deine Tochter auch irgendwo dort drüben?«
Meine Tochter Nicole war das Produkt meiner kurzlebigen Ehe, und sie war tatsächlich irgendwo dort drüben. Sie war vor gut einem Jahr nach Frankreich gezogen – nach mehreren missglückten Versuchen mit diversen teuren Studiengängen und sechs nach wenigen Monaten abgebrochenen Jobs hatte sie beschlossen, dass sie Übersetzerin aus dem Englischen ins Bretonische werden wollte. Mir war nicht einmal klar gewesen, dass Bretonisch eine Sprache war, aber da sie im Hauptfach Französisch und im Nebenfach Kunstgeschichte studierte, schien ihre Entscheidung möglicherweise sinnvoll. »Sie ist in Rennes, westlich von Paris. In der Bretagne.«
»Ich wette, sie würde gern ein bisschen Zeit mit dir verbringen.«
Ich stand auf und ging zum Fenster. Moment … vögelten diese zwei Enten etwa? »Wenn sie wirklich Zeit mit mir verbringen wollte, wäre sie nicht so weit weggezogen.«
»Paris, Maggie. Die Stadt des Lichts. Kunst, Geschichte und mehr attraktive Männer, als du dir vorstellen kannst. Ich wette, die werden deine romantische Inspiration auf Hochtouren bringen. Hast du einen Reisepass?«
»Ja, aber …«
»Wir fliegen Sonntagabend. Ich schicke dir den Link zu unseren Reservierungen, dann kannst du versuchen, denselben Flug zu buchen. Wahrscheinlich musst du einen Haufen Geld bezahlen, und vielleicht kannst du nur erste Klasse fliegen, aber das kannst du alles von der Steuer absetzen.«
»Was ist mit der Kampagne?«, fragte ich.
Die Kampagne zum Erscheinen des zweiten Bandes der Delania-Reihe Feuer im Blut mit der geplanten Lesereise, Interviews, Fernseh- und Radioauftritten. Und sie sollte schon in acht Wochen beginnen.
»Konzentrier dich die nächsten Wochen voll und ganz aufs Schreiben, dann kannst du zurückfliegen und dich auf den Rest vorbereiten«, sagte Lee. »Das ist mehr als genug Zeit, um einen ersten Entwurf aus dem Boden zu stampfen, und mehr brauchen wir nicht. Ich werde Ellen anrufen und ihr sagen, dass du dich zurückziehst, um das Ende zu schreiben. So wird sie dich nicht jeden Tag mit ihren Nachrichten verfolgen.«
»Mindestens dreimal am Tag«, korrigierte ich ihn.
»Seien wir ehrlich: Es steht eine Menge auf dem Spiel, und offenbar hat sie allen Grund, sich Sorgen zu machen.«
Gedankenverloren starrte ich aus dem Fenster. »Aber ich habe für eine Reise nach Paris nichts zum Anziehen.«
»Nimm viel Schwarz und Grau und einen fabelhaften Schal mit. Den traumhaft schönen Ferragamo-Schal, den du dir vor ein paar Jahren gegönnt hast. Und gute Schuhe.«
»Ich bin zu klein für Paris«, protestierte ich, aber ich konnte fühlen, dass ich mich allmählich mit der Idee anfreundete.
»Zu klein? Was meinst du denn damit?«
»Laut der Durchschnittsgrößenstatistik muss ich noch sieben Zentimeter wachsen.«
»Daran werden wir arbeiten, wenn wir dort sind«, vertröstete mich Lee. »In Paris gibt es jede Menge Schokolade.«
Verträumt blickte ich aus dem Fenster. Die Enten waren fertig mit ihrer Zurschaustellung hemmungsloser Hingebung und schwammen jetzt in entgegengesetzte Richtungen. »Ach ja?«
»Und Éclairs.«
»Schick mir den Link. Ich werde darüber nachdenken.«
Damit legte ich auf. Inzwischen befanden sich die Enten an entgegengesetzten Enden des Burnham Pond. Noch mehr Vogelgezwitscher. Hier und da ein paar unoriginelle gelbe Farbakzente, denn die Osterglocken blühten.
Paris könnte genau der Tapetenwechsel sein, den ich brauchte. Doch bevor ich aufbrach, musste ich mich noch um ein paar Dinge kümmern.
Ich hatte zwei beste Freundinnen, und wir schrieben uns immer über eine gemeinsame Gruppe.
Maggie:
Hab Greg rausgeworfen. Kann immer noch nicht schreiben, fahre daher Sonntag nach Paris. Können wir was trinken gehen?
Ihre Antwort war kurz und bündig. Morgen. Brunch. Elf Uhr dreißig im The Office.
Dafür waren beste Freundinnen da.
Eine der ältesten Konstellationen in Liebesromanen ist die naive Studentin, die sich in ihren attraktiven, älteren Professor verknallt und von ihm alles lernt, von der Wahl des richtigen Weines bis zu atemberaubendem Sex, bei dem sie in höchstens drei Minuten zum Orgasmus kommt. Klischees werden allerdings meist nur deswegen zu Klischees, weil sie im echten Leben so oft vorkommen. Nehmen wir zum Beispiel Alan und mich. Ich war Studentin und wusste bereits, dass ich Schriftstellerin werden wollte, brauchte aber einen nervtötenden Mathekurs, um meinen Abschluss machen zu können. Also wartete ich bis zum letzten Moment, und dann versuchte ich im fortgeschrittenen Studentenalter zu lernen, was ich in meiner gesamten Schulzeit ignoriert hatte: Algebra.
Bei Algebra gab es immerhin Zahlen und Buchstaben. Weil ich Buchstaben liebte, dachte ich, Algebra würde mir leichter fallen als gewöhnliche Mathematik.
Ich irrte mich gewaltig.
Schon nach zwei Wochen musste ich einsehen, dass ich Algebra nie verstehen würde, und das hieß, ich saß ganz schön in der Patsche. Weil ich so lange damit gewartet hatte, den absolut unabdingbaren Pflichtkurs zu belegen, würde ich, wenn ich durchfiele, riskieren, meinen Abschluss nicht zu schaffen. Also musste ich bestehen, egal wie, und zum Glück hatte ich einen guten Gesamtdurchschnitt, der einiges ausgleichen könnte. Ich durfte bloß nicht durchrasseln.
Als ich meiner Mitbewohnerin von meinem Dilemma erzählte, sah sie mich mit hochgezogenen Augenbrauen an und murmelte: »Vielleicht solltest du rausfinden, mit wem du schlafen musst, um Algebra I zu bestehen.«
Wie sich herausstellte, musste ich mit meinem Professor Alan Goddard schlafen. Ein großer, gut aussehender Mann, der überhaupt nicht merkte, dass die meisten seiner Studentinnen nur zu gern mit ihm ins Bett gegangen wären, selbst wenn er nicht derjenige gewesen wäre, der über ihre Noten zu bestimmen hatte. Ich muss gestehen, dass ich absolut willig gewesen wäre, zu tun, was immer nötig war, um diesen Algebra-Alptraum hinter mich zu bringen. Bei unserem ersten Gespräch unter vier Augen, bei dem ich meine vollkommene Ahnungslosigkeit in Sachen Mathematik offenbarte und ihn um Rat, Nachhilfe und Fördermaßnahmen anflehte, lächelte er nur, redete mir gut zu und bot mir einen Kräutertee an. Ich nahm an. Zwei Stunden später lud er mich zum Essen ein. Auch dieses Angebot nahm ich an. Bald darauf fragte er, ob ich mit zu ihm nach Hause kommen wollte.
Und ich nahm an.
Ich bestand den Kurs. Nicht weil wir im nächsten Semester heirateten, sondern weil ich so in ihn verknallt war, dass ich einen Tutor bezahlte, der sich zweimal die Woche mit mir hinsetzte und mir half zu verstehen, was zur Hölle im Kurs abging.
Alan und ich führten eine kurze, leidenschaftliche, turbulente Achterbahn-Ehe, die nach drei Jahren, direkt nach Nicoles zweitem Geburtstag, endete. Er war ein fürsorglicher, warmherziger Mann und Vater, und Nicole hatte immer eine liebevolle Beziehung zu ihm. Irgendwann wurden Alan und ich sogar Freunde. Und warum auch nicht? Er war immer noch charmant und attraktiv, und obwohl ich mir nicht vorstellen konnte, je wieder mit ihm zusammenzuleben, blieb mir seine Gesellschaft immer angenehm. Bis zu Nicoles College-Abschluss vor drei Jahren waren wir in den Ferien zusammen in Urlaub gefahren und hatten all die üblichen Meilensteine im Leben unserer Tochter gemeinsam gefeiert. Seitdem hatte ich ihn nicht mehr gesehen, aber wir schickten uns an unserem Scheidungstag immer noch Postkarten.
Nach der Scheidung war Alan nach Pennsylvania gezogen und hatte eine Stelle als Dekan einer kleinen, aber sehr angesehenen Universität angenommen. Ich unterrichtete Englisch an der Highschool, schrieb nebenbei meine ersten Geschichten, aus denen irgendwann Liebesromane wurden, die erst unter verschiedenen Pseudonymen und schließlich auch unter meinem eigenen Namen veröffentlicht wurden.
Nicole fing schon mit drei Jahren an zu lesen und wuchs zu einer brillanten, allerdings extrem komplizierten jungen Frau heran. Zu Beginn ihres dritten Schuljahres an der Highschool schickte ich sie zu einer Psychologin, um herauszufinden, wie jemand so Schlaues so große Probleme im sozialen Miteinander haben konnte. Irgendwann fiel die Diagnose Asperger-Syndrom, und plötzlich ergab alles einen Sinn. Die von ihr gesetzten Grenzen, die niemand zu übertreten wagte, weil es unweigerlich zu Wutanfällen und Tränen führte, waren nicht einfach von einem launischen, rebellischen Teenager gezogen worden, sondern standen für überlebensnotwendige Pfade, auf denen sich unsere Tochter durch diese Welt bewegen konnte, die so völlig anders war als die Welt in ihrem Innern. Ich hörte auf, so zu tun, als wüsste ich, was das Beste für mein Kind war, und von da an wurde unsere Beziehung um einiges leichter und freundlicher, ja fast so etwas wie normal.
Zwar hatte ich Nicole nicht mehr gesehen, seit sie mich zu Weihnachten besucht hatte, doch wir telefonierten jeden Montag. Sie rief mich an, nie umgekehrt, aber wenn ich irgendetwas Dringendes zu besprechen hatte, schickte ich ihr eine Nachricht, und sie meldete sich, sobald sie konnte. Ihr Leben war von Zeitplänen und Routine geprägt, deshalb achtete ich darauf, sie nicht zu stören, wenn es nicht absolut notwendig war. Jedes andere erwachsene Kind, das im Ausland lebte, hätte sich vielleicht über einen Überraschungsbesuch gefreut.
Nicht meine Tochter.
Jetzt schrieb ich ihr eine Nachricht, wann sie Zeit zum Telefonieren habe, und wir verabredeten uns für den nächsten Morgen um halb sieben.
»Mom, hi. Haben wir nicht neulich erst telefoniert?«
»Hey, Nicole. Ja, ich weiß, aber ich habe eine Überraschung für dich.«
Ich erwartete, dass mir eine gewisse Aufregung entgegenschlagen würde, doch natürlich war nichts dergleichen der Fall.
»Was für eine Überraschung, Mom?«
»Ich komme nach Paris.«
Immer noch keine Aufregung, auch keine Freude. »Warum kommst du nach Paris?«
»Weil ich Probleme mit dem Buch habe, an dem ich gerade arbeite, und Lee meint, ich solle nach Paris fliegen, um mich inspirieren zu lassen. Ich weiß, es kommt ein bisschen plötzlich, aber mir gefällt die Idee. Ich war noch nie in Frankreich. Ich werde in seinem Apartment wohnen und arbeiten, aber da ich schon mal da bin … Hast du nicht bald Semesterferien? Wollen wir uns treffen?«
Komm schon, Freude, na los … »Eigentlich bin ich mit meinen Kursen schon fertig. Und mit den Prüfungen. Und ich hatte sowieso geplant, den Sommer in Paris zu verbringen.«
»Oh? Wie schön. Dann können wir viel Zeit zusammen verbringen.«
»Ich werde bei Dad wohnen«, entgegnete sie bedächtig.
Mir verschlug es fast die Sprache. Was hatte sie gerade gesagt? »Alan ist in Paris? Aber er hasst Reisen. Er hasst Fliegen. Und wenn ich mich recht erinnere, hat er, als du ihm gesagt hast, dass du nach Frankreich ziehst, wochenlang versucht, dich davon abzubringen.«
Am anderen Ende des Ozeans sagte sie zu irgendjemandem irgendetwas auf Französisch, und ich hörte geduldig zu, obwohl ich kein Wort verstand. Meine Tochter telefonierte nie nur. Sie machte grundsätzlich etwas nebenbei, war irgendwohin unterwegs, putzte, kochte, was auch immer.
»Na ja«, sagte sie, jetzt wieder zu mir und auf Englisch, »Heather hat das Ganze wohl arrangiert, und jetzt haben sie sich getrennt, aber da er schon alles bezahlt hat, kommt er allein. Er hat eine Wohnung mit zwei Schlafzimmern im Marais, und ich werde bei ihm wohnen. Und er wird Louis treffen.«
Wer um alles in der Welt war Heather? Wie hatte sie es geschafft, Alan zu einer Reise nach Frankreich zu überreden? Anscheinend hatten sie sich getrennt, aber wann genau? Und deshalb flog Alan nun allein nach Frankreich? Und lernte zudem noch Nicoles Freund kennen, den sie seit Längerem sorgsam nicht öfter als unbedingt nötig erwähnt hatte?
Ich redete einfach weiter, in der Hoffnung, irgendwann Antworten zu bekommen. »Ich habe nichts dagegen, Alan zu treffen, weißt du. Oder Louis kennenzulernen. Dann kann ich mit euch allen ein wenig Zeit verbringen. Und wie findest du die Idee?«
Es trat eine lange Pause ein. Entweder dachte Nicole sehr gründlich über meine Frage nach, oder sie war dabei, eine Kommode auszuräumen.
»Gut«, sagte sie schließlich. »Gib mir Bescheid, wenn du ankommst. Weißt du schon, wo genau du wohnen wirst?«
»Nein, keine Ahnung, aber ich schicke dir die Adresse. Am Montag kommen wir an.«
»Okay, Mom. Hab dich lieb.«
Sie legte auf, bevor ich Hab dich noch mehr lieb sagen konnte, aber das wusste sie ja bereits.
Obwohl ich ein paar Minuten zu früh zum Brunch kam, wartete Cheri Robinson schon auf mich, und Alison Wazinski war mir an der Tür buchstäblich auf den Fersen. Ohne ein Wort miteinander sprechen zu müssen, bestellten wir Bloody Marys, studierten schweigend die Speisekarte und gaben unsere Essensbestellungen auf. Dann herrschte Schweigen, und ich sah die beiden an.
»Was?«, fragte ich schließlich.
»Wir warten«, erklärte Alison.
Ich trank einen großen Schluck von meinem Drink. »Greg und ich haben uns …«
»Das wurde aber auch Zeit«, meinte Cheri. Sie hatte sich schon vor fünf Jahren von ihrem Mann scheiden lassen und baute ihr Leben langsam wieder auf – mit Erfolg. Sie war in meinem Alter, wie ein Hydrant gebaut, und ihre Haare waren zu Rastazöpfen geflochten, einige davon knallrosa. »Ich warte schon seit Monaten darauf, dass du diesen Mann endlich abservierst. Machen wir uns nichts vor, gefühlsmäßig bist du doch schon seit Weihnachten über alle Berge.«
»Cheri«, warf Alison tadelnd ein, »ich dachte, wir hätten uns darauf geeinigt …« Alison war seit über dreißig Jahren verheiratet, hatte vier Kinder, sechs Enkel und einen langen grauen Zopf. Ihr sommersprossiges Gesicht hatte nie einen Schminkpinsel von Nahem gesehen, und ich war mir ziemlich sicher, dass sie sich Original Earth Mother auf den Rücken hatte tätowieren lassen.
»Ich muss um zwei bei der Geburtstagsfeier meines Neffen sein«, verkündete Cheri mit einer ungeduldigen Geste. »Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Du hast ihn also rausgeworfen. Gut. Aber was hat es mit dieser Reise nach Paris auf sich?«
»Moment. Gefühlsmäßig über alle Berge? Wie kannst du das sagen?«, protestierte ich, obwohl ich zugeben musste, dass sie recht hatte.
Cheri zog die Augenbrauen hoch. »Wann hattet ihr beide das letzte Mal Sex?«
Verlegen sank ich auf meinem Stuhl zusammen. Das war ein gutes Argument. Greg und ich hatten schon seit Wochen bestenfalls einen flüchtigen Gutenachtkuss ausgetauscht. »Na ja …«
Alison machte ein leises, missbilligendes Geräusch. »Wir kennen dich lange genug, Maggie.« Das stimmte. Alisons Klassenzimmer war direkt neben meinem gewesen, als ich vor über zwanzig Jahren als Lehrerin angefangen hatte. »Wir haben so etwas schon öfter erlebt. Wir kennen die Anzeichen – und haben wir uns je geirrt?«
Cheri trank einen Schluck, leckte sich genüsslich die Lippen und biss dann in ihre Selleriestange. »Bei diesem komischen Kerl Jackson wussten wir auch, wie das ausgeht. Erinnerst du dich noch an den?«
Jackson. Er war definitiv ein Fehler gewesen. »Na gut, okay, bei ihm lagt ihr möglicherweise richtig, aber …«
»Und Thomas? Der Zahnarzt mit dem dämlichen Dauergrinsen? Wir haben dir schon nach drei Dates gesagt, dass es reine Zeitverschwendung ist, ihn zu treffen«, sagte Alison ziemlich selbstgefällig.
»Und als du dich von diesem Lektor getrennt hast? Dem kleinen mit dem Schnurrbart. Da lag ich nur zwei Wochen daneben«, fügte Cheri hinzu. »Und mit dem warst du sehr lange zusammen.«
»Drei Jahre«, murmelte ich.
»Und außerdem«, fuhr Alison fort, »war Greg nie gut genug für dich. Keiner von diesen Typen war es. Aber jetzt erzähl von Paris. Wirst du dich mit Nicole treffen?«
Ich gab den Versuch auf, jede meiner Beziehungen in den letzten zwanzig Jahren zu analysieren, und wechselte bereitwillig das Thema. »Ja, sie wird nach Paris kommen. Alan ist auch zu Besuch da. Und ich glaube, ich werde Louis treffen.«
»Alan? Wie schön. Alan mochte ich immer«, sagte Cheri. Früher hatte sie direkt neben mir gewohnt, ihr Sohn war in Nicoles Alter. Da sie bei allen Geburtstagsfeiern meiner Tochter gewesen war, hatte sie Alan schon bei mehreren festlichen Anlässen getroffen.
»Wo wirst du wohnen?«, fragte Alison, und ich erzählte ihnen von Lees Apartment in Paris.
Cheri stieß einen anerkennenden Pfiff aus. »Dann hast du eine kostenlose Unterkunft? Du Glückliche. Ich würde jedes Jahr nach Paris fahren, wenn ich es mir leisten könnte. Du wirst es lieben.«
»Ich verreise nur, um zu schreiben«, erwiderte ich, »also gelten die üblichen Regeln.«
Die üblichen Regeln legten fest, dass ich mich beim Schreiben komplett von sozialen Medien fernhielt. Keine Ablenkung durch Anrufe, Nachrichten oder alberne Katzenvideos. Darauf hatte ich mich schon vor Jahren mit meinen Freundinnen geeinigt.
Alison schüttelte den Kopf. »Oh, das kann ich nicht glauben. Immerhin reden wir hier von Paris.«
»Aber ich werde schreiben.«
»Es ist trotzdem was anderes«, erwiderte Cheri.
»Warum?«
»Weil du in Paris sein wirst, darum«, sagte Alison schlicht.
»Ich werde schreiben.«
»Aber du wirst wochenlang dort sein«, gab Cheri zu bedenken. »Ich verstehe ja, dass du dich von Facebook und Twitter fernhalten willst. Die sind üble Zeitfresser. Aber Instagram? Wirst du deine Fotos etwa nicht auf Instagram posten?«
»Ich werde keine Fotos machen«, erwiderte ich. »Jetzt hört mir mal genau zu: Ich werde mit Schreiben beschäftigt sein.«
Cheri verzog das Gesicht. »Na schön. Aber was ist mit uns? Von uns kannst du dich nicht komplett abschotten. Was, wenn es wichtige Neuigkeiten von Nicole gibt?«
»Oder Alan?«, konterte Alison. »Oder, du weißt schon … du könntest jemanden kennenlernen.«
»Ich bin nur dort, um zu schreiben«, beharrte ich. »Keine Ablenkungen.«
Als ich aufsah, taxierten mich die beiden mit bösen Blicken.
»Okay, okay«, lenkte ich ein. »Aber nur Nachrichten, und nur sonntags. Es sei denn, meine Wohnung brennt ab oder jemand muss ins Krankenhaus.«
»Wir stellst du dir das vor?«, fragte Cheri in tadelndem Ton. »Paris, schon vergessen?
»Na gut. An jedem Wochentag.«
»Morgens oder abends?«
Ich schüttelte den Kopf. »Jetzt verlangst du von mir, die Zeitdifferenz zu berechnen, aber das geht nicht mit leerem Magen. Ich schreibe euch, wenn ich Zeit habe, und ihr macht es genauso. Wenn wirklich etwas Aufregendes passieren sollte, können wir so …«
»Du fährst nach Paris«, warf Alison ein. »Natürlich wird etwas Aufregendes passieren!«
»Ich werde schreiben«, wiederholte ich frustriert und bedachte sie mit einem strengen Blick. »Keine Katzenvideos«, schärfte ich ihr ein, dann wandte ich mich an Cheri. »Und nichts Politisches.«
Sie gab sich empört. »Wie bitte?«
»Ich mein’s ernst. Es interessiert mich nicht, was im Kongress beschlossen wird oder wie viele Schildkröten operiert werden müssen, weil sie Plastikstrohhalme gefressen haben. Ich kann mir keine Ablenkungen leisten.« Ein Teller Huevos Rancheros wurde vor mir abgestellt, und ich seufzte wohlig.
Cheri schnaubte. »Oh, Süße. Wo wir gerade von Ablenkungen reden: Das Essen in Frankreich …«
Gierig machte ich mich über die mexikanischen Frühstückseier her. »Ernsthaft? Das sind Huevos Rancheros. Das Beste überhaupt. Wie könnte das Essen in Frankreich noch besser sein?«
Cheri verdrehte die Augen. »Wart’s nur ab.«
Kapitel 2
In dem ich in Paris ankomme und es gar nicht so schrecklich finde
Manche meiner Autorenfreundinnen können in weniger als drei Stunden einen Koffer mit einer Auswahl von Kleidungsstücken packen, die sich zu dreiundzwanzig verschiedenen Outfits inklusive Accessoires kombinieren lassen. Außerdem schaffen sie es, drei Paar Schuhe, eine leichte Jacke und einen schicken Regenhut unterzubringen. In ihrem Gepäck ist immer Platz für das Portemonnaie, den Schlüssel, Laptop, einen E-Reader und sehr wichtige, womöglich sogar streng geheime Dokumente sowie Schminkzeug, beeindruckenden Schmuck und einen Reiseföhn. Sie treffen genau im richtigen Moment am Flughafen ein, um sich an der kürzesten Schlange anzustellen, segeln durch den Security-Check und schlürfen vor dem Abflug noch ein Glas Sekt. An Bord stellen sie fest, dass sie ganz zufällig ein Upgrade in die erste Klasse bekommen haben, und genießen den ruhigen Flug an ihren Zielort, wo sie erholt, freudestrahlend und voller Tatendrang aussteigen.
Ich gehöre nicht zu diesen Autorinnen.
Wer einen Blick auf meine Reise-Pinterest-Pinnwand wirft, könnte den Eindruck bekommen, ich verstünde es perfekt, mich in jedem Land der Jahreszeit angemessen zu kleiden, würde fünfundzwanzig essenziell wichtige Sätze in fünfzehn Sprachen beherrschen und wüsste, wie man Reisekrankheit, Jetlag und charmante Schwindler vermeidet. Leider entspricht trotz all meiner Pins nichts davon der Wahrheit.