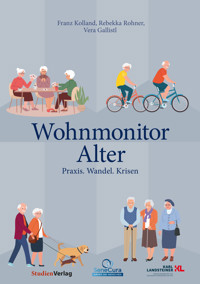
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: StudienVerlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In einer Zeit des demografischen Wandels und gesellschaftlicher Umbrüche beleuchtet dieses Buch das Thema "Wohnen im Alter" aus einem innovativen Blickwinkel. Es vereint aktuelle Forschungsergebnisse und Expertisen mit tiefgreifenden Einblicken in alternative Wohnformen, um ein umfassendes Bild der Herausforderungen und Chancen zu zeichnen, die das Altern in unserer Gesellschaft mit sich bringt. Gesellschaftliche Krisen, wie die Covid-19-Pandemie, der Pflegekräftemangel oder steigende Lebenserhaltungskosten, haben die Lebensbedingungen älterer Menschen beeinflusst. Hinsichtlich der Möglichkeiten und Grenzen sozialer Teilhabe zeigen sich neue Vulnerabilitäten und Resilienzen im Alter. Die Autor:innen untersuchen, wie betreutes Wohnen als Antwort auf den steigenden Bedarf an Versorgungssicherheit und Selbstbestimmung im Alter dient. Sie diskutieren, wie neue Wohnformen nicht nur individuelle Bedürfnisse erfüllen, sondern auch auf gesellschaftliche Krisen reagieren und dabei das soziale Gefüge der Nachbarschaft stärken. Dieses Buch bietet einen multidisziplinären Ansatz, um die Zukunft des Wohnens im Alter neu zu denken. Neben Ergebnissen aus Befragungen von Menschen über sechzig, die mit früheren Befragungen verglichen werden, bringt dieses Werk auch Analysen von Expert:innen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. Es ist eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich mit den Themen Alter, Wohnen und gesellschaftlicher Zusammenhalt befassen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 388
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Franz Kolland, Rebekka Rohner, Vera Gallistl
Wohnmonitor Alter
Inhalt
Vorwort
Teil I: Einführendes
Wohnen im Alter als soziale Praxis: Herausforderungen und Möglichkeiten (Franz Kolland & Sophie Kellerberger)
Krisen und ihre Bedeutung für das Wohnen im Alter (Vera Gallistl, Franz Kolland & Rebekka Rohner)
Teil II: Expertisen
Zur Psychologie des Wohnens im Alter (Antje Flade)
Wohnverbundenheit und Nachbarschaftskontakte im Alter – Erkenntnisse aus der Schweiz (Alexander Seifert)
Von „vollen“ und „leeren“ Nestern – Verbundene Wohnübergänge von Eltern (Karla Wazinski & Anna Wanka)
Zur Bedeutung von digitalen Alltagstechnologien für die Wohnumwelt älterer Menschen (Friedrich Wolf & Frank Oswald)
Potentiale und Herausforderungen von Ambient Assisted Living Technologien im Privathaushalt (Christine Pichler, Johannes Oberzaucher & Birgit Aigner-Walder)
Teil III: Wohnmonitor 2023
Zielsetzung und Methodisches Vorgehen (Franz Kolland, Rebekka Rohner & Vera Gallistl)
Wohnsituation älterer Menschen: Barrieren und Potentiale (Franz Kolland, Rebekka Rohner & Vera Gallistl)
Die Multidimensionalität des Wohnens im Alter (Franz Kolland, Rebekka Rohner & Vera Gallistl)
Umzugsbereitschaft und Wohnalternativen (Franz Kolland, Rebekka Rohner & Vera Gallistl)
Formelle und informelle Unterstützung im Privathaushalt (Karoline Bohrn)
(Krisenbedingte) Veränderungen der Wohnbedürfnisse und -vorstellungen seit 2018 (Franz Kolland, Rebekka Rohner & Vera Gallistl)
Exkurs: Das Betreute Wohnen aus Sicht der Bewohner:innen: Ein Österreich-Schweiz-Vergleich (Rebekka Rohner, Katrin Lehner & Franz Kolland)
Teil IV: Verdichtungen
Zielgruppen des Wohnens im Alter (Franz Kolland, Rebekka Rohner & Vera Gallistl)
Handreichungen für die Praxis (Franz Kolland, Rebekka Rohner & Vera Gallistl)
Bibliographie
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Anhang
Vorwort
Wohnen bedeutet für viele Menschen in der Moderne ungestört zu sein und die eigene Individualität leben zu können. Sich frei und ungestört entfalten zu können, hat zu einer Vielfalt an Wohnstilen in der eigenen Wohnung, im eigenen Haus geführt. Diese Entwicklung wird in den letzten Jahren durch die verschiedenen gesellschaftlichen Krisen überschattet. In den Vordergrund rücken in der öffentlichen Diskussion Themen wie leistbares Wohnen, Energieeffizienz oder Bodenversiegelung. Die Selbstverständlichkeit des Vorhandenseins von Räumlichkeiten, die auf selbstbestimmte Gestaltung des Wohnraums warten, ist für viele Menschen in die Ferne gerückt. Im Vordergrund steht nicht, wie das Wohnzimmer oder die Küche ein- und zugerichtet werden, sondern wie Photovoltaikanlagen oder Wärmepumpen installiert werden oder wie eine zu starke Versiegelung von Böden im Zuge der Eigenheimerrichtung vermieden werden kann. Im Vordergrund steht aber auch ganz schlicht die Leistbarkeit einer entsprechenden Wohnung, von eigenen vier Wänden. Die Ästhetisierung des Wohnens, die etwa in der Zeitschrift „Schöner Wohnen“, die seit dem Jänner 1960 erscheint, ihren Niederschlag gefunden hat, tritt in den Hintergrund. Zunächst braucht es überhaupt eine Wohnung.
Der beschriebene gesellschaftliche Trend betrifft vor allem Menschen, die auf dem Weg zu ihrer ersten eigenen Wohnung sind oder in Wohnungen leben, die durch stark gestiegene Mieten oder Betriebskosten in materielle Schwierigkeiten geraten. Die in diesem Buch angesprochene Zielgruppe ist vor allem von letzteren Veränderungen betroffen. Alte Menschen sind auch dann von den Veränderungen auf den Wohnungsmärkten betroffen, wenn sie umziehen wollen, wenn sie von einer größeren Wohnung in eine kleinere Wohnung wechseln wollen, wenn sie an Orte ziehen wollen, wo sie einen schnelleren Zugang zu gesundheitlichen Dienstleistungen haben.
Neben den beschriebenen gesellschaftlichen Veränderungen ist das Wohnen im Alter von einem anderen Trend beeinflusst, nämlich den Veränderungen des Alterns und der sozialen Position des Alters. Dieser Trend zeigt Veränderungen in der Lebensführung. Das Alter wird immer länger und großteils gesünder erlebt. Wir leben in einem Zeitalter der Langlebigkeit. Dabei ist es notwendig, sich von konventionellen Betrachtungen, die den Wandel als Bedrohung ansehen, zu verabschieden und zu einer ganzheitlichen Betrachtung des Veränderungsprozesses zu kommen. Die Wohnbedürfnisse und Wohnwünsche von Menschen im Alter werden zunehmend bunter. Dies hängt damit zusammen, dass ältere Menschen unterschiedliche Lebens- und Wohnerfahrungen hinter sich haben und auch Prozesse des Alterns individuell verlaufen. Deshalb gibt es im Alter keine Wohnform, die für alle gleichermaßen ideal ist.
Um Veränderungsprozesse des Wohnens im Alter erfassen zu können, ist es notwendig, die Wohnbedürfnisse und Wohnerwartungen im Zeitvergleich zu erfassen. Das geschieht über den Wohnmonitor Alter, der 2023 zum zweiten Mal die Wohnsituation älterer Menschen in Österreich auf Basis einer empirischen Forschung ausleuchtete. Wie 2018 werden auch in dem hier vorgelegten Buch Expertinnen und Experten zu Wort kommen, die das Wohnen älterer Menschen aus unterschiedlichen Blickwinkeln beschreiben und analysieren.
Bedanken möchte sich das Autor:innenteam bei der SeneCura-Gruppe, die dieses Projekt seit Beginn nicht nur finanziell unterstützt, sondern auch an der Veröffentlichung der Ergebnisse interessiert ist und damit die Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse ermöglicht. Ebenfalls möchte sich das Team bei Sophie Buschenreithner für ihre Unterstützung bei der Manuskripterstellung bedanken.
Krems, Frühjahr 2024
Franz Kolland, Rebekka Rohner, Vera Gallistl
Teil I: Einführendes
Wohnen im Alter als soziale Praxis: Herausforderungen und Möglichkeiten
Franz Kolland1 & Sophie Kellerberger1
1Kompetenzzentrum Gerontologie und Gesundheitsforschung, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften, Krems
Wohnen im Alter gewinnt in unserer Gesellschaft immer mehr an Bedeutung, da die Bevölkerung insgesamt älter wird und mehr Menschen aufgrund des demografischen Wandels lange leben. Es bringt verschiedene Herausforderungen und Möglichkeiten mit sich, da die Bedürfnisse und Präferenzen älterer Menschen vielfältig sind. In diesem Beitrag geht es um einen allgemeinen gerontologischen Blick auf die Wohnbedürfnisse, unterschiedliche Wohnformen und die Dynamik des Alterns. Bestimmt werden sollen am Beginn dieses Beitrags jene Begriffe, die als zentral im Titel herausgestellt sind, nämlich Alter, Wohnen und soziale Praxis.
Alter als mehrdimensionales Geschehen
Sich mit dem Alter in Hinsicht auf das Wohnen zu befassen, verlangt die Berücksichtigung mehrerer Ebenen (Höpflinger & Teti, 2021), nämlich das chronologische Alter, die Lebensdauer, den Lebenszyklus, die soziale Selektivität über den Lebenslauf und die Berücksichtigung der je vorhandenen Altersbilder.
Das chronologische Alter bestimmt Menschen in ihrer Zugehörigkeit zu einem spezifischen Geburtsjahrgang. Das ist deshalb bedeutsam, weil nicht jeder Geburtsjahrgang ähnliche gesellschaftliche Rahmenbedingungen vorfindet, um die eigenen Lebens- und Wohnchancen adäquat nutzen zu können. Geburtsjahrgänge, die unter günstigen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen leben, können ihre Wohnbedürfnisse stärker realisieren und in höherem Maß Wohneigentum bilden. Wohneigentum erhöht die Chance, ein gesichertes Leben im Alter führen zu können. Die Größe der Geburtsjahrgänge hat einen Einfluss auf die Wohnversorgung im hohen Alter. Das Altern der starken Baby-Boom-Kohorten führt zu neuen Angeboten im Pflegewohnen.
Die Länge der Lebensdauer hat Einfluss auf die sozialen und psychischen Erfahrungen, auf Lernprozesse und Bewältigungsstrategien, die zu Unterschieden im Wohnen zwischen und innerhalb von Altersgruppen beitragen können. Die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstandene lange Lebensdauer hat für die Mehrheit der Bevölkerung dazu geführt, dass sich empirisch eine lange Wohndauer in der gleichen Wohnung bzw. am gleichen Wohnort herausgebildet hat. Diese lange Wohndauer steht in einem Zusammenhang mit hoher Wohnzufriedenheit. Diese kann dann zu einer Problemlage führen, wenn die Personen, die diese lange Wohndauer aufweisen, die Wohnung nicht an die in ihrem Lebenslauf sich verändernden Bedürfnisse anpassen. Das geschieht besonders dann, wenn aufgrund steigender Kosten Schwierigkeiten gegeben sind, die Wohnung in einem guten Zustand zu erhalten.
Zu den wesentlichen lebenszyklischen Übergängen in der zweiten Lebenshälfte gehören Pensionierung, Verwitwung und Gebrechlichkeit. Verknüpft sind diese Übergänge nicht nur mit potentiellen Veränderungen in der Wohnung, sondern auch mit einer Neuausrichtung des Beziehungsgefüges zur Wohnumwelt. Werden an diesen lebenszyklischen Übergängen keine entsprechenden Veränderungen in der Wohnung vorgenommen, dann ist eine erhöhte Anpassungsleistung von der Seite der in der Wohnung lebenden Personen notwendig. Das gelingt dann besser, wenn positive Erfahrungen zur Bewältigung von disruptiven biografischen Ereignissen vorliegen. Wohnen im Lebenslauf ist jedenfalls ein dynamischer Prozess, der nicht nur mit Veränderungen in der Umwelt zu tun hat, sondern auch mit Veränderungen der Stellung im Lebenszyklus.
Die Wahrscheinlichkeit ein hohes Alter zu erreichen ist sozial selektiv. Wohlhabende Menschen und Frauen leben länger. Dabei zeigt die neuere Forschung, dass sich dieser Effekt im höchsten Lebensalter abschwächt. Die soziale Selektivität trägt jedenfalls dazu bei, dass die Menschen im Alter eine je unterschiedliche soziale Struktur aufweisen. Nach außen hin besonders auffällig ist die geschlechtsspezifisch unterschiedliche Mortalität, die zu einer Verschiebung der Geschlechterproportionen in Richtung eines zunehmenden Frauenanteils führt.
Eng in einem Zusammenhang mit Wohnwünschen stehen die vorhandenen Altersbilder (Spangenberg et al., 2013). Der Wunsch nach einem selbständigen und selbstbestimmten Leben und Wohnen im Alter ist Ausdruck eines positiven Altersbildes. Diese Sichtweise formt auch die Wohnpräferenzen. Positive Altersbilder, die Kompetenz und Eigenständigkeit im Alter beinhalten, finden sich in Wohnwünschen wie Verbleib im eigenen Haushalt oder selbst gewählter Wohngemeinschaft wieder. Negative Altersbilder zeigen sich im Zusammenhang mit einer defizitären Sichtweise in Bezug auf körperliche und geistige Gesundheit. Wenn auch nach wie vor nicht ganz klar ist, wie stark negative Altersbilder als eigenständige Variable kausal den Alternsprozess ungünstig beeinflussen, so zeigen sich Einflüsse auf die Wohnpräferenzen dergestalt, dass unterstützende Wohnformen (Betreutes Wohnen, Pflegeheimwohnen) bevorzugt werden. Dieser Zusammenhang gilt besonders für die Gruppe hochaltriger Menschen.
Wohnen als multifaktorieller Lebenszusammenhang
Das Wohnen wird von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst, darunter demografische Veränderungen, wirtschaftliche Gegebenheiten, Umweltüberlegungen und soziale Lebensbedingungen. Konzeptionell werden diese gesellschaftlichen Faktoren in ihrer Wirkung auf das Wohnen in sehr unterschiedlicher Weise gefasst. Sylvia Beck (2021, S. 42) arbeitet in ihrer Studie heraus, dass die Diskussion um Veränderungen des Wohnens weitgehend aus drei Blickrichtungen erfolgt, nämlich einer strukturdeterministischen Perspektive, einer Handlungsperspektive und einer physisch-räumlichen Perspektive.
Die strukturdeterministische Perspektive sieht Wohnwandel in gesellschaftlichen Mechanismen, d. h. veränderten Arbeitswelten, dem demografischen Wandel und dgl. begründet. Menschen können aus dieser Perspektive nicht umhin, so zu wohnen, wie dieser Wandel sie bestimmt. „Der Wandel der Wohnung und des architektonischen Gehäuses verweisen auf gesellschaftliche Veränderungen, auf den Wandel von Ehe und Familie, von gesellschaftlicher Arbeitsteilung und Herrschaftsorganisation, von Geschlechterverhältnis und Charakterstrukturen“ (Häußermann & Siebel, 1996, S. 12). Am deutlichsten ausgedrückt ist die strukturde-terministische Sichtweise über den Einfluss der Wohnbedingungen auf die Lebenschancen. Ungünstige Wohnbedingungen, wie z. B. Lärm, Schmutz, Nässe in der Wohnung, beengter Wohnraum werden als Ursache für Armut und soziale Benachteiligung gesehen. Die im Lauf des 20. Jahrhunderts sichtbare Verbesserung der Wohnsituation für viele Menschen hat diese strukturdeterministische Perspektive abgedrängt. Sie findet sich vorwiegend im Zusammenhang mit der Beschreibung von Armut.
Eine starke Repräsentation findet diese Perspektive in der wegweisenden Schrift von Hartmut Häußermann und Walter Siebel zum modernen Wohnen. Sie beschreiben diesen Idealtypus „Modernes Wohnen“ vor 30 Jahren über vier Entstehungslinien (Häußermann & Siebel, 1996, S. 24ff.):
Erstens ist die Trennung von Wohnen und Arbeiten konstitutiv für die Herausbildung modernen Wohnens. Wohnen wurde zum „Ort der Nicht-Arbeit“ (Häußermann & Siebel, 1996, S. 24). Damit einher gingen weitere Prozesse der Auslagerung, indem Lebenssituationen wie Geburt, Tod, Krankheit, auch Feierlichkeiten und Zusammenkünfte, Betreuung und Bildung von Kindern aus den eigenen Wohn-/Lebensräumen ausgelagert und organisiert wurden.
Zweitens kommt es zu einer „Ausgrenzung“ von Personen. Diese Ausgrenzung hat mit der Auslagerung von Arbeit an spezifisch dafür vorgesehene Orte (der Industrie, des Handwerks etc.) und auch der Abwanderung von verwandten und nichtverwandten Haushaltsmitgliedern zu tun.
Drittens zeigt sich ein Auseinandertreten von Öffentlichkeit und Privatheit. Durch die räumliche Ein- bzw. Ausgrenzung von Personen und Funktionen entstand „Wohnen als Ort der Intimität“. Das Private zeigt sich räumlich als Wohnung, rechtlich als privater Verfügungsraum, der sehr stark nach außen geschützt und abgegrenzt ist, und sozial-psychologisch als intime Sphäre, die durch die Wohnungstür abgeschlossen wird. Die Wohnung selbst wurde differenziert, und zwar über spezifisch angeordnete Räume. Dazu gehören das (repräsentative) Wohnzimmer, die Küche, das Schlafzimmer und nachrangig ausgestaltete Räume für Haushaltsarbeiten, Zimmer für die Kinder.
Viertens zeigt sich modernes Wohnen über die Entstehung des Wohnungsmarktes. Mit dem fortschreitenden gesellschaftlichen und industriellen Wandel, der Urbanisierung und den Entwicklungen des Wohnbaus entstand die „Wohnung als Ware“, die man durch Kauf oder Miete erwirbt. Entstanden ist damit ein neuer Mechanismus der Wohnungsversorgung, welcher das Wohnen bis heute prägt. Wohnen unterliegt den Mechanismen des Marktes und ist Statussymbol.
Diese vor dreißig Jahren formulierten Entwicklungslinien bestehen größtenteils fort, wenngleich die gesellschaftlichen Veränderungen in den letzten Jahren zu Modifikationen und neuen Wohnbedingungen geführt haben. Zu diesen Veränderungen gehören die Re-Privatisierung von Erwerbsarbeit im Zuge der Corona-Pandemie, die verstärkte Singularisierung als Folge des Anstiegs der Lebenserwartung und die Neuorganisation des Energieverbrauchs als Reaktion auf gestiegene Energiepreise.
Gegenüber der strukturdeterministischen Perspektive wird aus handlungstheoretischer Perspektive stärker auf subjektive Motivationen, Bedarfslagen, veränderte Lebensvorstellungen und Werthaltungen der Individuen abgestellt. Wohnen wird als intentionales und zielgerichtetes Tun verstanden. Wohnende können entsprechend dieser Konzeption ihre Wohnweise mehr oder weniger frei wählen und gestalten. Diese Argumentationslinie wird vor allem im Kontext neuer Wohnformen verfolgt. Dementsprechend werden Wohngemeinschaften, Mehrgenerationenwohnen, integratives Wohnen mit bewussten Lebensvorstellungen verknüpft. Der handlungsorientierte Ansatz greift dabei auf das Lebenslagenkonzept zurück, indem Wohnen verstanden wird als gestalterisches Handeln im Rahmen von Handlungsspielräumen, die das Individuum auch unter Bedingungen sozialer Festgelegtheiten und sozial ungleicher Zugänge zu Ressourcen hat.
Eine dritte Blickrichtung zur Erklärung des Wohnens und des Wohnwandels zeigt sich nach Sylvia Beck (2021, S. 42) über eine physisch-räumliche Perspektive. Empirisch wird dieser Ansatz in den meisten sozialstatistischen Erhebungen abgebildet über Wohnungsgrößen, Gebäudetypen, Ausstattung und Wohnumfeld. Aus dieser Perspektive wird Räumen bzw. Bauund Planungsweisen die „Fähigkeit“ zugesprochen, die Wohnweisen zu formen. Beispielhaft lässt sich das an wohnungspolitischen Maßnahmen zur sozialen Durchmischung der Wohnbevölkerung zeigen, an Zonierungen, ob das nun touristifizierte Orte sind oder Orte am Rande von Städten, die für den Konsum „reserviert“ sind oder Orte, die das private Wohnen über stark verkehrsberuhigte Flächen und Geschwindigkeitsbegrenzungen in den Vordergrund stellen. Letztlich ist die physisch-räumliche Perspektive von der Vorstellung geprägt, mittels räumlicher Gestaltungsweisen soziale Effekte zu erzeugen.
Soziale Praktiken des Wohnens
Die bisher angeführten Argumentationslinien bzw. Sichtweisen zur Beschreibung und Erklärung des Wohnwandels können durch eine Perspektive ergänzt bzw. modifiziert werden, die auf praxistheoretischen Überlegungen beruht. Als zentraler Gedanke soll hier eingeführt werden, Wohnen als soziale Praxis zu verstehen. Diese Perspektive sehen wir im Schnittpunkt der vier Argumentationslinien, die sich auf Strukturen, physische Räume, Handeln und nachbarschaftliche Wohnumwelt beziehen.
Die Vorstellung von sozialer Praxis schließt zielgerichtetes Handeln ein, geht jedoch über dieses hinaus, indem auch Unbewusstes berücksichtigt wird, welches in sozialen Praktiken gegeben ist und nicht immer aus individuellen oder auch kollektiven Entscheidungen rekonstruierbar ist. Wohnen ist mehr als das, was man in der Wohnung tut. Andreas Reckwitz (2003) beschreibt das Spannungsfeld von Routine und Unberechenbarkeit so: „In der Praxistheorie erscheint die soziale Welt der Praktiken im Spannungsfeld zweier grundsätzlicher Strukturmerkmale: der Routinisiertheit einerseits, der Unberechenbarkeit interpretativer Unbestimmtheiten andererseits. Anders formuliert, bewegt sich die Praxis zwischen einer relativen ‚Geschlossenheit‘ der Wiederholung und einer relativen ‚Offenheit‘ für Misslingen, Neuinterpretation und Konflikthaftigkeit des alltäglichen Vollzugs“ (Reckwitz, 2003, S. 294).
Im praxistheoretischen Ansatz werden strukturdeterministische Aspekte berücksichtigt, diese aber stärker über Alltagspraktiken zu rekonstruieren versucht. Für Jürgen Hasse (2012) lassen sich die sozialen Praktiken des Wohnens – phänomenologisch – als Praktiken beschreiben, wie Menschen ihr Wohnen arrangieren, sich in ihrem Wohnen arrangieren, wie sie sich Räume erschließen, aber auch, wie sie zugewiesene Räume im Netz gesellschaftlicher Institutionen bewohnen und auf welche Weise kulturindustrielle Mechanismen die Suche nach Orientierungen erwünschten Wohnraums lenken – und am Boden des individuell Machbaren halten“ (Hasse, 2012, S. 489).
Die physisch-räumliche Umwelt wird schließlich nicht nur als Bedingung gesehen, sondern als eigener Akteur im Geschehen sozialer Wohnpraxis. Um Wohnungsentwicklungen zu verstehen, reicht es nicht aus, Strukturen in ihrer Wirkung zu untersuchen oder intentionales Handeln über biografische Interviews zu erfassen. Wohnen kann vielmehr als Wechselwirkungszusammenhang (siehe Georg Simmel 1890) verstanden werden, der sich in Alltagspraktiken manifestiert, die sich auf einer Raum-Zeit-Achse in einer fortwährenden Dynamik zeigen. Von daher könnte das Wohnen auch als eine sich transformierende soziale Praxis (Dell, 2014) bezeichnet werden.
Erklärbar ist die Dynamik in den sozialen Praktiken des Wohnens mit einem Grundsachverhalt, nämlich Mensch sein, wie das Martin Heidegger (1954) in seiner Schrift zum Wohnen ausgedrückt hat: „Mensch sein, heißt: als Sterblicher auf der Erde sein, heißt: wohnen“ (S. 147). Ähnlich formulieren das François Höpflinger und Andrea Teti (2021): „Das Wohnen ist daher ein Existenzbedürfnis, das eine sehr hohe kulturelle und gesellschaftliche Variabilität zeigt“ (S. 479).
Wohnen als sozio-technische Praxis – Eine Erweiterung
Die folgenden Ausführungen beruhen auf Arbeiten von Nadine Marquard (2021). Sie bezeichnet Wohnen als komplexe sozio-technische Praxis. Moderne Wohnräume sind hoch technisiert und infrastrukturell vernetzt. Dennoch stehen, so Nadine Marquard, die technischen Dimensionen des Wohnens meist nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit der sozial- und kulturwissenschaftlichen Wohnforschung. Woher rührt diese Leerstelle? Ein Grund mag die Selbstverständlichkeit sein, mit der technische Netzwerke und Artefakte den Raum des Wohnens durchqueren und bestimmen. Die Wohnung gilt nicht unbedingt als Pionierort technologischer Innovationen, sie ist vor allem ein Schauplatz der Veralltäglichung von Technik. Die soziotechnischen Interaktionen des Wohnens erscheinen banal und selbst neue Geräte oft schon nach kurzer Zeit nicht mehr sonderlich bemerkenswert. Ob es sich um Küchengeräte wie den Thermomix handelt oder Staubsauger unterschiedlicher technologischer Entwicklung, die Geräte in Verwendung lassen jene, die gerade aussortiert werden, als „alt“ aussehen. Gerade aufgrund ihrer Allgegenwärtigkeit ist die Technik paradoxerweise ein eher unsichtbarer Bestandteil der Lebenswelt. Bemerkbar machen sich die vielfältigen technischen Installationen des Wohnalltags nur dann, wenn einmal etwas nicht funktioniert (der Saugroboter sich an Teppichenden hängen bleibt, die Alarmanlage die eigenen Wohnungsinhaber aussperrt usf.).
Im Folgenden werden drei Forschungsdebatten beleuchtet, die den sozio-technischen Charakter des Wohnens beschreiben und dabei als in der Zeit angeordnet verstanden werden können.
Die sozial- und kulturwissenschaftliche „Wohn-Technik-Forschung“ trat in den 1970er-Jahren mit einer Reihe feministischer Studien in den Vordergrund. Diese Studien richteten ihr Augenmerk auf die gesellschaftlichen Voraussetzungen und widersprüchlichen sozialen Effekte der Haushaltstechnisierung im Zuge von Elektrifizierung und Maschinisierung. Ziel dieser feministischen Technikstudien war es, den modernen Haushalt als einen zentralen Schauplatz technologischen Wandels im 20. Jahrhundert zu beschreiben. Der Schwerpunkt der Analyse lag auf der Frage nach der Wirkung moderner Haushaltsgeräte für die Geschlechterverhältnisse.
Zeitbudgetanalysen zeigen, dass die Zeitersparnisse, die durch die Nutzung moderner Techniken in der Haushaltsführung entstanden sind, durch neue Aufgaben und steigende Ansprüche wieder nivelliert wurden (Marquard, 2021, S. 145). Beispiel Kochen: Die Haushilfe Thermomix hat eine Vielfalt von Kochfunktionen. Um diese ausschöpfen zu können, braucht es ein erweitertes Wissen, welches auch die Technologie als integralen Bestandteil des Kochens einbezieht. Dazu kommt, dass diese Technologie sehr deutlich auf ein schnelles und singuläres Handeln abzielt.
Ab Ende der 1980er-Jahre entstand in den Medienwissenschaften eine Auseinandersetzung mit Technologien im Raum des Wohnens, wobei der Fokus nun auf Unterhaltungs-, Informations- und Kommunikationstechnologien lag. Durch Medientechnologien wird die Wohnung zu einem Interface zwischen öffentlicher und privater Sphäre. Die Wohnung wird weiter nach außen geöffnet. War sie bis dahin vorwiegend über das Radio mit der Außenwelt verbunden, wird das Fernsehen mit einem ständig erweiterten Programm zu einer Plattform über 24 Stunden. Ähnlich wie die Haushaltstechnik verlieren auch Medientechnologien durch ihre alltägliche Nutzung ihren technischen Charakter und werden zu einem selbstverständlichen Teil des Alltags.
Ab den 2000er-Jahren beschäftigt sich die Wohnforschung verstärkt mit der Digitalisierung des Wohnens und geht der Frage nach, wie Wohnräume durch smarte Technologien verändert werden. Es geht um intelligente Assistenz in der Haushalts- und Lebensführung. Telemedizin und Telecare werden unter Bedingungen von zunehmender Personalknappheit im Gesundheitswesen Bestandteile der gesundheitlichen Versorgung zu Hause. Indem Assistenzsysteme externen Diensten und Unternehmen den Blick in das Innere des Wohnens gewähren, kommt es zu einer kritischen Diskussion über die Grenze zwischen öffentlichem und privatem Raum. Einerseits hat diese Anbindung an die Außenwelt über soziale Medien oder Reparatur- und Lieferdienste während der Corona-Pandemie soziale Inklusion ermöglicht, andererseits wurde das Private eingeschränkt.
Wohnen und Vergemeinschaftung im Alter: Zwischen Barrierefreiheit, Bindung, Aktivität und sozialer Einbindung
Die Gestaltung des Wohnens im Alter ist eine komplexe Aufgabe, die eine ganzheitliche Betrachtung erfordert. Sie sollte die Bedürfnisse und Wünsche älterer Menschen respektieren und gleichzeitig innovative Ansätze für eine moderne, altersgerechte Wohnkultur integrieren. Eine erfolgreiche Wohnsituation im Alter sollte nicht nur den physischen, sondern auch den sozialen, psychologischen und kulturellen Aspekten Rechnung tragen, um eine hohe Lebensqualität für ältere Menschen zu gewährleisten. Gleichzeitig ist die psychologische Komponente des Wohnens im Alter von Bedeutung. Die emotionale Bindung an den Wohnort kann das Wohlbefinden älterer Menschen erheblich beeinflussen.
Hohe Lebensqualität wird erreicht, wenn eine Reihe von basalen Bedingungen erfüllt sind. Dazu gehört die Barrierefreiheit. Alte Menschen sollten in der Lage sein, sich sicher und bequem in ihrer Wohnung zu bewegen. Das bedeutet, dass architektonische Barrieren minimiert werden sollten, um Stürze zu verhindern. Dazu gehören beispielsweise breite Türen, ebenerdige Duschen und rutschfeste Böden. Eine zweite Bedingung ist soziale Teilhabe. Ältere Menschen brauchen einen Zugang zu sozialen Aktivitäten und Kommunikation, die auch mit anderen Personen in der eigenen Wohnung stattfinden können. Eine dritte Bedingung ist die Gesundheitsversorgung. Dabei geht es weniger um die Wohnung selbst, sondern um das Wohnumfeld, um die Nähe zu medizinischer Versorgung, Apotheken und anderen Gesundheitseinrichtungen. Als vierte Bedingung sind finanzielle Aspekte anzuführen. Hier zeigt sich aufgrund der Krisenerfahrungen der letzten Jahre, dass steigende Kosten für die Heizung oder den Strom zu erheblichen Herausforderungen führen können. Schließlich soll noch die technische Ausstattung genannt werden. Dabei geht es nicht nur um Notrufsysteme und gesundheitsbezogene Technologien, sondern um Technologien, die ein aktives Leben ermöglichen.
Nachfolgend sollen vier Aspekte des Wohnens im Alter näher ausgeführt werden, und zwar Ressourcen, die das Wohnen bestimmen (Gesundheit, Einkommen), der Wohnort und die Verbundenheit mit der eigenen Wohnung (Place Attachment, Ageing in Place), die soziale Seite des Wohnens (gemeinschaftlich/privat) und die Handlungsspielräume, die im Alter in der Wohnung/im Wohnumfeld möglich sind (Stichwort: Aktives Alter, Digitalisierung).
Abbildung 1: Schaubild – Wohnen im Alter (Eigene Darstellung)
Wohnen als Aktionsraum im Alter – Nutzung von Handlungsspielräumen
Wohnen im Alter wird sowohl in der Forschung als auch in der öffentlichen Diskussion sehr häufig mit dem Augenmerk auf Barrierefreiheit thematisiert. Das überrascht an sich nicht, weil die nachberufliche Lebensphase nicht in ihrer Vielgestaltigkeit gesehen wird, sondern primär in ihrer Pflege- und Schutzbedürftigkeit. Der Blick richtet sich auf das Pflegewohnen und die dafür notwendigen Anpassungen der Infrastruktur im privaten Wohnen oder auf institutionelle Wohnformen wie das Pflegeheim. Mit dem Blick auf die Pflege- und Hilfsbedürftigkeit geraten jedenfalls Aktivitäten und Handlungsspielräume älterer Menschen in den Hintergrund. Das Brennglas Corona-Pandemie hat sehr deutlich gemacht, wie rasch alte Menschen als vulnerabel und schutzwürdig eingestuft werden und damit ihre Handlungsspielräume eingeengt werden. Unsere Forschungen zum Wohnverhalten und zu den Wohnbedürfnissen zeigen ein ganz anderes Bild (Kolland et al., 2018). Wohnen in der nachberuflichen Lebensphase ist – unabhängig von der gesundheitlichen Situation – mit dem Bedürfnis verknüpft, mit Menschen zusammenzukommen, selbstbestimmt aktiv zu sein und die unmittelbare und mittelbare Wohnumwelt zu gestalten. Realiter bedeutet diese Erwartungsstruktur, dass Wohnanpassungen im späten Leben, die sich nur mit der physischen Umwelt befassen, unzureichend sind. Das gilt selbst unter Bedingungen einer dementiellen Erkrankung, wie eine rezente Studie aus Großbritannien zeigt (Newton et al., 2023). Diese zeigt, dass Änderungen der Wohnsituation fast ausschließlich die Barrierefreiheit betrafen (Handläufe, Stufenentfernung), aber kaum Aspekte wie Kommunikation und Stimulation (digitale Verbesserungen, farbliche Änderungen) abdeckten.
Wohnqualität ist mit Aspekten subjektiver Bedeutsamkeit verknüpft. Zu den wichtigsten subjektiven Elementen zählen die Kontinuität des Wohnens, welche in der Spätlebensphase einen besonders hohen Stellenwert hat, Identität, Sicherheitsbedürfnis und Selbstständigkeit. Alle diese Qualitäten werden – so die handlungstheoretische Perspektive – durch aktive und zielgerichtete „Selbstentäußerung“ entwickelt, stabilisiert und verändert. In gewisser Weise versucht damit das Individuum, sich gegen Entfremdungsprozesse im öffentlichen Raum zu wehren. Die unmittelbare Lebenswelt wird einer ökonomistischen Kolonialisierung zu entziehen versucht.
Als soziale Gruppe, die diese Handlungsspielräume im Alter deutlich nutzt, gelten die durch die 1968er Jahre geprägten Kohorten, die stark vereinfachend oft im Begriff der 68er-Generation zusammengefasst werden. Sie gelten als sozial bewegt, haben vor dem Hintergrund einer günstigen Ressourcenlage in Hinsicht auf Bildung und Einkommen einen klaren Gestaltungswillen im Alter. Heinz Bude (2024) schreibt über die Babyboomer: „Sie wollen keine Wahrheit verwalten, sondern Wirkungen ausprobieren. Sagen wir also als Formel für die Zukunft: Wirkungswille ohne Letztbegründung“ (S. 134). Stärker auf das Wohnen bezogen formulieren François Höpflinger und Andrea Teti (2021): „Aufgrund der Reduktion des Aktivitätsradius im höheren Lebensalter werden Wohnung und Wohnumfeld zentrale Dimensionen der Lebenslage und Lebensqualität Älterer. Neue Kohorten Älterer weisen allerdings andere Wohn- und Wohnmobilitätsvorstellungen auf als frühere Generationen. Alterswohnformen unterliegen sozialen Veränderungen, was die Gültigkeit früher durchgeführter Forschungsstudien in Frage stellt“ (S. 477).
Werden die Bedürfnisse älterer Menschen in den Mittelpunkt gestellt, dann kommt deutlich zum Vorschein, dass die eigene Wohnung als Handlungsspielraum gesehen wird. Und das nicht nur über die Aktivitäten, die in der Wohnung ausgeübt werden, sondern allein über den Besitz und die Führung einer eigenen Wohnung. Eine eigene Wohnung zu führen bedeutet jedenfalls, sich mit der Verwaltung, Instandhaltung und Ausgestaltung der Wohnung zu befassen.
David B. Fässler (2022) schreibt zum Leben und Wohnen im Alter in der Schweiz: Das lange Leben in den eigenen vier Wänden weist eine Reihe von Vorteilen auf. Für älter werdende Menschen bedeutet die eigene Wohnung das Zentrum des Lebens und vereinfacht die Orientierung im Alltag. Neben funktionalen Aktivitäten wie Essen, Wohnen und Schlafen wirkt die Wohnung durch persönliche und individuelle Gestaltung identitätsstiftend. Gleichzeitig ist die eigene Wohnung Rückzugsort und ermöglicht selbstbestimmte Regulierung sozialer Kontakte. Von zentraler Bedeutung ist die Betrachtung der Wohnung im Kontext des Wohnumfeldes. Meist bestehen hier Alltagsrituale, die mit dem Standort der Wohnung im Zusammenhang stehen. Das reicht vom Einkauf im Supermarkt bis zu Kaffeehausbesuchen, kleinen Spaziergängen und Besuchen bei Nachbarn.
Bei Fragen zu selbstbestimmtem Handeln im Alter wird meist das Alltägliche im Wohnen übersehen und taucht erst auf, wenn die eigene Wohnung nicht mehr vorhanden ist und einem Leben in institutionalisierten Wohnsettings Platz macht. Da zeigen sich Verlusterlebnisse, die das „Doing Age“ – und in einer Teilform das „Doing Home“ – einschränken. Eine rezente Forschungsarbeit von Louisa Smith et al. (2023, S. 1) zu Menschen mit Demenz in Pflegeheimstrukturen kommt zum Ergebnis: „Their body maps revealed that in care homes, people could not ‚do home‘ anymore because many of the practices, objects, people and places that mattered to them are no longer accessible“.
Wohnbindung im Alter: Place Attachment/Ageing in Place/Nachbarschaft
Wohnen im Alter wird konzeptionell seit Jahren über ökogerontologische Ansätze zu fassen versucht. Es sind Ansätze, die davon ausgehen, dass alterskorrelierte Rückgänge individueller Ressourcen und Kompetenzen den Einfluss der Wohnumwelt auf Verhalten und Erleben von Menschen im Alternsprozess erhöhen. Dabei steht der Gedanke im Zentrum, dass eine verschlechterte Passung zwischen individuellen Kompetenzen und Wohnbedingungen im Alter zum kritischen Problem wird und einen Umzug in eine betreute Wohnform oder in eine Pflegeeinrichtung erfordert. Neuere Ansätze betonen die Möglichkeit von Individuen, ihre Umwelt aktiv mitzugestalten und so selbstständig ein hohes Wohlbefinden zu erreichen (Oswald, 2015). In dieser Hinsicht schließen ökogerontologische Überlegungen an die im vorigen Kapitel ausgeführte handlungstheoretische Perspektive an.
Die ökologische Gerontologie adressiert Bedingungen, Prozesse und Ergebnisse des Person-Umwelt-Austausches im höheren Alter und fokussiert dabei zum einen auf das zielgerichtete Handeln („Agency“), zum anderen auf Prozesse nicht zielgerichteten emotionalen, mitunter unbewussten Erlebens („Belonging“), die sich infolge langen Wohnens am selben Ort (Ageing in Place) ergeben. Beide Prozesse sind wichtig für Selbstständigkeit, Identität und Wohlbefinden (Oswald & Wahl, 2019). Die Bedeutung des Wohnumfeldes nimmt mit steigendem Lebensalter zu, d. h. es wächst die emotionale Bindung. Sichtbar wird diese Bindung empirisch an dem mit dem Alter linear abnehmenden Bedürfnis, die Wohnung zu wechseln bzw. umzuziehen.
Es können zusammengefasst drei Ansätze unterschieden werden:
1.Aging-in-Place: Dieser Ansatz betont die Vorstellung, dass ältere Menschen in ihrer vertrauten Umgebung altern und wohnen sollten. Durch Anpassungen im Wohnumfeld, wie barrierefreie Gestaltung, technologische Unterstützung und soziale Netzwerke, soll es älteren Menschen ermöglicht werden, so lange wie möglich in ihren eigenen Häusern zu bleiben.
2.Place Attachment: Dieser Ansatz bezieht sich darauf, wie Menschen eine emotionale Bindung zu ihrem Wohnort entwickeln. Im Alter kann eine starke Bindung an den Wohnort das Wohlbefinden fördern und den Wunsch verstärken, dort zu bleiben.
3.Person-Environment Fit: Betont wird hier die Bedeutung der Passung zwischen der Person und ihrer Umgebung. Das Wohlbefinden im Alter hängt davon ab, wie gut die Umgebung auf die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten einer Person abgestimmt ist.
Gemeinsam ist den angeführten Ansätzen, dass Wohnen, Wohnumwelt und die Kompetenzen im Älterwerden durch eine dynamische Wechselwirkung bestimmt sind. Um eine gelungene Abstimmung zwischen diesen Dimensionen unter Bedingungen altersbezogener funktional-gesundheitlicher Veränderungen zu erreichen, wünscht sich das Individuum zuvorderst den Verbleib in der gewohnten Wohnumgebung. Das seit den 1990er-Jahren verwendete Konzept des „Ageing in place“ beruht auf empirischen Forschungsergebnissen. Diese belegen auch nach neueren Befunden, dass ältere Menschen auch bei Pflegebedürftigkeit so lange wie möglich in der eigenen Wohnung bzw. dem eigenen Haus verbleiben möchten (Höpflinger et al., 2019). In den letzten Jahren wurden zahlreiche Modifikationen am Grundmodell vorgenommen. Dafür soll beispielhaft der Beitrag von Maggie Ratnayake et al. (2022) herangezogen werden. Aus der Perspektive der Public-Health-Forschung wird erstens angemerkt, dass der Aspekt der Stabilität in Blockaden gegenüber Veränderungen umschlagen kann. Ein zweiter Punkt betrifft die soziale Vernetzung. Aging in Place kann also nicht nur aus einer psychologischen, sondern auch aus einer sozialen Perspektive zu einem Fallstrick werden. So kann eine altersgerechte Wohnung in einem schlechten Wohnumfeld den Trend zum Rückzug in die eigenen vier Wände verstärken und zu sozialer Isolation beitragen. Um den Fallstricken des Verbleibs im eigenen Wohnumfeld zu entgegen, schlagen die Autor:innen intergenerationelle Kompetenztrainings vor. Von solchen Trainings wird erwartet, dass jüngere Menschen im Wohnumfeld ihre Einstellungen gegenüber älteren Menschen verändern und ältere Menschen durch gemeinsame Trainings an Kompetenz in Fragen der Gesundheit und des Sozialraums gewinnen.
Wohnen mit oder ohne Nachbarschaft?
Die Bedeutung von Nachbarschaft verändert sich im Lebenslauf. Sie ist abhängig vom Lebensstil und dem Wohnort. Menschen mit höheren Einkommen und höherer Bildung verfügen meist über vielfältigere Bezugsgruppen, die über die unmittelbare Nachbarschaft hinausgehen. Nachbarschaft ist von daher umso wichtiger, je mehr Bezugssysteme fehlen, die über die unmittelbare Nachbarschaft hinausgehen. Über den Lebenslauf spielt die fußläufige Wohnumgebung vor allem in der Kindheit und im Alter eine größere Rolle. Von daher hat für diese Personengruppen auch die Nachbarschaft eine größere Relevanz.
Nachbarschaft kann als soziale Gruppe bzw. sozialer Ort bezeichnet werden, wo primär wegen des gemeinsamen Wohnorts Beziehungen stattfinden (Schnur, 2021). Nachbarschaft bezieht sich dabei auf die Dynamik von Nachbarschaftsbeziehungen, den Aspekt der Gruppenzugehörigkeit und den Raumbezug. Nachbarschaft hat im Kontext einer Wohnsituation viele Eigenschaften, die sich auch gut mit der ‚Logik der Praxis‘, wie sie Andreas Reckwitz nennt, analysieren lässt (Reckwitz, 2003, S. 294–296). Diese Analyse kann auf vier Punkte aufbauen:
1. Nachbarliche Praktiken sind kontextabhängig: Praxisroutinen funktionieren häufig gut, jedoch gibt es auch Kontextbedingungen, in denen unerwartete Reaktionen oder Effekte eintreten. Beispielsweise können solche Effekte eintreten, wenn Nachbarn exzessiv Müll/ Abfall erzeugen und die Müllbehälter ständig übervoll sind.
2. Nachbarliche Praktiken unterliegen einer Zeitlichkeit: Man kann von Praktiken, die früher verlässlich funktioniert haben, gewissermaßen erwarten, dass sie es jetzt auch noch tun. Dazu gibt es aber keine Gewissheit. Wenn Nachbarn sich immer wieder anbieten, Sorge für ein Haustier zu übernehmen und das plötzlich nicht mehr tun.
3. Nachbarliche Praktiken werden kollektiv aggregiert: Praktiken erscheinen in der Regel als lose Bündel von Praktiken, nicht als Einzelpraktiken, die „häufig nur bedingt und widerspruchsvoll aufeinander abgestimmt oder gegeneinander abgegrenzt sind“ (Reckwitz, 2003, S. 295). Die Praktik der Müllentsorgung kann z. B. als ein solches Bündel verstanden werden, das sowohl funktionale als auch lebensweltliche Komponenten aufweist.
4. Wissen über nachbarliche Wohnsituationen wird individuell aggregiert: Das Subjekt selbst ist als „Praktiker:in“ durch eine „Überschneidung und Übereinanderschichtung verschiedener Wissensformen“ gekennzeichnet, die wiederum die individuelle Praxis unabhängig von tradierten Routinen unberechenbar – und potenziell innovativ – machen. Bekommt jemand die Information, dass der gesammelte Papiermüll schlussendlich in der Müllverbrennung landet, dann kann das die Bereitschaft zur Mülltrennung beeinträchtigen.
Das Verweilen und die Vertrautheit mit der Nachbarschaft und dem Sozialraum haben eine für soziale Teilhabe förderliche Wirkung. Dabei ist darauf zu achten, dass neben Möglichkeiten der Teilhabe immer auch Chancen der Teilhabe geschaffen werden, sodass auch für diese Menschen ein Geben und nicht nur ein Nehmen erlebbar wird. Dies ist, ohne die Förderung einer Kultur der Aufmerksamkeit und Hilfsbereitschaft nicht zu haben, eine weitere Herausforderung für nachbarschaftliches Handeln.
Ein anderer Zugang zur Analyse nachbarschaftlichen Handelns kann über ihre Funktionen erfolgen. Auch dazu finden sich in der Fachliteratur vier Punkte (Hamm, 1973, S. 82ff.):
1. Nothilfe: Diese ist zweifellos eine komplexe Abfolge körperlicher Handlungen, wenn man etwa einen hochbetagten Nachbarn mit Einkäufen versorgt oder die Nachbarswohnung während einer Abwesenheit betreut. Dieser situationsbezogenen nachbarlichen Praktik liegen aber auch Mitgefühl, ein Fürsorgeideal oder Vorstellungen von Gemeinschaftlichkeit und Solidarität zugrunde.
2. Sozialisation: Dabei geht es um die Sozialisation von Kindern, Erwachsenen, alten Menschen sowie Personen, die neu in die Nachbarschaft ziehen. Sie alle werden mit je eigenen sozialen Normen und Konventionen konfrontiert. Dabei etablieren sich komplexe Praktiken, die wiederum stark von den Milieus und Sozialstrukturen, aber auch von baulich-räumlichen Strukturen abhängen.
3. Kommunikation: Nachbar:innen agieren zunächst und am häufigsten als Kommunikationspartner. Die schlichte Alltagskommunikation ist zentraler Bestandteil nachbarlicher Praktiken und damit Teil eines ganzheitlichen Wohnverständnisses. Die Gespräche zwischen „Tür und Angel“ haben viele Funktionen. Ob es um Information geht, ob es um Vertrauensbildung geht oder ob lediglich eine kurze gegenseitige Aufmerksamkeit entsteht, nachbarschaftliche Kommunikation ist ein Element kommunikativen Handelns. Die wichtige Funktion von Klatsch bei Inklusions- und Exklusionsprozessen sozialer Gruppen in Quartieren wurde zuletzt von Stacy Torres (2019) belegt. Heute spielen zunehmend Social Media oder Online-Nachbarschaftsplattformen eine Rolle in der nachbarlichen Kommunikation. Sie tragen dazu bei, dass sich die nachbarschaftliche Praxis und damit Wohnsituationen signifikant verändern.
4. Soziale Kontrolle: Die vierte Nachbarfunktion ist die der sozialen Kontrolle, also „[…] die geplanten und ungeplanten Prozesse, durch welche die Individuen gelehrt, überzeugt oder gezwungen werden, sich in Übereinstimmung mit den Gebräuchen und entscheidenden Werten derjenigen Gruppen zu verhalten, denen sie angehören“ (Hamm, 1973, S. 89). Wenn in dieser Definition von „ungeplanten Prozessen und Institutionen“ die Rede ist, die einen gewissen Rahmen setzen, werden wesentliche Eigenschaften einer emergenten sozialen Praktik bereits vorweggenommen. Hinzu kommt die Durchsetzung von Normen durch einschlägige Sanktionen. Soziale Kontrolle in einem Quartier kann informell, z. B. wiederum über Klatsch, ausgeübt werden. Im Vergleich zur Hochmoderne haben sich die sozialen Kontrollpraktiken verändert, mitunter abgeschwächt. Mit der fortschreitenden Individualisierung wurden zu starke soziale Kontrollen (z. B. durch Nachbar:innen) häufig abgelehnt und öfter Wohnformen bevorzugt, die das Private betonen – Wohnen, verstanden als Seinsebene, hat sich dadurch stark gewandelt.
Eine ähnliche Systematik legen Dörte Naumann und Frank Oswald (2020) zur Beschreibung und Analyse nachbarschaftlichen Wohnens vor: Als soziale Aspekte nachbarschaftlicher Verbundenheit werden soziale Zusammengehörigkeit, subtile Formen sozialer Teilhabe und wahrgenommene informelle soziale Kontrolle angeführt. Dazu werden empirische Befunde angeführt, wonach in eigenständigen und eher dörflich strukturierten Stadtteilen sich stärkere Gefühle der Zusammengehörigkeit in der Nachbarschaft beobachten lassen als in anderen, zentrumsnäheren Stadtteilen. Aktuelle Befunde verweisen zudem darauf, dass Teilhabe am Leben im Stadtteil und sozialer Austausch gerade im sehr hohen Alter wichtig sind, wobei neben institutionalisierten Formen gesellschaftlicher Teilhabe (z. B. dem Engagement in politischen Gruppen) insbesondere auch subtile Formen sozialer Teilhabe (mitbekommen, was im Stadtteil geschieht und sich darüber austauschen) in den Vordergrund treten.
Vergemeinschaftung im Alterswohnen
Die soziale Integration ist ein wichtiger Aspekt. Ältere Menschen haben ein starkes Bedürfnis nach Gemeinschaft und sozialen Interaktionen. Wohnungen und Quartiere sollten daher Möglichkeiten für Begegnungen und gemeinsame Aktivitäten bieten, um soziale Isolation zu verhindern. Zugleich müssen Gesundheitsversorgung, Einkaufsmöglichkeiten und Freizeiteinrichtungen leicht erreichbar sein, um die Selbstständigkeit älterer Menschen zu fördern.
Die hauptsächliche Wohnform im Alter ist das Zusammenleben in einer (ehelichen) Partnerschaft und das Alleinleben, meist nach dem Tode des Partners/der Partnerin. Dazu kommt, dass sich unmittelbare soziale Netzwerke durch Tod von Bekannten, Freunden und Nachbarn ausdünnen. Dadurch kann das Gefühl sozialer Isolation selbst in einer vertrauten Wohnumgebung auftreten. Das Pflegeheim als Alternative wird von den meisten alten Menschen in Betracht gezogen, noch weniger, wenn kein höherer Pflegebedarf gegeben ist. Vor diesem Hintergrund sind einige neue Formen des Wohnens im Alter entstanden, die vom Betreuten Wohnen bis hin zu selbstorganisierten Wohngemeinschaften reichen. Im Fokus der Diskussion stehen in der jüngeren Vergangenheit gemeinschaftliche Wohnformen. Bei diesen Wohnformen handelt es sich primär um Wohnprojekte für Menschen im dritten Lebensalter. Gemeinschaftsorientierte Wohnprojekte, bei denen Menschen mit ähnlichen Interessen oder Lebensstilen zusammenleben, könnten an Beliebtheit gewinnen. Diese Projekte könnten soziale Interaktion fördern und Ressourcen gemeinschaftlich nutzen. Es geht um durchmischtes und soziales Wohnen, welches mit beteiligungsorientierten, kommunikativen Planungselementen verknüpft ist (Uhlig, 2006).
Als zentrale Vorteile eines altersgemeinschaftlichen Wohnens werden gegenseitige Hilfe, gemeinsame Aktivitäten sowie für alleinstehende Personen ein geringeres Risiko von Alleinsein angeführt (Hechtfischer, 2013). Durch gemeinschaftliche Wohnformen können Anregungen, Kontakte und soziale Austauschbeziehungen im Alter gestärkt werden. Kommen die angesprochenen Wohnformen selbstorganisiert zustande, dann tragen sie zusätzlich zur Wahrung der Selbstbestimmung bei. Zentral für gemeinschaftliches Wohnen im Alter ist jedenfalls Gegenseitigkeit, wobei sich diese in sehr unterschiedlicher Ausgestaltung je nach Wohnform zeigt. So wird bei proaktiven Alterswohngemeinschaften schon vor der Realisierung das Ausmaß an Gemeinschaftlichkeit bestimmt. Wird gemeinschaftliches Wohnen zusätzlich mit Konzepten eines generationengemischten Wohnens verknüpft, dann ergeben sich noch weitere Erwartungen in Hinsicht auf Kommunikation und Austausch. Diese Wohnform drückt sich in Mehrgenerationenhäusern und generationengemischten Wohnsiedlungen aus. Bei generationenübergreifenden Hausgemeinschaften und generationendurchmischten Wohnsiedlungen ist eine Organisation gemeinschaftlicher Aktivitäten sowie eine Vermittlung bei intergenerationellen Konflikten notwendig. Generationenübergreifende Kontakte – die über ein nachbarschaftliches Nebeneinander hinausgehen sollen – müssen gezielt betreut werden. Ein Beispiel dafür ist das Projekt „OASE22“, welches im 22. Wiener Gemeindebezirk realisiert wurde. In der Beschreibung heißt es: OASE22, ein neuer Wohnpark für das optimale Zusammenleben aller Generationen. Es ist ein vielfältiges Wohnungsangebot mit modernen Grundrisstypologien für neue Wohnformen, wie Patchworkfamilien, Alleinerzieher:innen oder Einpersonenhaushalte. Weiters wurden Startwohnungen, Betreutes Wohnen und Generationen-Wohnen errichtet, ergänzt durch gemeinschaftlich nutzbare Freiräume im Gebäude und auf den Dachflächen. Die Freiraumgestaltung nimmt Bezug auf das übergeordnete Freiraumkonzept, das bauplatzübergreifend eine zusammenhängende Parklandschaft vorsieht. Die Zutaten für den Freiraum im Hof sind Rasenteppiche, Betonmauern und -wege. Zwischen den Mauerscheiben sind die Rasenflächen teilweise abgesenkt, teils erheben sie sich über das Gelände, teils sind sie mit Blütenstauden und Ziergräsern bepflanzt. Eine Holzplattform wird zur „Bühne“ – für Kindertheater oder als Aufenthaltsbereich. Auf den Dachflächen entstanden Gemeinschaftsterrassen und individuell anmietbare Hochbeete zur Pflanzung von Obst und Gemüse1. In den ersten Jahren nach der Fertigstellung wurden gemeinschaftliche Aktivitäten durch ein Projekt der Stadtteilarbeit der Caritas Wien unterstützt und entwickelt. Denn gemeinschaftliches Wohnen und Leben ist anspruchsvoll.
Gefährdet ist gemeinschaftliches Wohnen dort, wo soziale Beziehungen nicht nur als Zugewinn gesehen werden, sondern Ängste und Rückzug auslösen, weil das Gefühl vorhanden ist, dass das eigene Verhalten beobachtet und kommentiert wird und in der Folge in Form von Tratsch weitergegeben wird. Das zeigt sich nicht nur für privates gemeinschaftliches Wohnen, sondern auch für das Wohnen im Pflegeheimsetting. John Percival (2000) zeigt in einer ethnografischen Studie in Großbritannien, dass sich im Pflegeheimsetting sowohl soziale Nähe als auch sozialer Rückzug nachweisen lassen. Dies geschieht, so die Studie, aufgrund von Tratsch und Gerüchten. Von daher ist die Beziehungskultur ständig gefährdet, weil Sorge besteht, kontrolliert zu werden und Vertrauliches an Fremde weitergegeben wird.
Vor diesem Hintergrund ist das Konzept des resonanten Wohnens zu sehen (Jacob & Kopp, 2020). Es ist mehr als nur das Teilen eines physischen Raums; es ist eine Lebensweise, die auf gegenseitigem Verständnis, Respekt und Harmonie basiert. In einer Welt, die oft von Hektik und Stress geprägt ist, sehnen sich viele Menschen nach einem Zuhause, das nicht nur ein Ort zum Schlafen ist, sondern auch einen Raum bietet, in dem positive Schwingungen und ein gemeinsames Miteinander spürbar sind. Resonantes Wohnen geht über die bloße Anordnung von Möbeln hinaus. Es bezieht sich darauf, wie Menschen miteinander und mit ihrer Umgebung interagieren. Resonanz im Wohnen bedeutet, dass die Bewohner auf einer emotionalen, sozialen und spirituellen Ebene miteinander in Einklang stehen. Dies erfordert Achtsamkeit und die Bereitschaft, aufeinander einzugehen. In einem resonanten Zuhause ist die Kommunikation der Schlüssel. Bewohner praktizieren achtsames Zuhören, teilen ihre Gedanken und Gefühle und schaffen so eine Atmosphäre des Verständnisses. Konflikte werden nicht vermieden, sondern als Chancen zur Weiterentwicklung betrachtet. Die Kunst, respektvoll zu kommunizieren, trägt dazu bei, ein positives Umfeld zu schaffen. Resonantes Wohnen entsteht, wenn die Bewohner gemeinsame Werte und Ziele teilen. Dies können ethische Prinzipien, Umweltbewusstsein oder der Wunsch nach persönlichem Wachstum sein. Die Verbindung über geteilte Überzeugungen fördert ein tieferes Verständnis füreinander und schafft eine gemeinsame Grundlage für das tägliche Leben. Rituale, wie gemeinsame Mahlzeiten oder regelmäßige Treffen, stärken die Verbundenheit und schaffen Erinnerungen. Gemeinschaftsaktivitäten fördern das Gefühl der Zusammengehörigkeit und tragen dazu bei, dass sich jeder Bewohner in seinem Zuhause als Teil einer größeren Gemeinschaft fühlt.
Eine Zwischenlösung zwischen gemeinschaftlichen Wohnformen, die jenseits der Familie und diesseits von engem Zusammenleben in Wohngemeinschaften angesiedelt sind, ist das Betreute Wohnen. Im Betreuten Wohnen erhalten ältere Menschen Unterstützung bei der gemeinsamen Alltagsgestaltung, bewahren aber gleichzeitig ihre Unabhängigkeit in eigenen Wohnungen. In Pflegeeinrichtungen stehen umfassende Pflege- und Betreuungsdienste im Vordergrund, um älteren Menschen eine qualitativ hochwertige Versorgung zu bieten. Betreute Wohnformen bestehen aus einer Verflechtung der Kernelemente barrierefreie Wohnung und Dienst- bzw. Serviceleistungen wie z. B. Betreuung, Beratung und gemeinsame Aktivitäten. Im Betreuten Wohnen verfügen die Bewohner und Bewohnerinnen über eine abgeschlossene private Wohnung. Bei den Dienst- und Serviceleistungen besteht der Unterschied zu institutionellen Wohnformen, dass die einzelnen Bewohner und Bewohnerinnen selbst darüber entscheiden, welche Dienstleistungen sie in welcher Intensität in Anspruch nehmen.
Zusammengefasst steckt in vergemeinschafteten Wohnformen, die über die Familie hinausgehen, sehr viel Potential. Diese Wohnformen gewährleisten ein selbstbestimmtes Leben bei gleichzeitigem Zugang zu Kommunikation und sozialen Beziehungen. Dieser Zugang zu Kommunikation ist in der Regel vertraglich oder informell vereinbart und erleichtert soziale Integration. Allerdings sollte nicht übersehen werden, dass die große Mehrheit älterer Menschen in traditionellen Wohnverhältnissen verbleibt und gemeinschaftliche Wohnformen zwar zahlenmäßig zunehmen, jedoch noch unklar ist, ob diese als das Mittel gegen das Ausdünnen sozialer Beziehungen im Alter gesehen werden können.
Caring Community – Wohnen und soziale Sorge
Die soziale Sorgefähigkeit gilt als Voraussetzung für langfristigen wirtschaftlichen Wohlstand (Klie, 2014). Von der Sorgefähigkeit der Menschen vor Ort in ihren unterschiedlichen Spielarten hängen die Stabilität des Gemeinwesens und seine Zukunftsfähigkeit ab. In der partizipatorischen Quartiersentwicklung (Lucke, 2021) geht es nicht primär darum, wo welches Wohnangebot gebaut wird, sondern als Erstes wird man versuchen zu klären, nach welchem Ordnungsprinzip das Zusammenleben im Quartier organisiert wird. Erwarten wir, dass der sorgende Staat uns in allen Lebenslagen die Lösungen vorgibt und organisiert, oder wollen wir uns in die Produktion der notwendigen Hilfen und Dienstleistungen mit einbringen, sie sogar bestimmen?
Zuhause lebende ältere Menschen erhalten Unterstützung von Angehörigen, staatlichen Institutionen oder privaten Organisationen. Diese Systeme sind jedoch durch demografische Veränderungen und eine wachsende Ökonomisierung der Pflege und Betreuung herausgefordert. Familienangehörige können überfordert sein, und manche Ältere haben keine Unterstützung durch Angehörige. Viele möchten ihren Lebensabend in ihrem vertrauten Umfeld verbringen und nicht ins Pflegeheim gehen. Konzepte wie „Caring Communities“ betonen die Rolle von lokalen Gemeinschaften in der Pflege und Unterstützung älterer Menschen, um sowohl Angehörige als auch das institutionelle System zu entlasten (ZHAW, 2018).
Wohnen im Alter als soziale Praxis erfordert also mehr als nur eine Unterkunft, es erfordert die Schaffung und Pflege von Caring Communities, einer sorgenden Gemeinschaft, die auf gegenseitiger Unterstützung, sozialer Sorge und gemeinschaftlicher Solidarität basiert. In diesen dynamischen Gemeinschaften wird Wohnen zu einem integralen Bestandteil des sozialen Lebens älterer Menschen, die sich gegenseitig unterstützen, stärken und ermutigen (Ackermann et al., 2023). Das Konzept einer Caring Community definiert sich durch die Schaffung eines Umfelds, in welchem Menschen füreinander sorgen und einander unterstützen. Es soll gemeinsam Verantwortung für soziale Aufgaben übernommen werden, charakterisiert durch ein Geben und Nehmen (Zängl, 2023).
Innerhalb einer Caring Community übernehmen verschiedene Akteur:innen wie Bewohner:innen, Pflegekräfte, Freiwillige und lokale Organisationen unterschiedliche Rollen und Verantwortlichkeiten, um eine umfassende Versorgung zu gewährleisten. Ein Beispiel hierfür ist die CURAVIVA Schweiz, welche das Wohn- und Pflegemodell „Vision Wohnen im Alter“ für ältere Menschen entwickelt hat. Es legt Wert auf eine gemeinschaftliche Zusammenarbeit aller Beteiligten, um die Lebensqualität älterer Menschen zu verbessern. Dabei stehen ältere Menschen im Mittelpunkt und werden von einem Netzwerk aus Familienmitgliedern, Nachbar:innen, Fachkräften und Freiwilligen unterstützt. Das Konzept betont die Bedeutung von Selbstbestimmung und Partizipation und fördert eine ganzheitliche Lebensqualität durch Koordination und Stärkung der Kompetenzen aller Akteur:innen (CURAVIVA, 2016; CURAVIVA, 2020).
Ein wesentliches Schlüsselprinzip, neben niederschwelligem Zugang und Selbstorganisation, einer Caring Community ist das Empowerment älterer Menschen. Dies beinhaltet die Förderung von Selbstbestimmung, Selbstpflege und sozialer Teilhabe, um älteren Menschen ein Gefühl der Autonomie und Würde zu vermitteln (Fabian et al., 2017). Durch die Stärkung ihrer Ressourcen und Fähigkeiten können ältere Menschen aktiv an Entscheidungen teilnehmen, die ihr Leben betreffen, und sich als geschätzte Mitglieder der Gemeinschaft fühlen (Sempach & Steinebach, 2023).
Angesichts des demografischen Wandels und der zunehmenden Bedeutung des Wohnens im Alter ist es entscheidend, die Potenziale von Caring Communities zu erkennen und weiterzuentwickeln, um älteren Menschen ein würdevolles und selbstbestimmtes Altern zu ermöglichen. Indem wir die Prinzipien der gegenseitigen Unterstützung und sozialen Sorge in den Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns stellen, können wir eine Gesellschaft schaffen, in der das Wohnen im Alter nicht nur ein Ort ist, sondern ein aktives und erfülltes Leben in einer unterstützenden und fürsorglichen Gemeinschaft.
Ressourcen: Infrastruktur und Gesundheit
Die Wohnbedürfnisse älterer Menschen sind geprägt von einem breiten Spektrum an Faktoren. Barrierefreiheit steht hier an erster Stelle, um älteren Menschen die Möglichkeit zu bieten, sich sicher und komfortabel in ihren eigenen vier Wänden zu bewegen. Dies beinhaltet nicht nur ebenerdige Zugänge und breite Türen, sondern auch rutschfeste Böden und gut platzierte Handläufe. Die Gestaltung von Wohnungen unter Berücksichtigung dieser und ähnlich gelagerter Problemlagen lässt sich unter dem Begriff „altersgerechtes Wohnen“ subsumieren. Sicherheit spielt eine entscheidende Rolle, um Unfälle zu vermeiden und das Vertrauen der Bewohner zu stärken. Zu den wichtigsten Voraussetzungen für Alltagsmobilität im Wohnbereich gehört der barrierefreie Zugang zur Wohnung bzw. zum Haus. Ältere Menschen sind häufig eingeschränkt in ihrer Fähigkeit, Treppen zu steigen. So kann eine Wohnumgebung mit Barrieren die Mobilität beeinträchtigen, wenn zum Beispiel Hilfsmittel wie Rollatoren über mehrere Treppenabsätze transportiert werden müssen (Fuchs et al., 2022). Aber: Eine Studie zu einer Wohnsiedlung in Regensburg zeigt (Haug & Vetter, 2021): Das geringere Interesse der befragten Seniorenhaushalte an barrierereduziertem Wohnen könnte damit zusammenhängen, dass es ihr größter Wunsch ist, die eigene Wohnung und direkte Nachbarschaft nicht zu verlassen. Sie bevorzugen eine (energetische) Sanierung im bewohnten Zustand.
Wird die Wohnsituation von Menschen mit Mobilitätseinschränkung und ohne Mobilitätseinschränkung verglichen, dann zeigt sich, dass Menschen mit Mobilitätseinschränkungen eher selten in barrierereduzierten Wohnungen leben, d. h. stufenlos erreichbar sind und alle Treppen mit Handläufen ausgestattet sind (Nowossadeck & Engstler, 2017). Dagegen ist einzuwenden, dass die Wahrscheinlichkeit für Mobilitätseinschränkungen fraglos im hohen Alter zunimmt, weil der Wohnraum (noch) nicht barrierereduziert umgestaltet wurde. Dennoch ist fehlende Passung von Mobilitätseinschränkungen und barrierefreiem Wohnen kein Problem des hohen Alters, sondern ein gesellschaftliches Problem, und dies besteht unabhängig vom Alter der Betroffenen. Grundsätzlich tragen Wohnraumanpassungen zur Verbesserung der Alltagskompetenz und zur Vermeidung bzw. Reduzierung von Stürzen bei, wenngleich die Datenlage als gemischt eingeschätzt werden muss (Wahl et al., 2009). So ist es genau genommen die Zugänglichkeit, also die Passung zwischen Kompetenzen und Barrieren und nicht die reine Anzahl an Barrieren, die Stürze mit vorhersagen kann.
Helga Pelizäus-Hoffmeister (2013) kommt in ihrer Untersuchung zur Alltagsmobilität im Alter, d. h. der Mobilität im Wohnumfeld, zu folgenden Ergebnissen: „Nicht das Alter selbst, sondern vor allem das Erleben körperlicher, kognitiver oder sensorischer Einschränkungen führt dazu, dass Ältere den sie umgebenden gleichbleibenden, aber auch den sich verändernden Raum aus der Perspektive einer stärkeren Barriereorientierung wahrnehmen. Möglichen Hindernissen für die eigene Mobilität wird größere Aufmerksamkeit geschenkt. Diese Fokussierung führt zu Um- bzw. Neuinterpretationen des Raumes. Auf der Ebene der subjektiven Bereitschaft zur Mobilität zeigt sich ein diesbezüglicher Rückgang: Und nur wenn der Anlass als relativ wichtig interpretiert wird, besteht eine Bereitschaft zur außerhäuslichen Mobilität.“





























