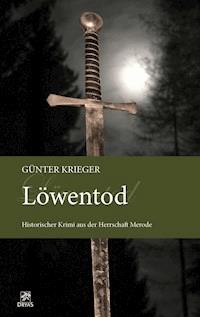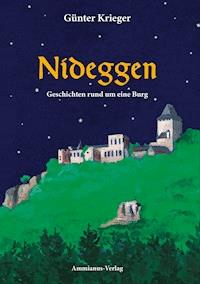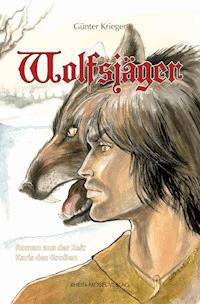
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rhein-Mosel-Vlg
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Eifel zu Beginn des 9. Jahrhunderts: In Walamar, einem Bauernort unweit von Prüm, lebt Ludwig, der von seiner Schwester Gudrun neckisch Lupus genannt wird. Grund für den Kosenamen ist ein Haarbüschel, das auf seinem Rücken wächst. Überhaupt, mit den lupii, den Wölfen, wird Ludwig ein Leben lang schicksalhaft verbunden bleiben. Als Wolfsjäger tritt er, gemeinsam mit seinem Vater, in die Dienste Kaiser Karls. Doch nicht die Wölfe sind seine wirklichen Feinde.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 273
Veröffentlichungsjahr: 2007
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© 2007 e-Book-Ausgabe 2015 RHEIN-MOSEL-VERLAG Brandenburg 17 D-56856 Zell/Mosel Tel. 06542/5151 Fax 06542/61158 Alle Rechte vorbehalten ISBN 978-3-89801-831-9 Ausstattung: Marina Follmann Umschlagbild: Sabine Weiss
Günter Krieger
Wolfsjäger
Roman aus der Zeit Karls des Großen
RHEIN-MOSEL-VERLAG
***
Prolog
Anno Domini 811
Die beiden Wolfsrüden verharrten auf der Anhöhe und blickten hinab ins Tal, über dem der Frühling lag. Der milde Sonnenschein hatte die Tiere träge werden lassen, und ihr Hunger war noch zu gering, um diese Trägheit abzulegen. Trotzdem, die Jagd musste stattfinden, denn nicht allein ihre Mägen galt es zu füllen.
Zwei Meilen entfernt, in einer Erdhöhle unterhalb eines Sandhügels, lag die Gefährtin des größeren Wolfes, und sechs Welpen saugten an ihren Zitzen. Die Strapazen der Geburt und die Mühen der Aufzucht hatten die Wölfin in den vergangenen Tagen sehr erschöpft. Ein paar Wurzeln und drei Wühlmäuse, das war alles, was sie seitdem gefressen hatte. Nun musste Fleisch für sie her, richtiges Fleisch, damit sie wieder zu Kräften kommen konnte. Zumal auch die Welpen sich längst nicht mehr allein mit der Milch ihrer Mutter zufrieden gaben.
Eine junge Hirschkuh war den beiden Wolfsrüden vorhin entwischt. Bis auf wenige Schritte waren sie an die Beute herangekommen. Der Wind hatte günstig gestanden, doch dann hatte ein ungeschickter Tritt des jüngeren Wolfs die anschleichenden Jäger verraten. Sofort hatte die Hirschkuh Reißaus genommen. Der Urheber des Missgeschicks stellte ihr augenblicklich nach, der ältere Wolf aber machte sich gar nicht erst die Mühe, es ihm gleichzutun. Er besaß genug Erfahrung, um zu wissen, dass die Verfolgung in dieser Phase der Jagd einer Vergeudung von Kräften gleichkam. Sie waren nah an die Beute herangekommen, aber nicht nah genug. Wären sie vier oder fünf Jäger gewesen und hätten die Hirschkuh vorsichtig umkreisen können, ja, dann hätten sie möglicherweise eine Chance gehabt. So aber war es zwecklos. Unwillig knurrte der Leitwolf, als der Ungestüme nach einer Weile zurückkehrte. Mit gesenktem Kopf folgte er dem älteren Bruder. Beute musste her, auf welche Weise auch immer.
Inzwischen hatten sie also die Anhöhe erreicht und blickten ins Tal. Lag da nicht ein eigentümlicher Geruch in der Luft? Zwar nicht der Geruch nach Wild, aber keineswegs weniger köstlich. Sie reckten ihre Nasen. Kein Zweifel, es roch nach Beute. Dann hörten sie das Meckern einer Ziege. Der Leitwolf wusste, dass Ziegen leichte Beute waren, vorausgesetzt, es gab keine Menschen in der Nähe. Genau hier aber lag die Schwierigkeit: Menschen waren fast immer in der Nähe von Ziegen oder Schafen. Menschen und ihre Hunde! Einen Hund konnte der Leitwolf diesmal nicht wittern, aber irgendwo gab es Menschen da unten im Tal. Dennoch, sie mussten es einfach wagen.
Der jüngere Wolf zögerte. Einmal war auch er einem Menschen begegnet. Dieser hatte reichlich Lärm gemacht, hatte gebrüllt und drohend mit seinen langen Armen gefuchtelt, als sie sich plötzlich und unerwartet gegenüberstanden. Voller Angst war der Wolf ins Dickicht geflüchtet. Menschen waren eine Bedrohung, so viel hatte er aus dieser Begegnung gelernt, und es war besser, ihnen aus dem Weg zu gehen. Zu seinem Unbehagen aber schickte der Leitwolf sich an, den Weg in das Tal anzutreten. Zögerlich folgte er ihm, denn er wollte nicht erneut seinen Zorn erwecken.
Das Mädchen, es mochte etwa dreizehn Jahre zählen, saß auf dem Stamm einer entwurzelten Eiche und blickte dem Burschen, der sich ihr näherte, ein wenig irritiert entgegen. Er nahm neben ihr Platz und grinste übers ganze Gesicht.
»Wohin hast du die Ziege gebracht?«, fragte das Mädchen.
»Hab sie angebunden«, entgegnete der Bursche und deutete in die Richtung, aus der er gekommen war. »Da hinten, an einen Baum.«
»Du hättest sie hier anbinden können.« Das Mädchen verstand immer noch nichts.
»Nee, nee. Die braucht uns nicht zuzusehen.«
»Zusehen? Wobei?«
»Na, bei dem, was ich dir zeigen will.«
»Ich frage mich schon seit Stunden, was du mir eigentlich zeigen willst. Mein Vater ist bestimmt schon böse, weil ich so lange weg bin. Es wird ein richtiges Donnerwetter geben, wenn ich wieder nach Hause komme.«
»Du wirst es nicht bereuen – trotz des Donnerwetters.«
»Da bin ich aber wirklich gespannt.« Sie blickte auf sein Wams, als wäre darunter etwas verborgen, das er gleich zum Vorschein holen würde. Er aber rührte sich nicht.
»Und?«, fragte sie ungeduldig.
Er hob seine Hand und ließ sie sanft durch ihre strohblonden Haare gleiten.
»Und das wolltest du mir zeigen?« Sie lächelte, doch die Verwirrung stand ihr ins Gesicht geschrieben.
»Das Beste kommt noch«, verkündete er, legte einen Arm um ihre Schulter und zog sie ganz nahe zu sich heran.
»Wernar! Was machst du?«
»Ich will dich küssen, das siehst du doch. Und du wirst keinen finden, der besser küssen könnte als ich.«
»Aber ... die Ziege! Musst du sie nicht zum Kloster bringen?«
»Das hat Zeit. Die läuft mir nicht davon.« Er presste seinen Mund auf ihren. Das Mädchen versuchte sich aus der Umklammerung zu befreien.
»Was hast du denn?«, fragte er leicht verärgert.
»Wernar, ich weiß nicht. Wir können uns doch hier nicht ein-fach ... küssen!«
»Wer sollte uns daran hindern?«
»Mein Vater würde mich erschlagen, wenn er das sähe. Und dich obendrein.«
»Er ist aber nicht hier.«
»Wernar ...«
»Der erste Kuss deines Lebens. Du brauchst es niemandem zu erzählen.«
Sie schwieg und starrte verlegen auf ihre Füße.
»Es ist doch dein erster Kuss?«, fragte er lauernd.
»Ja, schon. Aber ...«
»Was aber?«
»Wenn uns jemand sieht!«
»Es gibt nur uns beide hier. Uns, die Ziege und ein paar Vö-gel.«
Sie lächelte wieder, denn Wernar hatte Recht. Weit und breit gab es keine menschliche Behausung. Seit einer Stunde waren sie unterwegs, ohne einer Seele begegnet zu sein. Und wenn sie ehrlich war: Gehofft hatte sie es im Stillen schon lange, dass Wernar sie eines Tages küssen würde. Sicher, Vater würde ihr später gehörig die Leviten lesen, weil sie sich vor der Arbeit gedrückt hatte. Aber war ein Kuss, ein echter Kuss von Wernar, den ganzen Ärger nicht wert? Sie kannte Mädchen, die würden grün werden vor Neid, wenn sie erst erfuhren, dass sie und Wernar sich geküsst hatten. Vor allem die sommersprossige Gudrun, von der sie wusste, dass sie hoffnungslos in Wernar verliebt war.
»Was ist mit Gudrun?«, fragte sie zögernd. »Ich dachte, du und sie ...«
»Pssst!« Er legte einen Finger auf ihre Lippen. »Sieh dich doch mal um, Trudi. Siehst du Gudrun vielleicht hier irgendwo?«
Wernar spürte ihren Widerstand schwinden und drückte sie abermals an sich. Diesmal stieß sie ihn nicht zurück. Seine Lippen waren weich, aber die Barthaare, die schon auf seinem Kinn wuchsen, kratzten doch sehr. Trotzdem versuchte sie sich auf die Wonne zu konzentrieren, die das Küssen bereiten sollte. Zumindest, wenn man den Worten Verliebter glaubte. Das laute Meckern der Ziege aber hallte plötzlich laut durch das Tal.
»Was hat sie denn?«, fragte Trudi aufgeschreckt.
Wernar unterbrach sein Tun nur ungern. »Nichts«, murmelte er.
»Sie meckert doch nicht ohne Grund.«
»Sie mag nicht angebunden sein. Und wahrscheinlich gönnt sie uns das Küssen nicht, das blöde Biest.«
Das mochte eine Erklärung sein. Aber das Meckern wurde im-mer lauter.
»Sie hat Angst!«, sagte Trudi überzeugt. »Aber wovor?«
»Sie ist halt ein blödes Biest, das sagte ich doch.«
»Du solltest besser nach ihr sehen, Wernar.«
Der Junge schnaufte wütend, sah aber ein, dass Trudi Recht hatte, denn die Ziege schien äußerst beunruhigt zu sein. Er tastete prüfend nach dem Messer, das er an seinem Gürtel trug. »Bin gleich zurück«, verkündete er. »Und du bleibst hier, Trudi. Bewegst dich nicht von der Stelle, kapiert?«
»Wernar, sei bloß vorsichtig«, rief sie ihm besorgt hinterher.
Ein mulmiges Gefühl überkam ihn, denn das Meckern der Ziege glich immer mehr einem verzweifelten Brüllen. Ohne Zweifel war sie in Panik geraten. War es wirklich klug, zu ihr zu laufen und sich ebenfalls der Gefahr auszusetzen, die dem Tier drohen mochte? Was, wenn er plötzlich einem grimmigen Bären gegenüberstand? Doch wenn er unverrichteter Dinge zu Trudi zurückkehrte, stand er wie ein Feigling da. Es nützte alles nichts, er musste seine Furcht unterdrücken und nach dem Rechten sehen, schließlich war er für die Ziege verantwortlich. Was sollte er wohl den Mönchen der Abtei erzählen, wenn er ohne das Tier dort ankäme? Seit Monaten war sein Vater mit den Abgaben im Rückstand.
Der Anblick, der sich Wernar dann bot, ließ ihn erstarren. Blutüberströmt und zuckend lag die Ziege am Boden. Ein großer Wolf hatte sich in ihrer Kehle verbissen, ein zweiter umkreiste das Opfer knurrend.
Zunächst glaubte Wernar, er müsse ohnmächtig zusammenbrechen. Die Wölfe aber waren durch sein plötzliches Erscheinen nicht minder erschrocken. Der kleinere Wolf machte Anstalten, Fersengeld zu geben, der andere ließ von der sterbenden Beute ab und schien unschlüssig, was nun zu tun sei. Wernar schöpfte Mut. Sein anfänglicher Schrecken war angesichts der zaudernden Wölfe gewichen. Er zückte sein Messer und trat den Wölfen beherzt entgegen.
»Verschwindet, Mistviecher!« Er schrie so laut er konnte und ließ seine Waffe dabei immer wieder nach vorne schnellen.
Dem kleineren Wolf reichte es nun endgültig. Rasch verschwand er im Dickicht. Auch der Große war einige Schritte zurückgewichen, ließ Wernar aber nicht einen Moment aus den Augen. Offenbar war er nicht bereit, seine Beute kampflos wieder herzugeben, sein Nackenfell sträubte sich, dass es seinen Kopf wie ein Kranz umgab. Wernar machte drei große Schritte auf den Widerspenstigen zu, doch zu seinem Entsetzen dachte dieser immer noch nicht an Flucht, sondern starrte weiter unverwandt auf seinen Gegner. Die Augen des Wolfs funkelten unheimlich, sodass Wernar es abermals mit der Angst zu tun bekam. Unweit von ihm stieß die Ziege ein paar letzte röchelnde Laute aus. Der Wolf hob seine Lefzen und offenbarte fürchterliche, vom Blut der Ziege rot gefärbte Zähne. Ein dumpfes Grollen drang aus seiner Kehle.
Dieser Anblick war zu viel für Wernar. Sämtliche Schauergeschichten aus seiner Kindheit fielen ihm ein, Geschichten von Werwölfen, mordenden Bestien und finsteren Wesen aus der Hölle. Wernar machte kehrt und lief zurück, so schnell seine zitternden Beine ihn zu tragen vermochten.
»Wernar! Was ist passiert?«, empfing ihn Trudi mit bleichem Gesicht.
Er aber schüttelte nur den Kopf und gab ihr winkend ein Zeichen. »Weg hier!«, rief er atemlos. »Bloß weg von hier!«
Der Raum, in den der Pfortenbruder ihn geführt hatte, war klein und schmucklos. Ein winziges Fensterloch sorgte für spärliches Licht. Zwischen vier weiß gekalkten Wänden bildeten zwei Stühle und ein wackliger Tisch die gesamte Ausstattung der Räumlichkeit, abgesehen von einem Kreuz aus dunklem Holz, das wie ein Fanal an der Stirnwand prangte.
Bruder Eugenius ließ noch auf sich warten. Wernar hatte bereits öfter mit dem Cellerar zu tun gehabt. Eugenius war ein freundlicher, greiser Mann, und bestimmt würde er Verständnis zeigen für das Missgeschick, das ihm, Wernar, widerfahren war. Mit Wölfen war eben nicht zu spaßen, jedes Kind wusste das. Zweifellos würde Bruder Eugenius einen neuerlichen Aufschub der Abgabe gewähren. Den Verlust der Ziege später dem Vater beizubringen, das war wieder eine ganz andere Geschichte.
Nach einer Weile des Wartens beschloss Wernar, sich auf einen der Stühle zu setzen. Er verschränkte die Arme auf seiner Brust und starrte ein wenig ungeduldig aus dem Fenster. Das Ärgerlichste an diesem Tag war eigentlich, dass das Stelldichein mit der süßen Trudi ein so jähes Ende gefunden hatte. »Verdammte Wölfe«, murmelte er leise vor sich hin.
Endlich flog die Tür auf, und Wernar erhob sich gemächlich, um den alten Cellerar ehrerbietig zu begrüßen. Zu seiner Überraschung aber stand nicht Eugenius, sondern ein anderer, jüngerer Mönch ihm gegenüber. »Ich höre!«, sagte dieser schroff.
Wernar erschrak über diesen Tonfall und noch mehr über den durchdringenden Blick, der sich auf ihn richtete. »Äh, eigentlich wollte ich zu Bruder Eugenius«, stammelte er eingeschüchtert.
»Bruder Eugenius ist krank. Ich bin Bruder Anselmus und vertrete ihn«, behauptete der andere. Er war von großer Gestalt, was Wernars Unbehagen noch steigerte, musste er doch den Kopf weit in den Nacken legen, um den schrecklichen Blick erwidern zu können. Bruder Anselmus hatte das Gesicht eines Asketen, hager, schmal, die Nase höckrig. Vergeblich versuchte Wernar, sich diesen Menschen lachend oder auch nur schmunzelnd vorzustellen. Und mit einem Mal wurde ihm klar, dass der strenge Mönch ihm Schwierigkeiten bereiten würde.
»Ich komme aus Wallersheim, Frater. Mein Vater Radulf schickte mich, um eine Ziege abzuliefern. Doch leider ...«
Die Augen des Mönches verengten sich zu schmalen Schlitzen. Wernar rang nach Worten.
»Nun?«, drängte Anselmus.
»Wölfe! Sie haben die Ziege unterwegs gerissen!«
»Wölfe? Hast du dummer Kerl denn nicht auf das Tier aufgepasst?«
»Doch, Frater. Gewiss.«
»Gewöhnlich bleiben Wölfe dem Vieh fern, wenn Menschen in der Nähe sind.«
Wernar unterdrückte einen Stoßseufzer. Was sollte er diesem gestrengen Ordensmann bloß sagen? Unmöglich konnte er von seinem Stelldichein mit Trudi berichten, nie und nimmer hätte der andere Verständnis dafür gehabt. Was wusste ein Mann wie Anselmus schon über Frauen? Wahrscheinlich unterdrückte er seine männlichen Triebe durch stundenlange Gebete. Oder durch Selbstkasteiung. Wernar stellte sich vor, wie Anselmus sich mit Rutenstreichen züchtigte.
»Ich erwarte deine Erklärung, Bursche!«
»Nun äh, diese Wölfe scherten sich nicht um meine Anwesenheit, Frater. Sie waren plötzlich da, wie aus dem Erdboden gewachsen. Und stürzten sich auf die Ziege. Natürlich versuchte ich sie zu vertreiben, aber ... es waren ihrer einfach zu viele!«
»Wie viele?«, forschte Anselmus.
»Ein ganzes Rudel, Frater. Fünfzehn, zwanzig Wölfe. Vielleicht auch mehr!«
Anselmus runzelte misstrauisch die Stirn. »Ein ungewöhnlich großes Rudel.«
»Ja, Frater.«
»Wo geschah das?«
»Etwa auf halber Strecke, Frater. Im Wald.«
»Und dich ließen sie unbehelligt?«
»Ein paar von ihnen versuchten auch mich anzugreifen. Aber ich wehrte mich aus Leibeskräften. Mit einem Holzknüttel schlug ich auf die Biester ein, bis sie von mir abließen.«
»Wie mutig von dir!«
»Was sollte ich tun? Es ging ums Leben! Nur die Ziege ... für die konnte ich leider nichts mehr tun.«
Der Mönch schwieg eine Zeitlang, ließ Wernar aber nicht aus den Augen. Wernar spürte, wie aus all seinen Poren der Schweiß drang. Hatte er zu dick aufgetragen? Würde Anselmus ihm die Geschichte abkaufen? Nun, sein Bericht war ja immerhin nicht gänzlich gelogen, waren es doch tatsächlich Wölfe gewesen, die ihn um die Ziege gebracht hatten. Wenn auch nur zwei.
»Schwöre, dass du die Wahrheit gesagt hast!«, befahl Anselmus schließlich mit drohender Stimme.
»Wie?«
»Schwöre beim Himmel, dass es sich so zugetragen hat, wie du es berichtet hast!«
»Ich schwöre es, Frater.« War es ein Meineid, der da über seine Lippen kam? Und wenn schon, dachte er. Hauptsache, dieser ärgerliche Mönch ließ ihn endlich in Ruhe.
»Und jetzt verschwinde!« Anselmus’ Aufforderung war wie eine Erlösung für Wernar. Er verbeugte sich hastig vor dem Ordensmann und schickte sich an, den Raum zu verlassen. »Wir erwarten von deinem Vater eine neue Ziege binnen drei Monaten!«, rief Anselmus ihm nach.
Als der Bursche verschwunden war, rieb sich der Mönch nachdenklich das Kinn. Dann verließ auch er den Raum und suchte die Wirtschaftsgebäude auf. Vor den Stallungen traf er den jungen Knecht, nach dem er Ausschau gehalten hatte. Er winkte ihn zu sich heran.
»Unweit von hier treibt sich ein räuberisches Wolfsrudel herum«, erklärte Anselmus knapp. »Der alte Victor soll sich um sie kümmern. Finde ihn und schick ihn her zu mir.«
»Das dürfte nicht schwierig werden. Ich brauche nur sämtliche Wirtsstuben der Umgebung nach ihm abzusuchen.« Das Grinsen erstarb auf den Lippen des Knechts, als der strenge Blick des Mönchs ihn regelrecht zu durchbohren schien.
»Anstatt törichte Reden zu halten, solltest du dich unverzüglich auf den Weg machen. Denn spätestens übermorgen will ich den Wolfsjäger hier sehen.«
Endlich war sie satt. Das Fleisch der Ziege war das Köstlichste, was die Wölfin seit langem gefressen hatte. Die Welpen, die sie säugte, verlangten ihr alle Kräfte ab. Doch nun, da sie gesättigt war, fühlte sie sich in der Lage, die Enge der Höhle für eine Weile zu verlassen, um einen Spaziergang zum Bach zu unternehmen. Es plagte sie großer Durst, und schon allein der Gedanke an das kühle Wasser ließ sie vor Begehren winseln. Die beiden Rüden, die ihr das opulente Mahl verschafft hatten, blieben bei den Welpen zurück.
Sie genoss die Frühlingssonne, die warm vom Himmel schien. Bis zum Bach war es nicht weit. Ohne Eile legte sie den Weg dorthin zurück, es war eine Wohltat, sich die Läufe zu vertreten. Sie erblickte eine arglose Wühlmaus, die unmittelbar vor ihr aus dem Erdreich kroch. Vermutlich wäre es ein Leichtes gewesen, sie zu fangen und als Nachspeise zu verzehren, doch die Wölfin zog es nicht einmal in Betracht, das unvorsichtige Tier zwischen die Fänge zu kriegen. Zu satt hatte das Ziegenfleisch sie gemacht, und magere Mäuse hatte sie in letzter Zeit genug fressen müssen.
Am Bach angelangt, suchte ein erschrockenes Reh vor ihr das Weite; mit hastigen Sätzen verschwand es im Dickicht. Die Wölfin aber stieg in das kühle Wasser, das ihr bis zum Bauch reichte. Dann labte sie sich nach Herzenslust. Mehrmals unterbrach sie ihr Tun, um ihren Blick schweifen zu lassen. Westwärts lichtete sich der Wald und gab den Blick auf Wiesen und Felder frei. Irgendwo dort hinten schimmerten die weißen Umrisse eines Gehöftes durch eine Baumgruppe. Doch Menschen witterte sie in unmittelbarer Nähe nicht. Es drohte ihr keine Gefahr. Beruhigt senkte sie den Kopf und widmete sich erneut der Wasseraufnahme.
Endlich war ihr Durst gestillt. Sie verließ das Wasserbett, schüttelte sich kräftig und trat mit der selben Gemächlichkeit, mit der sie hierher gekommen war, den Rückweg zum Bau an. Sicher warteten die Rüden schon mit Ungeduld auf ihre Wiederkehr, denn die Welpen – sieben Wochen waren seit der Geburt nun vergangen – hatten derzeit nur Unsinn in ihren drolligen Köpfen. Zwar würden der Vater der Welpen und ihr Onkel es klaglos hinnehmen, dass man ihnen unentwegt in die Schwänze biss, doch es stand zu bezweifeln, dass solcher Schabernack ihnen Spaß bereitete, zumal die Jagd sie sehr ermüdet hatte.
Plötzlich hörte die Wölfin Stimmen. Menschliche Stimmen. Sie spitzte die Ohren. Die Stimmen näherten sich ihr unaufhaltsam. Rasch, doch jedes Geräusch vermeidend, stahl sie sich ins Unterholz. Erst als die beiden Frauen mit den Körben vorübergezogen und ihre Stimmen kaum noch zu vernehmen waren, wagte sie sich wieder aus ihrem Versteck hervor. Zügiger als vorhin setzte sie ihren Weg fort.
1.
Ludwig liebte den Frühling, die Zeit zwischen Aussaat und Ernte, wenn die Tage länger und wärmer wurden. Das Feld war bestellt, würzige Düfte lagen in der Luft, und nun war endlich Zeit für all die Dinge, die sonst unverrichtet blieben. Seit Weihnachten, als schwere Schneelasten das Dach des Schafstalles eingedrückt hatten, waren Ludwig und sein Vater noch nicht dazu gekommen, den Schaden gänzlich zu beseitigen. Bis in den März hinein hatten neue Schneefälle die Reparaturarbeiten immer wieder erschwert. Als Frost und Schnee sich endlich verabschiedeten, waren andere Arbeiten vorrangig gewesen. Jetzt aber, da das Feld gepflügt und die Saat gesät war, konnte man sich getrost dem Schafstall widmen. Gerwin, der Vater, hatte beschlossen, das Strohdach durch ein hölzernes Dach zu ersetzen. Von den Mönchen der Abtei Prüm hatte er sich die Erlaubnis eingeholt, im nahen Wald einen Baum zu fällen. Eines Morgens zog er also los, und Ludwig war selig, ihn begleiten zu dürfen. Der Vater beauftragte ihn, den Ochsen vor den zweirädrigen Karren zu spannen, mit dem sie das geschlagene Holz später heimwärts transportieren würden.
Der vierzehnjährige Ludwig nutzte jede Gelegenheit, die Enge des heimischen Hofes in Walamar zu verlassen. Manchmal glaubte er im Stillen, für das Leben eines Bauern nicht geschaffen zu sein. Glücklicher war er in der freien Natur, dort, wo keine Zwänge auf ihm lasteten, wie er glaubte. Im Wald fielen die Sorgen des Alltags von ihm ab. Aber er hütete sich, dies den Eltern gegenüber einzugestehen, denn wahrscheinlich hätte es sie gekränkt, vielleicht sogar empört.
Gerwin und sein Sohn wurden begleitet von Reco, einem mittelgroßen, schwarzen Hund, der ebenfalls über die willkommene Abwechslung glücklich zu sein schien, denn bellend und schwanzwedelnd lief er ihnen voraus. Nach kurzem Fußmarsch erreichten sie eine Gruppe bewaldeter Hügel. Gerwin blieb stehen und betrachtete nachdenklich die Bäume des Waldrandes. Dann erkor er eine hohe Buche für sein Vorhaben aus.
»Die nehmen wir«, verkündete er seinem Sohn. »Nicht zu dick, der Stamm, aber lang genug. Wird reichen für das Dach!«
Ludwig war enttäuscht, weil sie nicht tiefer in den vom Frühling eroberten Wald eindringen würden. Gleichzeitig sah er ein, dass es so sinnvoller war, schließlich mussten sie das Holz des gefällten und zerlegten Baumes später noch heimwärts transportieren. Sie ließen den Ochsen samt Karren ein wenig abseits stehen und machten sich ans Fällen der Buche.
Derweil erkundete Reco neugierig die Umgebung. Neidisch linste Ludwig dann und wann zu ihm hinüber, doch irgendwann war der Hund im Wald verschwunden und kam nicht wieder zum Vorschein.
Vater und Sohn arbeiteten schweigend mit Beil und Säge, und es dauerte nicht lange, bis der Baum krachend zu Boden stürzte. Der vor sich hindösende Ochse schaute halb erschrocken, halb verärgert zu ihnen herüber, bevor er seinen Schlummer fortsetzte. Gerwin wischte sich mit dem Hemdsärmel den Schweiß aus dem Gesicht, das mehr Falten aufwies, als sein wahres Alter vermuten ließ.
»Das wäre geschafft«, meinte Ludwig gut gelaunt.
»Nichts ist geschafft«, brummte der Vater. »Zerlegen wir ihn!«
Ludwig unterdrückte einen Seufzer. Der Vater scherzte nie. Immer war er bitterernst.
Sie begannen die Äste des gefällten Baumes abzusägen. Ludwig beobachtete den Vater aus seinen Augenwinkeln. Wie verbissen er wirkte! Ludwig überlegte, wann er ihn zum letzten Mal hatte lachen sehen. Solchermaßen unkonzentriert, glitt das Blatt der Säge in seinen linken Daumen. Erschrocken schrie er auf.
»Was ist denn?«, fragte Gerwin ungehalten.
Statt einer Antwort reckte Ludwig die verletzte Gliedmaße in die Höhe. Blut rann aus einer tiefen Wunde und tropfte unaufhörlich zu Boden.
»Tölpel, wieso passt du nicht auf? Zeig mal her!« Gerwin nahm den Daumen in Augenschein. »Bis zum Knochen«, sagte er kopfschüttelnd, riss einen Streifen Stoff von seinem Hemdsärmel und wickelte diesen fest um die Verwundung. »Ab, nach Hause mit dir! Die Mutter wird dir einen ordentlichen Verband machen!«
Das aber war Ludwig äußerst peinlich. Er hatte sich angestellt wie ein tollpatschiger Knabe, und es widerstrebte ihm, den Vater allein weiterarbeiten zu lassen.
»Lass nur, Vater. Es wird schon gehen.«
»Tu, was ich dir sage! Geh!«
Widerspruch war zwecklos. Wenn Vater etwas wollte, dann hatte es so zu geschehen, doch die Entscheidungen, die er traf, waren immer selbstlos und nur zum Wohl der Familie. Zumindest behauptete das die Mutter. Und immerhin hatte er ja zum Wohl des Sohnes sogar sein Hemd zerrissen. Er würde es künftig nur noch im Sommer tragen können.
»Gut, aber wenn sie mich verbunden hat, komme ich zurück«, versprach Ludwig und schielte nach Reco, in der Hoffnung, er würde ihn heimwärts begleiten. Der Hund aber war nirgends auszumachen, also machte er sich allein auf den Weg.
Sein Daumen hatte heftig zu pochen begonnen, doch er schenkte dem Schmerz keinerlei Beachtung. Bald schon sah er in der Ferne den Hofverband Walamar. Neben dem Hof seiner Eltern gab es ein halbes Dutzend weiterer Höfe, die allesamt der Abtei Prüm unterstanden. Von den Dächern der Häuser stieg heller Rauch in den fast wolkenlosen Himmel.
Die Tür zum Haus war angelehnt. Ludwig hörte die Stimme seiner Mutter und die eines Mannes. Gab es einen Besucher? Ludwig verharrte vor der Tür und lauschte. Radulf, einer der Nachbarn und ein guter Freund des Vaters, war offenbar gekommen, um sich etwas auszuborgen. Ludwig stieß einen leisen Fluch aus. Es passte ihm überhaupt nicht, dass Radulf nun erfahren würde, welches Missgeschick ihm zugestoßen war. Zwangsläufig würde es nämlich dann auch Wernar, Radulfs Sohn, mitbekommen. Wernar war nur ein Jahr jünger als Radulf, und es verband die beiden jungen Männer, wenn überhaupt, nur eine oberflächliche Kameradschaft. Wernar wusste stets alles besser, es gab so gut wie nichts, was zu tun er nicht imstande war. Er war ein unverbesserlicher Angeber, und Ludwig hasste es wie Bauchschmerzen, seine neunmalklugen Ratschläge mitanhören zu müssen. Die Mädchen des Ortes sahen das offenbar anders, es gab wohl keine, die nicht für ihn geschwärmt hätte.
Indes, lamentieren half nichts, das Unglück war geschehen, und schließlich hatte er dem Vater versprochen, bald zurückzukehren. Tief Luft holend, schickte er sich an, das Haus zu betreten, aber etwas hielt ihn zurück. Es war Radulfs Tonfall, der ihm plötzlich merkwürdig vorkam. Er spitzte die Ohren.
»Warum stellst du dich so an?«, hörte er den Nachbarn fragen. In seiner Stimme lag verzweifelter Ärger.
»Was fragst du?«, erwiderte die Mutter kalt. »Die Zeit lässt sich nicht zurückdrehen.«
Radulf schnaufte. »Wir beide können es – wenn wir nur wollen!«
»Nein, wir können es nicht. Nimm deine Hand weg, Radulf. Warum jetzt, nach so langer Zeit?«
»Weil wir zu lange geschwiegen haben. Letzte Nacht, da habe ich von dir geträumt. Da wurde mir klar, dass du immer noch die Frau meines Herzens bist.«
»Unsinn. Träumen sollte man nicht glauben. Nie!«
»Du hast Recht, es war nicht der Traum. Eigentlich war es mir immer schon klar, Gerberga. Nicht ein Tag ist vergangen, an dem ich dich nicht begehrt hätte.«
»Wie ein liebestoller Jüngling redest du. Wir sind seit vielen Jahren verheiratet, Radulf.«
»Aber nicht nach unserem Willen. Die Oberen zwangen uns. Nach unseren Wünschen hat nie jemand gefragt.«
»Mag sein, dass es so war. Aber nun ist alles anders. Ich liebe Gerwin. Und ich liebe die Kinder.«
»Gerberga ...!«
»Besser, du gehst jetzt!«
»Nein. Sag mir zuerst, dass ich dir nichts mehr bedeute. Sag es mir frei und offen ins Gesicht.«
»Wie du willst: Du bedeutest mir nichts mehr, Radulf.«
»Das ist gelogen.«
»Geh! Willst du alles zerstören, was wir uns aufgebaut haben?«
»Niemand braucht etwas davon zu erfahren. Komm!«
»Nein!«, schrie sie.
Ludwig, der fassungslos gelauscht hatte, betrat die Stube. Verwirrung, Wut und Entgeisterung standen ihm ins Gesicht geschrieben. Radulf, der den Eintretenden hörte, trat hastig zwei Schritte zurück, doch selbst der Einfältigste hätte bemerkt, dass er im Begriff gewesen war, Gerberga zu umarmen. Gerberga wischte sich eine Haarsträhne aus der Stirn und widerstand dem Impuls, beschämt zu Boden zu blicken.
Radulf räusperte sich. »Ah, sieh mal einer an. Da hat sich wohl jemand verletzt«, sagte er mit gequältem Grinsen.
»Alles in Ordnung, Mutter?«, fragte Ludwig, ohne dem Nachbarn Beachtung zu schenken.
»Natürlich, warum denn nicht? Ganz im Gegensatz zu dir, wie es aussieht. Lass mich raten, du hast dich mit der Säge verletzt.« Die Mutter wirkte wieder völlig beherrscht.
»Ich geh dann mal wieder.« Radulf hatte es plötzlich sehr eilig, das Haus zu verlassen. »Mach dir nichts draus, Junge. Kann passieren. Der Daumen wird schon wieder werden.«
Mit finsterem Blick sah Ludwig ihm hinterher.
»Na, dann zeig mir mal deine Verletzung, du Unglücksrabe.« Gerberga drückte ihn nieder auf einen Hocker und entfernte vorsichtig den Verband, den Gerwin angelegt hatte.
Ludwig musterte sie mit zusammengekniffenen Augen. Seine Mutter war immer noch unglaublich hübsch, obwohl sie fast dreißig Jahre zählte und fünf Kinder ausgetragen hatte, von denen drei das erste Lebensjahr nicht überlebt hatten. Ihr Haar war wellig und blond, so wie Ludwig sich in seiner Kindheit das Haar der Elfen vorgestellt hatte. Sie hatte blaue Augen und volle, rote Lippen – kein Wunder, dass Radulf Gefallen an ihr fand, zumal sein eigenes Weib Irmgard eher Ähnlichkeit mit einem Kerl hatte. Dennoch war es unfassbar für Ludwig, was er eben vernommen hatte.
»Was wollte Radulf hier?«, fragte er gepresst.
Seine Mutter blieb scheinbar gelassen. »Er wollte nur Bescheid geben, dass die Männer aus Walamar sich nächste Woche zum Kloster begeben sollen, um dort die Gräben zu säubern.«
Dies mochte der Wahrheit entsprechen, denn zum Säubern der Gräben riefen die Mönche ihre Hintersassen in jedem Frühjahr herbei. Den wirklichen Anlass von Radulfs Besuch aber verschwieg ihm die Mutter. Merkte sie ihrem Sohn denn nicht an, dass er alles mit angehört hatte? Warum tat sie so, als sei nicht das Geringste vorgefallen?
»Da hast du dich aber ganz ordentlich verletzt«, sagte sie, als die Wunde unter dem Verband zum Vorschein kam. Ludwig biss auf die Zähne. »Und dein Vater hat sein gutes Hemd für dich geopfert.«
»Warum wollte Radulf dich umarmen?«, platzte es aus Ludwig heraus.
»Mich umarmen? Was redest du da, dummer Junge?« Noch immer blieb sie beherrscht, schüttelte lächelnd den Kopf, als habe ein Kind etwas Unsinniges dahergeplappert.
Ludwig hasste es, wenn sie so mit ihm sprach. Es gab Burschen in seinem Alter, die waren schon verheiratet, hatten Kinder in die Welt gesetzt. Aber es war mehr als offenkundig, dass die Mutter über das Vorgefallene zu schweigen wünschte. Ludwig sah ein, dass es keinen Sinn machte, weiter auf sie einzureden.
»Wo ist eigentlich Gudrun?«, fragte er, während Gerberga in einer Holzkiste nach Arzneien suchte.
»Auf der Weide, bei den Schafen. Und jetzt halt still!« Sie drückte ihm ein getrocknetes Lindenblatt auf die Wunde und begann den Daumen wieder zu verbinden. Sie tat es sanft und mit Gefühl. »Du solltest dich heute schonen«, erklärte sie, »damit die Wunde zur Ruhe kommt.«
»Unmöglich. Vater braucht meine Hilfe.«
»Er wird es schon verstehen. Ich werde Gudrun zu ihm schicken.«
»Kommt nicht infrage. Ich gehe selbst!«
Schlecht gelaunt verließ er das Haus. Wenn die Mutter ihm schon nicht anvertrauen wollte, was zwischen ihr und Radulf vorgefallen war, dann tat er ihr erst recht nicht den Gefallen, ihren fürsorglichen Ratschlägen nachzukommen. Schließlich hatte er sich kein Bein gebrochen.
Draußen eilte seine Schwester Gudrun ihm entgegen. Gudrun war ein Jahr jünger als Ludwig und glich ihrer Mutter auffallend, abgesehen von den unzähligen Sommersprossen, die gleichmäßig über ihr Gesicht verteilt waren. Als Kinder hatten sie oft miteinander gestritten, doch nun, da beide praktisch erwachsen waren, empfanden sie eine echte geschwisterliche Zuneigung für den anderen.
»He, Lupus!«
Irgendwann hatte Ludwig aufgehört, sich über den Kosenamen aufzuregen, mit dem er einst von der Schwester bedacht worden war. Seit seiner Geburt nämlich hatte er eine dicht behaarte Stelle unter dem linken Schulterblatt, groß wie ein Handteller und merkwürdig wie ein gefrorener Teich im Sommer. Jedenfalls meinte Gudrun, dass der Bruder etwas Wölfisches an sich habe. Immerhin nannte sie ihn nur dann Lupus, wenn kein Fremder in der Nähe war, um ihn nicht in Verlegenheit zu bringen. Denn Ludwig hütete das seltsame Mal wie ein dunkles Geheimnis.
»Sommersprosse! Ich dachte, du wärst bei den Schafen!«
»Und ich dachte, du fällst Bäume. Aber wie ich sehe, ist dir was dazwischengekommen.« Mit dem Kinn deutete sie auf den Verband an seiner Hand.
»Halb so wild.«
»Willst du mit mir tanzen?«, fragte sie vergnügt.
»Tanzen?«
»Linkes Bein, rechtes Bein, einmal drehen ... du weißt schon.«
»Die Frühlingssonne hat dir wohl zu lange aufs Gehirn geschienen.«
»Ich hab einfach nur gute Laune. Stört dich das?«
Er überlegte, ihr von dem belauschten Gespräch zu erzählen. Dann wäre es wohl vorbei mit ihrer guten Laune. Aber vielleicht war es für alle Beteiligten besser, die Angelegenheit nicht weiter aufzubauschen. Und Radulf würde es sicher nicht noch einmal wagen, der Mutter Avancen zu machen. Schließlich hatte sie ihm ja klipp und klar gesagt, dass sie nichts von ihm wissen wollte.
»Für deine gute Laune gibt es bestimmt einen Grund, Sommersprosse.«
»Den gibt es. Willst du ihn hören?«
»Nö.«
»Oh ja, du willst es. Ganz bestimmt.«
»Dann rede endlich, bevor’s dunkel wird. Vater wartet auf mich.«
Sie wippte mit den Füßen, strich sich durch die langen, blonden Haare und blickte versonnen Richtung Himmel. »Er hat mich gefragt!«
»Wer hat dich was gefragt?«, wollte Ludwig wissen, obwohl ihm schwante, wovon seine Schwester sprach.
»Wernar! Er will mich heiraten.«
Ludwig ächzte leise.
»Zeigst du mir so deine Freude, Lupus?«
»Nichts für ungut, Sommersprosse. Aber du weißt, dass Wernar nicht unbedingt mein Abgott ist.«
»Aber meiner.«
»Ich befürchte es.«
»Hast du schon von seiner Heldentat gehört? Ein ganzes Wolfsrudel hat er in die Flucht geschlagen.«
»Gewiss, gewiss. Schade nur, dass trotz seines Heldenmutes die Ziege dran glauben musste. Hast du denn keine Angst vor all den anderen Mädchen, die ihn anhimmeln?«
»He, höre ich da etwa Neid in deiner Stimme? Wernar hat gesagt, dass er nur Augen für mich hat.«
»Ach ja?«
»Glaubst du, dass Vater einwilligen wird?«
»Einwilligen? Worin?«
»In die Hochzeit natürlich.«
»Na ja, immerhin gäbe es einen Esser weniger am Tisch.«
Sie kniff ihm mit gespielter Verärgerung in den Bauch.
»Aber nicht nur die Väter müssen einverstanden sein«, fuhr er fort. »Schließlich hat der Abt da auch noch ein gehöriges Wörtchen mitzureden.«
»Er wird schon nichts dagegen haben.«
Abermals dachte Ludwig über das Gespräch zwischen Mutter und Radulf nach. Noch immer konnte er sich nicht damit abfinden, dass die beiden einmal ein Liebespaar gewesen waren. Doch der damalige Abt hatte ihren Plänen offenbar einen Strich durch die Rechnung gemacht. Im Stillen wünschte sich Ludwig, dass Gudrun und Wernar Gleiches widerfuhr. Gab es denn keinen besseren Mann für seine Schwester als diesen Angeber? Was fand sie nur an ihm? Andererseits: Welches Recht hatte er, die Gefühle seiner Schwester zu bewerten?
»Und äh ... wann soll es soweit sein?«
Sie zuckte mit den Schultern. »Bald!«
»Na, dann mal viel Glück. Ich muss jetzt wieder an die Arbeit.«
Sie hielt ihn fest. Fragend sah er sie an.
»Freust du dich denn überhaupt nicht für mich?«
»Wenn du tatsächlich glücklich bist, freue ich mich. Wenn ich deinen Verlust auch bedauern würde.«
Sie küsste ihn auf die Wange.