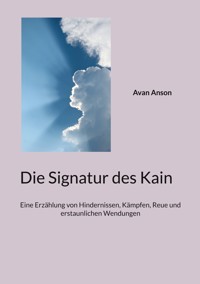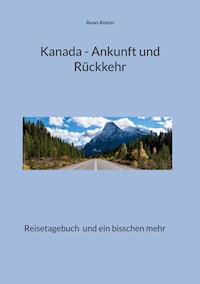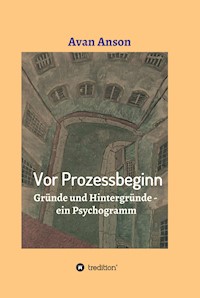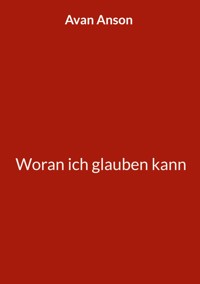
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Hinsichtlich existenzieller Fragen des Glaubens und Lebens stellt der Autor seine Gedanken und Überzeugungen zur Diskussion. Zwischen den Polen von Zweifel und Gewissheit, von kindlichem Glauben und erwachsener Spiritualität, entfaltet sich eine Reise durch die großen Weltreligionen und philosophischen Strömungen. Der Autor lädt den Leser ein, sich mit den grundlegenden Fragen des menschlichen Daseins auseinanderzusetzen: Wie beeinflussen Glaube und Vernunft unser Handeln? Welche Rolle spielt der Zweifel im Glaubensprozess? Und wie kann man in einer zunehmend säkularen Welt einen persönlichen Zugang zum Glauben finden? Dieses Buch richtet sich an alle, die sich auf der Suche nach Sinn und Orientierung befinden, unabhängig davon, ob sie einer bestimmten Religion angehören oder nicht. Es ist eine Einladung zur Reflexion über das eigene Leben und die eigenen Überzeugungen. Ein Werk für Menschen, die bereit sind, sich auf eine intellektuelle und spirituelle Reise zu begeben, ohne dabei einfache Antworten zu erwarten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 505
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die folgenden Abhandlungen sind das Ergebnis einer tiefgreifenden Selbstreflexion über die existenziellen Fragen meines Lebens. Mit zunehmendem Alter wächst das Bedürfnis, den eigenen Glauben und dessen Bedeutung zu hinterfragen. Das Schreiben bot mir die Möglichkeit, meine Gedanken zu ordnen und mich mit Themen auseinanderzusetzen, deren Relevanz sich im Laufe des Lebens wandelt.
Diese Texte dienen als Werkzeug meiner persönlichen Entwicklung und Klärung. Sie spiegeln - wenn auch unvollständig - meine geistige Reise wider. Obwohl ursprünglich für mich selbst verfasst, stelle ich sie nun der Öffentlichkeit zur Verfügung, in der Überzeugung, dass diese Reflexionen auch für andere von Bedeutung sein könnten. Immer wieder habe ich erfahren dürfen: "Der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott; er wird dich nicht verlassen noch verderben." (5. Mose, Kapitel 4).
In Glaubensfragen verzichte ich bewusst auf korrekte bibliografische Angaben. Einerseits, um mich nicht der Kritik auszusetzen, relevante Literatur übersehen zu haben. Andererseits, um mich direkt mit meinen eigenen Überzeugungen zu konfrontieren und meine Haltung zu verschiedenen Glaubensaspekten zu klären.
Meine Überlegungen bewegen sich zwischen Vagheit und Gewissheit, zwischen Zweifeln und festen Überzeugungen. Dabei wurde mir immer wieder bewusst, dass Überzeugungen oft auf Erfahrungen und Erkenntnissen beruhen, auch wenn sie nicht immer beweisbar sind. Manchmal ist es notwendig, an etwas zu glauben, um handlungsfähig zu bleiben, selbst wenn absolute Gewissheit fehlt.
Bei der Erstellung dieser Texte nutzte ich künstliche Intelligenz als Inspirationsquelle und zur Informationssammlung, insbesondere hinsichtlich der Gedanken großer Persönlichkeiten zu ausgewählten Themen. Die finale Formulierung erfolgte dann in meinen eigenen Worten.
Diese Abhandlungen stellen eine Art Bestandsaufnahme am Ende meines Lebens dar. Mein Glaube war nie statisch, sondern unterlag immer wieder Zweifeln und Veränderungen. Besonders prägend war der Übergang vom kindlichen zum erwachsenen Glauben. Durch alle Phasen hindurch blieb mir mein Konfirmationsspruch als Schutzschild und Wegweiser erhalten: "Fürchte dich nicht! Denn ich bin mit Dir und will Dich segnen."
Frau Dr. Elisabeth Drüe hat große Sorgfalt aufgebracht beim Lesen des Manuskriptes. Ihre orthografischen und so manche stilistische Korrekturvorschläge waren mir stets willkommen und haben mich motiviert. Dafür bin ich ihr sehr dankbar.
Das Manuskript hätte ich in vertretbarer Weise bei BoD nicht veröffentlichen können, wenn sich Frau Petra Horlbeck nicht mit ihrer Erfahrung und Kompetenz der Mühseligkeit des Vorhabens angenommen hätte. Ein herzliches Dankeschön für die Fertigstellung in der von Bod gewünschten Weise.
Inhaltsverzeichnis
Teil 1
Glauben
Gott
Jesus
Heiliger Geist
Teil 2
Advent und Weihnachten
Passionszeit und Ostern
Himmelfahrt und Pfingsten
Teil 3
Teufel und Hölle
Sünde und ein strafender Gott
Leid und Verzweiflung
Verurteilen und Trost
Verzeihen und Vergeben
Gnade und Barmherzigkeit
Vertrauen
Liebe
Teil 1
dieses Buches enthält die Kapitel
Glaube
Gott
Jesus
Heiliger Geist.
Der Text des 1. Kapitels erläutert den christlichen Glauben als Fundament der Trinität und betont deren untrennbare Verbindung.
Im 2. Kapitel wird die grenzenlose und bedingungslose Liebe Gottes hervorgehoben, die als zentrale Kraft im Leben der Gläubigen wirkt und sie in ihrer Gemeinschaft stärkt.
Das Kapitel über Jesus Christus wird als Vermittler der Gnade Gottes dargestellt, dessen unverdiente Gunst den Gläubigen zuteil wird und sie in ihrem Glaubensleben begleitet.
Im 4. Kapitel wird der Heilige Geist als göttliche Kraft beschrieben, die den Gläubigen hilft, ein Leben nach Gottes Willen zu führen.
Glauben
Seit Menschen Gedenken haben sich Angehörige in allen Kulturen dieser Erde mit Glaubensfragen auseinandergesetzt. Dank der Entwicklung der Schriftsprache wurden solche Überlegungen festgehalten und an die Nachfahren weitergegeben.
In den Veden des Hinduismus wurden vor vielen tausend Jahren Hymnen, Gebete und philosophische Texte zusammengestellt. Sie sind die ältesten Bücher der Menschheit und wurden an den Ufern des Indus schriftlich niedergelegt. Darüberhinaus gelten sie als die ältesten und heiligsten Texte der hinduistischen Religionen. Die Veden sind wie ein uralter Brunnen, aus dem die Menschheit seit Jahrtausenden Weisheit schöpft. Der Begriff "Veda" stammt aus dem Sanskrit und bedeutet "Wissen". Sie sind verbindliche göttliche Offenbarungen und werden als ewig, ohne Anfang und Ende, und als Quelle aller hinduistischen Weisheit und Spiritualität betrachtet.
Zentrale Konzepte sind das Gesetz von Ursache und Wirkung, der Kreislauf der Wiedergeburten und der Erlösung aus diesem Kreislauf. Viele Wahrheiten anderer Religionen lassen sich letztlich auf die Veden zurückführen. Sie enthalten tiefsinnige Gedanken über die Einheit von individuellem Selbst und universeller Weltseele. Inhalte und Text dieser großartigen Schriften - wenn man von Hinduismusforschern absieht - dem modernen Menschen weitgehend unbekannt. So ist beispielsweise das Epos "Gita" nicht nur ein Lehrtext der hinduistischen Religion, sondern ebenso eine Anschauung, wie man mit seinem Gegenüber einen Achtung gebietenden Diskurs führt - eine Gesprächskultur, der es heute weitgehend ermangelt, besonders in den Talkshows.
Die hinduistische Glaubenslehre ist handlungsorientiert. Gute Taten führen zu einem besseren Wiedergeburtsschicksal, schlechte Taten zu einem schlechteren. Erlösung bedeutet das Entrinnen aus diesem Kreislauf. Wahrheitsliebe, Gewaltlosigkeit, Keuschheit und Mitleid sollen ein rechtschaffenes Leben des Gläubigen leiten. Wer wollte diese Tugenden nicht auch heute noch als ethische und moralische Prinzipien des gemeinschaftlichen und gesellschaftlichen Miteinanders infrage stellen? Diese Tugenden sind wie Leuchttürme in stürmischen Zeiten - sie weisen uns auch heute noch den Weg zu einem ethischen Leben. Um so verwunderlicher ist, dass diese moralischen Gebote heutzutage weitaus weniger praktiziert werden. Ich meine, ein bisschen mehr über den eigenen Tellerrad zu schauen, wäre ein Schritt in Richtung mehr Gemeinschaft.
Vom Indus zum Jordan - die Reise des Glaubens führt uns nun zum Monotheismus des Judentums. Die Tora, also die ersten fünf Bücher des Alten Testaments, bilden die Glaubensbasis des Judentums. Sie wurden vor etwa 3.500 Jahren aufgeschrieben. Zentraler Bestandteil des jüdischen Glaubens ist der Monotheismus. Der eine Gott wird als Verheißung eines Retters geglaubt, wobei zuerst Menschen jüdischen Glaubens gerettet werden.
Diese axiomatischen Setzungen werden nicht von allen jüdischen Gelehrten bejaht. Manche betonen, dass alle Menschen vor Gott gleich sind. Die Vorstellung der Auserwählung kann zu Überheblichkeit und Abgrenzung gegenüber Nichtjuden führen, was von nicht wenigen Juden kritisch gesehen wird.
Die Auserwählung und Rettung der Juden wird begründet, mit dem Bund, den Gott mit dem Erzvater Abraham schloss. Der Auszug des jüdischen Volkes aus der ägyptischen Sklaverei wird als weiteres Argument genannt. Schließlich wird geltend gemacht, dass das jüdische Volk eine lange Geschichte der Verfolgung und Vertreibung überlebt hat, was als Beweis der göttlichen Auserwählung gesehen wird. - Mir ist nicht ersichtlich, was gerettet werden soll und worin die Rettung besteht.
Möglicherweise liegt in dieser Unbestimmtheit die Vielfalt unterschiedlicher Glaubensvorstellungen. In verschiedenen Prophezeiungen (vrgl. Jesaja) wird auf Jesus als den Retter verwiesen; zumindest werden diese Textstellen so gedeutet.
Wie soll jüdischer Glaube im Alltag praktiziert werden? Die zehn Gebote, die Gott Moses auf dem Berg Sinai gemäß den Tora-Texten gab, sind Verhaltensanweisungen für ein gottgefälliges Leben. Sie sind wie ein moralischer Kompass, der uns durch die Wirren des Lebens navigieren lässt. Dem gemäß sind wir gehalten, unsere Eltern zu ehren; nicht zu töten; nicht die ehelichen und eheähnlichen Beziehungen zu sabotieren; nicht zu stehlen; üble Nachrede, Beleidigungen, Verleumdung, oder Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener zu unterlassen; Fremdeigentum sowie Partner, Mitarbeiter oder Vorgesetzte, sowie alles, was der Nächste hat, zu begehren. - Diese Gebote regeln das Zusammenleben unter Menschen. Sie fordern Respekt vor Eltern, Leben, Ehe, Eigentum und Wahrheit. Begehrlichkeit und Neid sollen vermieden werden. Wie hilfreich wäre es, wenn wir - also nicht nur Juden, sondern vor allem Christen - sich diese Gebote zu eigen machten und im Alltag praktizierten. An ihren Taten werdet Ihr sie erkennen!
Die ursprünglich den Juden gegebenen Gebote wurden von Emanuel Kant vor etwa 250 Jahren als kategorischer Imperativ formuliert: "Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werden." Das bedeutet konkret: Prüfe, ob der Handlungsgrundsatz, gemäß dem du handelst, auch dann noch gültig wäre, wenn er von allen Menschen befolgt würde. Nur wenn du dir wünschen kannst, dass deine Maxime zu einem allgemein gültigen Gesetz wird, ist sie moralisch richtig.
Was sagen Ihnen diese Maxime? Kants kategorischer Imperativ ist wie ein ethischer Spiegel - er zwingt uns, unser Handeln im Licht universeller Gültigkeit zu betrachten. Muss man in einem religiösen Sinne glauben, um gemäß diesen Maximen zu leben? Ich meine nicht. Und doch gibt ein religiöses Glaubensverständnis gleich welcher Art ein Fundament, eine Orientierung, sich an diese Gebote zu halten. Diese Weisung sollten wir der Weisheit der jüdischen Religion verdanken. Wir werden sie vermutlich niemals vollständig einhalten. Was sollte uns aber aufhalten, uns von diesen Anweisungen leiten zu lassen? Würden wir uns bindend daran halten, wie stünde es dann mit kriegerischen Auseinandersetzungen, Korruption, unsere Mitmenschen zu täuschen, zu belügen oder zu hintergehen?
Festzuhalten ist somit, dass jüdische Glaubensvorstellungen eine Richtschnur, eine Handlungsanweisung und auch eine positive Sinngebung für unser eigenes Leben, aber auch für das friedliche Miteinander geben.
Was trägt die buddhistische Religion zum Glauben bei? Die ältesten Schriften entstanden etwa 100 v. Chr. in Sri Lanka. Lange Zeit zuvor wurden die Lehren lediglich mündlich überliefert. Buddha selbst formulierte vier Grundsätze, die dort als "edle Wahrheiten" bezeichnet werden. Sie beschreiben die menschliche Existenz und die Wege zur Erlösung. Der Buddhismus geht davon aus, dass Leben Leiden ist, deren Ursache im Verlangen begründet ist. Erst, wenn Menschen das eigene Verlangen reduzieren und im Idealfall abstellen, dann wird Befreiung vom Leiden möglich. Der Befreiungsweg ist achtfach: Der Mensch mag sich um Rechte Ansichten, Rechtes Denken, Rechte Rede, Rechtes Handeln, Rechter Lebenserwerb, Rechte Anstrengung, Rechte Achtsamkeit und Rechte Versenkung bemühen. Der Buddhismus mag dabei Hilfe und Stütze sein, denn er ist wie ein ruhiger See, der die aufgewühlten Wasser unseres Geistes zur Ruhe bringt.
Im Kern finden wir diese ethischen Grundsätze bereits im Hinduismus und im Judentum. Das Besondere an der buddhistischen Lehre sind allerdings geistige Übungen, die zur Befreiung vom Leid führen. Sie werden in den Schriften ausführlich beschrieben und sind im Kern meditative Versenkungen. Der oben genannte Achtfache Pfad ist aber keine Autobahn zur Erleuchtung, sondern ein verschlungener Waldweg, der Achtsamkeit bei jedem Schritt erfordert.
Es fällt auf, dass bei den verschiedenen praktischen Übungen durchgängig von "Recht" i.S.v. Richtig die Rede ist. Was aber ist richtig? Wer darüber nachdenkt, dem wird einfallen, das es sich um ein kategoriales Denken handelt, das Richtig versus Falsch, Wahr oder Unwahr udrgl. ist. Es steht nun aber außer Frage, dass mentale Prozesse nicht in diesen dichotomen Kategorien ablaufen. Allzu leicht verwechseln wir beispielsweise Wahr/Unwahr oder Richtig/Falsch mit Nützlich/Unnütz, sinnvoll/sinnlos funktionierend/dysfunktional oder hilfreich/schädlich. Übertragen auf Glaubensfragen ist es müßig, den einen, absoluten und richtigen Weg zum Glauben zu suchen. Unserem menschlichen Denken und der Realität entspricht eher ein Mehr oder Weniger. So sind denn die genannten acht Wege Heurismen für den Alltag. Für das Attribut "Recht" könnte besser "angemessen" stehen.
Die religiöse Basis des Islam ist der Heilige Koran. Er wurde in einem Zeitraum von 23 Jahren geschrieben. Im Jahr 610 n. Chr. habe der Prophet Mohammed im Alter von 40 Jahren die erste Offenbarung durch den Engel Gabriel in der Nähe von Mekka empfangen. Bis zu seinem Tod im Jahr 632 n. Chr. erhielt Mohammed weitere Offenbarungen, die er auswendig lernte und seinen Gefährten mündlich vortrug. Erst 20 Jahre nach Mohammeds Tod wurden seine Offenbarungen niedergeschrieben. Zwischen 700 und 900 n. Chr. lag der Koran dann als gesammeltes Buch vor. Für Muslime ist er die direkte, unveränderte Offenbarung Gottes. Wie in alle anderen monotheistischen Religionen glauben Muslime, dass es nur einen Gott gibt, der als Allah bezeichnet wird und dem sie sich völlig hingeben sollen. Der Koran ist nicht nur für Moslems wie eine Oase in der Wüste des Lebens - er bietet Erfrischung und Orientierung für die Gläubigen
Allah wird als der Schöpfer und Erhalter des Universums geglaubt. Er ist allmächtig, allwissend und barmherzig. Zudem wird Mohammed (Muhammad) als der Gesandte und Prophet Allahs Glauben geschenkt. Er ist der letzte und wichtigste Prophet, der die Offenbarungen Allahs empfing. Schließlich ist im islamischen Glaubensbekenntnis niedergelegt, das der Islam die wahre Religion ist, die Allah den Menschen offenbart hat. Der Glaube an den Jüngsten Tag und das Jenseits sind zentral. Jeder Mensch wird für seine Taten am Ende der Welt zur Rechenschaft gezogen. Muslime bekennen sich zum Islam als Glaubens- und Lebensweg. Bedeutsam ist die Existenz von Engeln, die Gott dienen und seine Botschaft den Muslimen überbringen.
Der Koran ist im Islam nicht die einzige Offenbarungsschrift. Die Thora, die Psalmen des Alten Testamentes und das Evangelium des Neuen Testaments sind gleichermaßen verbindlich für gläubige Muslime. Jesus wird wie beispielsweise Abraham oder Jeremia als Prophet Gottes verehrt, aber nicht als Sohn Gottes oder Erlöser gesehen.
Viele der vorgenannten Mitteilungen mögen für theologische Wissenschaftler relevant sein und Ansatzpunkte für einen theoretischen Diskurs bieten. Für meinen Glauben im Alltag sind die Gemeinsamkeiten von Judentum, Christentum und Islam bedeutsam. Alle drei Religionen glauben an den einen Gott als Schöpfer und Herrscher des Universums. Tora, Bibel und Koran sind je nach Religion zentrale Glaubensquellen. Und Gebete, Fasten und Wallfahrten spielen in allen drei Religionen eine wichtige Rolle. Zusammengefasst teilen der Islam, das Judentum und das Christentum als monotheistische Offenbarungsreligionen viele Grundlagen und Praktiken, auch wenn es auch Unterschiede gibt. Die Gemeinsamkeiten überwiegen. Judentum, Christentum und Islam sind wie Geschwister - sie mögen streiten, aber ihr gemeinsames Erbe ist unverkennbar.
Die ältesten schriftlichen Texte des Christentums stammen aus dem 1. und 2. Jahrhundert n.Chr. Sowohl das Alte als auch das Neue Testament sind die Glaubensgrundlage für christliche Menschen, wiewohl dem Neuen Testament die zentrale Bedeutung zukommt. Die Bibel als literarisches Gesamtwerk ist mit Abstand die am besten belegte Schrift des Altertums. Vom Neuen Testament gibt es mehr als 5.000 griechische Handschriften, vom Alten Testament über 10.000 Handschriften in Hebräisch und Griechisch.
An vielen Stellen des Neuen Testaments sind Ausführungen zum christlichen Glauben festgehalten. Hier sind einige zentrale Aspekte:
Im Mittelpunkt steht der Glaube an Jesus Christus, der als Gottes Sohn verehrt wird. In Folge seines Kreuzestodes habe er die Menschen von seinen Sünden erlöst und ihnen dadurch den Weg zu Gott vermittelt. Jesus als Messias ist somit die Grundlage des christlichen Glaubens.
Als Besonderheit des christlichen Glaubens wird die Rechtfertigung angesehen. Sie besagt, dass Menschen nicht durch ihre eigenen Taten oder Leistungen vor Gott bestehen können, sondern allein durch den Glauben an Jesus Christus und dessen Opfertod am Kreuz. Was hat das für Konsequenzen? Da wir Menschen vor Gott beständig versagen bzw. versagt haben - man spricht diesbezüglich von Sünde - können unsere Taten unsere Schuld nicht tilgen und uns nicht mit Gott versöhnen. Als Mittler zwischen Gott und uns hat Gott Jesus zur Erde gesandt. Indem wir an Jesus Christus und an seinen Kreuzestod glauben, empfangen wir Gottes Gnade und Vergebung. Unsere Sünden werden getilgt und wir werden vor Gott gerechtfertigt.
Also Rechtfertigung geschieht nur durch Glauben, nicht durch unsere Werke oder Leistungen. Sollen wir angesichts dessen die Hände in den Schoß legen und ausschließlich zu unserem Wohlgefallen leben? Unsere guten Taten sind allerdings Ausdruck unseres Glaubens, aber sie sind nicht die Grundlage unserer Erlösung. Rechtfertigung ist ein fortlaufender Prozess. Durch den Heiligen Geist werden wir verändert und wachsen in unserem Glauben. Einfach formuliert, kann man feststellen, dass Glaube ein Geschenk Gottes sei? Der neutestamentliche Glaube ist mehr als bloße Zustimmung zu den christlichen Glaubensinhalten. Er bedeutet Vertrauen auf Gott und Hingabe an ihn. Glaube als Weg der Nachfolge und damit Hoffnung auf Vollendung. Allerdings wird Gehorsam gegen Gott gefordert und die Bereitschaft, Leid und Verfolgung auf sich zu nehmen.
Wer das Neue Testament genau liest, wird feststellen, dass dort fast genauso viel vom Zweifel wie vom Glauben die Rede ist. Das Christentum ist halt dem Judentum vergleichbar wie ein vielstimmiger Chor - jede Stimme einzigartig, aber gemeinsam bilden sie eine harmonische Melodie des Glaubens.
Das führt zwangsläufig zu der Frage, Was soll ich machen, wenn ich nicht glauben kann? Wenn Glaube - innerhalb welcher der genannten Religionen auch immer - ein Angebot des Absoluten ist, liegt der Auftrag der Menschen vor allem darin, die Einladung anzunehmen und darauf so oder so zu antworten. In erster Linie betrifft der Glaube also nicht bestimmte Wahrheiten oder Verheißungen für die Zukunft, ja nicht einmal eine Erhellung der Existenz eines transzendenten Gottes. Der Glaube ist kein Mittel, dessen man sich bedient, um etwas zu erhalten. Er ist etwas viel Einfacheres, er ist schlichtes, stets staunendes Vertrauen: Bevor ich als im christlichen Glauben Lebender noch eine Bedingung erfülle, nimmt Gott mich neu in seine Freundschaft auf. Glaube ist eine reale und nicht theoretische Einladung. Es geht vorrangig nicht um Ideen, um das richtige Verständnis intellektueller Wahrheiten.
Wenn ich das hinterfrage, dann ist mir der Begriff Religion nicht sehr hilfreich, um den christlichen Glauben in seiner Einzigartigkeit zu beschreiben, auch wenn er einen „religiösen“ Aspekt hat, weil es sich um die Beziehung mit dem Absoluten handelt, das wir allgemein Gott nennen. Handelt es sich nach meinem Verständnis also um eine Form von Spiritualität? Ja, in dem Sinne, dass sie einen persönlichen Weg darstellt, der durch das Eintauchen in den Sinn der Existenz gekennzeichnet ist. Jedoch ist dieser Weg nicht allein dem individuellen Willen überlassen, er ist keine Ansammlung von Elementen, die ein jeder nach seinem persönlichen Interesse zusammenstellt.
Bisher wurde Glauben mit Bezug auf die religiösen Lehrtexte abgehandelt. Was aber haben große Persönlichkeiten von Glauben gehalten? Wie sind sie damit umgegangen. Und vor allem: Welche Bedeutung hat Glaube in ihrem Leben gehabt?
Auf die Antike bezogen, ist der Kirchenvater Augustinus von Hippo (354-430) zu nennen. In seinem Werk "Bekenntnisse" stellte er heraus, dass Glaube nicht ein für alle Male entweder vorhanden oder nicht vorhanden ist. Bei ihm lese ich mit großem Wohlwollen, dass Glaube ein Prozess voller Dynamik ist. Man kann nicht nicht glauben oder doch glauben. Zum anderen ist Glaube etwas, das in der Zeit sich verändert. Es gibt Zeiten, in denen Zweifel überwiegen; und es gibt Zeiten, da wirkt der Glaube in uns wie ein festes Fundament. Augustinus war der Auffassung, dass Glaube und Verständnis in einem wechselseitigen Verhältnis zueinander stehen.
Der Glaube wird als der Anfang postuliert, aber er soll durch Reflexion und Erkenntnis vertieft und gestärkt werden.
Wir können diese Dynamik bei Kindern beobachten: Je jünger sie sind, um so mehr vertrauen sie ihren Bezugspersonen. Sie glauben und sind voller Vertrauen, dass Erwachsene es gut mit ihnen meinen. Mir ist gut in Erinnerung, dass mein dreijähriger Sohn sich während Spaziergängen vor Fremden stellte und auf seine Weise grüßte: "Tuten Tag! Ich bin der Fanz. Und wer bist Du?" Das hatte jedes Mal ein Vergnügen der Erwachsenen zur Folge. Bis eines Tages ein älterer Spaziergänger unserem Franz nachäffte: "Tuten Tag! Du bis ein neugieriger Kerl, Fanz!" Unser Sohn kam weinend zu seinen Eltern und bedurfte des Trostes. Er hatte gelernt, dass Glaube an die unbegrenzte Offenheit gegenüber anderen nicht immer von Vorteil ist. Wir Erwachsenen sprechen in diesem Zusammenhang von Enttäuschung und meinen damit, dass unser Glaube wieder einmal in die Irre geführt worden ist.
Gelehrte des Mittelalters kümmerten sich vornehmlich darum, die Lehre vom rechten Glauben zu formulieren und in Einklang mit der Kirche zu bringen. Wie sein Lehrer in mente, Augustinus, sah auch Thomas von Aquino etwa 800 Jahre später den Glauben als einen dynamischen Prozess an, bei dem Glaube und Verständnis in einem wechselseitigen Verhältnis zueinander stehen. Der Glaube ist der Anfang, aber er soll durch Reflexion und Erkenntnis vertieft und gestärkt werden. Für Thomas ist der Glaube somit keine blinde Annahme, sondern eine Suche nach Einsicht in die göttlichen Geheimnisse. Diese Sichtweise entsprach ein halbes Jahrtausend lang der kirchlichen Auffassung von Glauben, wobei von der Kirche der rechte Glaube vorgegeben wurde.
In jeder Messe oder in jedem Gottesdienst gehört es zu den Obliegenheiten, dass die Gemeinde das Glaubensbekenntnis spricht. Provokativ ausgedrückt handelt es sich dabei um routinegemäßes Nachplappern eines sehr alten vorgegebenen Textes. Ein voll inhaltliches Bekenntnis, woran der Einzelne glaubt, ist es sehr wahrscheinlich nicht. Wenn ich beispielsweise nicht daran glauben kann, dass Jesus von Maria geboren worden ist, als sie noch Jungfrau war oder dass er tatsächlich den Kreuzestod erlitten hat, dann kann ich nur schweigen bei diesen Textstellen.
Nicht umsonst wird Thomas von Aquino als der herausragende Scholastiker bezeichnet.
Als Vertreter der Neuzeit ist unbedingt Martin Luther zu nennen. In seinem kleinen und großen Katechismus, aber auch in anderen seiner Schriften ging es ihm um den Glauben. Ein Katechismus ist bekanntlich ein systematischer Lehrtext, der die Grundlagen des christlichen Glaubens und der Lehre für Gläubige aufbereitet und vermittelt. Wiewohl Luther sich mit der katholischen und der evangelischen Sichtweise vom rechten Glauben durchaus kritisch auseinandersetzte, so war er dennoch letztlich in kirchlicher Denkweise verhaftet. Ich meine, er hat mehr über den Glauben geschrieben, als über die Art, wie man seinen individuellen Glauben festigt und dass Glaube schlussendlich eine Ressource ist, über das jedes Individuum verfügt. Die bereits genannte Rechtfertigungslehre mag dafür als Beispiel dienen.
Es verdient jedoch auch der Erwähnung, dass für Luther der Glaube keine bloße Kopfsache war, sondern eine "lebendige, verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade", die den Menschen fröhlich, mutig und voller Lust zu Gott macht. Solche Gedanken erwecken Optimismus, mit dem Glauben zu experimentieren. Wir sind zwar mehr geneigt, die Schwachstellen unseres Glaubens zu bedenken und kundzutun als seine Wegweisungen und Bewährungen uns vor Augen zu halten. Luther hätte wahrscheinlich gepredigt: "Hör doch nicht nur auf das, was man dir vom Glauben sagt und folge nicht irgendwelchen Vorgaben. Du profitierst vielmehr, wenn du in der Bibel suchst, was zu deinem Glauben passt. Die Bibel legt sich selbst aus. Sie ist die alleinige Autorität für den christlichen Glauben ist."
Das Zeitalter der Aufklärung wird in den meisten Quellen auf den Zeitraum von etwa 1650 bis 1800 datiert, mit einem Schwerpunkt auf den Zeitraum von ca. 1720 bis 1800. Wer hier nach Geistesgrößen des Glaubens recherchiert, wird zwangsläufig auf Baruch de Spinoza (1632-1677), einem niederländischer Philosophen jüdischer Herkunft stoßen. Er ist m.W. der Erste, der eine pantheistische Weltsicht entwickelt, in der Gott und Natur identisch sind. Spinoza vertrat die Auffassung, dass alles, was ist, aus der Notwendigkeit der göttlichen Natur folgt. Ich halte dafür, dass diese Auffassung eine entschiedene Abkehr von den dogmatischen Glaubenslehren der Kirche ist. Was Spinoza glaubensbezogen als objektive Realität interpretiert, ist bei Kant das Bewusstsein. Er spricht von Vernunft, die allein Maßstab für den Glauben sein müsse. Kant sah in Gott eine Idee der menschlichen Vernunft.
Zahlreiche Denker und Dichter des 18. und 19. Jahrhunderts beschäftigten sich explizit mit Glaubensfragen. Man kann einen Wandel im Verständnis des Glaubens und der Religiosität vor allem im katholischen Bürgertum Deutschlands nach 1730 feststellen. Kirchliche Bindung und Glaubenspraxis nehmen ab bzw. werden relativiert. Damit treten Glaube entsprechend der kirchlichen Dogmatik und der Zeitgeist miteinander in Konflikt. Jedenfalls gilt das für das aufgeklärte Bürgertum.
Ein beredtes Beispiel dafür ist Johann Wolfgang von Goethe (1749-1836). Als Minister am Weimarer Hof und zugleich künstlerischer Leiter des Weimarer Nationaltheaters traute er sich nicht, seine Fragen und Zweifel an den offiziellen Glaubensdogmen öffentlich zu äußern. In seinen "großen Hymnen" wie "Mahomets Gesang", "Wandrers Sturmlied", "Prometheus" und "Ganymed" setzt er sich poetisch dezidiert mit Fragen des Glaubens auseinander.
Im "Ganymed" formuliert er: "Hinauf! Hinauf strebt's. Es schweben die Wolken abwärts, die Wolken neigen sich der sehnenden Liebe. Mir! Mir! In euerm Schoße aufwärts! Umfangend umfangen! Aufwärts an deinen Busen, alliiebender Vater!"
In seinem Gedicht "Wandrers Sturmlied" wird seine Ambivalenz im Hinblick auf Glaubensfragen deutlicher, wenn er schreibt: "Was ich also verstehe, das glaube ich auch; aber nicht alles, was ich glaube, verstehe ich."
Einerseits betont Goethe, dass er nur das glaubt, was er auch versteht. Andererseits deutet er an, dass es Dinge gibt, an die er glaubt, ohne sie vollständig zu verstehen. Dieses Spannungsverhältnis zwischen Verstand und Glauben, zwischen Rationalität und Spiritualität, zieht sich durch viele von Goethes Werken und reflektiert seine eigene Suche nach einer neuen Form der Religiosität jenseits der etablierten Glaubensvorstellungen.
Goethes Ambivalenz entspricht dem, was in unserer Zeit Gang und Gäbe ist. Dieses Hin- und Herwanken hat durchaus auch eine produktive Note, weil die Auseinandersetzung mit dem eigenen Glauben zu dem führt, was man Glaubenssicherheit nennt. Mag der Glaube noch so gering oder spektakulär sein. Er erweist sich als Richtschnur, dem eigenen Dasein einen Sinn zu geben. Insgesamt gesehen verdeutlicht Goethes Darstellung das Streben nach einer unmittelbaren, spirituellen Verbindung zur Natur und zum Göttlichen.
Auch im 19. und 20. Jahrhundert beschäftigten sich insbesondere Naturwissenschaftler mit Fragen des Glaubens. Sie prüften die Vereinbarkeit ihrer wissenschaftlichen Erkenntnisse mit dem, was und woran sie glaubten. Die Auseinandersetzung mit Glaubensfragen war für sie oftmals eine große Herausforderung. Denn sie mussten lernen, die Grenzen der wissenschaftlichen Erkenntnis zu akzeptieren und dennoch offen für andere Formen der Erkenntnis zu sein. Ihre Ansichten variieren stark, spiegeln aber oft die tiefe Überzeugung wider, dass es in der Welt mehr gibt als das, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Der Dialog zwischen Wissenschaft und Religion führte sie letztlich zu einem tieferen Verständnis sowohl der natürlichen Welt als auch der spirituellen Dimension des Lebens.
Der Jesuit und Paläontologe Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) beschäftigte sich mit Darwins Evolutionstheorie und seinen Konsequenzen für den christlichen Glauben. Er sah in der Welt eine sich ständig entwickelnde Einheit, in der Materie und Geist miteinander verbunden sind. M.a.W.: Sowohl alles Materielle als auch alles, was als göttlich bezeichnet werden kann, sei einer ständigen Veränderung unterworfen. Er sah auch eine Entwicklung hin zu einem höheren Ziel, der Vereinigung mit Gott.
Der Astrophysiker und Philosoph Arthur Stanley Eddington (1882-1944) - er bestätigte Einsteins Relativitätstheorie und war an der Entwicklung der atomaren Kernfusion beteiligt - vertrat die Ansicht, dass die Gesetze der Physik nicht zufällig sind, sondern Ausdruck einer tieferen Ordnung, die von Gott geschaffen wurde. Die Gesetze der Physik seien Ausdruck des Willens Gottes. Er war davon überzeugt, dass die Wissenschaft uns helfen kann, die göttliche Ordnung des Universums zu verstehen. Wissenschaftler sind folglich auf der Spur zum göttlichen Wesen. Und er glaubte, dass die Wissenschaft uns helfen kann, diese Ordnung zu verstehen und die Größe Gottes zu erkennen.
Max Planck (1858-1947), der Begründer der Quantenphysik sah in der Wissenschaft keinen Widerspruch zum Glauben. Er war davon überzeugt, dass die Wissenschaft zwar ein mächtiges Werkzeug zur Erforschung der Welt ist, aber ihre Erklärungskraft an Grenzen stößt. Er, der mit seinen Forschungen in die tiefsten Tiefen des Universum blickte, kam letztlich zu der Gewissheit, dass die bloße die wissenschaftlichen Erkenntnis ihre Grenzen hat. Planck sah deshalb im Glauben eine Möglichkeit, diese Grenzen zu überwinden und einen universellen Sinn in der Welt zu finden. - Wir sollten beachten, dass die Religion als eine von mehreren Möglichkeiten ist - nicht nur für Planck. Mit Religion meinte er die christliche Religion, wobei man Planck sicherlich nicht überinterpretiert, wenn man davon ausgeht, dass eine transzendentale Gottheit gemeint ist. Diesbezüglich bestehen Parallelen zu Goethe.
Geistesverwandt ist ebenfalls Werner Heisenberg (1901-1976). Der deutsche Physiker und Mitbegründer der Quantenmechanik - er formulierte die berühmte, nach ihm benannte Unschärferelation, gemäß dem es unmöglich ist, zum Beispiel seinen Ort und seinen Impuls, gleichzeitig zu messen.Er war ein tiefgläubiger Christ und sah in der Wissenschaft einen Weg, die Größe Gottes zu erkennen. Für ihn war die Quantenmechanik nicht nur eine physikalische Theorie, sondern auch eine Herausforderung für unsere Vorstellung von der Wirklichkeit. Er glaubte, dass die Quantenmechanik uns zeigt, dass die Welt nicht so objektiv und deterministisch ist, wie wir es oft annehmen.
Schließlich sei auf John Polkinghorne (geb.1935) verwiesen. Der theoretische Physiker und anglikanische Theologe vertritt die Ansicht, dass Wissenschaft und Religion zwei verschiedene, aber komplementäre Wege sind, um die Wirklichkeit zu verstehen. Er gilt als der Begründer der Hochenergiephysik. Sie untersucht die Kräfte, die zwischen den Elementarteilchen wirken. Dazu gehören die starke Kernkraft, die schwache Kernkraft, die elektromagnetische Kraft und die Gravitation. Gemäß Polkinghome könne Wissenschaft und Religion uns zu einem tieferen Verständnis Gottes führen. Sie sind zwar zwei verschiedene Sprachen, beschreiben aber die gleiche Wirklichkeit.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Auseinandersetzung mit Glaubensfragen für viele Naturwissenschaftler des 19. und 20. Jahrhunderts eine wichtige Rolle gespielt hat. Sie haben erkannt, dass die Wissenschaft zwar ein wertvolles Werkzeug zur Erforschung der Welt ist, aber nicht alle Fragen beantworten kann. Deshalb haben sie sich auch mit anderen Formen der Erkenntnis, wie der Religion und der Philosophie, auseinandergesetzt, um ein gründlicheres Verständnis der Wirklichkeit zu gewinnen. - Ich wünschte, ich wäre fähig, diesen Weg zum Glauben auch den heute aktiven Wissenschaftlern, insbesondere den Geistes- und Sozialwissenschaftlern, mit auf den Weg geben zu können.
In der Auseinandersetzung mit Gegenpositionen ist durchaus ein Weg zur höheren Erkenntnis gegeben. Deshalb sei hier ausdrücklich auf berühmte Wissenschaftler verwiesen, die explizit Zweifel an der Nützlichkeit des Glaubens äußerten.
Zuerst ist in diesem Zusammenhang Charles Darwin (1809-1882), der Vater der Evolutionstheorie zu nennen. Er kämpfte im Laufe seines Lebens mit starken Glaubenszweifeln. Insbesondere bereitete ihm die Vorstellung von einem gütigen Gott, der Leid zulässt, große Schwierigkeiten. Seine ungezählt vielen Entdeckungen führten ihn zu der Feststellung, dass in der Evolution ein Prozess abläuft, der ohne göttliches Eingreifen abläuft. Dennoch schloss er trotz seines Agnostizismus die Existenz Gottes nicht vollständig aus.
Der einflussreiche Biologe und Befürworter der Evolutionstheorie, Thomas Huxley (1825-1895), war ein ausgesprochener Agnostiker. Er lehnte die Idee eines persönlichen Gottes und überhaupt jegliche übernatürlicher Erklärungen für die Welt entschieden ab. Stattdessen vertrat er den Standpunkt, dass sich die Welt durch natürliche Prozesse erklären lässt. Er war es, der den Begriff "Agnostizismus" prägte. Darunter verstand er eine kritische Haltung gegenüber Fragen, die jenseits des wissenschaftlichen Erkenntnisvermögens liegen.
Sigmund Freud (1856-1939), der Begründer der Psychoanalyse war ein Atheist und kritisierte seine jüdische wie auch die christliche Religion stark. Für ihn war Religion eine Illusion, die Menschen benutzen, um mit Angst und Unsicherheit umzugehen. Er versuchte zu belegen, dass Religion die psychologische Entwicklung des Menschen behindert und zu emotional gestörtem Verhalten führt. Grenzwertiges Selbstwerterleben sei eine Folge des menschlichen Glaubens an Gott. Freud plädierte für eine säkulare Gesellschaft, in der rationale Vernunft und Wissenschaft die Grundlage für das menschliche Leben bilden. Seine vielfältigen Theorien sind faszinierend, weil sie leicht eingängig sind. Die Theorie des Unbewussten hat er allenfalls ausdifferenziert, aber nicht erfunden. Denn das Unbewusste war bereits in der antiken Philosophie begann. Als Beispiel sei Platon genannt. Leider lassen sich Freuds Theorien - mit Ausnahme der Hypothese von der psychosexuellen Entwicklung - empirisch nicht belegen.
Die Religion beantwortet die Frage nach dem Sinn des Lebens, nach dem Wahren und dem Guten – die Wissenschaft und insbesondere die Naturwissenschaft befasst sich unter Zuhilfenahme der Logik und des rationalen Denkens mit dem Verständnis der materiellen Welt. Die Schwierigkeiten vieler Naturwissenschaftler mit der Religion mögen auch daher rühren, dass sie sich … mit der Erkenntnis der materiellen Welt zufrieden geben. Bei dem Versuch zusammenzufassen, was mir immer wieder Schwierigkeiten mit meinem Glauben bereitet, finde ich fünf Gesichtspunkte.
Zuerst sollen Widersprüche zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen einerseits und christlichen und nichtchristlichen Argumenten andererseits genannt werden. Sie haben das Potential, Zweifel zu nähren und Glauben zu schwächen. Denn es bestehen Widersprüche zwischen bestimmten Inhalten der heiligen Schriften und wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die christliche Archäologie hat an diesem Dilemma einen beredten Anteil. So kann der Auszug der Israeliten aus der ägyptischen Sklaverei nach Kanaan gemäß dem Alten Testament (Exodus, Kapitel 1-15) historisch nicht belegt werden. Es gibt auch keine eindeutige Definition, wer zu dem Volk der Israeliten gehörte. - Das Wunder der Blindenheilung durch Jesus - um ein weiteres Beispiel zu nennen - wird zwar in allen vier Evangelien beschrieben, allerdings jeweils in verschiedener Weise. Diese unterschiedlichen Berichte können die Glaubwürdigkeit der christlichen Religion nicht gerade festigen.
Viele Erzählungen in der Bibel sind Darstellungen übernatürlicher Phänomene, beispielsweise die Himmelfahrt Christi. Die Fortschritte in der Wissenschaft und die damit zunehmende Erklärungskraft natürlicher Phänomene führen dazu, dass übernatürliche Phänomene zunehmend hinterfragt werden,
Glaube wird von Menschen an Menschen weitergegeben. Dafür bedarf es organisierter Institutionen. In allen Religionen sind Beispiele für Machtmissbrauch, Skandalen und Intrigen innerhalb dieser Religionsgemeinschaften bekannt geworden. Keine kann die sogenannte weiße Weste tragen. Das ist für viele Menschen heutzutage und von vor Zeiten ein Grund, an den Glaubenslehren zu zweifeln oder sie gar abzulehnen, denn diesbezüglich wirken sie abstoßend im Hinblick auf deren Glauben.
Dogmatische Engstirnigkeit, Ausgrenzung und fehlende Toleranz in manchen Religionsgemeinden können zu Zweifel am Glauben nur verstärken.
Unlängst sagte mir ein Inder, dass die hinduistischen Götter lediglich Allegorien sein, die aus Tradition verehrt werden. Jedenfalls gelte das für die junge Generation.
Dass Menschen leiden müssen, Ungerechtigkeit und sie unter unschuldigem Leid leben müssen, kann mit der Vorstellung eines gütigen und allmächtigen Gottes unvereinbar erscheinen. (Darauf komme ich im nächsten Kapitel zu sprechen.) Die Frage nach dem "Leid der Gerechten" und der scheinbaren Ohnmacht Gottes gegenüber dem Bösen kann zu Zweifel am Glauben führen.
Welche Alternativen zu einem religiös untermauerten Glauben werden aufgesucht? Menschen finden heute in anderen Lebensbereichen, wie z. B. Kunst, Kultur, Philosophie oder Wissenschaft, Sinn und Erfüllung. Religion ist für viele nicht mehr sinnstiftend. Andere Menschen finden in esoterischen Strömungen, alternativer Spiritualität oder säkulare Lebensphilosophien eine attraktivere Antwort auf grundlegende Fragen des Lebens. Sie bieten Ersatz für traditionelle Religionen und werden zynischer Weise als Ersatzreligionen bezeichnet.
Unsere Zeit ist geprägt von einem Streben nach individueller Freiheit und Selbstbestimmung. Eine egozentrische, bisweilen sogar egoistische Haltung dominiert im Miteinander - sowohl im Politischen als auch in glaubensbezogenen Fragen. Alte Traditionen und überholte Dogmen lassen uns vom Glauben abkehren.
Angesichts der komplexen Thematik sind die genannten Argumente schlichte Vereinfachungen, wenn es um den Glauben geht. Immer aber ist - egal, ob für oder wider - Glaube individuell. Er beruht nicht zuletzt auf persönlichen Erfahrungen und sozialen Einlassungen wie Vorbild und Erziehung.
Ich möchte es anders herum probieren und fragen, weshalb es für uns zu glauben hilfreich und lohnenswert ist.
Fest steht, dass Glaube an einen höheren Sinn und Zweck des Lebens Trost und Hoffnung in schwierigen Zeiten geben kann. Ein starkes Wertesystem und eine Lebenseinstellung, die auf Mitgefühl, Ethik und Selbstverwirklichung basieren, sind Garanten für Sinn und Orientierung.
Die christliche Ethik, aber auch die der anderen Religionen, basiert auf den zehn Geboten und der Bergpredigt Sie bieten einen klaren Rahmen für ein moralisch gutes Leben. Manche Menschen lassen sich von säkulare Ethiken leiten, wie z. B. vom Humanismus oder vom Utilitarismus.
Selbstverständlich können auch sie Orientierung und Leitlinien für ein von ethischen Prinzipien getragenes Leben geben. Viele Politiker lassen sich davon leiten.
Der Glaube an ein göttliches Wesen kann Menschen Kraft und Unterstützung geben, um schwierige Situationen zu bewältigen. Innere Stärke, psychische Widerstandskraft, Herausforderungen anzunehmen, und die Fähigkeit zur Reflexion des eigenen Tuns und Nicht-Tuns, können Menschen helfen, persönliche und soziale Schwierigkeiten zu meistern. Man denke nur einmal daran, wie es einem ergeht, wenn Herausforderungen des Alltags einmal als Kampf und einmal als Akzeptanz angenommen werden.
Der Glaube an die Existenz eines göttlichen Wesens, das Unterstützung und Führung bietet, kann eine Person auf einem Pfad der spirituellen Entwicklung und Selbsterkenntnis führen. Dieser Glaube verleiht ihr eine einzigartige Prägung. Wer diesen Glauben für sich nicht zu akzeptieren vermag, dem können Entspannungsmethoden, Meditation, Yoga oder schlicht der Kontakt mit der Natur auf ihrem Weg der Selbstfindung unterstützen.
Glaube wird von Menschen oft erfahren und durch Menschen weiter getragen. Gemeinschaft lässt ein Gefühl der Geborgenheit und des Zusammenhalts entstehen. Wir pflegen Kontakte zu Menschen mit ähnlichen Werten und Lebensanschauungen. Das verbindet uns. Man denke nur an die Atmosphäre und die Solidarität in Sportvereinen, im Freundeskreis oder in Selbsthilfegruppen. Rasch entwickelt sich ein Gefühl der Zugehörigkeit und des Miteinanders. Bei diesen Überlegungen fällt mir das Jesuswort ein: "Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen."
Die Frage, ob und wie Glaube persönlichen Sinn und Hilfe bietet, ist eine individuelle und subjektive Entscheidung, die von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird. Glaube ist letztendlich eine Annahme im doppelten Sinne! Er ist keine Leistung, sondern etwas, das unerwartet aufkommt, und niemand weiß genau, wie. Er ist Vertrauen, das sich über sich selbst wundert. Deshalb empfinde ich Glauben als Hoffnung! Hoffnung, dass dieser Glaube mich trägt; ich bin bereit, mich davon tragen zu lassen.
Der bekannte Autor und Holocaust-Überlebende, Vaclav Havel, formulierte es so: .„Hoffnung ist kein Optimismus, der erwartet, dass alles gut ausgeht. Glaube ist etwas, das in der Überzeugung wurzelt, dass es Gutes gibt, für das es sich zu leben lohnt.“
Der Text bietet eine umfassende Analyse der zentralen Elemente des christlichen Glaubens und vergleicht diese mit den Grundlagen anderer Religionen wie Hinduismus, Judentum und Islam. Er beleuchtet die historischen Ursprünge und die ethischen Prinzipien, die diesen Glaubenssystemen zugrunde liegen, und zeigt auf, wie diese Prinzipien auch in der modernen Gesellschaft von Bedeutung sind.
Die Diskussion über den Glauben als dynamischen Prozess wird durch historische Persönlichkeiten wie Augustinus und Thomas von Aquino ergänzt, die betonen, dass Glaube nicht statisch ist, sondern sich im Laufe der Zeit entwickeln kann. Diese Perspektive ermöglicht ein tieferes Verständnis für die Herausforderungen und Zweifel, die viele Gläubige im Alltag erleben - so auch ich.
Ein zentrales Anliegen des Textes ist es, die praktischen Implikationen der Glaubensvorstellungen zu verdeutlichen. Die ethischen Grundsätze aus den verschiedenen Religionen bieten wertvolle Orientierung für das persönliche und gemeinschaftliche Leben. Insbesondere die Betonung von Respekt, Mitgefühl und moralischer Verantwortung ist heute relevanter denn je.
Zusammengefasst zeigt der Text, dass trotz der Unterschiede zwischen den Religionen viele gemeinsame Werte existieren. Die Auseinandersetzung mit diesen Glaubensgrundlagen kann nicht nur zur persönlichen Reflexion anregen, sondern auch zu einem besseren Verständnis und einem respektvollen Miteinander in einer vielfältigen Gesellschaft beitragen.
Gott
Es ist nun schon eine Weile her, da besuchte ich meine beiden Enkelinnen. Nora besuchte die 3. Klasse. Ihre ältere Schwester, Jennifer, war schon in der 7. Klasse. Nora zeigte mir ihre Schulhefte. Im Religionsunterricht waren sie dabei, über Gott zu sprechen. Ihre Hausaufgabe bestand darin, die persönlichen Vorstellungen von Gott auf ein Blatt Papier zu malen. Ich sah - umgeben von grünem Rasen - eine Kirche und mehrere Häuser. Oben rechts in der Ecke des Blattes hatte Nora ein Dreieck platziert. Dass Gesicht einer alten Männerfigur mit einem langen Bart und aufgeblasenen Wangen war zu sehen. Er blies heftig auf die Erde hinunter. Auf diese Figur deutend, ließ Nora mich wissen, dass sie sich so Gott vorstelle.
Zufällig behandelte Jennifers Klasse ebenfalls das Thema Gott. Auch sie hatte die Hausaufgabe, ihre Vorstellungen von Gott bildnerisch aufs Papier zu bringen. Ihr Blatt war noch leer, denn sie könne sich nicht vorstellen, wie Gott malbar auf dem Blatt dargestellt werden könne.
"Großvater, wie stellst Dir Gott vor?", fragte Jennifer. "Das sei eine sehr schwere Frage", entgegnete ich. Denn in der Bibel antworte Gott auf die Frage, wer er sei, mit: "Ich bin, der ich bin!" Das sei doch nichts, womit man etwas anfangen könne. Nach einigem Überlegen bekannte ich, dass ich mir Gott wie die Wolken am Himmel vorstellen könne. Mal sieht man freundliche, helle Wolken; dann wieder große und graue wie vor einem Gewitter. "Und was ist, wenn gar keine Wolken am Himmel sind? Ist er dann nicht da?", fragte Nora ratlos. Das gab mir zu denken. "Ich habe ein besseres Bild von Gott. Er ist wie der Wind. Er kann gewaltig sein, wie bei einem Orkan. Er kann aber auch mild wehen und Dein Gesicht berühren, wenn Du vielleicht am Strand liegst und Dich von der Sonne bescheinen lässt. Selbst, wenn Windstille ist, können Meteorologen messen, dass dennoch der Wind weht. Wind ist also immer gegenwärtig - genauso ist es mit Gott. Wir können nur seine Wirkungen feststellen."
Jennifer resümierte, dass sie jetzt wisse, was sie auf das Papier zaubern will. Später kam sie mit dem Blatt, das sie in drei Spalten geteilt hatte. "In jeder der drei Spalten werde ich unterschiedliche Auswirkungen von Wind einzeichnen. Ich weiß noch nicht, wie ich jede Spalte ausfülle. Das will ich mir noch überlegen."
Die Frage, wer und was Gott ist, wird seit Menschengedenken immer wieder gestellt.. Die Vorstellungen von Gott haben in jeder Religion zentrale Bedeutung, wenngleich die Ansichten sich unterscheiden. Besonders relevant sind sie in verschiedenen Kulturen und Religionen.
Im Hinduismus verehrt man eine Vielzahl von Göttinnen und Göttern. Sie verkörpern verschiedene Aspekte der kosmischen Realität. Ganesha beispielsweise, der elefantenköpfige Gott, ist Sohn von Shiva und Parvati, den beiden wichtigsten Gottheiten. Er wird von vielen Hindi verehrt, weil er Glück und Weisheit bringt und Hindernisse aus dem Weg räumt.Viele Hindi haben zu Hause Ganesha-Statuen oder -Bilder, vor denen sie Räucherstäbchen anzünden, Blumen und Süßigkeiten als Opfergaben werden Ganesha dargebracht und dabei gebetet. So oder so ähnlich sind auch die Rituale für die anderen Götter, Gebete und Opfergaben. Die Gläubigen streben danach, sich mit dem Göttlichen zu vereinen.
Weshalb existiert eine große Vielzahl an Göttern im Hinduismus? Sie hat den Zweck, die unendlichen Aspekte und Qualitäten des einen Göttlichen Brahman greifbar und verehrbar zu machen. Brahman ist der höchste Gott und Schöpfer des Universums. Wir können festhalten: Im Hinduismus existiert eine Hierarchie der Gottheiten, ähnlich, wie in der griechischen und römischen Antike. Jede Gottheit steht für einen Teilaspekt des menschlichen Lebens.
Wenn Gott Allwissenheit zugesprochen wird, dann wusste er von Kains Mordplan an seinem Bruder Abel, bevor er ihn ausführte. Man kann sich fragen, weshalb er Kain in diese Lage brachte und den Brudermord zuließ. Es ging doch um Opfergaben zu Gottes Ehren. Hat er Kain eine Falle stellen wollen? - Ähnlich ist es mit Gottes Auftrag an Abraham, seinen Sohn Isaac auf einem Altrar zu opfern. Weil Gott im Vorhinein weiß, welche Konsequenzen sich aus den Aufträgen ergeben, kann man auf den Gedanken kommen, dass der Allmächtige mit seinen Geschöpfen ein Doppelspiel treibt. In letzter Konsequenz misstraut Gott seiner Schöpfung. Eine Erklärung kann darin gesehen werden, dass es sich in beiden Geschehnissen um Legenden handelt. Selbst vor mehr als 3000 Jahren fragten sich die Menschen nach Eigenschaften ihrer Gottheit. Versuchung und Misstrauen Gottes wären also Eigenschaften des Höchsten.
Das Judentum betont die persönliche Beziehung zwischen Gott und den Menschen sowie die Bedeutung der zehn Gebote und des Bundes zwischen Gott und dem jüdischen Volk. Die zehn Gebote und der Sinaibund bilden den Höhepunkt und Angelpunkt der Bundesbeziehung zwischen Gott und Israel. Sie regeln das Verhältnis des Volkes zu Gott untereinander, indem sie das Volk Israel zu Gottes besonderem Eigentumsvolk erklärt. Was die Beziehung zwischen Gott und seinem auserwählten Volk betrifft, so ist damit implizit eine Personifizierung Gottes gegeben. Gott als Vertragspartner. Wie ein Mentor leitet Gott seine Vertragspartner, bietet Weisheit und Unterstützung, um die vereinbarten Ziele zu erreichen und das Beste aus der Partnerschaft herauszuholen.
Wer ist dieser mysteriöse Vertragspartner? Gott – ein Name, der Fragen aufwirft und Rätsel birgt. Es genügt nicht, dass er sich lediglich mit den rätselhaften Worten "Ich bin, der ich bin!" präsentiert. Ist Gott eine verborgene Figur hinter einer Maske, die inkognito in Erscheinung tritt? Solche Gedanken wecken Zweifel und Neugier zugleich.
Vielleicht liegt die Antwort in der Geschichte der Menschheit selbst. Die Menschen von einst formten ein Bild von Gott, das ihnen vertraut war, ein Spiegel ihrer eigenen Existenz. Schließlich sind sowohl das Alte als auch das Neue Testament von Menschenhand verfasste Zeugnisse des göttlichen Wortes.
In der Tiefe der Zeit und im Glauben orthodoxer Juden lebt die Überzeugung fort, dass Gott selbst jene kraftvollen Worte sprach, die im 45. Kapitel des Jesaja zu finden sind: "Ich bin der Herr, und sonst keiner mehr, kein Gott neben mir ... Ich bin's, der das Licht macht und schafft die Finsternis, der Frieden gibt und schafft das Unheil. Ich bin's, der Herr, der all dies tut." Ebenso bei Hesekiel im 20. Kapitel: "Ich erhob meine Hand und schwor dem Hause Israel und sprach: Ich bin der Herr, euer Gott." Diese Worte sind mehr als bloße Sätze; sie sind Überzeugungen, fest verankert im Glauben jener, die sie hören. Überzeugungen sind wie Anker in stürmischen Zeiten – sie geben Halt und bewahren uns vor dem Abdriften.
Im Islam wird Allah als der einzige Schöpfer des Universums verehrt. Seine Barmherzigkeit und Gerechtigkeit sind zentrale Pfeiler des Glaubens und werden im täglichen Gebet bekräftigt. Muslime erfahren diese Eigenschaften durch Segen und Führung in ihrem Leben.
Die Vielfalt der Gottesbilder zeigt uns die verschiedenen Wege, auf denen Menschen das Göttliche begreifen. Doch trotz all dieser Vorstellungen bleibt die Frage: Wer oder was ist Gott wirklich?
Inmitten dieser Vielfalt erkennen wir, dass jede Religion und jede individuelle Auffassung eine einzigartige Perspektive auf das Göttliche bietet. Vielleicht ist es gerade diese Vielfalt an Überzeugungen, die uns ein tieferes Verständnis für den Glauben ermöglicht. Diese Version verwendet lebendigere Sprache und Metaphern, um den Text ansprechender zu gestalten.
Wie Gott verstanden werden kann, das verdeutlicht die Vielfalt der Vorstellungen von Gott in verschiedenen Kulturen und Religionen. Sie lassen erkennen, wie diese Konzepte das Leben, die Moral und die Spiritualität der Gläubigen prägen. Bei den monotheistischen Religionen sind viele Gemeinsamkeiten zu finden. Von den primär asiatischen Religionen kann ich lernen, auf welchen Wegen eine Begegnung mit Gott möglich sein kann. Und dennoch kommt man nicht weiter mit einer Antwort auf die Frage, wer oder was Gott ist. Es käme einem Irrtum gleich, wollte man davon ausgehen, dass innerhalb einer Religion dieselben Vorstellungen von Gott existieren. Das zeigen das Judentum und erst recht das Christentum. Selbst, wenn man die gedanklichen und spirituellen Grenzen überwindet, lassen sich Konzepte von Gott aus verschiedenen religiösen und philosophischen Traditionen voneinander unterscheiden. Hier sind einige Beispiele dafür:
Atheisten sind wie skeptische Detektive in einer Welt voller Mythen und Legenden. Sie lehnen die Existenz eines Gottes oder einer göttlichen Entität ab, denn für sie gibt es kein transzendentes, übernatürliches Wesen, das das Universum erschaffen hat oder darin eingreift. In philosophischen und religiösen Texten kann man über Atheismus lesen, doch er ist keine starre Lehrmeinung. Vielmehr neigen Atheisten dazu, skeptisch gegenüber Behauptungen zu sein, die nicht durch nachprüfbare Beweise oder logische Argumente gestützt werden können. Sie schätzen kritisches Denken und rationale Überlegungen, um die Annahmen über eine Existenz Gottes zu hinterfragen und zu überprüfen.
Für Atheisten sollte moralisches Verhalten auf Vernunft, Mitgefühl und Empathie basieren, anstatt auf religiösen Geboten oder göttlichen Anweisungen. Sie betonen oft die Bedeutung der individuellen Freiheit des Denkens und der persönlichen Überzeugung. Das Recht jedes Menschen, seine eigenen Überzeugungen zu hinterfragen und gegebenenfalls zu verändern, verteidigen sie leidenschaftlich. Es fällt jedoch auf, dass Atheisten bei der Diskussion um eine göttliche Existenz häufig in die Strukturen der Religion flüchten und das Thema 'Gott' selbst außen vor lassen. In dieser Welt der Überzeugungen sind Atheisten wie Leuchttürme der Rationalität, die in einem Meer aus Glauben und Dogmen stehen und den Weg zur Vernunft weisen.
Gelehrte, die in der Wissenschaft von sich Reden machten und sich zum Atheismus bekannten, waren u.a. der britisch-amerikanische Journalist Christopher Hitchens (1949-2011) und der britische Philosoph, Logiker und Mathematiker Bertrand Russell (1872-1970). In der Sowjetunion und den mit ihnen verbundenen Staaten war Atheismus offizielle Räson.
Agnostizismus unterscheidet sich vom Atheismus durch seine Haltung zur Gottesfrage: Er betrachtet es als unmöglich, die Existenz oder Nichtexistenz Gottes mit absoluter Sicherheit zu beweisen oder zu widerlegen. Weder empirische Daten noch logische Argumente können das Dasein eines übernatürlichen, transzendenten Wesens zwingend belegen. Letztlich bleibt der Glaube an Gott eine persönliche Überzeugung. Agnostiker sehen es oft als unerheblich oder gar unmöglich an, eine feste Position zur Existenz Gottes einzunehmen. So finden sich unter ihnen vielfältige Ansichten. Die Weisheit des Agnostikers liegt schlussendlich in der Akzeptanz der Ungewissheit, denn nicht alles, was zählt, kann gezählt werden.
Der britische Evolutionsbiologe Richard Dawkins (geb 1941) argumentiert gegen die Existenz eines übernatürlichen, persönlichen Gottes und bezeichnet den Glauben daran als eine Art "Wahn" oder Illusion. Er kritisiert die Religionen, insbesondere den christlichen Glauben, als "Virus des Geistes" und sieht sie als Quelle von Konflikten, Unterdrückung und unmoralischen Verhaltens. Mir fällt es schwer nachzuvollziehen, in welcher Weise der Glaube an die Existenz eines göttlichen Wesens die Quelle für die von ihm genannten Widerwärtigkeiten sind. Dawkins plädiert für einen "militanten Atheismus" und fordert eine aktivere Auseinandersetzung mit religiösen Dogmen aus einer rationalen, wissenschaftlichen Perspektive. Der große Physiker, Albert Einstein (1879 - 1955), der für seine bahnbrechenden Beiträge zur Relativitätstheorie, bekannt ist, wurde oft als agnostisch beschrieben. Einstein war zwar selbst kein gläubiger Anhänger einer bestimmten Religion, hatte aber großen Respekt vor der spirituellen und ethischen Dimension von Religionen. Er kritisierte die dogmatische Seite und den blinden Glauben ohne Verständnis. Ebenso betonte er die Bedeutung des Strebens nach Wissen und Verständnis der Welt durch die Wissenschaft. Dafür steht das folgende Zitat: "Ich glaube an Spinozas Gott, der sich in der gesetzlichen Harmonie des Seienden offenbart, nicht an einen Gott, der sich mit Schicksalen und Handlungen der Menschen abgibt." Einstein lehnte also die Vorstellung eines persönlichen, in die Welt eingreifenden Gottes ab. Er sah Gott eher als unpersönliches Prinzip der Naturgesetze. Letztlich war für ihn die Gottesvorstellung ein Mysterium.
Wie sich das Verhältnis zu Gott ändern kann, dafür ist der britische Evolutionsbiologe Charles Darwin (1809 - 1882) ein beredtes Beispiel. Sein Verhältnis zu Gott und zur Religion wandelte sich im Laufe seines Lebens von einem anfänglichen christlichen Glauben hin zu Agnostizismus und letztendlich Atheismus, der die Existenz eines persönlichen Gottes anzweifelte. Er lehnte die biblische Schöpfungsgeschichte ab und sah seine Evolutionstheorie nicht als vereinbar mit einem Schöpfergott an. Dennoch wollte Darwin die Möglichkeit eines höheren Prinzips oder einer ersten Ursache nicht gänzlich ausschließen. Er vermied es, sich als Atheist zu bezeichnen, und nannte sich stattdessen einen Agnostiker. Darwin respektierte den Glauben anderer, auch wenn er ihn nicht teilte. Er sah Religion als etwas Subjektives an und vertrat eine Haltung der Toleranz gegenüber Gläubigen. Gleichzeitig kritisierte er aber auch die Dogmen und Widersprüche in den heiligen Schriften. Seine Haltung war eher eine der Ungewissheit als der strikten Ablehnung Gottes. In seinen späteren Jahren beschrieb Darwin sich als "stillen Inhaber christlicher Werte", der jedoch die Existenz eines persönlichen Gottes ablehnte. Seine Weltsicht war eher naturalistisch und rational geprägt.
Ähnlich wie für Einstein war für Thomas Huxley (1825 - 1859), einem angesehenen Biologen seiner Zeit das Verhältnis zu Gott. Er betonte die Notwendigkeit, offene Fragen mit wissenschaftlicher Evidenz zu behandeln. Er lehnte religiöse Dogmen ab, die nicht durch Beweise gestützt werden können.
Im Pantheismus wird Gott mit dem Universum gleichgesetzt, das Göttliche ist in allem gegenwärtig. Alles Existierende ist Teil dieses göttlichen Ganzen, wie ein unendlicher Teppich, der sich über das Universum erstreckt. Einige Strömungen des Hinduismus und des Taoismus verkörpern diese Vorstellung. Der Taoismus lehrt, dass man im Einklang mit der Natur lebt und den Fluss des Universums akzeptiert, indem man loslässt und natürlich handelt. Diese Sichtweise geht davon aus, dass Gott nicht als separates Wesen existiert, sondern als allumfassende Realität, die alles durchdringt. So wie ein Fluss, der durch jedes Tal fließt und alles Leben nährt, ist das Göttliche in jedem Aspekt der Welt präsent.
Kernaussage des Pantheismus ist, dass Gott und die Natur, das Universum beziehungsweise die Welt identisch sind. Gott wird nicht als persönliches, übernatürliches Wesen gesehen, sondern als die allumfassende Realität selbst. Wir erkennen also, dass der Pantheismus eine starke Wurzel in dem seit dem 4. Jahrhundert v.Chr. existierenden Taoismus hat.
Weiter vorn wurde schon Spinoza erwähnt, auf den sich Einstein im Hinblick auf seine Gottesvorstellungen bezieht. Der Niederländer Baruch Spinoza (1632 -1677) gilt neben den Lehrern des Taoismus als einer der einflussreichsten Pantheisten der Philosophiegeschichte. Seine beiden Kernaussagen sind: (1) Gott und die Natur sind identisch, es gibt nur eine Substanz. (2) Gott ist die allumfassende, unendliche Realität, in der alles existiert. "Die Gesamtheit aller Dinge ist Gott, außer dem es kein Sein gibt." Einen so gemeinten Gott kann man verehren, anbeten und wie ein Kind staunen, dass solch eine Allmacht uns hält und trägt.
Sehr ähnlich ist das Gottesbild von Johann Wolfgang von Goethe (1749 -1832). Der Dichter und Naturkundler vertrat in seiner Spätphilosophie eine pantheistische Naturauffassung. Seine Kernaussage lässt sich so zusammenfassen: Die Natur ist Gottes lebendiges Kleid; Gott ist in allem Natürlichen gegenwärtig. Gott und Welt sind eine Einheit. "Die Natur verbirgt Gott nicht: denn sie ist nur die Natur in sich." Ebenso anschaulich wie einleuchtend stellt er seine pantheistische Weltsicht in dem Gedicht "Gesang der Geister über den Wassern" dar:
"Gott gleicht dem Wasser: vom Himmel kommt es, zum Himmel steigt es, und wieder nieder zur Erde muss es, ewig wechselnd."
Goethe stellt mithin eine Analogie zwischen der menschlichen Seele und dem Naturkreislauf des Wassers her. Die Seele wird als Teil der Natur und des kosmischen Kreislaufs gesehen, was Goethes pantheistische Sichtweise widerspiegelt. Goethe setzt das Göttliche - er nennt es Seele - mit einem Naturphänomen gleich. Andererseits geht es ihm um eine zyklische, ewige Bewegung zwischen Himmel und Erde. In seiner "Dichtung und Wahrheit" konkretisiert er das: "Die Natur wirkt nach ewigen, notwendigen, dergestalt göttlichen Gesetzen, dass die Gottheit selbst daran nichts ändern könnte." Für Goethe sind die Naturgesetze göttlich. Die Natur ist nicht von Gott getrennt, sondern mit dem Göttlichen identisch. Die Natur ist das höchste Prinzip.
Im Deismus wird Gott als Schöpfer des Universums betrachtet, der jedoch nach der Schöpfung die Welt ihrem eigenen Lauf überlässt und nicht aktiv in das Geschehen der Welt eingreift. Der Deismus betont also die Vernunft und die natürliche Ordnung des Universums. Eine solche Sichtweise ist charakteristisch für das Zeitalter der Aufklärung.
Die Aufklärung brachte im 17. und 18. Jahrhundert einen grundlegenden Wandel im Denken mit sich und bereitete den Weg für die Moderne. Traditionen und Autoritäten wurden von fortschrittlichen Denkern zugunsten der Vernunft und des rationalen Denkens abgelehnt. Aufklärung und Bildung der Menschen wurden gefordert, um sie aus ihrer "selbstverschuldeten Unmündigkeit" zu führen, wie Kant es formulierte.
Als maßgebliche Protagonisten des Deismus sind Voltaire (1694 -1778) und Jean-Jacques Rousseau (1712 - 1778) zu nennen, wenngleich die beiden einflussreichen Philosophen unterschiedliche Ansichten über Gott vertraten. - Voltaire glaubte an einen Gott als Schöpfer des Universums, lehnte aber die Offenbarungsreligionen (Judentum, Christentum, Islam) und die Vorstellung eines persönlichen, in die Welt eingreifenden Gottes ab. Er hielt den Glauben an Wunder und übernatürliche Ereignisse für Phantastereien und setzte sich für einen rationalen, auf Vernunft und Wissenschaft basierenden Gottesglauben ein.
Rousseau war von der Existenz Gottes überzeugt, den er als "Seele der Natur" und als gütigen, weisen Schöpfer der Welt sah. Dennoch verneinte er die etablierten Religionen und Dogmen und vertrat eine natürliche, von Vernunft geleitete Religion ohne Offenbarung und Priester. Für Rousseau war Gott eine Quelle für ethische Werte und ein tugendhaftes Leben. - Als weitere Denker im Sinne des Deismus sind René Descartes (1596-1650), Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) und John Locke (1632-1704) zu nennen.
Insgesamt nimmt der Deismus heute eine Minderheitenposition ein, die aber weiterhin von einigen Denkern, Organisationen und in der Freidenker-Bewegung vertreten wird. Die Betonung der Vernunft, Naturgesetze und Ablehnung übernatürlicher Offenbarungen sind typische Merkmale des modernen Deismus. Bezüge zu christlichen Erklärungen halte ich für unverkennbar. Worin aber unterscheiden sich Deismus und Christentum?
Deisten glauben zwar an einen Schöpfergott, lehnen aber die christliche Vorstellung der Dreieinigkeit (Vater, Sohn und Heiliger Geist) sowie die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus ab.
Sie distanzieren sich von der Idee einer göttlichen Offenbarung durch die Bibel. Stattdessen betonen Deisten die menschliche Vernunft und Naturgesetze als Quelle der Gotteserkenntnis.
Diese Konzepte sind im Deismus nicht zu finden. Das Christentum hat eine ausgeprägte Kirchenstruktur mit Priestern, Sakramenten und Riten. Deisten lehnen solche religiösen Autoritäten und Traditionen ab und betonen stattdessen die individuelle Vernunft. Eine solche Organisationsstruktur wird im Deismus abgelehnt.
Die in Umrissen dargestellten Konzepte bieten einen Einblick in die Vielfalt der Vorstellungen von Gott und das breite Spektrum religiöser und philosophischer Überzeugungen. Die Vielfalt der geäußerten Gedanken und Ansichten schafft Verwirrung bei jenen, die nach Gott suchen. Deshalb stellt sich abermals die Frage, wer oder was ist Gott?
Die vielfältigen Auffassungen über Gott und die Welt gibt folgende Fabel preis: In einer fernen Galaxie, weit entfernt von der Erde, lebten die Sternenwesen. Diese Wesen waren bekannt für ihre Weisheit und ihre Neugier auf das Universum. Eines Tages beschlossen sie, die Vielfalt der Gottesvorstellungen zu erkunden, die in den verschiedenen Kulturen des Universums existieren.
Die Sternenwesen trafen sich auf einem schimmernden Planeten, um ihre Entdeckungen zu teilen. Das erste Wesen, das sprach, war Zorak, der Forscher. "In meiner Reise habe ich die Menschen der Erde beobachtet. Sie sehen Gott oft als einen allmächtigen Schöpfer, der das Universum lenkt wie ein Kapitän sein Schiff." Dann erhob sich Lyra, die Weise. "Ich habe die Bewohner eines Planeten entdeckt, die Gott als den Wind betrachten – unsichtbar und doch immer präsent. Für sie ist Gott eine Kraft, die sanft streichelt oder heftig tobt und alles bewegt." Als nächstes sprach Orion, der Denker. "Auf einem anderen Planeten sehen sie Gott als das Licht in der Dunkelheit – eine Quelle der Hoffnung und des Wissens, die den Weg erhellt." Schließlich meldete sich Vega, die Träumerin, zu Wort. "Ich fand eine Welt, in der Gott als ein endloses Meer verehrt wird – tief und unergründlich, voller Geheimnisse und Leben."
Die Sternenwesen lauschten aufmerksam und erkannten: Die Vielfalt der Gottesvorstellungen ist wie ein kosmisches Mosaik – jedes Stück einzigartig und doch Teil eines größeren Ganzen. Mit dieser Erkenntnis kehrten die Sternenwesen in ihre Heimat zurück, bereichert durch das Wissen um die unendlichen Facetten des Göttlichen im Universum.
Selbstverständlich weiß niemand, wer und wie Gott ist und ob es diesen überhaupt gibt. Sollte man angesichts dessen sich von derartigen Überlegungen und Ungewissheiten fernhalten? Ich meine nicht. Es ist zwar für viele Menschen - mich eingeschlossen - schwer, mit dieser Ungewissheit zu leben. Und deshalb machen wir uns ersatzweise Bilder von Gott, aber unser Bild von Gott ist nicht Gott. Wie gehen wir mit diesem unseren Gottesbild um? Dafür mag folgender Vergleich herhalten: Wir wissen zwar nicht, wie hoch die Inflationsrate sein wird, wenn das Jahr zu Ende geht - aber wo und wie Gott ist und womit er sich beschäftigt, das meinen wir mit großer Wahrscheinlichkeit zu „wissen“. So sind wir Menschenkinder!
Der Schweizer Nachrichtentechniker Matthias Pöhm - er wird als bester Rhetoriktrainer innerhalb des deutschen Sprachraumes bezeichnet - schreibt über Gott aus einer nicht-theologischen Perspektive. In seinen Schriften vertritt er die Ansicht, dass Gott nicht als eine Person oder ein Wesen, sondern als ein Bewusstseinszustand oder eine Erfahrungsebene zu verstehen ist. Er verwendet verschiedene Begriffe, um Gott zu beschreiben, wie zum Beispiel "das Absolute", "die universelle Quelle", "das Licht" und "die Liebe". Pöhm betont, dass es dienlich ist, offen für verschiedene Gottesbilder zu sein und sich nicht auf ein festes Konzept zu fixieren. Solche Empfehlungen machen neugierig, zumal Pöhm eine Person der Gegenwart und mit den Gegebenheiten unserer Zeit vertraut ist. Also beschloss ich, in seinem OEuvre zu recherchieren und fand in einem seiner Newsletter zehn Thesen über Gott. Hier sind sie:
Gott ist kein einzigartiges Superwesen, das irgendwo im Universum oder außerhalb lebt. Gott ist die Gesamtheit aller Seelen, die im und außerhalb des Universums leben. Sie selbst, ihr ärgster Feind, jede Fliege, jeder Grashalm, jeder Stein ist Teil von Gott.
Gott hat nichts nötig. Gott braucht nichts, um glücklich zu sein. Gott ist die Glückseligkeit selbst.
Deshalb verlangt Gott von nichts und niemanden im Universum irgendetwas. Gott hat keine einzige Regel für uns Menschen aufgestellt.
Das, was Gott ist, kann in keiner Weise gekränkt oder verletzt oder beschädigt werden. Er hat es deshalb auch nicht nötig, zu bestrafen oder sich zu rächen als Reaktion auf Gotteslästerung oder Leugnung seiner Existenz. Alle Dinge sind ‚ein Ding‘. Alle Dinge sind Teil des einen Dings. Wir hängen alle zusammen – ohne uns dessen bewusst zu sein. Alle Menschen, alle Tiere, alle Pflanzen, alle Materie im ganzen Universum ist EINS.
Jeder Mensch ist genauso außergewöhnlich, genauso besonders, wie jeder andere Mensch. Kein Mensch wird von Gott mehr geliebt, als ein anderer Mensch. Wir sind alle Boten in jedem Augenblick unseres Lebens.
Gott hat nie aufgehört, mit den Menschen direkt zu kommunizieren. Jeder kann Botschaften von Gott empfangen. Jede Botschaft von Gott ist genauso wertvoll, wie jede andere Botschaft. Gott schickt jedem nur die Botschaften, die in sein momentanes Glaubenssystem passen. Deswegen widersprechen sich die Botschaften von diversen Menschen oft.
Wir sind nicht nur unser Körper. Das, was wir sind, ist grenzenlos und hört nie auf zu existieren. Unser Körper ist wie ein Radioapparat, aus dem Musik erklingt. Wir sind nicht das Gerät, wir sind die unsichtbaren Radiowellen dahinter, die auch noch da sind, wenn das Radiogerät nicht mehr existiert.
Wir können nicht sterben. Unsere Seele wird ewig existieren. Wir sind weder in Sünde geboren, noch werden wir je zu ewiger Verdammnis verurteilt werden, egal was wir tun.
Keine Religion ist „die einzig wahre Religion“; kein Volk ist das „auserwählte Volk“ und kein Prophet ist der „grösste Prophet“.
So etwas wie Richtig und Falsch gibt es nicht im Verhältnis zu Gott. Es gibt nur Ziele, die sich Menschen oder Menschengruppen selber stecken. Und gemäß diesen selbst gesteckten Zielen gibt es nur ein „funktioniert besser“ oder „funktioniert schlechter“.