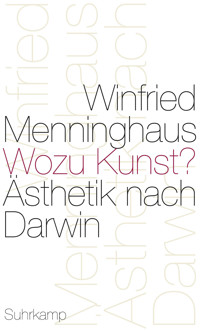
27,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Gesangskünste von Vögeln haben Künstler und Denker vielfach zu Parallelen mit den menschlichen Künsten angeregt. Erst Charles Darwin jedoch hat solchen Parallelen eine Theorie gegeben und sie anhand eines allgemeinen evolutionären Modells ästhetischer Darstellung und Rezeption erklärt. Winfried Menninghaus präsentiert Darwins Überlegungen als einen bedeutenden Ansatz zu einer Theorie der Künste, die neben der Musik auch Rhetorik, Poesie und die visuellen Künste umfaßt. Dabei räumt er mit dem verbreiteten Mißverständnis auf, Darwins Musiktheorie postuliere auch für den Menschen einen direkten Zusammenhang von Singen/Musik und sexuellem Werbungserfolg. Das »singing for sex« bleibt, so Darwin, nur mehr als eine archaische Erinnerungsspur erhalten, die die menschlichen Künste phantasmatisch mit einem breiten Spektrum latent sexueller Affekte auflädt, welche alle Nuancen zwischen »love and war« durchlaufen können. Menninghaus liest Darwins Ausführungen vor dem Hintergrund des heute enorm gewachsenen Wissens in Archäologie und Evolutionstheorie sowie im Lichte der philosophischen und empirischen Ästhetik. Er ergänzt Darwins kühne Analyse, indem er die Rolle von Spielverhalten, Technologie und symbolischen Praktiken für die hypothetische Transformation sexueller Werbungspraktiken in menschliche Künste untersucht. Das Buch entwickelt ein überzeugendes Szenario für das "Woraus", "Wie" und "Wann" der Entstehung der menschlichen Künste und gibt eine komplexe Antwort auf die oft gestellte – und noch öfter vermiedene – Frage: "Wozu Kunst?"
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 431
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Winfried Menninghaus
Wozu Kunst?Ästhetik nach Darwin
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikationin der Deutschen Nationalbibliografie;detaillierte bibliografische Daten sind im Internetüber http://dnb.d-nb.de abrufbar.Erste Auflage 2011
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2011© Suhrkamp Verlag Berlin 2011 Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. eISBN 978-3-518-77010-8
Zur Gewährleistung der Zitierbarkeit zeigen die grau hinterlegten Ziffern die jeweiligen Seitenanfänge der Printausgabe an
www.suhrkamp.de
Cover
Impressum
Vorbemerkung 7
Einleitung 9
I . Werbung, Wettbewerb, Wahl: Darwins Konkurrenzmodell der Künste 31
II. Das Gegenmodell: Die Künste als Agenten sozialer Kooperation und Kohäsion 151
III . Sexuelle Werbung, Spiel, Technologie und Symbole: Vier evolutionäre Vektoren der Künste 195
IV . Ästhetische Selbstpraktiken 260
Bibliographie 280
Ausführliches Inhaltsverzeichnis 318
Anmerkungen 318
7 Vorbemerkung
Das vorliegende Buch ist das Gegenstück zu meiner 2003 erschienenen Studie Das Versprechen der Schönheit . Diese behandelte Adonis und andere mythologische Gestalten herausragender Schönheit gegen den Horizont von Darwins Theorie körperlicher Schönheit . Nun geht es um die Evolutionstheorie der menschlichen Künste . Wieder sind Überlegungen Darwins ein Hauptbezugspunkt: dieses Mal sein an Tieren entwickeltes Modell der Künste des Singens, Tanzens und multimodaler Vorführungen sowie seine Benutzung dieses Modells für eine evolutionäre Perspektive auf die menschlichen Künste. Und wieder werden auch Mythen herangezogen, dieses Mal Künstlermythen. Darwins eigene Erzählung von den visuellen und auditiven Künsten des Menschen hat selbst viele Merkmale eines zugleich wissenschaftlichen und phantasiegeborenen Mythos.
Das neue Projekt wurde bereits vor der Publikation des alten begonnen. Bis 2005 waren Konzept und einzelne Teile auch gut vorangekommen. Doch dann habe ich es übernommen, für die Freie Universität den Forschungscluster »Languages of Emotion« zu beantragen. Beantragung, Gründungsphase und mehrjährige Leitung dieses Clusters haben dazu geführt, dass mir die Fertigstellung des Buches sehr viel schwerer gefallen ist als diejenige aller Bücher, die ich zuvor geschrieben habe.
Zu den zeitlichen Schwierigkeiten kamen solche der inhaltlichen Ausrichtung hinzu. Die Forschungsprojekte im Cluster haben mir Gelegenheit gegeben, meine über viele Jahre verfolgten Interessen an den distinktiven Eigenschaften poetischer Sprache mit neuen Methodiken und unter Einbeziehung von theoretischen Modellen aus Psychologie und Linguistik zu betreiben. Experimentelle Rhetorik und Ästhetik in Kooperation mit meinen Berliner und Leipziger Cluster- 8 Kollegen aus den Sciences sind ein intellektuelles Abenteuer von großem Reiz. Leider ergab sich daraus auch eine gewisse Entfernung von dem evolutionstheoretischen Projekt. Denn beide – evolutionstheoretische Theoriebildung und streng empirische Ästhetik – sollten sich zwar idealiter wechselseitig unterstützen und begrenzen. Vorläufig berühren sie sich jedoch nur ausnahmsweise.
Immerhin weiß ich heute besser als noch vor zwei Jahren, wie sich einige Hypothesen des vorliegenden Buches empirisch testen lassen. Entsprechende Projekte werden demnächst entwickelt. Ihre Durchführung wird aber frühestens in zwei Jahren zu publizierten Resultaten führen. Nur an einigen wenigen Stellen des Buches konnte ich auf schon laufende experimentelle Studien zurückgreifen.
Ein sechswöchiges Fellowship des Humanities Research Center der Rice University gab mir im Sommer 2007 die Möglichkeit, grundlegende Ideen des vorliegenden Buches erstmals in einer Serie von drei Vorlesungen zur Diskussion zu stellen. Ein Opus magnum -Stipendium der Volkswagen und der Thyssen-Stiftung hat mir schließlich entscheidend geholfen, den Spagat zwischen den sehr verschiedenen Forschungsparadigmen auszuhalten und die Studie zur Evolutionstheorie der Künste trotz des starken Sogs in die empirische Forschung doch noch fertigzustellen. Meinen Cluster-Kolleginnen Laura Damerius, Katja Liebal und Constance Scharff danke ich für wichtige Hinweise aus evolutionsbiologischer und -psychologischer Perspektive, Philip Ekardt für seine kritische Lektüre der ersten Fassung des Gesamtmanuskripts. Henning Dahl-Arnold, Bendix Düker, Nina Peter und Michael Steimel danke ich für ihre Hilfe bei der Sichtung der Forschung und bei der Einrichtung sowie gründlichen Korrektur des Manuskripts. Ohne diese vielfältige Unterstützung wäre das vor längerer Zeit projektierte Buch vielleicht zwischen den vielen neuen Anforderungen und Interessen zerrieben worden.
9 Einleitung
Gegenstand und Ziel der Studie
Charles Darwins Buch The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex ( 1871 ) 1 enthält viele hundert Seiten über körperliche Schönheit bei Tieren und Menschen, aber nur wenige Seiten über die menschlichen Künste der visuellen Selbstverschönerung, des Singens und des rhetorisch-dichterischen Sprechens. An Kühnheit sind diese wenigen Seiten kaum zu übertreffen: Die im Tierreich verbreiteten Praktiken des Präsentierens körperlicher Ornamente und des werbend-kompetitiven Vorführens von Sing-, Tanz- und Baukünsten könnten, so Darwins Vermutung, eine frühe evolutionäre Phase auch der menschlichen Künste gewesen sein. Im kardinalen Fall der Musik betont er zugleich, dass ihre hypothetische archaische Phase nicht identisch mit einer Beschreibung und Erklärung der von homo sapiens sapiens tatsächlich geübten Künste sei ( II 330 - 333 ).
Das erste Kapitel der vorliegenden Studie widmet sich einer eingehenden Sichtung von Darwins Hypothesen zu den menschlichen Künsten. Es schreibt dabei gegen eine massive Tendenz der Darwin-Rezeption an, feinere Unterscheidungen zugunsten stark vereinfachter Basisannahmen nicht zu beachten. Darwins Theorie von Rhetorik und poetischer Sprache ist weithin noch zu entdecken; sie ist nie ernsthaft gegen den Ho 10 rizont der klassischen rhetorischen Theorie gelesen worden. Musik und Rhetorik treffen sich in Darwins Diagnose in dem Ziel, mit den nichtsemantischen und gewaltfreien Mitteln einer kunstvollen Elaborierung von Signal- und Symbolsystemen Aufmerksamkeit zu wecken und die Hörer affektiv für Person, Kunstleistung und die soziale oder sexuelle Agenda des jeweils Singenden oder Sprechenden einzunehmen.
Übereinstimmungen und Unterschiede zwischen den Künsten bei nichtmenschlichen und menschlichen Spezies hat Darwin in sehr ungleicher Weise erörtert. Die Ähnlichkeiten werden konzeptuell klar begründet und in Teilen auch detailliert beschrieben; die Differenzbehauptung bleibt dagegen blass und unausgeführt. Die vorliegende Studie bearbeitet diese Lücke. Als Leitfaden dient dabei die Frage: Welche anderen Verhaltensadaptionen des Menschen könnten dazu beigetragen haben, dass die hypothetischen Analoga der Vogelkünste des Singens, Tanzens und Vorführens des Federschmucks beim Menschen etliche distinktive Merkmale ausbilden konnten ? Die Künste, so die genealogische Hypothese, entstanden als neue Varianten menschlichen Verhaltens, als die sehr alten Adaptionen der Bewertung sexueller Attraktivität, des Spielverhaltens und des Werkzeuggebrauchs nach Erwerb und unter Mithilfe unserer Fähigkeit zu Sprache und Symbolgebrauch einem neuen gemeinsamen Gebrauch zugänglich wurden. Vor dieser Verschaltung im Feld der Künste war ästhetisch aufwändige Werbung weitgehend gegen Spielverhalten abgedichtet, hatte Spielverhalten wenig oder gar nichts mit Werkzeuggebrauch oder mit symbolischem Denken zu tun und trug die fortgeschrittenste Technologie der Materialbearbeitung nur wenig zu den Praktiken der Körperornamentierung bei. Das Flüssigwerden dieser Grenzen ermöglichte die Emergenz der Künste. Diese beerben zugleich einige der funktionalen Leistungen, die mit den teilweise sehr viel älteren Adaptionen von Spiel, Technologie und Symbolgebrauch verbunden sind.
Diese Hypothese zu den Künsten entspricht typologisch 11 einer generellen kognitionswissenschaftlichen Hypothese zur Struktur des menschlichen Geistes. Danach hängt die eigentümliche Kreativität und Flexibilität des menschlichen Geistes nicht zuletzt davon ab, dass wir einen crossmodularen Gebrauch von unseren kognitiven, emotiven und behavioralen Fähigkeiten und Dispositionen machen können. Kants berühmte Formel vom »freien Spiel unserer Vermögen« hat eine solche entgrenzende Verwendung und Integration sonst heterogener »Vermögen« bereits als zentrales Merkmal des Ästhetischen bestimmt.
Darwins Tierbeispiele weisen der ästhetischen Elaborierung durchweg eine klare Funktion zu. Als Form der Selbstanpreisung dienen sie primär der Werbung um das andere Geschlecht, oft zugleich der Herausforderung von Konkurrenten aus dem eigenen. Physische wie künstlerische Exzellenz erhöht die Chancen in der sexuellen (und sozialen) Konkurrenz. Die menschlichen Künste beerben diese Funktionen in je unterschiedlichem Umfang; sie relativieren sie zugleich durch eine Vielzahl weiterer Faktoren. In dem Maß, in dem die schönheitsgestützten Mechanismen sexueller Wahl hybride Verbindungen mit den Adaptionen von Werkzeuggebrauch, Spiel und Sprache (Symbolgebrauch) eingehen, ergibt sich eine enorme Erweiterung ihres Funktionsspektrums:
( 1 ) Konkurrenz : Die Fortsetzung des Schönheitswettbewerbs in der Konkurrenz der Künstler und die statusverleihende Funktion des Erwerbens und dekorativen Verwendens von Kunstwerken entspricht Darwins Vogelmodell und damit der sexuellen Genealogie der Künste (Kapitel I ).
( 2 ) Kooperation/Kohäsion : Die menschlichen Künste können ebenso in vielfältiger Form der Synchronisierung, Kooperation, ja Kohäsion sozialer Gruppen zuarbeiten und Konkurrenzmechanismen gerade einklammern, neutralisieren, ja überwinden (zumindest innerhalb von Gruppen). Erzählungen und Lieder, die gruppenweit gekannt, gesungen, teilweise auch geglaubt werden, und die Synchronisierung der Bewegungen vieler Individuen in gemeinsamen Tänzen 12 sind dafür einschlägige Beispiele. In Kapitel II wird für diese Phänomene ein Partizipations modell der menschlichen Künste entwickelt.
( 3 ) Selbstbildung/Selbstpraktiken : Die Produktion und Rezeption der Künste kann des Weiteren in der Ontogenese von Individuen motorische, kognitive und affektive Fähigkeiten befördern. Entsprechende Hypothesen stehen seit langem im Zentrum des klassischen Modells ästhetischer »Bildung« und Unterhaltung. In diesem Kontext wird der produktive und rezeptive Umgang mit den Künsten weder als kompetitive Werbung und zugehörige Wahl noch als Bindemittel für soziale Gruppen, sondern primär als Form der Selbstbildung gedacht. Funktionshypothesen dieses Typs werden in Kapitel III auf eine evolutionstheoretische Basis gestellt und in Kapitel IV vergleichend erörtert.
Die Konkurrenz-, Kohäsions- und »Selbstbildungs«-Hypothesen werden in der Regel als sich ausschließende Optionen vertreten. Keine der Hypothesen ist neu; jede hat bereits eine reiche, je eigene Geschichte. Das vorliegende Buch kann deshalb allein eine neue Sichtung, Begründung und Begrenzung dieser Hypothesen leisten. Dazu gehört der Nachweis, dass die konkurrierenden Hypothesen durchaus nicht grundsätzlich unvereinbar sind: Eine und dieselbe ästhetische Praxis kann zwei, ja allen drei Funktionen gleichzeitig zuarbeiten . Einzelne Kunstarten und -gattungen neigen zu unterschiedlichen Profilen in dominanter Einzelfunktion und möglichen Funktionsüberblendungen. Die theoretische Modellierung der möglichen Interaktionen der drei Funktionspole zeigt des Weiteren, dass die Kunsteffekte des dritten Typs eher als Implikation oder Nebeneffekt der beiden anderen Funktionspole gedacht werden können als umgekehrt.
13 Was ist evolutionäre Ästhetik ?
Schönheitswettbewerbe und das Vorführen von Gesangs-, Tanz- und Baukünsten gehören seit Darwin zum Kernbestand einer Evolutionsbiologie des Verhaltens. Darwins Hypothesen zur Rolle sexueller Körper-»Ornamente« und kunstvoller Vorführungen bei nichtmenschlichen Spezies haben insbesondere im späteren 20 . Jahrhundert ein breites Echo und eine enorme Vertiefung gefunden. Für seine Ausführungen speziell zu den menschlichen Künsten des Singens, Sprechens und Sich-Schmückens gilt das Gegenteil: Sie sind nur in kleinen akademischen Nischen rezipiert und nur selten ernsthaft weiterverfolgt worden.
Immerhin hat sich in den zurückliegenden Dekaden ein grenzgängerisches Gebiet mit dem Namen »Evolutionäre Ästhetik« etabliert. Es hat den Charme – und zugleich den prekären Charakter – eines Außenseiters, der sowohl in den etablierten Wissenschaften von den Künsten und der philosophischen Ästhetik als auch in der akademischen Psychologie und Biologie auf verbreitete Skepsis stößt. Überdies gibt es selbst unter den wenigen Vertretern der evolutionären Ästhetik erheblichen Dissens auch bei fundamentalen Fragen und Begriffen. Ein weithin geteiltes Verständnis der Begriffe »Evolution« und »Ästhetik« ist nicht gegeben. Ich werde deshalb vorab basale Optionen in der Semantik dieser Begriffe unterscheiden, um dadurch den theoretischen und methodischen Fokus zu bestimmen, unter dem die vorliegende Studie evolutionäre Ästhetik betreibt.
Ästhetische Wahrnehmung ist nicht denkbar ohne ein wertendes Moment. Entsprechend ist die Aussage, etwas sei schön oder weniger schön, gut inszeniert oder weniger gut inszeniert, stets mehr als eine deskriptive Aussage. Das »Geschmacksurteil« ist deshalb für Kant der zentrale Gegenstand der Ästhetik. Bewertet werden – auch jenseits von Regelpoetiken – die kognitive und affektive Lustfähigkeit visueller, auditiver und multimodaler Objekte und Ereignisse. Ästhetik 14 heißt deshalb in diesem Buch die Theorie von den Eigenschaften, der Entstehung und den Funktionen ästhetischer Präferenzen, wie sie sich in impliziten und expliziten ästhetischen Wertungen äußern. Wie in Kants Theorie des »ästhetischen Urteils« geht es mithin vor allem um die Seite der Rezeption . Fragen der »objektiven« Ästhetik – im Sinne der Romantiker und hegelianischer Ästhetiken – nach Geschichte und System der Künste und ihrer Unterarten stehen dementsprechend nicht im Vordergrund. Fragen der Aisthesis im weiteren Sinne – als generelle Theorie der sinnlichen Wahrnehmung und Erkenntnis überhaupt – werden nur behandelt, sofern dies für ästhetische Präferenzbildung im engeren Sinn unerlässlich ist. Und Fragen der Produktions ästhetik werden ebenfalls nur einbezogen, soweit sie direkt aus Art und Macht der Rezeption erklärbar sind. Bei den vermutlich besonders alten menschlichen Künsten des Singens und Tanzens gehen Rezeption und Produktion allerdings oft ineinander über. Diese Künste laden zum aktiven Mitmachen ein und verringern damit den Abstand zwischen Rezipienten- und Produzentenrolle. Funktional gleichwertig werden beide Rollen gleichwohl nicht. Das eigene Mitsingen und Mittanzen ersetzt keineswegs das Beobachten der Gesangs- und Tanzqualitäten anderer. Beide Rollen bleiben trennbar und funktional verschieden.
Darwin hat Kants Betonung der wertenden Rezeption noch verstärkt: Nach seiner Theorie verändern sich etwa die körperlichen Ornamente oder die Gesangsvorführungen von Vögeln speziesweit in genau dem Maß, in dem die Rezipienten systematisch ihre »Macht der Wahl« (»power of choice«, II 122 ) ausüben. Die Grundfragen der Ästhetik in diesem Verständnis lauten: Was bedeutet es, dass Rezipienten einige Phänomene in der Art ihres Erscheinens und Präsentiertwerdens (Aussehen, Klang, Bewegung und multimodale Überkreuzungen) anderen Phänomenen vorziehen ? Auf welchen sensorischen, kognitiven und affektiven Mechanismen beruht diese Bevorzugung ? Und welche Konsequenzen und Funktionen hat sie ?
15 Das Feld ästhetischer Bewertung ist weitaus größer als das engere Feld der Künste. Naturphänomene können ebenso ästhetisch geschätzt werden wie die Eleganz eines mathematischen Beweises. Ästhetische Bewertung kann ein mitlaufender Teil zahlloser Wahrnehmungsprozesse sein. Stärkere bis dominante Grade erreicht sie in der Regel nur bei bestimmten Objekt- und Ereignisklassen. 2 Prototypisch dafür sind die wertenden ästhetischen Sensitivitäten für das mehr oder weniger »schöne«, »gute«, »ansprechende« Aussehen natürlicher Körper und technisch hergestellter Objekte (Kleidung, Schmuck, Gebrauchsgegenstände diverser Art) sowie für die verschiedenen Künste. Es sind diese starken Auslöser ästhetisch wertender Wahrnehmung, die den gegenständlichen Horizont der vorliegenden Studie bestimmen. Die Künste stehen dabei obenan. Die Streuung ästhetisch ›urteilender‹ Wahrnehmung durch eine Fülle weiterer Bereiche wird hingegen nicht untersucht.
Die verschiedenen Künste machen von verschiedenen Sinnesdomänen und Prozessierungsmustern Gebrauch. Die Evolutionstheorie fragt deshalb primär nach je spezifischen Mechanismen und Funktionen der einzelnen Künste . Ohnehin ist der Kollektivsingular »die Kunst« für die Gesamtheit aller einzelnen Künste eine moderne westliche Erfindung, die wenig älter als 200 Jahre ist. Etliche Sprachen kennen einen solchen Sammelbegriff gar nicht. Im vorliegenden Buch werden zwar auch gemeinsame Merkmale der einzelnen Künste und mehr noch ihrer Rezeption herausgearbeitet; angesichts der evolutionstheoretischen Fragestellung dominiert jedoch die Ergründung der Arbeitsweisen und Funktionen 16 der einzelnen Künste. Der Titel müsste also streng genommen »Wozu die Künste ?« lauten.
Wie Archäologen, Ethnologen und Anthropologen nehmen evolutionäre Ästhetiker durchweg an, dass das moderne westliche Denken eines eigenen sozialen Subsystems mit Namen »Kunst« nur eine hochgradig spezielle Spielart kultureller Praktiken darstellt, die in früheren Zeiten mit großer Selbstverständlichkeit die alltägliche Lebenswelt einerseits, die Feste und religiösen Riten andererseits geprägt haben. Die vorliegende Studie folgt diesem Sprachgebrauch und bezeichnet mit dem Sammelbegriff »Künste« ein sehr weites Feld an Praktiken, die allesamt einen für unmittelbar praktische Zwecke entbehrlich scheinenden ästhetischen Aufwand betreiben, eben dadurch aber Aufmerksamkeit zu binden und eine Lust des Betrachtens, Zuhörens, Mitsingens, Mittanzens zu bereiten vermögen. Im Einzelnen umfassen diese Praktiken das Singen und Überliefern von Liedern und Erzählungen, Tänze, instrumentale Musik, Praktiken des Sich-Schmückens, Verzierung oder zumindest ästhetisch überdeterminierte Gestaltung etlicher selbsthergestellter Gegenstände des Alltagslebens, Riten mit mehr oder weniger großem ästhetischen Aufwand, vielfach auch Produktion von Skulpturen und Malereien. Alle diese ästhetischen Praktiken zeigen eine hohe kulturelle und historische Varianz in Verbreitung und Ausführung.
Evolutionstheoretische Modelle sind eine Option, die Entstehung, Verbreitung und kulturelle Variation der Künste zu erklären. Ziel des vorliegenden Buches ist allein die kritische Diskussion, Vertiefung und Ausdifferenzierung evolutionstheoretischer Hypothesen. Ambitionen, die Konflikte evolutionärer und anderer Erklärungsmodelle zu entscheiden, sind nicht damit verbunden. Vereinfachte Vorstellungen ihres Unterschieds werden allerdings ausgeräumt.
17 Die Vielfalt evolutionärer Prozesse
Wohl keine andere wissenschaftliche Innovation des 19 . Jahrhunderts hat das Denken so grundlegend verändert wie Darwins Einsichten in die Mechanismen biologischer Evolution. Die evolutionäre Ergründung komplexer menschlicher Verhaltensmerkmale hat gleichwohl vielfach immer noch das Negativimage improvisierter Spekulation und unterentwickelter Empirie. Für evolutionäre Ästhetik gilt dies in besonderem Maß. Darwins spekulative Hypothesen zu transkulturellen Merkmalen von Moral, Religion und ästhetischen Präferenzen ( I 34 - 106 , I 158 - 164 , II 330 - 384 ) bezeugen dieses Dilemma. Es ist erstaunlich, in welchem Umfang, mit welcher intellektuellen Brillanz und in welcher Präzision Darwin die Theoriebildung des späteren 20 . Jahrhunderts zu diesen Fragen vorweggenommen hat. Konzeptuelle Fortschritte über Darwin hinaus halten sich in engen Grenzen. Als Muster empirischer Forschung kann sein kühner Aufriss dieses riesigen Forschungsgebiets aber keineswegs gelten. Im Gegenteil: Wohl nur einem so phantasievollen Denker wie Darwin konnte es gelingen, bei so wenig Wissen über die Evolution der menschlichen Künste so weit reichende Hypothesen aufzustellen, deren Substanz noch längst nicht erschöpft ist.
Komplexe Verhaltensmerkmale sind die riskantesten Objekte evolutionstheoretisch fragender Untersuchungen. Um sicher sein zu können, dass ein Verhalten eine evolvierte Adaption ist, müsste idealiter gezeigt werden, dass es sowohl aufgabenspezifisch ist als auch – bei aller ontogenetischen Entwicklung und Varianz – angeborenen Einschränkungen unterliegt. 3 Der härteste Beweis dafür wäre der Nachweis, dass bestimmte Gen-Komplexe das fragliche Verhalten – und möglichst nur dieses – selektiv bedingen. Evidenzen dieses härtesten Typs sind bei komplexen Verhaltensmerkmalen zu 18 mindest vorläufig eine extreme Seltenheit. Selbst im Fall der Sprache steckt die genetische Entzifferung noch in den Anfängen. 4 Von einer Genetik ästhetischer bzw. auf Künste bezogener Verhaltensmerkmale weiß man so gut wie nichts.
Die letzten 15 Jahre haben vielfältige Versuche gesehen, diesen Mangel neurowissenschaftlich zu kompensieren, insbesondere auf dem Gebiet der neuronalen Prozessierung von Musik. Der Grundgedanke dabei ist: Wenn unser Gehirn musikalische Tonfolgen transkulturell zuverlässig in den gleichen Netzwerken prozessiert, wenn Läsionen dieser Netzwerke die entsprechenden Fähigkeiten nachweislich beeinträchtigen oder unmöglich machen, dann könnte es sich um angeborene Prozessierungsmuster handeln (auch wenn sie ontogenetisch zugleich auf kulturelles Lernen angewiesen sind).
Inzwischen hat sich allerdings die Einsicht durchgesetzt, dass die transkulturelle Gleichheit neuronaler Verarbeitungsmuster per se noch kein Goldstandard für angeborene Einschränkungen ( innate constraints ) ist. Forschungen zur Schrift bieten hierfür ein schlagendes Beispiel. Die Schrift ist viel zu jungen Datums, um die in bildgebenden Studien gefundene transkulturelle Übereinstimmung in der neuronalen Prozessierung als Effekt und Ausweis einer evolutionäre Adaption denken zu können. Für neue kulturelle Erfindungen wie die Schrift, so die Erklärung, rekrutiert unser Gehirn auf je geeignete Weise Prozessierungsnetzwerke, die für affine Aufgaben zuständig sind. 5 Bei der Schrift sind dies die Netzwerke für Sprache einerseits, für visuelle Erkennung andererseits. Die 19 flexible Anpassung an eine neue Aufgabe resultiert so in einem hochgradig uniformen Verarbeitungsmuster.
Diese neuronal recycling -Hypothese besagt nicht dasselbe wie eine rein kulturkonstruktivistische Erklärung. Indem unser Gehirn Schrift unter ökonomischem Rekurs auf evolvierte Netzwerke verarbeitet, bleibt diese Verarbeitung an die speziellen Möglichkeiten und Grenzen der rekrutierten Adaptionen gebunden. Zugleich ergibt sich die Konsequenz, dass selbst eine universelle Rekrutierung bestimmter Netzwerke für bestimmte kulturelle Kognitions- und Verhaltensmuster keineswegs ausreicht, um auf eine aufgabenspezifische Adaption gerade dieser Muster kraft natürlicher Selektion schließen zu können. Es könnte sich vielmehr um ein kulturelles Recycling weit älterer Adaptionen handeln, die gar nicht für diesen speziellen neuen Zweck evolviert sind.
Eine negative Gewissheit sei deshalb vorausgeschickt: Genetische und neurobiologische Evidenzen, dass die einzelnen Künste modular als spezialisierte Adaptionen evolviert sind, weiß das vorliegende Buch nicht beizubringen. Für eine evolutionstheoretische Erkundung ist dies keine Katastrophe. Wie Stephen J. Gould und Elisabeth S. Vrba betont haben, 6 bedeutet Evolution nicht stets und nur, dass natürliche Selektion aus einem Pool an Variationen ein bestimmtes Merkmal ausprägt, das für einen speziellen Gebrauch adaptiv ist. Evolutionäre Prozesse bringen auch viele Merkmale hervor, die nicht durch natürliche Selektion für eine bestimmte adaptive Aufgabe geprägt worden sind. Dabei kann es sich etwa um die zahlreichen Nebenprodukte adaptiver Selektion handeln. 7 Und vor allem: Einmal existierende adaptive und nichtadaptive Merkmale können von der weiteren Evolution als »ein Pool von Merkmalen, die für eine Kooptation verfügbar sind«, 8 be 20 nutzt und neuen Verwendungen zugeführt werden. 9 Darwins Beobachtungen und Bemerkungen schließen, so schon Gould und Vrba, ein breites Spektrum solcher evolutionärer »Kooptationen« ein. 10
Zentral für die evolutionäre Perspektive des vorliegenden Buches sind zwei Typen des Funktionswandels ( functional shift ), die evolvierte Adaptionen betreffen können:
( 1 ) Alte adaptive Merkmale können nicht nur ihre ursprüngliche Funktion zugunsten einer neuen verlieren; sie können auch neue Funktionen hinzugewinnen, ohne die bisherigen einzubüßen . 11
In mechanischer Hinsicht können etwa die Technologien der Selbstornamentierung als eine neue Verwendung unserer Adaption für Werkzeuggebrauch beschrieben werden. Die älteren Leistungen des Werkzeuggebrauchs für die Zwecke 21 der Jagd, der Nahrungszerlegung und des Kampfs mit Artgenossen gehen dabei nicht zugunsten der neuen (Herstellen von Farbe und Schmuckstücken, Entwicklung von Malinstrumenten und -techniken) verloren. Es wird vielmehr ein neuer Anwendungsbereich – und zugleich eine kulturelle Ausdifferenzierung der Technologie selbst – erschlossen. Das neue Phänomen der selbstdekorativen Künste entsteht durch den neuen kooptierenden Gebrauch einer sehr alten Adaption (Werkzeuggebrauch) zugunsten einer vermutlich noch älteren Verhaltensadaption (vorteilhafte Selbstpräsentation im Kontext sexueller Werbung bzw. sozialer Distinktion). Wie sich bei näherer Betrachtung zeigen wird, spielt die relativ neue menschliche Adaption der symbolischen Kognition dabei eine wichtige, die Kooptation vermittelnde Rolle.
Für die nichtdekorativen visuellen Künste sowie die sprachlichen und multimedialen Künste werden ähnliche Kooptationsmodelle vorgeschlagen. Darwins Hypothese zur Rhetorik besagt, dass rhythmische und melodische Fähigkeiten, die in der hypothetischen archaischen Proto-Musik der sexuell werbenden Überredung dien(t)en, in der neuen Adaption der Wortsprache als prosodisch-emotionale Überredungsmittel mit stark erweitertem Anwendungsspektrum weiterwirken.
( 2 ) Verhaltensadaptionen können ihre ursprüngliche Funktion verlieren, diesen Verlust der einstmaligen Funktion aber sehr lange überleben, ohne dass eventuelle neue Funktionen die obsolete alte gänzlich überlagern oder gar tilgen.
In diesen Fällen können Residua der einstmaligen Funktion auf wie immer erratische Weise spürbar und wirksam bleiben. Sie ragen dann als ein »evolutionäres Überbleibsel« (»evolutionary vestige«), 12 als insistierende Spur einer ganz oder weitgehend untergegangenen Funktion in eine neue Zeit hinein, in der die alten Koordinaten nicht mehr gelten. Ebendiese letzte Möglichkeit – das wiedergängerhafte, ›unto 22 te‹, assoziative Weiterleben von Verhaltensmerkmalen, deren evolutionäre Zeit ›eigentlich‹ abgelaufen ist – wird sich als die Kernfigur von Darwins Theorie der Musik erweisen.
Biologische Evolution und Kultur
Alte Adaptionen, ihre Nebenprodukte und die zahlreichen nicht durch Adaption entstandenen Merkmale von Lebewesen sind der riesige Varianz-Pool, aus dem durch Kooptation und rekombinierende »bricolage« immer wieder neues Verhalten entstehen kann. 13 In verstärktem Maß gilt dies für Lebewesen, deren Verhalten nur teilweise durch genetische Programme festgelegt ist und die daher auf den ontogenetischen Erwerb von Fähigkeiten und Kenntnissen angewiesen sind. Nach heutigem Wissen ist kein anderes Wesen so sehr ein sozial lernendes Wesen wie der Mensch. Darüber hinaus prägt homo sapiens sapiens in besonderem Maß ein Merkmal aus, das im Standardmodell der Adaption oft vernachlässigt worden ist, obwohl es grundsätzlich seit Darwin dazugehört: Lebewesen passen sich nicht nur an eine unabhängig von ihnen gegebene Umwelt an; sie verändern diese auch ihrerseits. 14 Erdwürmer und Ameisen etwa transformieren die Zusammensetzung des Bodens, in dem bzw. von dem sie leben; von Bibern gebaute Dämme verändern ökologische Systeme in einer sofort ins Auge fallenden Weise. Konsequent gedacht sind letztlich alle Lebewesen stets auch aktive Erzeuger und Veränderer ihrer eigenen Lebenswelt. Und je mehr sie durch ihr Verhalten und ihren Stoffwechsel ihre je eigene Umwelt verändern, desto mehr müssen sie sich wiederum an die Effekte ihrer eigenen Tätigkeiten anpassen.
Aus solchen fortgesetzten Rückkopplungen ergibt sich für 23 Spezies mit Spielräumen für soziales Lernen die Konsequenz, dass sogar ihre biologische Evolution zumindest in Teilen eine Funktion ihres eigenen, ontogenetisch erworbenen Verhaltens sein kann. Jede Generation einer sozial lernenden Spezies gibt an die nächste nicht nur Gene und einen je spezifischen materiellen Veränderungsstand der Umwelt ( ecological inheritance ), sondern auch lernbare Fähigkeiten weiter. 15 Beim Menschen schließt der je weitergegebene Stand der »niche construction« auch die dauerhafteren materiellen Produkte technologischer Praktiken ein: Hütten, Häuser, Werkzeuge aller Art, Schmuck, Kunstwerke und andere Objekte. 16
Insgesamt weiß man noch sehr wenig über die Interaktion von genetischer, ökologischer und kultureller Evolution. Dies hat insbesondere drei Gründe: ( 1 ) Die Komplexität des Rückkopplungsmodells erschwert eine trennscharfe Zuschreibung von Ursache und Wirkung bei einzelnen Korrelationen. ( 2 ) Der Stand des Wissens über die drei Variablen ist sehr ungleich; die meisten erlernten und protokulturellen Verhaltensformen haben nur sehr wenige eindeutige Spuren in der archäologischen Überlieferung hinterlassen. ( 3 ) Schließlich und vor allem: Genetische, ökologische und (proto)kulturelle Evolution arbeiten mit zum Teil sehr unterschiedlichen Geschwindigkeiten. 17 Das begrenzt entschieden die Möglichkeiten ihrer Rückkopplung.
Beispiele für Rückwirkungen kultureller Erfindungen auf die biologische Evolution stützen sich regelhaft auf Phänomene, in denen kulturelle Phänomene entweder eine sehr langfristige Stabilität zeigen oder in denen sie eine unge 24 wöhnlich rapide genetische Evolution begünstigt haben können. Der erste Fall könnte bei steinernen Handäxten gegeben sein: Diese haben eine so lange, mindestens anderthalb Millionen Jahre zurückreichende Präsenz in der menschlichen Überlieferung, dass die Annahme einer auch genetisch relevanten Rückkopplung mit der Evolution der Hominiden nicht abwegig scheint. 18 Für die kulturelle Benutzung von Feuer zur Zubereitung sonst ungenießbarer Nahrungsmittel könnte Ähnliches gelten. 19 Musterbeispiel für den zweiten Fall ist die Entwicklung zur Laktose-Toleranz. Diese genetische Veränderung antwortete offenbar relativ schnell auf einen neuen, sehr stark wirkenden Adaptionsdruck, der von der kulturellen Erfindung der Milchwirtschaft ausging. 20
Wo die besonderen Bedingungen der genannten Beispiele nicht gegeben sind, tappt die Erforschung der Wechselwirkungen zwischen Genen, Ökologie und Kultur noch weitgehend im Dunkeln. So gut daher die Hypothese einer »biokulturellen« Rückkopplung in der Evolution des Menschen auch begründet ist, 21 vorläufig ist sie kaum mehr als eine evokative Losung, für die probate Forschungsmethoden noch in den Anfängen stecken. Die theoretischen Konsequenzen sind gleichwohl erheblich: Bei systematischem Einschluss der »niche construction« erfordert Darwins Modell der Evolution grundsätzlich keine spezielle Modifikation für den Menschen. 22 Zugleich herrscht weithin Übereinstimmung, dass einige besonders machtvolle Mechanismen der Konstruktion selbstgeschaffener Umwelten nur beim Menschen zu finden 25 sind. 23 Dies gilt zumal für die gezielt unterrichtende Weitergabe von Informationen und Fähigkeiten und den akkumulierenden »Wagenheber«-Effekt menschlicher Kulturen, der sich durch symbolgestützte Erinnerung und Weitergabe ergibt und durch die Verwendung externer Speichermedien seine volle Kraft erreicht. 24
Die biologische Evolutionstheorie des Menschen ist mithin von sich aus in einem prägnanten Sinn eine Theorie seiner Evolution zu einem kulturellen Wesen . Einige Modelle dafür betonen so sehr ein selbstkonstruktives, auf soziales Lernen gestütztes Moment, dass die immer wieder strapazierte Opposition von biologischer Genese und Kulturkonstruktivismus dem Stand der Evolutionstheorie selbst nicht (mehr) gerecht wird.
Ein besonderer, primär für den Menschen reklamierter Typ der Interaktion von selbstgeschaffener Umwelt und biologischer Evolution impliziert sogar den Gedanken einer weitgehenden Entkopplung beider. Grundsätzlich können die Resultate der Tätigkeiten, mittels deren Lebewesen ihre eigenen Umwelten autopoietisch verändern, den biologischen Adaptionsdruck sowohl verstärken und beschleunigen als auch herabsetzen und verlangsamen. Beim Menschen gibt es nur wenige Anhaltspunkte für den ersten Fall, die so klar scheinen wie die bereits genannte Entwicklung zur Laktose-Toleranz. Anders verhält es sich mit dem entgegengesetzten Abhang der Interaktion von kultureller und biologischer Evolution. Zahlreiche Kulturtechniken – wie Kleidung, Impfung usw. – verringern oder suspendieren gar einige Mechanismen natürlicher Selektion. Sie erlauben dem Menschen, wie schon Wallace und Darwin hervorgehoben haben, »mit einem unveränderten Körper in Einklang mit einer sich verändernden Welt zu bleiben« ( I 158 - 159 ). Erlernte kulturelle Praktiken des Menschen können biologische Adaptionszwänge aus 26 hebeln, ja »überwältigen«. 25 Evolutionstheoretiker nehmen mehrheitlich an, dass spätestens seit der vielbeschworenen »kulturellen Revolution« der jüngeren Steinzeit – also seit 40 000 bis 50 000 Jahren vor unserer Zeit – Prozesse sozialen Lernens und die Erfindung neuer kultureller Praktiken die Entwicklung menschlichen Lebens weit stärker prägen und verändern, als dies für den Faktor genetische Evolution gilt. Andere, wie Robin Dunbar, 26 verlegen den Eintritt des Menschen in eine Kulturzeit, deren Beschleunigung kausal mit einem relativen Einfrieren insbesondere der bis dahin erreichten kognitiven Adaptionen einhergeht, sogar bis in die Zeit vor 150 000 Jahren zurück. 27
Diese hypothetische Verschiebung der Gewichte von biologischer und kultureller Evolution mag auch Dawkins’ Vorschlag motiviert haben, beide als völlig separate Systeme mit analogen Mechanismen zu betrachten. 28 Eine sehr rasche Verbreitung neuer kultureller Entwicklungen ist ein typischer Indikator für eine geringe Bedeutung spezieller biologisch-genetischer Beschränkungen der fraglichen Phänomene. 29 Die Forschungsrichtung einer Phylogenese der Kulturen 30 hat darüber hinaus Methoden entwickelt, kulturelle Abstammungsbeziehungen und Änderungsprozesse auch über sehr viel längere Zeiträume zu modellieren, im Fall der Sprachen über etliche tausend Jahre. 31 Aus den Resultaten ergeben sich 27 direkte Konsequenzen auch für die evolutionsbiologische Frage, ob und in welchem Umfang die kulturelle Evolution der Sprachenvielfalt eventuell Beschränkungen durch angeborene spezialisierte Adaptionen unterliegt. 32
Auf einige Produkte der menschlichen Künste, die eine lange archäologische Überlieferung haben – allen voran Keramik –, sind ›kladistische‹ Untersuchungen, die strukturelle Merkmalsanalysen kultureller Phänomene mit aufwändigen statistischen Methoden verbinden, ebenfalls bereits angewandt worden. Auch diese extrem vielversprechende empirische Methode hat allerdings inhärente Grenzen: Kein noch so subtiler und gut begründeter Stammbaum von Alter und Verteilung natürlicher Sprachen, keramischer Produkte oder anderer Klassen selbsthergestellter Kunstwerke gibt Antworten auf die Fragen, wie die Fähigkeit zu Sprache und symbolischer Kognition überhaupt evolviert ist, welche menschlichen Fähigkeiten die kulturelle Evolution der Künste begünstigt haben könnten, welche kognitiven und affektiven Mechanismen von den Künsten rekrutiert werden, welche Funktionen diese Mechanismen evolutionär hatten und heute haben. Das vorliegende Buch ist primär an diesen letzten Fragen interessiert.
Der heikle Status der Funktionsfrage
In einem mittlerweile klassischen Aufsatz hat Tinbergen vier Vektoren evolutionstheoretischen Fragens unterschieden: eine mechanistische, eine ontogenetische, eine phylogenetische und eine funktionale. 33 Grundsätzlich stellen diese Vektoren je unabhängige Forschungsziele mit eigenen Methodiken dar. Wer nach der Funktion des Vogelgesangs fragt, muss nicht unbedingt genau wissen, wie Vögel ihren Gesang me 28 chanisch erzeugen und in welchen Schritten sie ihre Gesangskünste ontogenetisch perfektionieren. Andererseits ist die Ablösung der Funktionsfrage von den anderen Vektoren einer Adaption bei Desideraten der evolutionären Ästhetik wenig zu empfehlen. Denn Funktionsfragen stehen hier generell auf besonders schwachem empirischem Fundament. Die größten wissenschaftlichen Fortschritte sind in den zurückliegenden Jahren für das »mechanistische« Niveau (etwa die physiologischen und neuronalen Grundlagen der Gesangserzeugung) gemacht worden. Dieses Niveau ist hier und jetzt empirisch bestens untersuchbar. Das ontogenetische Erlernen von Gesängen ist ebenfalls gut beobachtbar, und die phylogenetische Entwicklung der vokalen Trakte kann sich auf Artenvergleich und archäologische Funde älterer Hominiden stützen.
Die Funktionsfrage dagegen ist das wissenschaftliche Sorgenkind. Archaische Funktionen einer Adaption von Körper oder Verhalten hinterlassen oft keine, im günstigeren Fall nur sehr indirekte und schwer lesbare Spuren in der archäologischen Überlieferung. Auch ist keineswegs klar, ob eine heute beobachtbare Funktion identisch mit der archaischen Funktion ist, um deretwillen das Verhalten eventuell einstmals evolviert ist. Die Funktion einer Adaptation kann weit instabiler sein als die körperlichen oder behavioralen Mechanismen, welche dieser Funktion in der Umwelt ihrer Entstehung gedient haben. 34 Die Zuschreibung evolutionärer Funktionen sieht sich deshalb regelmäßig der Kritik ausgesetzt, wenig mehr als beliebige Ad-hoc-Erfindungen zu bieten.
Diese Achillesferse der evolutionären Psychologie wird im vorliegenden Buch nicht methodisch oder diplomatisch umgangen. Im Gegenteil: Die Funktionsfrage ist zentral, und gleichzeitig kennt der Autor den größeren Teil der empirischen Forschung nur aus interessierter Kenntnisnahme. Ein solches Vorgehen kann mit folgenden Argumenten gerechtfertigt werden:
29 ( 1 ) Theoriebildung enthält stets empirisch (noch) ungedeckte Vorgriffe. Einerseits gründet sie in dem Fundus verfügbarer empirischer Daten; andererseits benutzt sie theoriegestützte Modellannahmen, um sowohl die gegebenen Daten als auch fehlende und/oder noch unverstandene Daten zu konzeptualisieren. Ohne einen Überschuss der Theoriebildung über empirische Daten ist wissenschaftliches Arbeiten kaum denkbar. Dies schließt allerdings ein, dass Theoriebildung gehalten ist, sich so weit wie wie möglich auf verfügbare empirische Daten zu stützen.
( 2 ) Kritiker der evolutionären Ästhetik merken gern an, die vertretenen Funktionshypothesen seien allenfalls »interessant« oder »anregend«, nicht aber »wissenschaftlich« in dem Sinn, dass sie hier und heute mit allgemein akzeptierten Methoden für sich allein oder gar gegeneinander testbar und mithin empirisch falsifizierbar seien. Für einen Autor, der primär aus den Literaturwissenschaften und der theoretischen Ästhetik kommt, ist dies weniger abschreckend als für einen Biologen oder Psychologen. Die Texte der philosophischen Ästhetik und der den Künsten gewidmeten Disziplinen würden nach diesen Standards ohnehin bestenfalls »interessant« sein. Die Unterwerfung unter eine Empfehlung, zentrale Desiderate der Ästhetik mit Rücksicht auf mangelnde oder noch nicht hinreichend entwickelte empirische Testbarkeit lieber gar nicht zu verfolgen, wäre sicher nicht »interessanter«.
In ihrer eigenen Methode bleibt die vorliegende Studie der wissenschaftlichen Herkunft ihres Verfassers treu. Ein gutes Drittel der Studie wird primär aus einem close reading von Darwins Buch The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex ( 1871 ) entfaltet; die neuere Forschung zum Thema wird extensiv in dieses close reading einbezogen. Wie bei anderen Gegenständen soll die immer noch eher junge Methode des close reading zu einer differenzierteren Sicht auf Entwicklung und Funktionen der Künste verhelfen. Darwins Perspektive auf die menschlichen Künste, so stellt sich heraus, ist weitaus reicher und komplexer, als dies an ihrer heute 30 üblichen Wiedergabe erkennbar ist. Das genaue Lesen historischer Texte gehört sicher nicht zu den Stärken der aktuellen empirischen Wissenschaften. Heutige Evolutionsbiologen verlassen sich weit mehr auf ein abstrahiertes topisches Wissen von Darwins kardinalen Hypothesen, als dass sie seine Bücher tatsächlich noch lesen. Unter diesen Voraussetzungen scheint die Erwartung nicht zu verwegen, dass in diesem Feld manches auch noch lesend zu entdecken ist.
Archäologie und philosophische Ästhetik sehen in den Künsten vielfach ein, wenn nicht das entscheidende Definiens des Menschen. Metaphorologische Modelle der Künste haben den Abstand zu anderen Spezies dagegen regelmäßig überbrückt: Die aufwändige Honigproduktion der Bienen beschreibt seit der Antike die »Süße« dichterischer Sprachschöpfungen; 35 der Zikadenmythos evoziert eindringlich das Getriebensein zum »Singen« selbst um den Preis von Nahrungsaufnahme und Weiterleben; 36 und der Gesang der Vögel figuriert immer wieder als kaum zu übertreffender Inbegriff auch der menschlichen Musik. 37 Darwins Evolutionstheorie macht als Erste buchstäblich ernst mit einem Tiermodell der Künste. Seine Hypothesen zu den menschlichen Künsten gelten deshalb vielfach als reduktionistisch, »biologistisch« und heillos kunstfern. Das vorliegende Buch will das Gegenteil zeigen: Eine evolutionstheoretische Erkundung der Künste im Ausgang von Darwin tilgt nicht die Unterschiede der menschlichen und nichtmenschlichen »Künste«; sie erlaubt es vielmehr, diese Besonderheiten profunder und anders zu denken. Sie erschließt wichtige Einsichten in Entstehung, inhärente Mechanismen, Wirkungsweisen und – nicht zuletzt – die individuellen und sozialen Funktionen der Künste.
31 I. Werbung, Wettbewerb, Wahl: Darwins Konkurrenzmodell der Künste
1. Die Trajektorie visueller Ästhetik: Natürliche Körperornamente – dekorative Künste – Malerei und Skulptur
Autoren so unterschiedlicher Provenienz wie Platon, Edmund Burke, Charles Darwin, Sigmund Freud und viele andere teilen bei der begrifflichen Bestimmung ästhetischer Wahrnehmung und Wertschätzung ein ganzes Bündel semantischer Zuschreibungs- und sprachlicher Verwendungsregeln:
(1) Als Leitdifferenz für ästhetische Bewertung figuriert der Begriff der Schönheit.1 Gewiss haben Poetiken und Ästhetiken ein historisch wie kulturell variantenreiches Spektrum weiterer Bezeichnungen für ästhetische Qualitäten entwickelt; auch scheinen viele Bereiche der modernen Künste mit der Kategorie des Schönen nicht mehr angemessen erfassbar zu sein. Für das gesamte Gebiet der Ästhetik, das neben den modernen Künsten auch die ästhetische Wahrnehmung von Landschaften, natürlichen Körpern, von Gegenständen des täglichen Gebrauchs und dekorativen Objekten sowie industrielles Design und die älteren Künste umfasst, bewahrt der Begriff aber durchaus eine grundlegende Bedeutung. Sogar Kunstwerke oder Werbungen, die ganz gezielt Schönheits-kompatible Erwartungen verletzen, bleiben vielfach negativ an das gebunden, was sie nicht mehr sein wollen; sie bekräftigen insofern die jeweiligen Schönheitsnormen noch in deren Transgression.
(2) Schönheit wird als eine Auszeichnung der äußeren Er32scheinung verstanden, als ein distinktiver Vorzug, ein übernormaler Reiz.
(3) Das Wort »schön« hat sehr weit gestreute Anwendungen. Es wird umgangssprachlich als beinahe universeller Signifikant für die Zuschreibung positiver Wertigkeit (Valenz) verwendet, sogar in Verbindung mit negativen Begriffen. Wenn etwas als »ganz schön teuer« bezeichnet wird, ist das nicht identisch mit der unzweideutigen Ablehnung eines übertriebenen Preises. Die große semantische Streuung des Wortes »schön« wird vielfach beklagt; sie ist aber eine hochgradig allgemeine Eigenschaft des Sprachgebrauchs überhaupt und diskreditiert nicht per se die Verwendung des Wortes als Begriff einer ästhetischen Theorie. Im engeren Kontext ästhetischer Bewertung werden zwei Klassen von Objekten besonders häufig mit dem Attribut »schön« belegt: natürliche Körper (vorzugsweise der eigenen Spezies) und Kunstwerke aller Art. In einem weiteren Sinn umfassen Letztere auch die Bemalungen und Schmuckstücke, die menschliche Körper zieren, sowie die vielen von Menschen hergestellten Objekte – Werkzeuge, Häuser, Mobiliar u. a. –, denen auch ein ästhetisches Design zugrunde liegt oder die zumindest regelhaft für ihre ästhetischen Eigenschaften bewertet werden.
(4) Der Zuschreibung von Schönheit wird eine handlungsmotivierende Komponente zugesprochen: Schönheit weckt Begehren – und damit ein Annäherungsverhalten. Bei sexuellen Körpern geht das Ziel der Annäherung oft über die ästhetische Betrachtung hinaus; bei Kunstwerken und anderen schönen Objekten besteht die Handlungskonsequenz darin, schöne Objekte aller Art bevorzugt und länger als andere zu betrachten, wiederholt den Anblick zu suchen, eventuell auch sie zu erwerben.2 Eine Entscheidung für fortgesetzte oder erneute Betrachtung ist im vollen Wortsinn eine Handlungskonsequenz ästhetischen Gefallens.
33(5) Die Wahrnehmung des Schönen hat an sich selbst eine positive Empfindungsqualität. Woran immer Schönheit ›objektiv‹ festgemacht wird, ihre Wahrnehmung hat eine affektive Dimension, die subjektiv als (ästhetische) Lust empfunden wird. Sie ist mithin inhärent selbstbelohnend.
Diese elementaren semantischen Implikationen und Verteilungsregeln des Attributs »schön« – die gewiss nicht sein gesamtes Bedeutungs- und Anwendungsspektrum erschöpfen – finden sich nicht allein bei den eingangs genannten Autoren. Sie gehören vielmehr zum allgemeinen Sprachgebrauch zahlreicher natürlicher Sprachen. Charles Darwins Reflexionen über die mögliche Entstehung der menschlichen Künste haben der sprachlich und theoriegeschichtlich sedimentierten Brücke zwischen der ästhetischen Bewertung sexueller Körper und künstlerischer Hervorbringungen eine evolutionstheoretische Formulierung gegeben. Ein vermittelndes Glied zwischen beiden Phänomenkreisen hat Darwin darin gesehen, dass bei etlichen Vögeln, Insekten, Amphibien und anderen Tieren nicht besser ausgebildete sexuelle Körperornamente, sondern unterschiedliche Gesangs- und Tanzfähigkeiten über sexuelle Attraktivität (mit)-entscheiden.
Darwin glaubte, dass Vögel und Insekten entweder durch Aussehensvorzüge oder durch kunstvolle Darbietungen, nicht aber in beiden Domänen zugleich miteinander konkurrieren (II56, 226, 352). Er stützte sich dabei auf die vielen unscheinbar aussehenden Vögel, die hervorragend singen können. Heute weiß man, dass Darwin die Gesangs- und sonstigen Vorführkünste hochkolorierter tropischer Vögel weit unterschätzt hat. Viele Vögel scheinen gleichzeitig einer ästhetischen Konkurrenz in Aussehen, Gesang und Bewegungsdisplays zu unterliegen. Der Mensch gehört zu den Spezies, die ebenfalls in einen ästhetischen Mehrkampf verwickelt sind. In Darwins Ausführungen lassen sich gleich fünf Domänen ästhetischer (Selbst-)Präsentation und Rezeption beim Menschen unterscheiden: natürliche Aussehensvorzü34ge, Gesangskünste, Tanz/Selbstbewegungskünste, Praktiken artifizieller Selbstornamentierung sowie visuelle Kunstwerke jenseits des eigenen Körpers.
Das vorliegende Kapitel skizziert in Abschnitt 1.1 zunächst die theoretische Basis für Darwins Hypothesen zu den menschlichen Künsten: sein Modell der Evolution ästhetischer Präferenzen für körperliche Aussehensmerkmale und ihrer Rückkopplung mit sexueller Wahl. Darwin selbst hat dieses Modell – was in dessen Wiedergabe fast immer vernachlässigt wird – in Begriffen entwickelt, die weithin der philosophischen Ästhetik entnommen sind. Abschnitt 1.2 erörtert das nach Darwin kardinale Aussehens-»Ornament« des Menschen: die nackte Haut. Abschnitt 1.3 untersucht die Bedeutung dieses sehr besonderen Ornaments für die Entwicklung der visuellen Künste der Selbstbemalung und sonstigen Selbstdekoration. Abschnitt 1.4 schließlich zeigt die Bedeutung der nackten Haut für die Entstehung einer visuellen »Imagination« und für die relative Ablösung ästhetischer Wertschätzung von direkt sexuellen Implikationen.
Neuheit, Übertreibung, Variation um der Variation willen, Symmetrie/Rhythmus, friedliche Konkurrenz
Darwin hat vor allem deshalb mehrere Jahrzehnte über »beauty« nachgedacht, weil sie ein Problem für seine Theorie der natürlichen Selektion darstellt. Schmückende Federn, Hörner und Geweihe haben bei etlichen Tierarten »staunenswerte Extreme« erreicht. Sie haben eine solche Größe bzw. eine solche Form angenommen, dass sie in den »in den allgemeinen Lebensbedingungen« eher hinderlich und als Waffen nur noch wenig tauglich sind (I279). Ein kardinaler Text der philosophischen Ästhetik, den Darwin auch mehrfach explizit zitiert hat, scheint ganz direkt sein Fragen nach »beauty« und »taste« angeleitet zu haben: Edmund Burkes 35Philosophische Untersuchung über den Ursprung unserer Ideen vom Schönen und Erhabenen (1756). Burke behandelt bereits die »extreme Schönheit« des Pfauenschmucks in Darwins Begriffen eines Konflikts mit natürlicher »Fitness« und »guter Angepaßtheit«.3 Wie konnte es zu Phänomenen wie dem Pfauenrad kommen ?
Den ersten Schritt in Richtung bevorzugter Körperornamente hält Darwin für grundsätzlich arbiträr. Irgendein gegebenes Merkmal wird durch (genetische) Variation geringfügig verstärkt. Die bloße »Neuheit«, relative »Seltenheit« und »Verschiedenheit« dieser »Übertreibung« kann verstärkt Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Auf welche konkreten Merkmale sich solche Präferenzen für unwahrscheinliche Differenzqualitäten im Einzelnen verlegen, kann Darwins Theorie nicht vorhersagen, ja sie verneint eine entsprechende Erwartung. Eine Schnabelform etwa kann durch natürliche Selektion zugunsten der Erschließung neuer Nahrungsressourcen adaptiv modifiziert werden; daraus folgt recht genau, wie die Modifikation ausfallen muss. Sexuelle Ornamente dagegen entbehren einer solchen pragmatischen Funktion weitgehend. Sie müssen vor allem an sich selbst beeindrucken und gefallen – und das können sie grundsätzlich auf mehr als eine Weise. Deshalb postuliert Darwins Modell eine große Varianz und auch Arbitrarität der für ihre »Schönheit« bevorzugten Merkmale. Die »Capricen der Mode« (II339) sind dafür das kulturelle Vorbild.
Um Aufmerksamkeit und potenziell Begehren auf sich zu ziehen, muss die Überausprägung ornamentaler Merkmale keineswegs groß sein; es genügen vielmehr kleine, ja minimale Gradunterschiede. Deshalb ergibt sich auch kein Konflikt zwischen den Präferenzen für »bloße Neuheit« (»mere novelty«), »Veränderung um der Veränderung willen« (»change for the sake of change«) und »bloße Vielfalt« (»mere variety«) (II230) mit der gleichermaßen gut etablierten Präferenz 36für das Erfüllen eines durchschnittlichen Gattungsschemas (Prototypikalität):4
Alle Menschen bevorzugen, was sie gewöhnt sind. Jeder abrupte Wechsel mißfällt ihnen; aber sie lieben Abwechslung und bewundern es, wenn ein charakteristisches Merkmal bis zu einem maßvoll extremen Grad entwickelt wird. (II354)
Diese Rückkopplung von Abweichung (Differenz, Neuheit, Übertreibung) und Konformität zur Gattungsnorm5 entspricht recht genau einer Aristotelischen Grundregel für ästhetisch wirkungsvolle Sprachkunst. Danach soll der Dichter in seine Diktion einerseits etwas Fremdartiges (xenón) und Übertreibendes (aúxesis) mischen, andererseits eine Nähe zum Gebräuchlichen und Vertrauten wahren. Das Fremdartige bereitet eine Lust, die aus Bewunderung und Verwunderung ihre Quelle bezieht (hedy dè tó thausmastón); das Gebräuchliche wiederum ist angenehm, weil es leicht zu prozessieren ist. Beides ist, je nach Kontext und Redegattung, auf angemessene Weise zu mischen.6 Die heutige Theorie der »optimalen Innovation« im Feld ästhetischer und rhetorischer Formen besagt dasselbe.7 Fortgesetzte Akte der Bevorzugung minimaler Abweichungen können zu einem sich selbst tragenden und in evolutionärem Maßstab relativ rasanten Prozess des Differenzgewinns um seiner selbst willen führen (II351) – und mithin zu einer im Endeffekt oft extremen Verstärkung eines Körper-»Ornaments«. Dieser Gedanke wird seit Ronald 37A. Fishers Reformulierung von Darwins Modell weithin akzeptiert.8
In den auditiven und visuellen Künsten hat Darwin dieselben Mechanismen am Werk gesehen wie bei der Bevorzugung bestimmter Körperornamente. Von selbst versteht sich, dass die Künste noch schneller und noch variabler die Nachfrage nach Übertreibung, Varianz und Vielfalt bedienen können als die natürlichen Aussehensunterschiede sexueller Ornamente. Dies gilt umso mehr, je größer der lernbare, mithin individuell perfektionierbare Anteil ästhetischer Vorführungen ist. Darwins Begriff der »Künste« betont den oft großen Lernaufwand, den sich etwa viele Singvögel abverlangen müssen (I55-56). Ontogenetische Faktoren, generelle Lernfähigkeiten und lokale Traditionen gewinnen damit an Bedeutung gegenüber einer rein genetisch gedachten Varianz sexueller Körperornamente, auf die allein sich Fishers Reformulierung bezieht.
Die Entdeckung des »Prinzips« sich selbst verstärkender Ornamentpräferenzen hat Darwin Alexander von Humboldt zugeschrieben (II351). Humboldts Reiseberichte liefern etliche der ethnologischen Evidenzen, die Darwin für natürliche wie für kulturelle Körpermoden anführt. Humboldts Beispiele betreffen vornehmlich die Interaktion von natürlichen Körpermerkmalen und kultureller Bearbeitung, etwa die Verstärkung biologisch evolvierter Hautfarbenunterschiede durch die kulturelle Bemalung der Haut (II352, 346-347). Den männlichen Bart behandelt Darwin besonders ausgiebig als ein Beispiel für dieses Prinzip:
Es ist merkwürdig, daß auf der ganzen Erde diejenigen Rassen, die beinahe vollständig bartlos sind, Haare im Gesicht und am Körper nicht leiden können und bemüht sind, sie zu entfernen. Die Kalmücken sind bartlos, und es ist eine bekannte Tatsache, daß sie sich wie die Amerikaner alle vereinzelt erscheinenden Haare ausreißen. Das gleiche gilt von den Polynesiern, einigen Malaien und Siamesen. [. . .]
38 Andererseits schätzen und bewerten bärtige Rassen ihren Bart sehr hoch. Bei den Angelsachsen hatte jeder Körperteil seinen bestimmten Wert. »Der Verlust des Bartes wurde auf 20, ein Schenkelbruch dagegen nur auf 12 Schilling taxiert.« (II349)
Für eher ovale oder breite Gesichtsformen (II344-345, 354) gibt es analog je entgegengesetzte kulturelle Präferenzverstärker. Kapriziöse Praktiken zugunsten noch kleinerer Füße (II352), weit ausladender weiblicher Gesäße (II345-346), verrückter Haartrachten (II340, 348) oder Zahn- und Kopfformmoden aller Art (II340-341) passen nahtlos in diese Revue am Leitfaden des »Humboldt-Prinzips«. Mehr noch: Viele Tierarten sind vermutlich überhaupt nur entstanden, weil sich abweichende Präferenzen für sexuell anziehende Form-, Farb- und Tonornamente gegenseitig hochgeschaukelt und am Ende zu eigenen Unterarten geführt haben.9 Darwin erwähnt als Beispiele Vogelarten, die sich bei sonstiger Nicht-Verschiedenheit in entgegengesetzte Farbextreme entwickelt haben, wie schwarze und weiße Schwäne, Storche oder Ibisse (II230-231).
Die Tendenz zur Forcierung sexueller Ornamente kann mithin in ausgeprägten ästhetischen Kontrasten zwischen den Arten resultieren. Generell kann die Forcierung einmal eingeschlagener Ornamentpräferenzen langfristig – sofern die natürliche Selektion den auffälligen Trend nicht bremst und/oder Sinnesdispositionen in Verbindung mit Licht- und Sichtbarkeitsbedingungen der ökologischen Nische dem nicht entgegenstehen – sehr auffallende Farben, Formen und Bewegungs-/Präsentationsmuster sexueller Ornamente begünstigen. Daher die vielen bunten, ja grellen und exzentrischen Beispiele, die Darwin wie ein Panorama natürlicher Schmucksucht zu präsentieren weiß. Die Bevorzugung starker gegenüber schwachen Kontrasten, reiner strahlender gegenüber gemischten Farben und elaborierterer ästhetischer Displays gegenüber weniger elaborierten ist in Studien mit 39Tieren wie mit Menschen (zumal Kindern) vielfach bestätigt worden.10 Ebenso unverkennbar ist, dass die menschliche Ästhetik in Bildern, Kleidung und Innen-Design auch die entgegengesetzte Richtung einschlagen kann, indem sie geringe, fein abgestufte Farbkontraste bevorzugt.
Darwins Beispiele und seine generellen Bestimmungen ästhetisch-sexueller Bevorzugung betonen allesamt – und ganz im Stile dessen, was gern die Autonomie-Ästhetik genannt wird – eine zumindest partielle Selbstgesetzlichkeit des ästhetischen »Sinns für Schönheit« bzw. »Geschmacks für das Schöne« (I63-64) gegenüber pragmatischen Rücksichten. Lokal divergente ästhetische Präferenzen innerhalb einer Spezies sind – wie das Beispiel des männlichen Bartes zeigt – auch nur sehr schwer als genetisch rückgekoppelte Fitnessindikatoren tauglich (sofern nicht gezeigt werden kann, dass in der einen Population der Bart, in der anderen dagegen dessen Fehlen mit »guten Genen« korreliert).
Selbst Kant und die idealistische Ästhetik haben die Begriffs- und Zwecklosigkeit des Schönen allerdings an eine Funktionalität für kognitive und affektive Bedürfnisse des Menschen geknüpft.11 Darwins Hypothese zur Funktion der in Farbe, Form, Größe und Elaborierung nicht aus pragmatischen Adaptionszwängen erklärbaren Ornamente lautet: Sie verschaffen Konkurrenzvorteile im hochspezifischen Kontext der sexuellen Werbung. Die tendenziell hinderlichen Effekte im Register der allgemeinen Lebensbedingungen begründen die ›Autonomie‹ des Ornaments, der adaptive Bezug 40auf die arteigenen Geschlechtsrollen dagegen seine Funktionalität.
Gewiss wird die Kantische Interesselosigkeit des ästhetischen Urteils in Darwins Theorie vom idealistischen Kopf eines rein »intellektuellen Interesses«12 auf die Füße eines markanten sexuellen Interesses gestellt. Gleichwohl ist auch die Präferenz der Pfauenhenne ein Urteil kraft unmittelbaren Gefallens. Die Hennen präferieren nicht deshalb den schönsten Pfau, weil sie mit ihm die Vorstellung eines Vorteils für die Proliferation ihrer eigenen Gene verbinden. Die proximaten Mechanismen sexueller Werbung und Wahl dürfen nicht mit der ultimaten Ursache des Verhaltens – seiner Auswirkung auf die Selbstreproduktion – gleichgesetzt werden. Das Präsentieren von Aussehensvorzügen, Singen und Tanzen sind als Verhaltensformen eigener Art bei Vögeln und anderen Tieren auf die Phase der sexuellen Werbung und Wahl spezialisiert, nicht aber auf deren mögliche Folge (Kopulation, Austragen, Aufzucht des Nachwuchses). Ein motivationales Band zwischen beiden Verhaltenskreisen muss nicht existieren und existiert in der Regel auch nicht. Am Beispiel der Künste gesprochen: Ein Künstler, der nach den (proximaten) Antrieben seiner Arbeit gefragt wird, wird typischerweise einen großen Kreis möglicher Motive nennen – Lust am Ausprobieren neuer Formen, Obsession für bestimmte Stoffe, Inspiration durch große Vorbilder usw. Extrem unwahrscheinlich ist dagegen die Antwort, er sei von dem ultimaten Ziel einer Proliferation seiner Gene beseelt. Daraus kann aber noch nicht gefolgert werden, dass ein erfolgreicher Künstler nicht zumindest teilweise seine sozialen Möglichkeiten, einschließlich der sexuellen, seinen besonderen künstlerischen Fähigkeiten verdankt. Die kategoriale Trennung proximater und ultimater Mechanismen ist umso wichtiger, als Darwin an keiner Stelle die menschliche Musik der evolutionären Letztwährung des Reproduktionserfolgs unterstellt.
41Die Nichtbeachtung dieser Unterscheidungen ist für etliche Konfusionen und Pseudoalternativen verantwortlich. Besonders verbreitet ist der Einwand, in Darwins evolutionärer Ästhetik gehe es gar nicht um »Schönheit«, sondern allein um physische »Attraktivität«.13 Zentral für ästhetische Wahrnehmung sei, mit Kant zu reden, die »Interesselosigkeit des Wohlgefallens«; ebendiese aber sei beim Urteil über sexuelle Werbungskünste nicht gegeben. Das Argument versäumt nicht nur, die historische Spezifizität des modernen Uninteressiertheitsgebots zu hinterfragen. Es übersieht ebenso souverän, dass etliche Sprachen und philosophische Theorien von der Antike bis heute die sexuell anziehende Erscheinung von Frauen und Männern durchaus regelmäßig als »Schönheit« bezeichnen. Erst der protestantische Affekt, mit dem insbesondere Kant jede noch so entfernte Affinität zum sinnlich-sexuellen »Reiz« aus der Höhenlage transzendentaler Ästhetik zu verbannen versucht hat, hat die Abtrennung eines genuin »ästhetischen« Reichs der Schönheit von jeder Erinnerung an sexuell anziehende Schönheit zum Ausweis (bürgerlich) gehobener Geschmackskultur gemacht. Die britische und französische Ästhetik kennt keinen vergleichbaren Exorzismus des Sexuellen, die zeitgenössische literarische Imagination des Schönen noch weit weniger.
Der theoretische Preis für die Entkopplung von physisch-sexueller Schönheit und »reinem« ästhetischen Urteil ist hoch: Ein hypothetisches gemeinsames Fundament beider im Sinne Platons, Darwins, Freuds und anderer gerät aus dem Blick. Diesen Preis zu zahlen, lohnt umso weniger, als selbst die evolutionäre Erzählung von der sexuellen Funktion der Schönheit keineswegs wichtige kategoriale Unterschiede verwischt. Die inhärenten Mechanismen, mittels deren werbende Aussehens-, Tanz- oder Gesangsvorführungen ästhetisch »beurteilt« werden, werden in diesem Modell durchaus als eine Adaption sui generis gedacht. Deren mögliche zeitlich 42und funktionale Folge, die Einleitung und Durchführung eines sexuellen Akts, gehorcht wiederum eigenen Verhaltensmustern. Die logische Trennbarkeit, ja Getrenntheit beider wird vollends zu einer Wahrnehmungsrealität, sobald körperliche Schönheit in künstlerischen Darstellungen an dem »Entkopplungs«-Effekt teilhat, der eine grundlegende Leistung unserer Fähigkeiten zu symbolischer Kognition ist.14 Freud hat zudem gezeigt, dass gerade die von Darwin beschriebene Schönheit des Menschen von sich aus eine Tendenz hat, direkt sexuelle Handlungsimpulse ›abzulenken‹.15 Und nach Horst Bredekamp kann sexuelle Wahl im Sinne Darwin grundsätzlich mit der gleichen »Theorie des Bildakts« gedacht werden, die Bredekamp primär für die Malerei und andere kulturelle Bildwelten entwickelt hat.16
Darwins Rede von sexuellen Körper-»Ornamenten« schließt den evolutionsbiologischen Diskurs an eine zentrale Kategorie der philosophischen Ästhetik an. Ornamente gelten seit der Ästhetik des späteren 18. Jahrhunderts als Inbegriff des zweck- und begriffslosen Schönen. Arabesken, ornamentale Ranken und andere »Parerga« dominieren deshalb die Beispiele, die Kant in der Kritik der Urtheilskraft für »freie« Schönheit gibt.17 Owen Jones’ Grammar of Ornament (1856) lieferte Darwin ein zeitgenössisches Panorama der Ornamentästhetik. Die Evolution bestimmter Körperteile denkt Darwin in voller Analogie zur Applikation von Ornamenten. Dies entspricht dem biologischen Umstand, dass viele Körperornamente oft nur in den Zeiten sexueller Werbung ausgebildet werden und danach wieder mehr oder 43weniger schnell verschwinden. Der Agent dieser Ornamentierung ist nicht länger ein Schöpfergott, der die Natur nicht nur weise, sondern auch schön ›verziert‹ eingerichtet hat. Es sind vielmehr sexuelle Wahlakte von Seiten des anderen Geschlechts, die über sehr lange Zeiträume bestimmte »Ornamente« erblich gemacht und verstärkt haben. Darwin ist der erste und vielleicht einzige Autor in der Geschichte der Ästhetik, der den schönen Körper – und nicht nur, wie Bachtin, den grotesken Gegenpol zum schönen Körper18 – stringent mit den Mitteln der Ornament-, Grotesken- und Arabesken-Ästhetik gedacht hat.
Darwins Poetik des »Kapriziösen« (caprice; II230, 339) pointiert die Unmotiviertheit, Arbitrarität, auch die Unsinnigkeit eines in seiner Art gleichwohl aufwändigen und stringenten Phänomens. Die launischen Präferenzen für exuberanten Federschmuck scheinen Darwin letztlich genauso erratisch wie die Vorlieben, denen sich die pinkfarbenen Hinterteile mancher Affen verdanken.19 Als Tick, Marotte oder beliebiges Steckenpferd haben kapriziöse Neigungen durchaus etwas Liebenswertes; das Moment des Unsinnigen und Schrägen, ja leicht Verrückten wird dadurch aber nicht aufgehoben.
In der Literatur erinnert Darwins Formel von den Capricen des Geschmacks (capriciousness of taste) nicht nur von fern an die launische Digressionspoetik, die Lawrence Sternes Roman Tristram Shandy (1759-1767) und seine romantischen Verwandten prägen. Sternes Roman verspricht »Leben und Ansichten« (Life and Opinions) seines Protagonisten, braucht aber angesichts fortgesetzter Unterbrechung des erwartbaren Handlungskerns durch immer neue, sich vermehrende und untereinander vernetzende Exkurse theoretischer, historischer und narrativer Art, durch ›launische‹ Anekdoten und Rahmenerzählungen etliche hundert Seiten allein bis zur 44Geburt des Protagonisten. Die Erzählkunst der deutschen Romantik macht reichlich von ähnlichen Unterbrechungs- und arabesken Wucherungstechniken Gebrauch. In beiden Fällen drängen sich immer wieder scheinbare Paratexte und Addenda in den Vordergrund der Werke und überlagern ihren (vermeintlichen) narrativen Kern. Von Friedrich Schlegel über Edgar Allan Poe bis Charles Baudelaire war die Ornamentform der Arabeske Namen-gebend für solche literarischen Praktiken, insbesondere in der speziellen Ausprägung der Rokoko-Arabeske.20





























