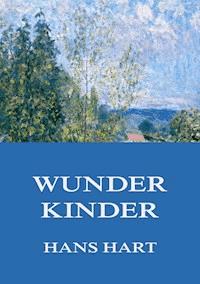
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Buch, das von Wunderkindern erzählt, in dem es von Wunderkindern einfach wimmelt, und das ihr Entwickeln zu dem Alltag oder zur reifen Höhe glaubhaft schildert. Viel Musik ist darin: Der Knabe Karl Maria Iredenius, der Geiger, der alle Gefahren des frühen Berühmtseins durchmacht, alleGefahren einer folgenden Sterilität, alle Gefahren einer neuansetzenden, nun schwergesetzten Arbeit; das Judenmädel Miriam, das als sechsjähriges Kind schon im Hofballett Triumphe einholt und als Zwanzigjährige eine umstürmte Sängerin ist. (Sie ist die stärkste Gestalt des Buches: genial, weibisch, berückend, gemein.) Und dann noch eine ganze Suite von Variationen über das Motiv Wunderkinder: ein Organist Willi Guth, der alle seine Kinder gewaltsam, mit Stockhieben und evangelischer Frömmigkeit, zu musikalischen Größen aufziehen will und dessen etwas gewaltsame Erziehung immerhin den Erfolg hat, daß sein Aeltester eines Tages von einem Impresario als — Meisterringer geworben wird und schließlich sogar den berühmten Türken Kara Mustapha beim Preisringen wirft. Nochmals: es ist ein herzliches Buch, nicht erschütternd, nicht unvergänglich, nicht revolutionär: doch man liest es gern, mit einer gewissen Spannung nach dem Fortgang der Handlung, zu Ende. Es gehört zu jenen Büchern, die zwischen Kunst und Unterhaltung einen Mittelweg zu finden wissen, die den Leuten die Entdeckung großer Dichtkunst zwar noch erschweren und sie doch schon eindrucksvoll vom vielgeliebten Schund fortführen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 481
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wunderkinder
Hans Hart
Inhalt:
Wunderkinder
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
Wunderkinder, H. Hart
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849646417
www.jazzybee-verlag.de
www.facebook.com/jazzybeeverlag
Wunderkinder
1
Ein alter Fliederstrauch steht in voller Blüte, die knorrige Linde wickelt gerade ihre Blätter aus. Ein Rosenstock, dessen Haupt eine rote Glaskugel schmückt, streckt zartgrüne spitze Finger vor. Die drei alten Gesellen sind der einzige Schmuck des Gärtchens, wenn man den Efeu, der die hohen, häßlichen Feuermauern ein Stück hinanklettert, nicht mitrechnet. Der Frühling hat harte Arbeit in diesem schmalen Gartenstück, das wie eine vergessene Märcheninsel zwischen dem alten Winkelwerk sich birgt. Der Flieder muß doppelt süß duften, will er die Küchengerüche besiegen, die aus den offenen Fenstern ringsum herausflattern. Und auf das junge Gras fallen oft Glasscherben, leere Konservenbüchsen, auch alte Schuhe und Orangenschalen, wenn einer das grüne Fleckchen als Schuttplatz ansieht, derweil von dem armen Volk mit der lichtlosen Seele keine Rücksichtnahme auf ein winziges Gärtlein verlangt werden kann.
Im Fenster einer Parterrewohnung sitzt ein kleiner, fetter Kerl mit rotem Haar, läßt die Beine über den Efeu baumeln, hält eine Geige in der Hand – und zieht langsam und fleißig den Bogen über die Saiten. In dem bartlosen Gesicht leuchten scheue, braune Augen so warm und innig, daß nicht einmal der breite Froschmund und die häßlichen Henkelohren dieser Schönheit Abbruch tun können. Auf dem spärlichen Gras zu seinen Füßen hocken zwei Kinder, ein Bub und ein Mädel.
Der Junge horcht mit stiller Andacht auf die schwirrenden Töne, die Beethoven für sein Violinkonzert fand, horcht wie einer, der die Englein musizieren hört; sie spielt mit Sardinenbüchsen und stopft Orangenschalen hinein, auch kleine Kiesel und Gartenerde, die ihrem Kindersinn eitel Süßigkeit scheinen. Eine häßliche Fetzenpuppe liegt nicht weit davon im Schatten des Fliederbaumes.
So spielte Joseph Italiener ganz versunken seinen Beethoven, schlug auf dem armen Efeu den Takt und drückte das Kinn über die Geige. Die kleine Schwester warf plötzlich die Sardinenbüchse fort, ergriff die geliebte Puppe, deren hauptsächliche Toilette aus den Resten eines Betschales bestand, bei den Armen und begann mit ihr, sich leise in den Hüften wiegend, über den Nasen zu tanzen, mit wunderbarer Gelenkigkeit des siebenjährigen Körperchens, die schwarzen Augen ernsthaft aufgerissen, den blonden Kopf in den Nacken gelegt, gliederschnell und leicht wie ein Elflein auf dem Libanon. Ganz zierliche Schritte machte sie, hob die Beinchen mit den häßlichen, groben Strümpfen, ließ sie kunstgerecht Wippen und schwingen, und schließlich stand sie bloß auf einem Bein wie ein Storch und drehte den Körper und das zweite Bein wie Windmühlenflügel um die feste Achse. Die kleine Miriam Italiener war ja ein Ballettkind, dem man schon vor drei Jahren Gelenke und Knochen biegsam und elastisch gemacht hatte.
Und die Geige des Bruders reizte sie, ihre Kunst zu zeigen.
Wie eine Sehnsucht war es, loszukommen aus dieser Enge voll Schmutz und Düster, in der Blumen und Kinder nicht gedeihen wollten. Mit den winzigen Händen warf Miriam dem Geiger Kußhände zu. Joseph lächelte schwermütig und übte weiter seine springenden Läufe, ganz in sich gekehrt, mit einer stumpfen, schier verzweifelten Beharrlichkeit. Der kleinen Miriam fiel alles so leicht, sie sah keine Schwierigkeiten, nur die Grazie ihrer kleinen Persönlichkeit, und freute sich darüber. Für sie war das arme Gärtlein der richtige Gan Eden Paradies., in dem winzige Mägdlein Königinnenrecht haben.
In ihrem Übermut traf sie beim Tanzen mit der Fußspitze die Nase des kleinen Knaben, der mit halb offenem Munde dem Geigenspiel lauschte.
»Himmelsgucker!« lachte sie und zeigte die spitze Zunge, die wie ein rotes Schlänglein der Bosheit vorschnellte.
Der Kleine fuhr mit der seinen, schmalfingerigen Hand nach der getroffenen Nasenspitze und glitt von dort nachdenklich aufwärts über die breite, niedrige Stirn zum dunkelbraunen Haar, das wild und zerzaust durcheinanderhing; dann sagte er langsam: »Auch Geige spielen!«
Aber Joseph geigte weiter, und Miriam tanzte.
Da riß der kleine Karl Maria ein Gänseblümchen aus, das neben ihm aus dem Gras guckte, hielt das weißrote Sternchen in der Hand und pfiff leise vor sich hin.
Joseph Italiener ließ den Bogen ruhen.
»Jetzt pfeift mir der Knirps gar die Melodie nach, und fehlerlos auch noch!«
Es war ein dünnes, mühseliges Pfeifen, wie Grillenzirpen, aber Takt lief nach Takt ab, ganz rein und klar. Joseph ließ wieder den Bogen hüpfen und kniff den breiten Mund zusammen, was gar komisch aussah. Miriam wenigstens fand die Komik heraus. Flugs hielt sie mit dem Tanzen inne und sang noch ganz atemlos mit ihrer glockenhellen Kinderstimme:
»Klein's Männele, klein's Männele, was kannst du machen? Ich kann wohl spielen auf meiner Geig'. Ging, Ging, Ging, so macht meine Geig'.«
Und Karl Maria pfiff innig vergnügt auch diese Melodie, die er gar nie gehört hatte.
Jetzt aber lief die Geige wie ein Ritter in Brünne und Selm fort über Kindersang und Pfeifen. Bub und Mädel lauschten. Plötzlich hob der Knabe den Arm. Den Kopf hielt er gesenkt, wie in angestrengtem Lauschen, dann glitt die rechte Hand wie ein Bogen über den linken Arm, und er spielte stumm mit.
»Dummerle,« lachte die Miriam.
Mitten im Spiel riß Joseph den Bogen ab und den Mund weit auf, als sei er hungrig und warte auf den größten und besten Bissen vom Leviathan. Unentwegt geigte Karl Maria mit der Hand auf dem Arm, ein Zwerglein im schüchternen Frühling dieser armen Umwelt. Miriam schlich herbei und legte ihre Orangenschalen dem Buben auf das dunkelbraune Haar.
Er merkte es garnicht.
Da lachte die Miriam und klatschte in die Hände. Die Abendsonne aber glitt hernieder und ließ ihr Spiel über das Gärtlein tanzen, über das rote Haar des Joseph, über das feine Blond der Miriam und über die zerquetschten grellroten Orangenschalen auf dem Kopfe des Karl Maria Tredenius, der sein stummes Abendlied der Sonne vormusizierte.
Der Glanz dieser Abendstunde blieb bei Karl Maria, als er längst in der düsteren Elternwohnung beim kargen Abendessen saß.
Mit den Händen deckte er die Ohren, weil die scharfe Stimme des Vaters seine Träume zerriß. Der Postoffizial Franz Tredenius schimpfte wieder einmal über alles. Amt und Abendessen waren ihm gleich zuwider. Und als er gar bemerkte, daß der Bub sich die Ohren zuhielt vor seinem Poltern, gab er ihm eine Ohrfeige und schrie: »Verdammter Balg!«
Der Junge duckte sich, zog die Schultern ein, aber er weinte nicht. Groß und starr lag sein Blick auf dem roten, feisten Gesicht des Franz Tredenius, der zornig seinen langen, blonden Schnurrbart zauste. Die sechzehnjährige Martha, ein hübsches Ding mit einem klugen, nichtsnutzigen Grisettenkopf, lachte schadenfroh und nickte dem Vater zu. Frau Lisbeth zog die feinen, schwarzen Brauen hoch und wandte die Augen ab. Tag für Tag gab es solche Szenen, und ihre Widerstandskraft, die Karl Maria in Schutz nehmen wollte, wagte sich allgemach nicht mehr hervor. Scheu, und wortkarg tat sie ihre Pflicht nur heimlich; wenn sie mit dem Kleinen allein war, ward ihre Seele licht und froh und suchte die eigene verkümmerte Jugend im Kerzen ihres Kindes. Ließ sie sich aber doch einmal hinreißen, der Roheit ihres Gatten zu widersprechen, gab es wüsten Zank und gemeine Schimpfworte, welche die Gegenwart der Kinder nicht scheuten. Dann saß sie wie unter Peitschenhieben und biß die Lippen wund vor Scham.
Drum schwieg sie auch heute und wartete, bis Franz Tredenius ins Wirtshaus eilte und Martha, die längst ihre eigenen Wege ging, zu Freundinnen an die Haustür lief, mit denen sie an diesen Frühlingsabenden die Gasse auf und nieder zog.
Karl Maria saß lautlos und sah der Mutter zu, die den Tisch abräumte. Seine Seele fror, er kroch ganz in sich hinein und ließ die Umwelt versinken. Nur seine Kinderträume behielten ihr Recht. In seinen Ohren war das Geigenspiel des Joseph Italiener, die Noten sprangen zum offenen Fenster herein, wie winzige Knaben, mit denen er spielen durfte.
Auf einmal riß er die Augen weit auf und erschrak, wie stark und schnell sein Herz ging. Klaviertöne kamen aus dem Nebenzimmer. Die Mutter spielte, – wie immer, wenn Vater und Schwester fort waren. Es war ein Wiegen und Gleiten wie vorhin, als Miriam tanzte. Ganz leise glitt er von seinem Stuhl und schlich der Musik nach. An der Tür blieb er stehen und barg sich in den Falten des alten roten Vorhangs. Da saß seine Mutter vor dem Klavier, hoch aufgerichtet und schön, und spielte. Ihre Augen waren jetzt hell, und auf den blassen Wangen lag eine leichte Röte, als wüchsen aus dem Halbdunkel des Abends rosarote Rosen.
Da weinte der Sechsjährige, als seine Mutter so überirdisch schön wurde in der geliebten Musik. Karl Maria rührte sich nicht. Mit gefalteten Händen, wie ein betender kleiner Engel stand er in stiller Andacht. Und sein Gebet flehte den lieben Gott an, daß Mutter jeden Abend so spielen möchte, so feierlich einsam und so wunderschön. Sein Kindergesicht hatte plötzlich einen willensstarken, fast harten Zug, als müßte er alle Kraft seines Herzens in diese Bitte legen. Derweil perlten die Töne fort, verklangen in die Nacht, die alle Farben löschte, und kamen wieder zu Frau Lisbeth und ihrem kleinen Jungen. Karl Maria sah in der Dunkelheit nur mehr das feine, leicht erregte Antlitz seiner Mutter, alles andere verschwand in der Finsternis, die heute mit vielen und süßen Stimmen zu Karl Maria redete, wie sonst nur ein Sonnentag, wenn die ersten Bienen summten und der Wind Melodien pfiff.
Plötzlich seufzte die Mutter und ließ das Spiel. Sie stützte den Kopf in die Hand und sann vor sich hin. Ein Schluchzen kam zu dem Bübchen, das in jähem Erschrecken sich in die Vorhangfalten hängte, als suchte es da Hilfe. Zitternd betete Karl Maria: »Lieber Gott, schick' einen Engel.« Der sollte der Mutter helfen. Und im Dunkel schwebte wohl ein Engel herein. Denn Frau Lisbeth richtete sich auf, blickte zum offenen Fenster wie in stiller Dankbarkeit und griff dann wieder in die Tasten.
Ein Stürmen geschah da, ein Hinjagen und Rennen, als liefen viele, viele Menschen der Sonne entgegen. Karl Maria lächelte glücklich und schlich lautlos in sein Kämmerlein. Wenn der liebe Engel da war, durfte er nicht stören und mußte artig schlafen gehen. Still lag er in seinem Bett, da kamen Schritte, und die Mutter trat herein.
»Schläfst du, Kleiner?«
Er gab keine Antwort, öffnete nur die Arme und wartete. Dann schlang er sie um den Nacken der Mutter und blieb ganz still. Sie küßte ihn, da faßte er kecken Mut und bettelte: »Darf ich auch Geige spielen, wie der Joseph?«
»Du bist noch zu klein dazu, Liebling.«
»Aber die Miriam tanzt doch auch und ist noch klein.«
»Vater würde es nicht erlauben.«
»Spielst du deshalb nur am Abend?«
Statt zu antworten, legte sie ihm die Hand auf den Mund. Eine Weile schwieg er und blieb glücklich in dieser sicheren Liebe. Dann aber bat er wieder um seine Geige und ließ sich nicht davon abbringen.
»Es geht nicht, Karli, glaub' mir's doch!«
»Ich will so fleißig sein, Mutter, da lerne ich es ganz allein!« Angst war in Frau Lisbeth, als sie sah, wie ihre eigene Sehnsucht in ihrem Kinde Wurzel schlug und die Musik auch ihn in Bann und Zauber nahm. Aber sie dachte, wie Franz Tredenius ihr Klavierspiel verlachte und haßte, wie er es im Laufe der Jahre allmählich zum Schweigen gebracht hatte, daß es sich nur mehr am Abend hervorwagte, wie ein Dieb auf lichtlosem Pfade. Sie wollte dem Kleinen dies Leid ersparen und seine Seele vor ihres Mannes Fäusten schützen, die diese Kinderfreude mit rauhem Griff ersticken würden.
Und da sie Karl Maria nicht mit einem unwiderruflichen »Nein« kränken wollte, schob sie die Aussicht einfach hinaus und versprach ihm eine kleine Geige zu seinem nächsten Geburtstage, wenn er sehr brav wäre und aus der Schule, in die er im Herbst kommen sollte, gute Noten heimbrächte. Damit war er ganz zufrieden, hielt die Hand der Mutter fest und schlief ein. Im Traum hörte er wieder seine geliebte Geige klingen. Aber es war nur seine Schwester Martha, die beim Nachhausekommen eine Operettenmelodie pfiff.
Als auch Martha zu Bett gegangen war, stand Frau Lisbeth noch am offenen Fenster und starrte in die Nacht. Sie wollte jedes Opfer bringen, wenn nur ihr Bub etwas Rechtes wurde. Das war ihr Gebet.
Um Mitternacht schrak sie auf. Drei Männer taumelten Arm in Arm einher, die Hüte schief auf den Köpfen, schwangen die Stöcke und brüllten dazu einen Gassenhauer. In der Mitte schwankte Franz Tredenius. Sein schönes, wildes Gesicht war rot und verzerrt. Mit einem harten Lachen schloß Lisbeth das Fenster.
2
Am Morgen lief Karl Maria mit seiner jungen Freude ins Nachbarhaus zu Miriam. Aber sie war noch nicht von der Schule zurück. So setzte er sich neben den Großvater Italiener, einen dürren Greis, der noch Kaftan und Löckchen trug. Großvater Samuel besaß ein kleines Bänkchen, das er gewissenhaft der Sonne nachschleppte, um jeden Sonnenstrahl mit seinem frostigen Körper aufzufangen. Für Karl Maria war der gutmütige, etwas schmierige Samuel einfach der Märchengreis. Er erzählte wunderhübsche, kleine Geschichten, die er mühelos erfand. Nicht umsonst war er in seiner polnischen Heimat Hochzeitstroubadour und Witzmacher gewesen, der Tränen und Lachen mit gleicher Kunst hervorzwang. Hier, in der großen, fremden Stadt allerdings war es ihm schief gegangen. Er galt, wie sein Sohn, der bärenstarke Gideon, als ein Schlemihl, der im Tempel und in der Gemeinde etwas galt, im praktischen Leben aber stets einige Stunden später antrabte, nachdem schon die anderen in das Himmelreich des Rebbach eingegangen waren. Aber seine Herzensgüte lockte den kleinen Karl Maria, der mäuschenstill neben dem Alten hockte und es sich in der Sonne wohl sein ließ.
In dem ehemaligen Ghetto herrschte heute bewegtes Leben. Man stand vor der Osternacht. Feierlich angetan wandelte alles in den Tempel oder schritt in weisen Gesprächen durch die frühlingshellen Gassen. Mitten durch diese ehrwürdigen, festlichen Menschen tobte jetzt eine Rotte Schulkinder, voran ein kleines Mädel mit dickem, blondem Zopf.
Grimmig schwang Miriam die Schultasche und hieb damit auf die kleinen frechen Jungen ein, die höhnend von ihr Mazza verlangten. Karl Maria lief zu ihrem Schutz herbei, bekam einen Stoß, daß er taumelte, hieb aber wacker um sich, bis der alte Samuel sein Sonnenbänkchen als Waffe brauchte, wie einst Simson den Eselskinnbacken, und die kecken Christenknaben verscheuchte.
Lachend kehrte er dann wieder in den geliebten Sonnenschein zurück. Ganz rot und zerzaust stand Miriam vor ihm.
»Die dummen Kerle,« sagte sie wegwerfend und zog die kurze Oberlippe hoch, die zu ihrem starken Mund gar nicht recht paßte. Sie warf den Kopf in den Nacken und streichelte Karl Maria die Wangen, wie ein besorgtes Mütterlein: »Hast du's arg gekriegt von den Eseln?«
Er schüttelte den Kopf: »O nein, Miriam, gar nicht.«
Samuel sah den Kindern zu und lächelte still. Er freute sich, daß seine Enkelin aufrecht und keck durchs Leben ging auf ihren kurzen Beinchen, ganz anders als der Knabe, der nur Märchen hören wollte.
»Darf ich am Abend wiederkommen?« fragte Karl Maria. Er liebte diesen feierlichen Singsang, der an jüdischen Festen durch die alten Häuser ging; diese fremde Sprache, die in seltsamen Rhythmen an seine Ohren klang, und nicht zuletzt die Anhänglichkeit von Eltern und Kindern, die er daheim nicht kannte. Hauptsächlich aber kam er wegen Miriam, die dann tanzte und sprang und tausend Narrenspossen trieb. Auch spielte Joseph an solchen Abenden stets Violine, weil Großvater Samuel und Vater Gideon es so liebten, obschon die strenggläubige Frau Charlotte, die in ihren großen, fetten Händen die Zügel des Hausregiments hielt, solches Treiben Sünde nannte.
Und im Garten erzählte der Kleine dann Miriam ganz heimlich von der seligen Zukunft, die ihm eine Kindergeige bringen sollte. Sie klatschte in die Hände und sprang um ihn herum: »Du wirst besser spielen als der dumme Joseph!«
Karl Maria wußte zwar nicht, wie er besser spielen sollte als der rothaarige Joseph, der für ihn ein großer, unerreichbarer Künstler war, aber er lächelte geschmeichelt über ihr Vertrauen und half ihr, die ersten winzigen Heuschrecken zu fangen, die sie dann dem Singvogel brachten. Hatte die Amsel einige Heuschrecken verzehrt, legte sie los und sang, daß es eine Lust war. Bub und Mädel standen still und lauschten dem Schmettern und Rollen.
Die Familie Italiener saß beim Ostermahl. Großvater Samuel verstand es, die religiöse Grundstimmung durch vergnügte Witze in wohlige Behaglichkeit hinüberzuleiten. Sein treuester Schildknappe war sein ältester Enkel Jacques, Auslagenarrangeur in der Vorstadt, ein mageres, elegantes Bürschchen mit klugen, schwarzen Augen und beweglichen Händen, die immer etwas zu ordnen schienen. Frau Charlotte, die ihre üppige Rundlichkeit in ein gelbseidenes Festkleid gehüllt hatte, schleuderte Drohblicke nach Schwiegervater und Sohn, wenn diese die eintönigen Gebete des wackeren Gideon durch schnöde Witzeleien störten. Fünf andere größere und kleinere Italiener beiderlei Geschlechts zierten die Tafel, alle frischgewaschen und in den besten Kleidern. Neben Miriam saß als Gast der kleine Karl Maria, der Jacques' anzügliche Sticheleien wegen seines christlichen Bekenntnisses verständnislos über sich ergehen ließ und sich an den vielen süßen Speisen der guten Frau Charlotte gütlich tat.
Die Hausfrau und Gideon wie der alte Samuel genossen nur ungesäuerte Brote und die bitteren Kräuter, die an die Wehmut der ägyptischen Gefangenschaft mahnten. Gideon, der Schlemihl, der lieber in den Parks und auf den Straßen träumte, statt sein Trödlergeschäft zu betreiben, nahm seine religiöse Pflicht sehr ernst, vielleicht nur, weil seine Phantasie mit den alten Gewohnheiten gern spielte, tatenlos und versonnen, wie es in seiner Art lag. Feierlich sprach er über die vier Becher den Dank für die Gabe des Weinstocks und fragte den roten Joseph, was diese vier Becher zu bedeuten hatten. Joseph gab ungenaue Auskunft.
Frau Charlotte ward rot und zerkrümelte zornig Mazza.
Gideon sagte traurig: »Du weißt gar nichts, mein Sohn.«
Schuldbewußt senkte Joseph den Kopf, sein Vater seufzte und tat desgleichen. Denn Gideon hatte die schönen Einnahmen, die Joseph vor Jahren als Wunderkind mit seiner Geige erzielt, schnöderweise an der Börse verspielt. Und seitdem wagte er nicht, seinem Joseph Vorwürfe zu machen, wenn es auch mit dem Geigenspiel längst bergab ging, vielleicht deshalb, weil der gute Joseph wie sein Vater ein Träumer war und das Spazierengehen dem langweiligen Üben vorzog. Frau Charlotte aber fragte scharf: »Joseph, was ist eigentlich mit deinem Konzert in Laibach?«
»Das macht sich, Mutter. Gegen Ende April.«
»Und dann?« Frau Charlotte hielt streng auf Genauigkeit.
»Ich denke ins Operettenorchester des Bellevue-Theaters einzutreten.«
»Operettenorchester – hübsche Aussicht das,« murrte die Mutter und gab Jacques, der seinen Becher Wein verschüttet hatte, eins auf die Hand.
Gideon lächelte mild: »Reg' dich nicht auf, mein Gold.«
Die Hausfrau wollte entgegnen, aber die schlaue Miriam, die Ungemütlichkeit nie leiden mochte, kam ihr geschickt zuvor. Sie wies auf Karl Maria, der gerade ein riesengroßes Tortenstück im Munde stecken hatte, und erzählte wichtig: »Der will auch ein Geiger werden.«
Der Kleine schluckte verzweifelt seine süße Beute hinab und sah verlegen vor sich hin.
Der elegante Jacques fragte anzüglich: »Willst du nicht lieber werden, was dein Vater ist?«
»Nein,« antwortete das Kind sehr bestimmt.
Charlotte und Gideon wechselten einen vielsagenden Blick und schauten dann behaglich auf die Kinderschar.
Miriam verteidigte ihren Freund: »Er hat ganz recht. Er ist kein solcher Siebenschläfer wie der Joseph. Karl Maria wird ein Geiger und ich eine Sängerin. Dann heiraten wir. – Darf ich nicht singen, Mutter?«
»Nein,« erwiderte Frau Charlotte und schlug auf den Tisch. Aber Miriam ließ sich nicht beirren: »Gestern hab' ich zur Ermattinger in die Garderobe dürfen. Wie es da gut riecht, – viel besser als in deinem Tempel, Großvater.«
Samuel schmunzelte sehr heiter und schenkte Miriam ein ganz neues Geldstück. Sie tanzte vergnügt um den Tisch, bis sie wieder zum alten Samuel kam, dem sie einen langen Kuß gab. Ihr Mäulchen aber ging weiter: »Die Ermattinger hat auch nach dir, Joseph, gefragt. Sie erinnert sich noch an dich. Ob du noch so gut spielen kannst, will sie wissen. Was soll ich ihr sagen, Joseph?«
»Das ist lange vorbei,« antwortete trübselig Gideons Sohn.
Miriam legte Karl Maria die Hand auf den Mund: »Iß nicht so viel, Dummerl, du bist noch zu klein. Wenn du erst mal ein junger Herr bist, nehme ich dich zu meiner Ermattinger mit,« sagte sie huldvoll.
»Sind dort viele Geigen?« fragte der kleine Junge und biß Miriam in die Hand, die zwischen seinem Mund und der Torte lag.
Alle lachten.
Frau Charlotte aber hob die Tafel auf und trieb Mann und Kinder in den Tempel. Nur Samuel, der ein heimlicher Freigeist war, schützte Müdigkeit und sein Alter vor und blieb daheim. In stiller Behaglichkeit trank er alle Becher aus, weil er so die vorgeschriebene Vierzahl nach seiner Ansicht niemals überschritt. Dann öffnete er die Türen für alle, die in der Osternacht in dieses Haus kommen wollten, stellte den vollen Becher für den Propheten Elias zurecht und machte es sich im Lehnstuhl bequem. In Wirklichkeit hatte er keine Sehnsucht nach Bettlern und fremden Gästen, sondern nur nach der reinen, würzigen Luft dieses Frühlingsabends.
Er zog die Kappe über die Augen und faltete die Hände im Schoß. Solche Augenblicke hatte er in seinem langen Leben stets geliebt. Karl Maria sperrte Mund und Augen auf und harrte des Propheten Elias. Samuel öffnete noch einmal die schlaftrunkenen Augen: »Trink' den Becher aus. Kleiner! Dann erscheint dir der Elias.«
Voll heiliger Ehrfurcht tat Karl Maria, was der Greis ihm befahl. Aber er hatte noch nie Wein getrunken, und so erging es ihm wie einst dem braven Noah. Er sah plötzlich viele Propheten und Erzväter um sich, führte verworrene Reden mit ihnen, sang ein bißchen und zupfte schließlich gar den schlafenden Samuel am weißen Bart. Dann schlich er ins Nebenzimmer, wo Josephs Geige samt Bogen offen auf dem Bette lag, und begann abscheulich die Saiten auf und ab zu kratzen, als müßte er dem Propheten ein Einzugslied vorspielen. Da flogen jäh die Weingeister fort, und er mühte sich mit seinen winzigen Händen an dem ungefügen Instrumente. Der Prophet Elias mußte doch gekommen sein, denn ein paarmal gab die mißhandelte Geige einen wunderschönen, reinen Klang. Endlich übermannte den Kleinen die Müdigkeit, und er schlief, den Geigenbogen fest im Arm, einfach ein.
So fand ihn Samuel und trug das Kind hinüber zu seiner Mutter. Fräulein Martha öffnete, blickte dem Alten höhnisch ins Gesicht und schnitt eine Fratze. Franz Tredenius, dem unerwartetes Klingeln von Amts wegen an die Nerven ging, hieb die Tür hinter sich ins Schloß und schrie: »Hinaus mit dem allen Juden!«
Samuel lächelte gutmütig und wartete, bis Frau Lisbeth kam. Der gab er Karl Maria in den Arm und küßte ihn noch zum Abschied auf die Stirn. Vom Becher des Elias aber sagte er nichts.
3
Seit diesem Abend verbot der Vater dem Knaben ernstlich den Verkehr mit der Familie Italiener. Aber Karl Maria ging nun heimlich. Dort drüben hatte er ja zum erstenmal eine wirkliche Geige in der Hand gehalten, weil der Prophet Elias kleine Knaben so lieb hatte. Und Josephs Geige zog das Kind an wie ein singender Zauberschrank aus einem Märchen.
»Die Miriam gibt schon auf mich acht,« sagte er beruhigend zur Mutter, die um seine Schleichwege wußte. Und Frau Lisbeth wehrte ihm nicht. Sie ließ ihrem Jungen seine kleinen Heimlichkeiten, seinen ersten inneren Besitz, und war zufrieden, wenn er mit leuchtenden Augen von seinen verbotenen Gängen heimkam, still zu ihren Füßen saß und ihrem Klavierspiel lauschte. Und darüber schlief er geruhsam ein.
Lisbeth bat jeden Abend aufs neue um diesen Schlaf, damit der Kleine nichts hörte, wenn Franz Tredenius aus dem Wirtshaus heimfand und zärtlich zu werden begann. Sie trug seine Küsse wie Brandmale. Aber sie wollte Karl Maria die Unberührtheit seiner Kinderjahre retten, darum blieb sie stumm. In einer Nacht jedoch geschah es, daß Franz Tredenius ihre fromme Lüge zuschanden machte. Er hatte allzuviel Geld im Kartenspiel verloren und beichtete nun seiner Frau in der Wehmut der Trunkenheit, daß er einen Griff in die Postkasse getan und dieses Geld bis Samstag unbedingt ersetzen müsse.
Da vergaß Lisbeth ihre Selbstbeherrschung und gab ihm harte Worte, die laut und schrill klangen wie gesprungenes Glas. Alles, was sie jahrelang unterdrückt, kam hervor und zerriß die Stille der Nacht. Tredenius raufte sich das Haar und schrie: »Du und der Bub, ihr seid an allem schuld. Hätte ich euch nicht, wäre ich ein freier Mann.«
In Hose und Hemd rannte er durchs Zimmer und hämmerte mit den Fäusten wider die Wand. In seiner hilflosen Wut packte er Lisbeth und schüttelte sie. Sie bog sich zurück, daß sein Atem, der nach Bier und Schnaps roch, sie nicht traf.
Da brüllte er: »Ekelt dir gar vor mir?« und schlug ihr mit der Faust ins Gesicht.
In der Tür stand Karl Maria in seinem langen weißen Nachthemdchen, hatte die Augen entsetzt aufgerissen und die kleinen Hände wider den Vater geballt. Mit einem dumpfen Laut stürzte er sich auf den starken Mann, der halb zornig, halb verlegen ihn abwehrte, und hieb seine Fäuste gegen die Knie des Vaters, an die er gerade reichen konnte.
»Karl Maria!« Lisbeth riß das Kind an sich.
Franz Tredenius strich den blonden Schnurrbart, schob die Hosenträger empor, zuckte die Achseln und sagte endlich finster: »Bis Samstag brauche ich das Geld.«
Damit ging er.
»Mutterle!« stammelte der Bub und huschelte sich in das weiche, schwarze Haar der erschrockenen Frau. »Er darf dir nichts tun, Mutterle!«
Und der kleine Mund wurde herb, beinahe hart.
»Ja, Kind.« Und sie strich ihm das Haar aus der Stirn. Karl Maria zitterte am ganzen Körper und hielt noch immer die Fäuste geballt. So trug sie ihn in sein Bettlein, wie damals, als er den Becher des Elias zu rasch ausgetrunken, und blieb die ganze Nacht bei ihm.
Am Morgen zog sie sich besser an als sonst und nahm das Büblein mit sich. Schier feierlich schritt Karl Maria mit der Mutter durch die morgenhellen Gassen, in dem Gefühl seiner neuen Wichtigkeit. Allen Menschen sah er trotzig ins Gesicht, als wollte er ihnen zeigen, daß die Mutter unter seinem Schutze stehe. Er lauschte auf jegliches Geräusch und formte selbst das schrille Läuten der Pferdebahn zu hüpfenden Takten. Was er hörte, setzte sich in seinem Ohr allsogleich in Musik um. So wandelte er freudig in den Morgen hinein und hatte nach Kinderart die schlimme Nacht schon längst vergessen. Da kam ihnen ein Herr entgegen, stattlich und elegant gekleidet, mit eisgrauem Schnurrbart und hellen blauen Augen.
Frau Lisbeth hob flüchtig den Blick und lächelte ein wenig, als sie den Fremden bemerkte.
»Kennst du den? Wer ist das?« fragte der Knabe.
»Ach Gott, das ist ein Geiger.«
Karl Maria riß es herum, er ließ die Mutter los und starrte dem Herrn nach, der langsam über den sonnenhellen Platz schritt.
»Ein wirklicher Geiger?«
»Ein ganz großer, Kind.«
»Und wie heißt er?«
»Hans Geßner, du Neugier.«
Der Kleine war sehr nachdenklich und trabte stillschweigend neben der Mutter her. Jetzt hatte er einen großen Geiger gesehen. Das Kinderherz brannte. Dieser Hans Geßner hatte sicher schon als ganz kleiner Junge eine Geige haben dürfen.
Endlich machte die Mutter vor einem einstöckigen Hause halt, das mit Mitteltrakt und zwei vorspringenden Flügeln, sowie dem Glockentürmchen auf der Dachmitte einem kleinen Kloster glich. »Zum blauen Herrgott« hieß das Gaus kurzerhand, weil vor Jahren irgendein weltfroher Kauz das ehemalige Klösterlein, das längst profanen Mietern diente, ganz himmelblau hatte tünchen lassen.
Und plötzlich wußte der Kleine, daß er hier schon einmal gewesen war. Ein guter, duftender Bratapfel tauchte in seiner Erinnerung auf und ein großer, dicker Mann, der ihm diesen Leckerbissen gereicht.
Frau Lisbeth blieb stehen und sagte ernst: »Hier wohnt dein Onkel.«
»Gelt, der ist sehr dick? Warum kommt er nie zu uns?«
Sie gab keine Antwort, sondern zog einen Glockenstrang, der ein geflügeltes Engelköpfchen als Handgriff trug. Wie in einem Zauberschloß ging die Tür von selbst auf, daß Karl Maria voll Ehrfurcht sein Käppchen lüftete. Weit und hell war das Stiegenhaus, durch große Fenster mit kleinen bunten Scheiben kam die Sonne.
»Es muß gerade Messe sein,« dachte das Kind, denn laute Musik lief ihnen entgegen, übernatürlich laut. Auch Frau Lisbeth griff diese Musik ans Herz, so zerrissen und abscheulich sie im Grunde war. Nach drei Jahren kam sie zum erstenmal wieder in dies wundersame Haus, darin ihr einziger Bruder, der Chormeister bei St. Pankraz, Johann Sebastian Williguth, mit zwölf Kindern und seiner Frau Musika hauste. Sein eheliches Weib Apollonia, genannt »Affi«, rumorte in Küche und Keller und haßte den tollwütigen Lärm, der losbrach, wenn der Musikgewaltige seine Orgelpfeifen zu einem Orchester zusammenzwang.
Wie in die Heimat kam Lisbeth in das blaue Kloster, wo ihre Kindheit noch in allen Ecken schlummerte. Ihr Mann hatte sie auch von dem wunderlichen Bruder losgerissen, den er stets anpumpte und dann einen dicken Hanswurst nannte, bis eines Tages der empörte Bruder Williguth seinen Cellobogen auf Franz Tredenius' Rücken tanzen ließ. Da war dann alles aus. Und Lisbeth hielt sich fern, weil sie den Zorn des Gatten fürchtete und auch ihren Gram nicht zeigen wollte. Heute aber trieb die liebe Angst sie wieder her. Als Willkommengruß schmetterte ihr Vater Haydns Musik zu den letzten Worten Christi entgegen. Aber, o Jammer, wie zerstückt und zerschlagen! Vom martervollen Durst des Heilands war im Pizzikato nichts zu verspüren. Die Viola allerdings kratzte abscheulich.
Still blieb die Frau vor der Tür, hinter der dieser Hexensabbat raste. Williguths Kinder waren alle fast unmusikalisch, und der Fiedelbogen des Vaters übte da pädagogisches Zwangsrecht. Das Schicksal war grausam mit Johann Sebastian.
Wutschreie drangen heraus. Eine greuliche Dissonanz. Jemand klopfte zornig ab. Ein mächtiger Baß fluchte alle Teufel herab und bat Meister Haydn, der bei diesem Gewinsel die Perücke tief über die Ohren gezogen hätte, kniefällig um Verzeihung.
Karl Maria stand und lauschte. Drin bekam einer Hiebe. Deutlich tönte sein Wehgeschrei. Dann hob das Klingen wieder an. Und jetzt dröhnte der feierliche Baß: »In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum.«
Hellauf jubelte die erste Geige, wurde weich und innig und frohlockte von neuem, weil der Sohn das Werk vollbracht hatte und zum Vater im Himmel heimkehrte. Dann glitt wieder alles auseinander, ein kräftiger Fluch schuf Ordnung.
Frau Liesbeth öffnete leise die Tür und ließ Karl Maria den Kopf hineinstecken. Sie wagte nicht einzutreten, bevor ihr Bruder den Satz und seine zwölf Kinder zu Ende gemartert hatte.
Schnell und herrlich sollte die Melodie hinfließen, doch sie hatte nur kurzen Atem und widerwillige Erzeugerhände. Oft war es ein Winseln und Kratzen. Aber es war und blieb ein Sturm, der vor dem Erdbeben wehte. Die Hörner trieben es am tollsten, wollten gar nicht mehr schweigen und ließen die armen Geigen nicht zu Worte kommen. Soviel Freude hatten die Hornbläser an dem prächtigen Lärm, der sogar für ein wirkliches Erdbeben hingereicht hätte. Lisbeth schob sich leise hinter ihren Buben und sah den Bruder, der sein Cello hielt. Kleine, größere und fast erwachsene Buben und Mädel seufzten und wischten den Schweiß von den jungen Stirnen. Groß und erhaben thronte Johann Sebastian unter seinem Volk.
Da erschaute er Frau Lisbeth und ihren Knaben, warf das mächtige kahle Haupt nach vorn, daß das Blut ins fette Antlitz schoß, und streckte den Cellobogen wie ein Schwert von sich: »Du bist's, Schwester?«
Dann sank der Fiedelbogen langsam herab und sauste schließlich mit wilder Kraft auf den Rücken eines dicken, zwölfjährigen Jungen, der noch das Horn in der Hand hielt, und eine mächtige Baßstimme brüllte den Text zu dieser Melodie: »Lausbub, verdammt in Apoll! So denkst du den seligen Meister Haydn zu verschustern?«
Der dicke Junge duckte sich und suchte seine fette Leiblichkeit vor dem musikalischen Schwert zu schützen. Nachdem Herr Williguth seinen Zorn, der eigentlich der Schwester galt, die den Lumpen Tredenius geheiratet hatte, auf dem Rücken seines Buben ausgetrommelt, schrie er grimmig: »Instrumente versorgen, Musikidioten!«
Hierauf stieg der Riese von seinem Hochsitz und nahm Lisbeth in den Arm.
Es war mäuschenstill.
»Du armes, armes Ding!«
Karl Maria zupfte ihn am Ärmel: »Ich lasse sie nicht schlagen.« Und mutig blickte er zu dem Onkel auf. Frau Lisbeth schrak zusammen, machte sich los und sah den hilfsbereiten Kleinen schier zornig an.
»Komm!« sagte der regens chori und zog die Schwester mit sich.
Karl Maria stand ganz allein unter den großen dicken Williguth, die sich gegenseitig neckten, an den Ohren zogen und ein gar nicht scherzhaftes Raufen anhuben. Nur der Mann mit der Primgeige im Arm schritt groß und knochenstark, trotz seiner vierzehn Jahre, auf den Kleinen zu, hob ihn mit einem Ruck auf die Schulter, hielt ihn an den Beinen fest und lachte.
Ein kleines Mädchen, dem flachsgelbes Haar um die Schulter wehte, lief herbei und sagte gutmütig: »Laß ihn, Giacomo, er ist noch zu klein.«
Aber sie selbst war nicht älter als Karl Maria.
Statt einer Antwort griff der junge Riese auch sie auf, schob Karl Maria auf die eine Schulter, stellte das blonde Ding auf die andere und sagte schmunzelnd:
»So, jetzt seid ihr beide groß!«
Das Mädel ward rot: »Wie heißt du eigentlich?«
»Karl Maria. Und du?«
»Kunigunde. Eigentlich Gundl, das ist mir lieber.«
»Kundry heißt sie,« heulte der Balg mit dem Horn und schwang das mißhandelte Instrument wie einen Tomahawk.
»Kundry, die Hexe!« brüllte der Chor, der blutwenig von Musik, aber viel von den närrischen Namen wußte, mit denen Williguth seine Nachkommenschaft geziert hatte.
Das Mädel weinte. Karl Maria beugte sich ritterlich hinüber und küßte sie.
Da ward sie rot und glücklich: »Du bist gut.«
Eine große, schwere Frau trat jetzt ins Zimmer und trug eine Platte mit riesigen Butterbroten. Sie lachte über das breite rote Gesicht, als sie das Durcheinander erblickte: »Da hat man's wieder! Das nennt er dann Musik!«
»Das ist der Karl Maria Tredenius«, stellte Giacomo vor, »Tante Lisbeth ist beim Vater.«
»Da muß ich doch gleich – o Gott, o Gott,« ächzte die dicke Frau, »sonst rennt ihm wieder das Herz davon.«
Sie stellte schnell die Butterbrote auf das große Schlagwerk und lief schnurstracks dem weichen Herzen ihres Eheherrn nach.
Die kleine Gesellschaft fiel über die Platte her und tat sich gütlich. Kunigunde teilte ihr Stück mit Karl Maria und bat mit leiser Stimme: »Willst du meine Puppen sehen?«
Ihr neuer Freund nickte. Er hatte Angst vor diesem wilden Volke, das am hellen Sonntagmorgen so lärmte. Das kleine freundliche Mädchen führte Karl Maria eine schmale Hintertreppe hinab, stieß mit dem ganzen Körper eine nur angelehnte Tür auf, – und Karl Maria stand im Wunderlande.
Maiblüte war es, der langgestreckte Obstgarten trug sein Hochzeitskleid; im jungen Gras lagen ganze Häufchen von weißen und rosenroten Blüten, die es in ihrer duftigen Freude allzu toll getrieben hatten und deshalb abgestürzt waren. Nun mußten sie sterben. Ein Summen von Bienen brummte auf und nieder, gewaltig im Baß. Und darüber läuteten die Sonntagsglocken die Meßzeit ein. Es war ein feines Zittern in der Luft, das Karl Marias Ohr sogleich auffing.
»Hörst du die Musik?« fragte er.
Doch Johann Sebastians unmusikalische Tochter erwiderte bedrückt: »Die Glocken läuten.«
»Nein, hier, dicht bei uns. Die Bienen und der Wind. Hörst du nicht?«
»Nein,« gestand die blonde Kundry sehr beschämt und zog den Knaben schnell fort zu ihrem Puppenhaus.
In einem alten, einstöckigen Gartenhäuschen war Gundls Puppenheim. Zwölf Puppen beiderlei Geschlechts saßen und lagen herum. Es gab da häßliche und schöne, armselige Fetzenkinder und vornehme Porzellanpuppen mit starren, hochmütigen Augen. Und nun verwunderte sich der Bub, wie Gundl: »Guten Morgen, liebe Kinderchen« beim Eintritt sagte, dann die Reihe abschritt, ein Gesicht küßte, eine andere Puppe beim Schopfe zog, weil sie sich wieder nicht gewaschen habe, und dann die Sonntagstoilette vornahm. Eine greuliche Fetzenpuppe, deren Gesicht eine gerunzelte Kastanie bildete, in die zwei schwarze Schuhknöpfe als Augen geklemmt waren, bekam ein prächtiges rotes Kleid, weil sie in der letzten Woche die bravste gewesen sei. Und Kundry erzählte, daß sie mit Mutters Hilfe dies Festkleid aus einem von Vaters rotseidenen Taschentüchern selbst zusammengenäht habe.
»Es kommt alles viel billiger, wenn man es daheim macht!«
Sie plapperte wichtig diesen Satz her, wie sie ihn wohl von den Großen gehört hatte, und schien sehr stolz darauf. Karl Maria dachte nach, dann fragte er hastig: »Kann man auch eine Geige daheim machen?«
»Ganz gewiß.«
»Weißt du nicht wie, Gundl?«
»Ach nein. Ich bin so dumm.«
Und einen Augenblick ging ein trauriges Lächeln über das helle Kindergesicht. Dann spielten sie mit der Puppenküche. Er sammelte dürres Holz, schleppte Wasser und brachte Veilchen und Blütenblätter vom Markt heim. Sie schalt, wenn er etwas schlecht machte, und lobte, wenn er brav war. Er machte aber meistens seine Sache schlecht und lässig, weil er immer noch grübelte, wie er sich selbst eine Geige verfertigen könnte. Der Joseph Italiener würde ihm dabei sicher helfen. Das war sein Trost.
Schließlich erklärte Kundry, sie müsse jetzt einige Puppen ins Bad tragen, nahm ein altes Taschentuch als Handtuch mit und gab Karl Maria eine Puppe in den Arm. Die andere hielt sie an ihr Herz gedrückt und sagte belehrend: »Anständige Kinder müssen baden. Sonst werden sie schmutzig und dürfen nicht in den Himmel. Mama gibt dir dann auch einen Kuß und kocht dir Veilchenkompott.« Karl Maria trabte geduldig hinterdrein und sah dem Puppenbad zu. Nun kam seine Puppe dran.
Aber plötzlich rutschte Gundl aus, das Porzellankind entglitt ihr und sank im Wasser des Teichleins unter. Gundl heulte: »Nun muß sie ertrinken!« Sie rang die Hände und tat verzweifelt. Karl Maria aber überschritt die Wiese, in der er abseits stehen mußte, weil die Kinder sich beim Baden vor dem Papa schämten, wie Gundl behauptete, und marschierte schnurstracks in das seichte Wasser, das ihm bis ans Knie reichte. Er bückte sich und holte das Puppenkind vom Grunde. Stolz überreichte er den Schatz der blonden Gundl, die das nasse Ding innig herzte und küßte. Mit einem Male fiel ihr ein, daß der arme Lebensretter zähneklappernd daneben stand und sich verzweifelt die Sonne auf den Bauch scheinen ließ, von dem das Wasser in kleinen Bächlein lief. Sie warf die Puppe ins Gras und fragte mitleidig: »Ist dir kalt?«
Er klapperte mit den Zähnen und schüttelte heldenmütig den Kopf.
Gundl warf einen suchenden Blick ringsum, doch sie fand nichts. Da riß sie ihr Schürzlein herab, kniete vor Karl Maria hin und rieb und trocknete emsig.
»Ach, Gundl,« seufzte der Bub und tat einen heftigen Nieser in die Sonne.
Zwei dunkle Schatten fielen über das lenzgrüne Gras, und vor den Kindern stand Johann Sebastian mit Frau Lisbeth.
»Was ist meinem Buben geschehen?« rief die Mutter und zog Dame Kundry am Flachshaar empor.
»Gar nichts,« sagte Karl Maria und lächelte glücklich.
»Er hat meine Puppe aus dem Teich geholt,« beichtete reumütig die zitternde Gundl.
»Steck' ihn ins Bett und gib ihm Fliedertee zu trinken!« riet Herr Williguth und sandte unheilvolle Blicke nach seiner Tochter. Und so geschah es. Den ganzen Tag lag Karl Maria im Bett des dicken Hornbläsers, bekam Tee und Glühwein und glühte wie ein Apfel im Bratrohr. Er hatte selige Träume, in denen Engel musizierten und der heilige Petrus dazu die Orgel spielte. Die schuldbewußte Gundl saß am Bett und hielt seine Hand, voll Angst, daß er sterben könnte. Als er im Halbschlaf wieder von einer Geige sprach, schlich sie fort und kramte aus einem Winkel alte Geigensaiten zusammen, die legte sie ihm auf das Deckbett. Und als er erwachte, faßte er diesen Schatz mit beiden Sünden und war fest entschlossen, sich eine Geige zu machen. Aber Onkel Johann Sebastian sagte er nichts davon; er hatte Angst vor diesem Riesen mit der Stimme, die so gewaltig rollte wie der Donner.
So gingen sie am Abend aus dem »Blauen Herrgott«, Karl Maria mit einem Schnupfen und einer Handvoll zerrissener Geigensaiten, Frau Lisbeth mit dem Gelde, das ihren Mann wieder ehrlich machen sollte.
4
Im Judengärtlein saß der kleine Karl Maria nun manchen schönen, hellen Maitag und mühte sich verzweifelt, die geschenkten Saiten auf eine leere, niedere Zigarrenkiste zu spannen, die er dem Gideon Italiener abgebettelt. Gideon rauchte gern wertvolles Kraut, in dessen blauen Ringen seine Seele auf luftige Wanderschaft flog.
Aber Karl Maria hatte kein Glück mit der schönen Schachtel und brachte keine Geige zustande. Mit dem Fiedelbogen ging es besser. Ein Fliederzweiglein bog er zusammen und knüpfte eine von Gundls Saiten an beide Enden.
Als er wieder einmal verzweifelt sich plagte, kam der elegante Jacques Italiener daher, der gern aus dem Gärtchen Flieder mauste. Als er den Kleinen so gekränkt und hilflos sah, fragte er überlegen: »Was soll's denn werden?«
»Eine Geige. Aber ich kann's noch nicht.«
Da lachte Herr Jacques und hob die unglückselige Zigarrenschachtel empor; die Saiten zitterten, daß es ein ganz feines Schwirren gab. Jacques war stets geschmeichelt, wenn er seine Geschicklichkeit zeigen konnte, und die Zähigkeit Karl Marias gefiel ihm. Der Kleine träumte von einer Geige und der vornehme Jacques von einem großen Warenhaus. So versprach er dem Buben, aus der dummen Kiste eine Geige zu machen.
Und er hielt sein Wort, leimte, schnitzte, setzte einen Steg auf, bohrte die Löcher und spannte die Saiten mit kleinen Schrauben fest. Hals hatte diese Geige freilich keinen, sah auch einer Zither weit ähnlicher als irgendeinem anderen Instrument; aber sie konnte, besonders wenn man mit den Fingern ein wenig nachhalf, doch ein paar leidlich klare und vernehmliche Töne von sich geben.
Es war ein Festtag für Karl Maria, als er dies Geschenk erhielt. Die Linde hatte schon grüne Blätter, der alte Rosenstock auch, und der Flieder duftete im Abblühen doppelt süß. Bienlein summten um die violette Pracht, Mücken tanzten im Sonnenlicht auf und nieder, immer zwischen zwei Tönen in der Terz. Und Karl Maria saß mit Geige und Bogen und lauschte diesem leisen Leben. Er atmete schwer, als er den ersten Strich tat. Es war ein artiges Kratzen. Auch mit den kleinen, auffallend gelenkigen Fingern half er wacker nach und zupfte an den Saiten, wie er es von Joseph gesehen hatte. So feierte er das Fest seiner ersten Geige.
5
Und dieses Fest dauerte den ganzen Mai.
Die Bienen ließen sich durch sein armes Spiel nicht stören; sie summten fleißig und wohlwollend, als wollten sie Karl Maria weisen, wie er es machen müsse. Die Mücken tanzten ihr Sonnenballett und musizierten dazu ganz zart, wie Harfenspiel. Der Bub plagte sich, es den Mücken und Bienen gleichzutun, seine Finger waren fein und geschickt, nur mit dem Bogen blieb es ein mißliches Ding. Im Fliederstrauch nistete jetzt ein Amselpaar. Das Männchen setzte sich oft neben den winzigen Musikanten und schmetterte sein Liedlein aus dem gelben Schnabel. Manchmal, wenn sein Mut stark und keck ward, spielte Karl Maria der kleinen Miriam vor, die gerne zu seinem Spiel tanzte. Sie und ihr Bruder Jacques waren die einzigen, die um Karl Marias Geheimnis wußten. Nicht einmal die Mutter weihte er ein. Immer hatte er Angst, man könne ihm seine einziggeliebte Geige rauben.
Als einmal gerade die Amsel sang und er geigte, kam plötzlich seine Schwester Martha in den Garten. Sie brach keck die allererste schüchterne Rosenknospe, die Karl Maria seit Tagen voll heimlicher Freude bewunderte, von dem alten Stock und steckte ihre Stupsnase in die gelbe Blütenpracht. Zu Tode erschrocken schob Karl Maria seine Geige ins Gras und legte den Fiedelbogen unter den Fliederstrauch, dann rupfte er schnell Löwenzahn und blies eifrig die Blütenfedern ab.
Aber Martha sah ihn gar nicht, sie ging gemächlich auf und ab, wiegte sich kokett in den Hüften und trällerte vor sich hin. Karl Maria drückte sich sachte immer tiefer unter den Fliederbaum, bis er ganz darin verschwand.
Da erschien Herr Jacques, blickte sich vorsichtig um und legte spitzbübisch die Hand an den Mund. Dann zeigte er Martha etwas, worauf diese in die Hände klatschte und ihm einen Kuß gab. Mit beiden Händen faßte sie das Geschenk und breitete es vorsichtig auseinander. Die Sonne fiel darauf, und Karl Maria sah ein rotseidenes Garibaldi-Hemd. Er atmete schwer, als sei vor seinen Augen eine Sünde geschehen.
Am Abend schon trug Martha das rote Jäckchen, das sie in einem Räumungsverkauf überraschend billig erstanden haben wollte.
Frau Lisbeth biß die Lippen aufeinander und schwieg.
Der Vater aber lachte und bewunderte Martha: »Die hat es weg!«
Karl Maria saß steinunglücklich und hatte Todesangst, daß jetzt etwas Furchtbares geschehen müsse.
Aber es geschah gar nichts.
Als er am nächsten Morgen alles der Miriam erzählte, lachte diese ihn aus: »Unser Jacques ist ein Lump.«
Doch Karl Maria wußte nicht einmal, was ein Lump sei. Er schämte sich bloß, daß er diesem Jacques seine Geige verdankte.
Die Miriam aber hüpfte durchs Gärtlein, flocht einen Kranz aus den gelben Löwenzahnblüten und drückte ihn ins Haar.
»Gib acht, Dummerl!« rief sie und tanzte vor ihm auf dem frühlingsgrünen Gras, wunderhübsch mit dem gelben Schmuck im goldhellen Haar. »So tanz' ich Mittwoch in der Oper im neuen Ballett. Meine erste Solopartie!«
Sie überschrie sich fast: »Und alle werden klatschen. Siehst du, so und so.«
Laut schlug sie die schmalen, festen Hände zusammen.
»Darf ich auch hin?«
Sie stand auf einem Bein, beschrieb mit dem anderen kunstvolle Kreise in der Luft, hielt den Kopf schief und dachte nach: »Hübsch wär's schon. Die Ermattinger könnte dich in die Künstlerloge nehmen.« Nach einer Weile aber entschied sie: »Nein, du bist noch zu klein. Später vielleicht.«
Karl Maria nickte betrübt. Die Welt war so groß, und er so klein. Wie eine schwere dunkle Wolke zog dieser Gedanke über ihn hin.
Später machte sich Miriam an ihren Bruder Jacques, blinzelte ihn von untenher an und fragte sanft: »Was bekomme ich geschenkt, wenn ich schweige?«
»Freches Ding!« brummte der Auslagenarrangeur und schob seine Krawatte zurecht.
»Mutter ist vielleicht neugierig, Jacques –.«
»Was weißt du denn schon wieder?«
»O, nichts.« Sie tat gekränkt und strebte nach der Küchentür.
Da packte er sie an beiden Armen: »Farbe bekennen, du Giftkröte!«
»Ist das Jäckchen wirklich so schön, Jacques?«
Er fixierte sie drohend, doch sie lachte nur.
»Hast du es teuer bezahlt?«
Er war wütend: »Ist eine Schachtel Bonbons genug?«
»Aber Schokolade mit süßer Füllung, das bitte ich mir aus!«
»Sollst sie haben, kleines Luderchen,« antwortete Jacques Italiener und überzählte in Gedanken seine knappe Barschaft. Sollte Martha geplaudert haben? Ach nein, die Miriam war ein Ekel, das in allen Ecken sich verbarg und einfach das Gras wachsen hörte. Das Häkchen krümmte sich beizeiten. Auch Jacques bewunderte das frühreife Kind, wie die ganze Familie Italiener.
Wie keck sie nur nach der kleinen Solopartie gehascht hatte!
Jacques mußte lachen. Aus dem Nichtsnutz konnte etwas werden. Der Ballettmeister hatte in der Übungsstunde gefragt, ob eines von den Kindern den Mut zu der Rolle im Ballett »Blaubart« hätte.
Alle schwiegen, nur die Miriam trat resolut vor: »Ich!«
Der Gewaltige lachte spöttisch: »Du Knirps? Unsinn.«
Die Miriam jedoch warf sich in Positur und fragte kurzerhand: »Was habe ich zu tun?«
Und jetzt sollte das siebenjährige Ding wirklich als kleinste Koryphäe die Kinderrolle tanzen. Jacques ward beinahe weich bei dem Gedanken. Die war kein Schlemihl.
Frau Charlottens Blick streifte in diesen Tagen oft in schlecht verhehlter Verachtung den armen Joseph, der nach seiner mißglückten Konzertreise nach Laibach im Operettenorchester untergekrochen und so aus dem ehemaligen Wunderkind ein richtiger Schlemihl geworden war. Frau Charlottens fette, aber energische Hände begruben die Hoffnung, die sie vor zehn Jahren an den ältesten Sohn gehängt, und bauten ein neues Haus für die kleine Miriam, die es so mutig mit dem Leben wagte. Voll Stolz besetzte die Mutter ihr gelbseidenes Festkleid mit schönen cremefarbenen Spitzen und erstand bei einer Nachbarin in der Judengasse ein paar elegante Schuhe, in die sie mutig ihren Fuß zwängte, als der bedeutungsvolle Abend da war.
Der starke Gideon mußte im Laden bleiben, weil der alte Isaak, der für die Firma Italiener abgelegte Kleider einkaufte, gern mehrere Schnäpse zu sich nahm und deshalb nicht ganz vertrauenswürdig erschien. Auch fürchtete Frau Charlotte, dem Herzblatt Miriam könnte Übles zustoßen, wenn ein solcher Tunichtgut wie ihr Eheherr, der sechs lebendige Kinder hatte und nun tatenlos in den blauen Himmel guckte, am Geburtstage von Miriams Ruhm mit dabei säße.
Joseph küßte die kleine Schwester. Ihm war ganz seltsam zumute. Vor zehn Jahren ging er hinaus wie heute die Miriam und lief dem Ruhme nach. Jetzt saß er tagsüber bei dem Vater im dunklen Laden und mußte abends die Geige streichen zu dem Blödsinn, der wie ein Mechanismus sich zum 150. Male abhaspelte. Der unbeholfene, schwere Mund des Joseph zog sich in bittere Falten: »Werd' glücklich. Kleine!«
Die Miriam aber blickte ungeduldig auf die alte Rokokouhr, die vorn im Laden stand.
6
Frau Charlotte im Gelbseidenen rauschte würdig durch die Parkettreihen, von dem eleganten Jacques geleitet. Die Miriam war keck und ganz allein durch das Bühnentürchen in die schmale Straße gerannt, die zum Glück führte. Die Mutter seufzte gewaltig, daß die schönen Spitzen auf dem umfangreichen Busen zitterten und Jacques verzweifelt sich abwandte und eine Logenschönheit durch sein Glas fixierte. Mutter hatte gar keine Weltgewandtheit. Er bangte, daß sie mit den Sitznachbarn sofort ein Gespräch beginnen könnte.
Zum Glück setzte das Orchester ein. Frau Charlotte aber kränkte es, daß ihr Joseph da draußen in der Vorstadt spielte. Ihre Lippen bewegten sich leise, sie bat in hebräischer Sprache ihren Gott um Erbarmen mit dem Kinde, das heute vor diesen vielen reichen Menschen tanzen sollte.
Das alte Ballett »Blaubart« von Vestris war neu einstudiert und prunkvoll ausgestattet, weil ein Prinz seine Herzallerliebste gern tanzen sah. Sie gab die Hauptrolle, in der einst Fanny Elßler Berlin entzückt hatte. Das indische Milieu bot reiche Gelegenheit zu Pracht und Glanz. Alles leuchtete und flirrte, daß es der guten Frau Charlotte aus der Judengasse fast sündhaft schien.
Schon in der dritten Szene sprang Miriam lustig in der Volksmasse mit, die dem Einzug des Blaubart zusah. Der zweite Akt spielte im Palaste des Rajah Abomelick.
Das Kind Beda aber gab die Miriam Italiener.
Frau Charlotte kam von dem Theaterzettel nicht los, der diese Kunde enthielt, obschon es ganz dunkel war und sie gar nichts lesen konnte.
Jacques stieß sie leise an: »Da ist die Miriam.«
»Mein goldenes Herzblatt,« seufzte Frau Charlotte und begann zu weinen, daß ihre Tränen wie ein Büchlein durch die schwarze Stille liefen.
Miriam tanzte wie ein Kobold, die roten Schleier wehten um sie. Wie ein Bote Gottes, dachte die Mutter.
Voll Neugierde näherte sich jetzt Miriam der geheimnisvollen Tür, die zu Blaubarts unterirdischer Kammer führte. Sie bog sich zurück und klopfte mit der Fußspitze dreimal an die hohe goldene Pforte.
»Der Balg ist kostbar,« sagte jemand neben Frau Charlotte.
»Danke,« stammelte ganz verwirrt die dicke Frau.
Als Abomelick auf dem Thron saß und die Huldigungen zu seiner Hochzeit entgegennahm, leuchteten wieder Miriams rote Schleier aus der Menge hervor.
Dann sank der Vorhang.
Und jede einzelne Hand klatschte für die Frau aus der Judengasse einzig und allein ihrer Miriam Beifall. Sie ärgerte sich nur, daß kein Tänzer nach dem Hausgesetz danken durfte. Es schien ihr eine persönliche Bosheit.
Der Herr, der vorher Miriam gelobt hatte, lächelte jetzt der erregten Frau zu. Da strömte ihr Herz über, und in ihrem schönsten Hochdeutsch gestand sie dem freundlichen Herrn, daß die Kleine ihre Tochter sei.
Voll Entsetzen ergriff Jacques die Flucht.
Der Herr aber plauderte sehr verbindlich mit Frau Charlotte. Es war ein großer schöner Mann mit hellen blauen Augen und einem angegrauten Schnurrbart. Mit feinem Lächeln hörte er, was Frau Charlotte überlaut erzählte.
Eine Gruppe bildete sich.
Da zog er die Brauen hoch: »Da will ich gleich mal der Kritik um den Bart gehen.«
Er nickte leicht und trat auf mehrere Herren zu, die ihn zuvorkommend begrüßten.
»Das muß ein Fürst sein,« grübelte Mutter Charlotte und sah wundervolle Zukunftsbilder.
Doch es war nur der Geiger Hans Geßner.
Mit heißen Wangen saß Miriam zwischen Mutter und Bruder und fuhr heim.
In ihren Ohren rauschte noch der Beifall, auf ihren Lippen brannten noch die Küsse, die Ballettmeister und Solotänzer dem kleinen Wunder gegeben. Wie ein Pfau dehnte und räkelte sie sich.
Plötzlich rief sie: »Ich will Blumen haben.«
Frau Charlotte murmelte eine schwache Einwendung, doch Jacques ließ den Wagen halten. Da lief Miriam in den Laden, Mutter und Bruder hinterher. Sie kaufte dunkelrote Rosen und trug sie stolz zurück. Nach einer kleinen Weile ließ sie wieder halten, und als jetzt Frau Charlotte ernstlich widersprach, schlug sie zornig gegen die Scheiben: »Ich will aber!«
Diesmal galt es einem Delikatessenladen. Doch sie wußte nichts zu wählen, als sie unter all den Leckerbissen stand. Hochrot und verlegen zupfte sie Jacques am Ärmel: »Suche du aus!«
Das tat er nun. Zuletzt deutete Miriam auf ein kaltes Huhn: »Für Großvater!«
Da küßte Charlotte das Kind und war sehr gerührt, unterließ es auch nicht, dem ganzen Personal die Geschichte des heutigen Abends zu erzählen.
Vater Gideon hatte den Abend mit dem alten Isaak im Laden verbracht, in einer schweren, dunklen Stimmung, deren er nicht Herr werden konnte. Es schien ihm, als entrisse ihm dieser Abend seine Miriam, deren kindische Freude an Flitter und Tand er nie recht leiden mochte. Er war ein beschaulicher Mensch, der gern den Dingen auf den Grund sah und nie an den endgiltigen Erfolg glaubte. Darum war ihm dieser auch stets aus dem Wege gegangen. Seine Gedanken liefen immer wieder zu seinem Joseph, der jetzt im Operettentheater die Geige strich. So hatte es mit Joseph auch begonnen. Gideon lächelte trübselig und machte sich auf den Weg, seinen Sohn abzuholen. Er war heute mit Joseph milde und vertraulich, wie schon lange nicht, scherzte und lachte, als stände Laubhütten vor der Tür. So suchte er Joseph irgendein Unrecht abzubitten, das der Junge in dem Erfolg der Miriam, den Vater Italiener trotz seines sonstigen Mißtrauens kurzerhand vorwegnahm, etwa finden konnte.
»Man muß es innen haben,« sagte er schließlich philosophisch. Aber es blieb ungewiß, was er damit meinte.
Als sie vor ihr Haus kamen, löste sich eine kleine Gestalt aus dem Torschatten, lief ihnen entgegen und schwang ein Fliederkränzlein. Es war Karl Maria.
»Für die Miriam,« flüsterte er und huschte heim.
Joseph nahm das Geschenk und zog den Mund in herbe Falten.
Dem Karl Maria Tredenius sollte erspart bleiben, was wie ein schwarzer Schatten über Joseph Italiener lag.
Da hörte er einen Wagen heranrollen.
Vater Gideon faßte nach seiner Hand: »Sei stark, Joseph!«
So empfingen sie die triumphierende Miriam.
7
Der Oktober war für die Kinder Italiener stets ein froher Monat, weil man da Laubhütten feierte, überall roch es gut nach süßen gefüllten Fladen und frischem Obst, man durfte am Wein nippen und erhielt Datteln, Apfel und Nüsse. Im Gärtlein stand Hütte an Hütte, bunt geputzt, das dünne Laub raschelte, wenn man in die Laube trat, fromme Gebete erfüllten das sonst so stille Fleckchen Erde mit lautem Singsang.
Untertags aber hockten die Kinder allein in den raschelnden Laubhütten, bewarfen sich mit welkem Laub, aßen im Übermaß zur Feier des Festes und spielten die besten Leckerbissen im Mariandlspiel aus. Das war so aufregend wie ein richtiges Hasardspiel. Von den acht schmalen Feldern eines achteckigen Kreisels, der auf einem dünnen, spitzen Beinfüßchen stand, waren sechs genau wie Dominosteine ausgestattet, mit mehr oder weniger schwarzen Punkten; die siebente Fläche war ganz leer, und ihr gegenüber trug die achte das Bildchen einer bunten kleinen Marketenderin, der »Mariandl«.
Voll Spieleifer drehten die Kinder den Kreisel, der schnurrend tanzte und stets nur auf eine der acht Seitenflächen fallen konnte, wenn er zur Ruhe kam. Die oben liegende Fläche galt und zeigte Gewinn oder Verlust an. Man spielte um Feigen, Datteln und Nüsse, die Knaben auch um Federn oder Briefmarken.
Kam die »Mariandl« obenauf zu liegen, so bedeutete das den höchsten Triumph, und der glückliche Gewinner heimste von allen Seiten ein. Miriam trieb dies Spiel mit Leidenschaft. Selbst Gideon und Jacques fanden daran Gefallen und ließen den Kreisel wirbeln, wie dies Miriam im Ballett tat, nur spielten die Männer um Geld. Miriam saß mit der Sparbüchse, einem grünen Affen mit gewaltigem Bauch, daneben und bettelte um milde Gaben.
Das kleine Mädel hatte sich überhaupt langsam in den Mittelpunkt geschoben. Voll Stolz blickten Eltern und Geschwister auf den Karton, der unter Glas und Rahmen drei Zeitungsausschnitte zeigte, die Miriams Tanz im »Blaubart« lobten. Darüber hing ein welkes, verstaubtes Kränzlein, das leise raschelte, wenn der Wind durchs Zimmer strich.





























