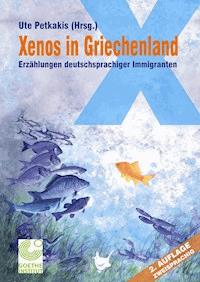
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Größenwahn Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
'Hals über Kopf hat sich Eva dazu entschlossen, mit ihrer großen Liebe nach Griechenland zu ziehen. Keinen Gedanken hat sie daran verloren, wie das Leben sein wird in einem fremden Land …' Deutsche und deutschsprachige Immigranten erzählen aus ihrem Leben in Griechen-land: über Begegnungen, Erfahrungen und ihre Gefühle. 19 ausgewählte Beiträge des Kurzgeschichtenwettbewerbs 'Xenos in Griechenland' werden zweisprachig – im deutschen Original und in griechischer Übersetzung – präsentiert. Der Wettbewerb wurde aus Anlass des 50-jährigen Anwerbeabkommens zwischen Deutschland und Griechenland vom Goethe-Institut Thessaloniki in Zusammenarbeit mit dem Größenwahn Verlag Frankfurt am Main veranstaltet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 316
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Xenos in Griechenland | Reihe: 21
Die Deutsche Nationalbibliothek – CIP-Einheitsaufnahme.Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet dieses Buch in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Erste Auflage 2011© Größenwahn Verlag Frankfurt am Main Sewastos Sampsounis, Frankfurt 2011www.groessenwahn-verlag.deAlle Rechte Vorbehalten.ISBN: 978-3-942223-06-5eISBN: 978-3-942223-61-4
Ute Petkakis (Hrsg.)
Xenos in Griechenland
Erzählungen deutschsprachiger Immigranten
19 ausgewählte Beiträge des Kurzgeschichtenwettbewerbs»Xenos in Griechenland«,veranstaltet vom Goethe-Institut Thessalonikiin Zusammenarbeit mit dem Größenwahn-Verlag Frankfurt am Mainaus Anlass des 50-jährigen Anwerbeabkommenszwischen Deutschland und Griechenland
IMPRESSUM
Xenos in Griechenland
Reihe: 21
HerausgeberinUte Petkakis
Seitengestaltung und CoverGrößenwahn Verlag Frankfurt am Main
SchriftenConstantia und Lucida Calligraphy
CovergestaltungPeter Sarowy
CoverbildMártios Sigma: Unterwasser
LektoratThalia AndronisGrößenwahn Verlag Frankfurt am MainOktober 2011
ISBN: 978-3-942223-06-5eISBN: 978-3-942223-61-4
In Abhängigkeit von der verwendeten Lesesoftware kann es sein, dass griechische Schriftzeichen nicht korrekt wiedergegeben werden.
I N H A L T
VorwortUTE PETKAKIS
GedankensplitterJUDITH SCHIEBEL
Bamies und ein weises SchiffCARITAS FÜHRER
GefühlUTE ALTANIS-PROTZER
Der erste SchrittLEA OBERMÜLLER
Der böse BlickANNA JAHN
VerkehrEDIT ENGELMANN
SprachschwierigkeitenKARIN GODINEZ
Brot und HeimwehDOROTHEE VAKALIS-FöLSTER
Das SamstagskindGUDRUN KITIDIS-VON ANDRIAN
KönigsschwesternANDREA DIMITRIADIS
Im VergehenNICOLE QUINT
Auf und DavonMELINA PROIKAS
NikosALKIMOS SARTOROS
Der liebe Gott und der NachbarINGRID LEHMANN
Griechisch für FortgeschritteneKHATUNA MANOS
Bucklige bei der IKAMARIA GALITSAS
Heimkehr in die FremdeBRIGITTE MÜNCH
Happy EndANNA KABANA
Zu HauseDIRK R.STROHBUSCH
BIOGRAPHISCHES
UTE PETKAKIS
Vorwort
2010 wurde das Jubiläum des vor 50 Jahren geschlossenen deutsch-griechischen Anwerbeabkommens gefeiert. Viele der griechischen »Gastarbeiter« haben inzwischen in Deutschland eine Heimat gefunden und Familien gegründet. Über das (Ein-)Leben dieser Gastarbeiter in Deutschland wurden zahlreiche Bücher veröffentlicht, viele von ihnen haben sich auch literarisch mit dem Leben in der Fremde auseinandergesetzt. Eine große Anzahl der Migranten, die in ihre Heimat zurückgekehrt sind und dort ein neues Leben begonnen haben, brachten ihre deutschen Partner, Kinder und Freunde mit.
Wenig bekannt ist, dass einige dieser deutschen Immigranten ihrerseits ihr Leben in der neuen griechischen Heimat literarisch verarbeitet haben. Das brachte uns – den Größenwahn-Verlag und das Goethe-Institut Thessaloniki – auf die Idee, einen Wettbewerb auszuschreiben: Gesucht wurden Kurzgeschichten, in denen die deutschsprachigen Auswanderer über ihr Leben als Xenos (= Fremder) erzählen sollten. Wir wollten erfahren, wie sie sich mit dem neuen Land, mit der neuen Mentalität und mit den oft sehr andersartigen Lebensumständen auseinandergesetzt haben.
Die zehn besten Kurzgeschichten sollten in einem Buch veröffentlichen werden – falls diese Zahl zustande käme. Mit der dann erfolgten großen Resonanz auf unseren Wettbewerbsaufruf hatten wir nicht gerechnet – 53 Einsendungen trafen ein, die alle über das Leben in Griechenland berichteten. Es waren die verschiedensten literarischen Formen vertreten: Gedichte, Erzählungen und reine Aufzählungen von Lebensdaten.
Die Jury, die die besten Kurzgeschichten auswählte, setzte sich aus Vertretern des Goethe-Instituts Thessaloniki, des Größenwahn-Verlags Frankfurt, des Deutschen Generalkonsulats in Thessaloniki, der Deutschen Schule Thessaloniki, der Germanistischen Abteilung der Aristoteles-Universität Thessaloniki und des Romiosini-Verlags Köln zusammen. Die Jury musste darüber entscheiden, welche Einsendungen die gestellten Kriterien erfüllt hatten: in literarischer Form Antwort zu geben auf die Frage, wie sich die Deutschen bzw. deutschsprachigen Ausländer in Griechenland fühlen, ob und wie sie sich integriert haben und was sie über das Leben in der Fremde berichten können.
Die Qualität der Kurzgeschichten hat die Jury bewogen, die Anzahl der Erzählungen, die in die geplante Anthologie aufgenommen werden sollten, auf 19 zu erhöhen. Die ausgewählten Geschichten wurden ins Griechische übersetzt; so können auch die Partner und das griechischen Umfeld lesen, wie ihre deutschsprachigen Lebensgefährten und Nachbarn ihr Leben in der »Fremde« erfahren haben.
Im Namen des Goethe-Instituts Thessaloniki und des Größenwahn-Verlags Frankfurt möchten wir uns herzlich bedanken bei allen, die uns ihre Geschichten zugesandt und dieses Buch möglich gemacht haben, sowie bei der Jury, die sich die Auswahl nicht leicht gemacht hat.
Ute Petkakis, Goethe-Institut ThessalonikiThessaloniki, Juni 2011
JUDITH SCHIEBEL
Gedankensplitteraus meinem Leben in Thessaloniki
Halbeingerichtete Zimmer
IKEA-Ausstellungsraum auf der Suche nach Individualität
Griechenland angedacht als längere Zwischenstation
doch Straßenlärm und dichte Luft machen Wunsch zu bleiben Bange
das Leben, erlebt sich bebend
Zerreißprobe des Aushaltens:
anders- sein
anders- handeln
anders- fühlen
dann wieder und dazwischen
SEIN
in Begegnungen
durch Verständigung
Sprachfetzen ebnen Wege des Vertrauens
wohlgesonnen ist die Landschaft
sonnig lächelnd vom PVC-Flaschengewicht unerschüttert
am Meer stimmt Aufatmen heiter
und Kaffeerausch bewehrt sitzt man am Strand
es verstummen nur die Fische
und der Sand in der windstillen Sommernacht
Griechisch gleicht einem welligen Gemurmel
wie Gute Nacht Musik
doch da ist es wieder
heim
wehe wenn ich daran denke
denn manchmal vermisse ich den miesepetrigen Gleichklang der
Wintertage
und das als schlecht bezeichnete Wetter
da
heim
dein, mein, ich, mich, mir
in
mir
hier tut regenverhangener Himmel gut
gibt zu viel Freude einmal Zeit zum Nachspüren
nachdenken
über sich
verhilft zum In-sich-Gehen
gehen am betonierten Strand
flattersatzgesäumte Gedankensplitter
denkt
ein Bleiben kommt nicht in Frage
denn der Wanderer verweilt nicht
das Ziel – die Bergspitze
das Ankommen die baumlose Zone des Ichs
bei sich
und so wird mir Thessaloniki in Erinnerung bleiben
als Reise zu mir
am Außen abgearbeitet
zum Innenblick verdammt
letztlich wehmütig zurück blickend
die Kielspur im Wasser verschwimmen sehend
dankbar für eine atemberaubende Zeit im Exil
selbstgewählt
an Schönheit und Hässlichkeit gleich stark
lebendig
ein Baustein
ein Brückenschlag
ein Glücksfall
und es hätte kein anderes Land sein können
keine andere Stadt
denn nur hier tut sich das Spannungsfeld auf
staunt jeder ob der unbeschreiblichen widersprüchlichen Alltäglichkeit
als Lied gesungen
ein zwischen
ein da
heim
CARITAS FÜHRER
Bámies und ein weißes Schiff
Eigentlich gibt es noch gar nichts zu erzählen. Gravierendes oder gar Spektakuläres hat sich noch nicht ereignet. Kaum, dass wir selber schon begriffen haben, dass wir uns nun in einem anderen Land befinden. Seit reichlich zwei Monaten sind wir in Griechenland, seit dreiundsiebzig Tagen erst. Mann und Frau.
Wir haben eine gute Arbeit verlassen, da, wo wir herkommen. Wir haben eine gute Arbeit erhalten, hier, wo wir jetzt sind. Wir haben eine Wohnung bezogen mit gläsernen Schiebetüren und einem Balkon aus weißen Marmorfliesen, der sich um die Räume herumzieht wie ein helles Band.
Wenn wir ganz hinaustreten und uns recken, schauen wir nach vorn, zwischen zwei Häusern hindurch, auf das Meer. Ein kleiner Ausschnitt, unsere Wetterstation. Wenden wir den Blick nach links, erkennen wir das Kastro von Thessaloniki, mit dem wir uns etwa auf einer Höhe befinden. Rechts endet die Straße an einem Pinienwäldchen, in dem wilde Hunde in der Sonne liegen und schlafen. In unserem Vorgarten wächst eine Palme. Am Straßenrand gegenüber zittert eine Mimose neben einem mit prallen Früchten behangenen Lotosbaum. Der Hausbesitzer hat Zweige mit hellrosa Früchten für uns abgeschnitten, die wir solange in der Wohnung aufhängen sollen, bis sie dunkelrot und weich sind. Isst man sie vor Ungeduld eher, wird der Mund innen pelzig, was ich schon getestet habe.
Das Außergewöhnlichste aber, das mir begegnet ist, ist unsere Nachbarin Marika. Sie wohnt im Nebenhaus, zusammen mit ihrem Mann. Ein grauer Igelschnitt verleiht ihrem Gesicht ein munteres Aussehen. Ihr Balkon liegt ein Stockwerk höher als unserer, was Marika in die Lage versetzt, sich gegenüber unserer Küchentür ans Geländer zu stellen, von oben laut nach mir zu rufen und mir auf Griechisch ihre Mitteilungen zu machen, von denen ich nichts verstehe. Anfangs dauerte es eine Weile, bis ich begriff, dass ihre lauten Rufe, deren Sinn ich nicht erfasste, mich meinten. Gleich in der zweiten Woche hatte sie sich offenbar vorgenommen, mir unbedingt den Bazar zu zeigen. Tag und Ort ließ sie mir ausrichten, die Uhrzeit malte sie in die Luft. Pünktlich stand ich am Auto und wurde von Marikas Mann durch die Altstadt kutschiert bis zu einer Straße, in deren Kurve wir in der dritten Reihe parkten. Forsch bedeutete mir Marika, mich ihnen anzuschließen, und so lief ich hinter ihr her, von Stand zu Stand. Wollte ich haltmachen, um Gurken und Auberginen zu kaufen, schüttelte sie unwillig den Kopf und zog mich am Ärmel weiter. Ab und zu blieb sie an einem der Tische stehen und bedeutete mir, dass ich hier und jetzt kaufen sollte, so, wie sie es mir vormachte. Das brachte mich in einige Verlegenheit. Zwar war ich ebenfalls an Tomaten und Paprikaschoten interessiert, auch wenn mir die Früchte am Stand davor besser gefallen hätten, aber Maiskolben und ganze Melonen mitzunehmen weigerte ich mich entschieden, da ich keine Lust hatte, mich eine Woche lang von ihnen zu ernähren. Vergeblich und hartnäckig redete Marika auf mich ein, und es schien ihr viel daran zu liegen, dass ich meinen Beutel wenigstens mit Maiskolben füllen ließ. Marika dagegen und ihr Ehemann schleppten schon nach kurzer Zeit Unmengen von prall gefüllten Plastiktüten mit Mais, Pflaumen, Pfirsichen, Tomaten, Gurken und Auberginen, Melone und Oliven, während ich mir jeweils genau bedachte Portionen für zwei Leute abwiegen ließ. Bei den Pfirsichen allerdings gelang es mir nicht, zwei wundervolle große Exemplare zu erwerben, denn als ich auf die Frage des Verkäufers nach der Menge zwei Finger in die Höhe reckte, begann er, zu Marikas Vergnügen, zwei Kilo in die Tüte zu sortieren. Gebäck zu erwerben erlaubte sie mir keinesfalls und flüsterte mit verschwörerischer Miene und missliebigen Seitenblicken zum Bäckerstand hin mir Unverständliches ins Ohr. Ab und zu traf sie Bekannte und teilte ihnen mit, dass ich »Jermanída« sei, also Deutsche. Als ich ihr auf die Schulter tippte und deutlich machte, dass ich noch gerne Fisch kaufen möchte, schüttelte sie den Kopf und trabte, schwerer beladen als ihr Mann und ohne den Blick nach mir zu wenden, davon, bis ich begriff, dass sie erst einmal alles ins Auto zu packen gedachte.
Alsdann kehrte sie mit mir zurück und begutachtete wohlwollend meinen Fischkauf. Ich hatte mit Pangasius offenbar eine in Marikas Augen gute Wahl getroffen, die aber lediglich meinem Unvermögen entsprang, irgendeinen der anderen Fische und deren Zubereitung zu kennen.
Und dann fiel mein Blick auf etwas, das ich erst ein Mal in meinem Leben gesehen und mit großem Appetit genossen hatte, auf der Insel Kalangala im Victoriasee. Und genau das wollte ich haben. Mit verwundertem Blick registrierte Marika, dass ich offensichtlich vorhatte, Okraschoten zu kaufen. Sie sprach mit ihrem Mann, der bedenklich mit dem Kopf wackelte und mir mit besorgter Miene etwas mitzuteilen versuchte. Aufgeregt sprach Marika eine Frau an und ließ mir übersetzen, sie käme gleich morgen zu mir, in meine Küche, um mir zu zeigen, wie man Bámies kocht. »Bámies, Bámies«, sagte sie immer wieder. Denn das könnte ich unmöglich allein, Bámies kochen, das sei gefährlich. Das ginge nur mit ihrer Hilfe!
Als ich vor unserem Haus aus dem Auto stieg, zeigte Marika noch einmal auf die grünbraunen Okraschoten und bedeutete mir, dass morgen der große Tag sei, an dem sie mit ihrer Hilfe in den Topf kämen.
Ich muss gestehen, dass mich die Aussicht, mit Marika zusammen die Okraschoten zuzubereiten, in leichte Panik versetzte. Denn auch wenn sich durchaus ein freundliches nachbarschaftliches Band zwischen uns geknüpft hatte, waren wir uns doch noch nicht so vertraut, dass mir der Gedanke an eine gemeinschaftliche Kochaktion mit ihr schon selbstverständlich gewesen wäre.
Umgehend besorgte ich mir ein Rezept und ließ ihr ausrichten, dass ich längst wüsste, wie man Bámies kocht und dass ich allein zurechtkäme. »Efcharistó! – Danke!« Marika in meiner halbfertig eingerichteten Küche, mit einer alten elektrischen Kochplatte und einem bindfadendünnen Strahl aus dem Wasserhahn, undenkbar! Ich würde die Bámies allein kochen! Zuerst schälte ich die Fruchtstände vorsichtig Richtung Stiel und hütete mich, sie abzutrennen, denn dann würde unweigerlich eine schleimige Soße herauslaufen und das Essen verderben. Genau davor hatte mich Marika wahrscheinlich bewahren wollen. Nachdem ich dieser Gefahr nicht erlegen war, wusch ich die Schoten, besprenkelte sie mit Essig und stellte sie zwei Stunden in die Sonne, nicht ohne sie alle zehn Minuten behutsam zu rütteln. Dann ließ ich Olivenöl in der Pfanne heiß werden und röstete Lauchzwiebeln und Knoblauch, raspelte Fleischtomaten auf dem Reibeisen und gab zuletzt die Okraschoten hinein. Ich ließ sie schmurgeln, bis sie weich und dunkel waren. Sie waren köstlich.
»Mein Magen lernt Griechisch«, zitierte mein Mann am Mittagstisch. He, Marika, ich habe Bámies gekocht, und das nach zwei Wochen Griechenland! Bravo!
Aus so ganz alltäglichen, ja banalen Sachen fügt sich derzeit mein Alltag zusammen. Kürzlich fiel mir vor Schreck fast die Gabel aus der Hand, als Marika geräuschlos wie ein Geist gegenüber der Küchentür auf ihrem Balkon auftauchte und so laut und lange rief, bis ich hinauskam. Sie warf mir ein Päckchen übers Geländer, in dem sich zwei gegarte heiße Maiskolben befanden. Mitunter legt sie mir auch scharfe Peperoni aus ihrem Garten unter den Zaun, bindet Blumen ans Gitter oder legt eine Dose mit Auberginensalat aufs Mäuerchen. Sie redet grundsätzlich lautstark und unbekümmert griechisch mit mir. Offenbar nimmt sie an, dass ich mich nur verstelle, denn Griechisch kann doch jeder hier! Und irgendwie begreife ich ja meistens doch, um was es geht. Also …!
Kürzlich haben wir uns bei Leroy Merlin einen großen, metallicfarbenen Briefkasten gekauft und am Gittertor angebracht. Der Briefkasten ist wichtig. Er ist unsere Verbindung nach Deutschland. Die Werbung, die wir vorfinden, können wir nicht lesen. Aber die Briefe sprechen unsere Sprache und erinnern uns daran, dass wir an anderen Orten Spuren hinterlassen haben.
Heute wird in Deutschland der »Tag des Mauerfalls« begangen. Uns ist sehr bewusst: Wir wären nicht hier ohne diesen 9. November, an dem die Grenze bedeutungslos wurde, die unser Land zerteilt hatte. Und um das verstehbar zu machen, muss ich eine Geschichte erzählen, die lange zurückliegt. Und obwohl sie lange zurückliegt, achtundzwanzig Jahre nämlich, weiß ich noch genau, wo wir uns in diesem konkreten Sommer befanden, und auch, warum.
Wir erwachten in den Dünen, weil der Tau durch den Nylonstoff der Schlafsäcke drang. Lange hatten wir in der Nacht wachgelegen und klopfenden Herzens auf das Bellen der Suchhunde gehört, hatten uns tiefer in die Mulde geduckt, wenn die Lichtkegel der Stablampen über den Sandstrand strichen.
Wenn wir gefasst würden, so hatten uns andere Tramper am Nachmittag gesagt, müssten wir eine Strafe zahlen, die niedriger wäre als die unverschämt hohe Zeltplatzgebühr für zwei Leute. Man würde uns filzen, unsere Personalausweise und Visa kontrollieren, die Daten aufnehmen und uns aus den Dünen jagen. Wenn wir Pech hätten, würde man uns mitnehmen und verhören, um herauszufinden, ob wir vorhätten, Republikflucht zu begehen. Aber Letzteres war nicht sehr wahrscheinlich. Und deshalb hatten wir gehofft, dass sie uns gar nicht finden würden.
Nachdem die bulgarische Grenzwache sich entfernt hatte, war nur noch, leise, das Geräusch der Wellen zu hören. Über uns der allen Blicken zugängliche, unbegrenzte Sternenhimmel, hinter uns die sozialistischen Plattenbauhotels von Varna, unter unserem Steilhang der berühmte ›Goldstrand‹. Wir hatten es geschafft.
Wir erwachten in den Dünen und die Sonne ging auf. In roten Glanz getaucht das Schwarze Meer. Überwältigt von dem Gefühl, hier zu sein, setzten wir uns auf. Es war so irre, zu denken: Wir sind am Ziel. Das hier war seit drei Wochen unser Ziel gewesen. Aber was ist schon ein Ziel, wenn man übers Meer blickt und weiß, dass dahinter die Welt nicht zu Ende ist, dass es dort, wo der helle Himmel mit dem Horizont verschwimmt, Länder gibt, Menschen, Häuser, Bäume.
Plötzlich wurde uns schmerzhaft klar, dass wir noch lange nicht am Ziel waren, sondern dass wir nur Halt gemacht hatten an einer unsichtbaren Grenze, die wir uns nicht selber gezogen hatten und die wir nicht bereit waren zu akzeptieren.
Und da sahen wir das Schiff, ein weißes Schiff, eine Fähre vielleicht, das schob sich aus der Dämmerung heraus, zielgerichtet, und hielt Kurs aufs offene Meer. Da es viel zu weit weg war, um es hören zu können, bewegte es sich fast gespenstisch in einer vollkommenen Stille und Lautlosigkeit, die uns erschauern ließ. Unwirklich war dieses Schiff, eine nicht glaubhafte Erscheinung aus einer anderen Welt.
Auch wenn wir es erst viel später, auf dem Rücktramp, aussprachen, gedacht haben wir es beide damals, bei Sonnenaufgang in den Dünen: Dieses Schiff fährt nach Griechenland. Wir sind jetzt Anfang Zwanzig. Wenn wir Glück haben und es erleben, werden wir vielleicht in fünfundvierzig Jahren, wenn wir Rentner geworden sind, in den Westen fahren. Man wird uns, wenn alles gut geht, einen Reisepass ausstellen, und vielleicht haben wir bis dahin so viel Geld gespart, dass wir von Westberlin oder München oder Stuttgart aus nach Griechenland fliegen können. Und vielleicht werden wir dann als alte Leute mit einem solchen Schiff über das Schwarze Meer fahren oder über das Mittelmeer oder die Ägäis, über all die Meere, von denen in unserem Erdkundeunterricht nie die Rede gewesen ist.
Vielleicht aber – und das dachten wir im Grunde die ganze Zeit parallel zu den Gedanken über das weiße Schiff – vielleicht aber ist das hier auch schon alles gewesen. Dieser Sommer, in dem wir per Anhalter von Leipzig über Prag nach Budapest, Bukarest und Sofia bis hierhergekommen sind, in klapprigen Autos, auf LKWs und in vollgestopften Überlandbussen, mit Fernlastern, Zügen und zu Fuß, getrieben von der sehnsüchtigen Gier nach Ferne, die uns immer wieder dazu bringt, das vertraute verhasste Land zu verlassen und auszutesten, wo die letzte, die endgültige Grenze für uns gezogen worden ist – vielleicht ist das schon alles gewesen.
Und jetzt hier zu sitzen, in Varna, Bulgarien, am »Goldstrand«, und einem weißen Schiff hinterherzublicken, das gerade eben verschwindet, am Horizont verschwindet, im Sonnenhell wegtaucht, nicht mehr da ist. Wahrscheinlich nie wirklich da gewesen ist.
Vielleicht war es das, ist es das, unser Leben hinter Stacheldraht, Mauern und Selbstschussanlagen, beschränkt, grau, eng.
Wir standen auf, rutschten den Hang hinunter, breiteten wortlos die Schlafsäcke in die Sonne, tauchten ins Wasser, alles in dem Wissen der erzwungenen Rückkehr, der Endgültigkeit der für immer fehlenden weißen Schiffe, der Nichtexistenz von Griechenland auf unseren verlogenen Landkarten.
Das musste ich unbedingt noch loswerden. Denn diese Geschichte ist genauso unsere Lebensgeschichte wie die Ankunft hier in Griechenland vor zwei Monaten. Und wenn ich sage: Eigentlich kann ich über unser Leben hier noch gar nichts berichten, dann stimmt das so nicht ganz. Denn alles, was uns bisher hier begegnet ist, auch die allerkleinste Banalität, und auch unsere liebenswerte Nachbarin Marika, ist aus dem Blickwinkel von zwei Menschen um die Fünfzig, die es nicht mehr für möglich gehalten hatten, dass es einen 9. November mit einem Mauerfall geben könnte, etwas Besonderes.
Am Wochenende haben wir an einem kleinen Hafen in der Abendsonne gesessen und gebratene Fische gegessen. In der Ferne erhob sich die Insel Thassos. Vor uns ankerte ein Fischerboot. Der Besitzer war mit dem Reinigen seiner Netze befasst. Und da, auf einmal, haben wir es wiedergesehen, unser weißes Schiff. Majestätisch lief es in den Hafen ein. Und wir wussten: Es ist genauso wirklich wie wir beide hier in Griechenland.
UTE ALTANIS-PROTZER
GefühlGriechenland 1980
Plözlich sah sie nichts mehr. Das Unwetter hatte sich angekündigt, schwarz war der Himmel gewesen, als sie den gewundenen Weg hinunter auf die Straße fuhr, aber die Urgewalt der Gewitter und die Wassermassen überraschten sie immer noch in diesem Land. Vielleicht hing es damit zusammen, dass sie früher geglaubt hatte, hier regne es nie, aber das war lange her.
Das Auto schwimmt. Nicht bremsen, nicht denken. Tragen lassen vom Wasser. Bis es nicht mehr getragen wird, nichts mehr weich ist. Bis der Untergrund sich anfühlt wie Eisenbahnschwellen. Bis zum Aufprall. Der Wagen wird auf die Seite gekippt. Sekundenangst vor der Explosion, die nicht kommt.
Sie hängt im Gurt, wagt kaum nach hinten, nein, oben zu sehen, dann die Frage:
»Ist alles o.k.?«
»Ja, Mami.«
Erleichterung.
Der Dreijährige wird festgehalten von der Großen. Beide leben.
Die Fenster sind so schwer zu öffnen!
Sie steigt nach oben aus, es schüttet wie aus Kübeln, durchnässt erreicht sie die Straße. Jemand hält. Hilft, die Kinder herauszuholen. Fährt zur nächsten Tankstelle. Da soll es ein Telefon geben.
Das Telefon gibt es, aber es funktioniert nicht.
Die Große hat Kopfschmerzen. Der Kleine wird weiß wie ein Leintuch.
Mein Bauch tut weh! Gibt es einen Tisch, wo wir das Kind hinlegen können? Wo ist das nächste Krankenhaus? Wie komme ich an ein Taxi?
Die Nachbarn kommen gelaufen, reden durcheinander, gestikulieren aufgeregt.
»Siehst du denn nicht? Das Kind stirbt!«, hört sie wie durch Watte.
Angst.
Milz- oder Leberruptur.
Wie oft hatte sie das gesehen in der Klinik im Dienst, schreckliche Verletzungen, ohne äußere Wunden und Vorwarnungen, auf einmal verblutet man, wenn man nicht sofort operiert.
Das Kind friert.
Ich brauche eine Decke. Kreislaufzusammenbruch?
Angst.
Die Große hat Brechreiz.
Gehirnerschütterung?
Das Kind auf dem Tisch zittert.
Wo ist das Taxi? Wir müssen ins Krankenhaus! Aber der Puls ist doch gut, vielleicht ist es nur der Schock, die Schreckreaktion.
Das Telefon im Nachbarhaus funktioniert. Sie kann zu Hause anrufen. Sagen wo sie sind, wo sie hinfahren, wo das Auto liegt. Sie bringt die Kinder ins Taxi, fühlt Puls.
In zehn Minuten sind wir im Krankenhaus. Alles wird gut.
»So eine kalte Frau … nie vorher gesehen … unglaublich …«
Das Letzte, was sie durch das Fenster hört.
Sie meint, sich verhört zu haben.
Was muss eine gute Mutter in diesem Land tun? Sich auf die Straße werfen, die Haare raufen, ihr Elend zum Himmel schreien. Sie kann und darf keinen Verstand haben, keine Ruhe bewahren, keine Decke verlangen und nicht geordnete Angaben am Telefon machen, keinen Plan haben und keine Gefahren abwägen.
Sicher, das Kind könnte inzwischen wirklich sterben – Gott möge ihm verzeihen, dem Engelchen, so früh, so ungerecht, einfach schrecklich – aber SIE wäre eine gute Mutter gewesen, so warmherzig … ihr hättet sie sehen sollen, die tragische Figur, wie sie zusammenbrach über dem leblosen Körper ihres Kindes …
Ja, die Fremden, sie sind eben anders. Haben eben kein Gefühl.
Das Kind muss nicht operiert werden. Das andere ist außer Gefahr. Sie sitzt zwischen beiden Bettchen und weint. Jetzt.
LEA OBERMÜLLER
Der erste Schritt
Lao Tse hat mal gesagt: »Selbst der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt.« Nur stimmt das auch? Ist es nicht so, dass wir uns unseren eigenen Weg legen mit den Steinen, die uns gegeben werden? Die Frage ist, was wir daraus machen, nicht wie wir es machen.
Angefangen hat alles mit der Scheidung meiner Eltern vor 10 Jahren. Damals ist mein Vater nach Griechenland gezogen, auf das Grundstück, das meine Eltern zuvor gemeinsam gekauft hatten. Es liegt auf der Mani, dem mittleren Finger der Peloponnes. Wunderschön und riesengroß. Er baute dort mit seiner neuen Freundin und heutigen Frau ein großes Haus mit vielen Zimmern für die vielen Kinder. Claudia brachte zwei Kinder mit in die Beziehung. Meine beste Freundin Sophia und deren Bruder.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























