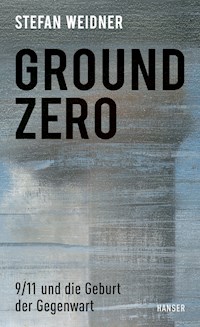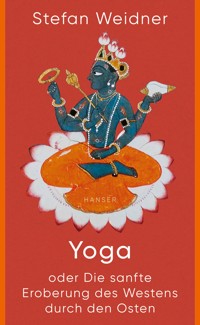
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein unbekanntes Kapitel Weltgeschichte: Yoga ist viel mehr als ein Weg zum Wohlbefinden. Morgens die Yogamatte auszurollen gehört für viele Menschen zur Routine. Ahnen sie, in welcher Tradition sie stehen? 2500 Jahre sind die ersten Yoga-Sutren alt, Anweisungen für eine spirituelle Praxis, die von Buddhismus und Hinduismus aufgegriffen wurde. Im Mittelalter von den Arabern wiederentdeckt, inspirierte sie auch Muslime, Christen und Juden zu einer mystischen Gotteserfahrung. Philosophen wie Schopenhauer entdeckten in der altindischen Lehre die Möglichkeit reiner Erkenntnis, im Kampf gegen die Kolonialherrschaft brachte sie das europäische Überlegenheitsgefühl ins Wanken. Stefan Weidner erzählt die Geschichte des Yoga als die sanfte Kraft des Ostens, die sich des Westens bemächtigt hat: ein Blick auf die Welt, der alle Grenzen überwindet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 485
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Ein unbekanntes Kapitel Weltgeschichte: Yoga ist viel mehr als ein Weg zum Wohlbefinden.Morgens die Yogamatte auszurollen gehört für viele Menschen zur Routine. Ahnen sie, in welcher Tradition sie stehen? 2500 Jahre sind die ersten Yoga-Sutren alt, Anweisungen für eine spirituelle Praxis, die von Buddhismus und Hinduismus aufgegriffen wurde. Im Mittelalter von den Arabern wiederentdeckt, inspirierte sie auch Muslime, Christen und Juden zu einer mystischen Gotteserfahrung. Philosophen wie Schopenhauer entdeckten in der altindischen Lehre die Möglichkeit reiner Erkenntnis, im Kampf gegen die Kolonialherrschaft brachte sie das europäische Überlegenheitsgefühl ins Wanken. Stefan Weidner erzählt die Geschichte des Yoga als die sanfte Kraft des Ostens, die sich des Westens bemächtigt hat: ein Blick auf die Welt, der alle Grenzen überwindet.
Stefan Weidner
Yoga
oder Die sanfte Eroberung des Westens durch den Osten
Hanser
Unser Verlangen nach Wahrheit, insbesondere nach Wahrheit über die Götter, ist eigentlich ein Streben nach Göttlichkeit; das Lernen und Suchen, worin es sich äußert, ist gleichsam das Übernehmen heiliger Güter, und diese Tätigkeit ist frömmer als jede Art von Enthaltsamkeit und Tempeldienst.1
Plutarch, Über Isis und Osiris, 1. Jahrhundert
Wenn wir an manchen Stellen bei einzelnen Gegenständen verweilen und uns in Probleme vertiefen, die mit dem Gang der Darstellung nur eine lose Beziehung aufweisen, so geschieht das nicht aus einem Hang zur Weitschweifigkeit und Ausführlichkeit. Vielmehr möchten wir die Lesenden von der Langeweile fernhalten; denn wenn die Untersuchung lange bei einem einzigen Gegenstand verweilt, führt das zum Überdruss und zur Ungeduld. Wechselt sie aber von einem Gebiet zum anderen, so befindet sich, wer meinen Text liest, in der Lage eines Menschen, der durch Gärten spazieren geht. Er hat kaum einen durchschritten, da taucht schon ein anderer vor ihm auf und erweckt die Neugier und das Verlangen, ihn auch zu sehen.2
Abu Rayhan al-Biruni, Überbleibsel vergangener Epochen
Prolog in Kalkutta
Belur Math, Kloster der Ramakrishna-Mission nördlich von Kalkutta, Dezember 2022: Ich ziehe mir die Schuhe aus, reihe mich in die Schlange ein und steige andächtig hinter den anderen Besuchern die Treppe hinauf. Ein schmaler Korridor führt in das Zimmer, in dem der Heilige mit dem Mönchsnamen Swami Vivekananda seine letzten Tage verbrachte. Dort stehen sein Bett und der Tisch, an dem er saß und schrieb.
Das Fenster gibt den Blick auf den großen Fluss frei, den Ganges, wie er an Kalkutta vorbei in den Indischen Ozean fließt. Ich sehe hinaus, und sogleich verliert alles andere an Bedeutung. Die Stimmen werden leise, das Gedränge stört mich nicht mehr, die Ärgernisse des Tages sind vergessen. Ich verliere mich im Fließen des Stroms. Eine abrupte, unerwartete Versenkung.
Am 4. Juli 1902, hier in diesem Raum, wusste der Heilige, dass es zu Ende ging. Er litt an der Zuckerkrankheit. Sein vierzigstes Lebensjahr würde er nicht mehr erreichen. Aber hatten diese vierzig nicht genügt? Was er erlebt, gesehen und geleistet hatte, reichte für viele Leben, auch für eins wie seines, eines der exzessiven Art. Wäre es nach ihm gegangen, hätte es ohnedies nie gereicht.
Ich versuche, mich in jenes Jahr 1902 zurückzuversetzen, und merke: Ich bin schon längst dort. Der Blick aus dem Fenster ist derselbe: Der Ganges fließt so gemächlich wie eh und je. Wer immer auf ihn blickt, für den steht die Zeit still. Gleich, was die Geschichte gebracht hat oder noch bringen wird, es zählt wenig: Treibholz, vorbeiziehende Äste, ein Wasservogel, der sich ein Stück weit dahintragen lässt. Es sind Nichtigkeiten, flüchtige Sinneseindrücke. Maya, ein Gaukelspiel, haben es die Inder genannt.
Ein paar Tage vor meinem Besuch in Vivekanandas Sterbezimmer im Kloster von Belur hatte ich in Kalkutta die Villa besucht, in der er geboren und aufgewachsen war. Doch der Vater verschuldete sich, musste ein Zimmer nach dem anderen vermieten, dann starb er. Das prächtige Haus lag im damals besten Viertel Kalkuttas, bis 1911 Hauptstadt von Britisch-Indien, nur einen Spaziergang vom schlossartigen Anwesen der Bankiersfamilie Tagore entfernt, heute ebenfalls ein Museum. Ein Nachkomme, Rabindranath Tagore, bekam 1913 als erster asiatischer Autor den Nobelpreis für Literatur. Er schrieb auf Bengalisch. Eines seiner Gedichte wurde nach der Unabhängigkeit zur indischen Nationalhymne. Ein anderes zu der des muslimisch geprägten Bangladesch.
Noch ein weiteres Museum liegt in diesem Viertel. Es ist Rammohan Roy gewidmet, einem 1833 verstorbenen Reformer und Aktivisten gegen die Witwenverbrennung. Die von ihm ins Leben gerufene »Gesellschaft der Gottgläubigen« wurde zum Vorbild für die Bewegungen, die Indien aus der kolonialen Apathie wachrütteln und in ein modernes, weltoffenes Land verwandeln wollten. Die Ramakrishna-Mission, die Vivekananda Ende des 19. Jahrhunderts gründete, zählt dazu. Mit Vivekanandas Vortragsreisen in den USA und Europa begann die weltweite Popularität des Yoga.
Sein Geburtshaus war bis vor Kurzem eine Ruine. Dann ließ es der indische Staat nach alten Plänen und Fotografien mit viel Geld restaurieren. Der weitläufige zweistöckige Gebäudekomplex verfügt über einen großen, lichten Innenhof. Die Zimmer sind klein und in traditioneller Art zum Hof hin ausgerichtet, dem heißen, feuchten Klima angepasst.1
Im heute heruntergekommenen Stadtteil wirkt das frisch renovierte Anwesen steril. Die Zimmer sind mit lebensgroßen Wachsfiguren ausstaffiert: Sie stellen Verwandte und Freunde des Heiligen dar. Auf Tafeln werden Anekdoten aus seiner Kindheit erzählt: dass er ein wilder, schwer erziehbarer Junge war. Dass er hochbegabt war und ein Ringer werden wollte. Dass er wunderbar singen konnte und Ramakrishna, sein späterer Guru, deswegen auf ihn aufmerksam wurde.
Als ich schon gehen will, entdecke ich die Ankündigung eines Animationsfilms.2 Dafür ist eigens ein hochmoderner Kinosaal in das Haus eingebaut worden. Am Eingang bekomme ich eine 3D-Brille ausgehändigt und wähle mir einen Platz mitten im leeren Saal. Kurz bevor das Licht ausgeht, drängt eine indische Schulklasse herein, und als der Film losgeht, sitze ich unter lauter indischen Teenagern. Vivekananda gilt in Indien als Nationalheld. Sein Bild und seine Büste sieht man in Kalkutta überall. Der Film ist ein inoffizieller Teil des staatlichen Erziehungsprogramms.
Nach dem Tod seines Gurus Ramakrishna1886 zog er drei Jahre kreuz und quer durch Indien. Wie Ramakrishna predigte er einen modernen, weltoffenen Hinduismus für alle. Yoga wurde zum Zauberwort, zur Chiffre für eine verjüngte, zeitgemäße indische Frömmigkeit. Sie sollte Indien erneuern und aus dem Würgegriff des Kolonialismus befreien. Zu diesem Zweck wollten die Ramakrishna-Jünger nicht nur in Indien missionieren, sondern auch den Westen für sich einnehmen, ihn zum neuen, zeitgemäßen Hinduismus bekehren. Das war der Anfang der sanften Eroberung des Westens durch den Osten, der weltweiten Verbreitung von Yoga. 1893 reiste Vivekananda nach Chicago, um auf dem Weltparlament der Religionen zu predigen. Das Religionsparlament gehörte zum Beiprogramm der »Columbiade«, der epochemachenden Weltausstellung im Rahmen des 400. Jahrestags der europäischen ›Entdeckung‹ Amerikas durch Kolumbus. Wenn man dem Zeichentrickfilm in seinem Geburtshaus und den Berichten der Zeitgenossen glauben darf, war Vivekanandas Auftritt in violetter Robe und mit leuchtend rotem Turban ein voller Erfolg. Sein Englisch war perfekt. Und er war ein charismatischer Redner.
»Schwestern und Brüder von Amerika«, spricht sein Avatar im Animationsfilm, »es erfüllt mein Herz mit unaussprechlicher Freude, auf das warme und herzliche Willkommen, das Sie uns gegeben haben, zu antworten. Ich danke Ihnen im Namen des ältesten Mönchsordens der Welt; ich danke Ihnen im Namen der Mutter der Religionen; und ich danke Ihnen im Namen von Abermillionen von Hindus aller Klassen und Glaubensgemeinschaften. […] Wir glauben nicht nur an die universale Toleranz, sondern wir erkennen alle Religionen als wahr an.«3 Das traf einen Nerv. Die Menschen im Saal stehen auf, applaudieren. Die Amerikaner im Film sind hin und weg.
Vivekananda, die Figur im roten Turban, zitiert einen Spruch des Gottes Krishna: »Wer auch zu mir kommen möge, in welcher Gestalt auch immer, den werde ich erreichen: Alle Menschen kämpfen sich auf verschiedenen Lebenswegen ab, die am Ende zu mir führen.«4 Laut Vivekananda besagt dies, dass es viele unterschiedliche Wege zum Heil gibt, dass sie aber am Ende alle zu Krishna führen, zur »Mutter aller Religionen«, nach Indien.
Swami Vivekananda vor dem Weltparlament der Religionen, Chicago 1893
Krishnas Worte stammen aus dem vierten Gesang der Bhagavad-Gita, einem der religiösen Grundtexte des alten Indien. Dort werden solche Lehrsprüche als »Yoga« bezeichnet. »Diesen uralten Yoga«, sagt Krishna im dritten Vers desselben Kapitels, »habe ich dir heute verkündet.«5 »Yoga« bedeutet in diesem Zusammenhang Lehre, Pfad, Methode, Haltung. Es ist ein mächtiges, geheim zu haltendes Wissen. Es ist das Wissen davon, wie man in der Welt wirkt und zugleich darübersteht; wie man mit der Welt fertigwird, ohne unter ihr leiden zu müssen. Yoga ist die Lehre von der richtigen Haltung zur Welt: äußerlich teilhabend, innerlich distanziert.
In diesem Sinn benutzt auch Vivekananda das Wort Yoga. Er verstand darunter keine Körpertechnik oder Leibesübung. Das konnte mit Yoga zwar auch gemeint sein. Zu den Meditationstechniken der indischen Asketen zählten seit alters her bestimmte Körperstellungen, »Asanas« (wörtlich »Sitze«). Doch nie wäre Vivekananda auf die Idee gekommen, dass ein Jahrhundert nach seinem Tod Millionen von Menschen überall auf der Welt sich solchen Exerzitien unterziehen könnten.
Yogis galten als Asketen und Fakire, die sich von der Gesellschaft abgewendet hatten. Ihre Posituren dienten dazu, sich abzuhärten und körperliche Disziplin anzutrainieren, Sinneseindrücke und leibliche Bedürfnisse zu unterdrücken und den Verlockungen der Welt zu entsagen. Manche Übungen liefen auf regelrechte Kasteiungen hinaus. Mit Yoga, wie es heute praktiziert wird, hatte das wenig zu tun, auch wenn einige der überlieferten Askese-Techniken zum Vorbild für heutige Yoga-Positionen geworden sind. Bei aufgeklärten, fortschrittlichen Indern wie Vivekananda hatten die Yogis noch Anfang des 20. Jahrhunderts einen schlechten Ruf. Sie galten als Scharlatane, Gaukler und Bettler.
Vivekananda meditierte regelmäßig. Er war diszipliniert, aber sah sich nicht als Fakir oder Yogi im herkömmlichen Sinn. Yoga als Leibesübung praktizierte er nicht, und er zog sich auch nicht dauerhaft in eine Einsiedelei oder einen Ashram zurück. Stattdessen wandte er sich der Gesellschaft zu, wollte in sie hineinwirken, um sie zum Besseren zu verändern. Es war ein Zwiespalt: einerseits über den Dingen stehen zu wollen, das Gespinst der gaukelhaften Erscheinungswelt, Maya, zu durchschauen. Andererseits aktiv in die Welt, in ebendieses Gespinst und Getriebe hineinwirken zu wollen, um Reformen anzustoßen, die Menschen aufzuklären, sie aus dem Elend zu führen und zu spiritueller Reife anzuleiten.
Die Lehren der Bhagavad-Gita, auf die Vivekananda sich in seinen Vorträgen über Yoga stützte, boten einen Ausweg. Sie zeigten auf, wie man beides vereinen könne, die Abkehr von der Welt hier, die Pflicht, in ihr zu wirken, da. Kurz gesagt bestand die Lösung darin, Innen und Außen zu trennen: Nach innen ist der Mensch frei, steht über der Welt. Nach außen wirkt er in ihr, gehorcht den Notwendigkeiten, handelt.
Heute wird Yoga oft so gesehen, als käme es direkt aus einer tiefen Vergangenheit, wie eine unberührte Wasserquelle oder ein überraschend wiedergefundener, vor Jahrtausenden vergrabener Schatz. Als wäre es mithilfe einer Zeitmaschine in unsere Gegenwart versetzt worden, ohne dass es sich im Lauf der Zeit verändert und verwandelt hätte. Viele Yoga-Anhänger glauben, Yoga gewähre Zugang zu einer unverfälschten, uralten Weisheit und spirituellen Kraft. So klang es schon bei Vivekananda an, als er in Chicago sagte, er spräche »im Namen des ältesten Mönchsordens der Welt«.
Solche Behauptungen machen neugierig und laden dazu ein, einen frischen, historisch informierten Blick auf Yoga zu werfen. Dann wird klar, dass die asketischen Strömungen Indiens und andere Lehren von einem weltabgewandten Leben sich seit jeher wechselseitig befruchteten; dass sie sich mit ähnlichen Überlieferungen, vor allem aus dem Mittelmeerraum und aus der islamischen Welt, vermischten. Sie wanderten durch Zeiten und Länder, wechselten gelegentlich auch den Namen und die Religion. Mal hießen ihre Anhänger Yogis, mal Mönche, mal Derwische, mal Fakire. Was sie dachten und glaubten, war universell, keiner bestimmten Kultur, keinem Land, keiner Religion allein zugehörig. Wir haben das heute nur vergessen.
Betrachten wir Yoga in seiner Geschichtlichkeit, zeigt es sich als weit mehr als eine körperliche oder spirituelle Technik. Es erweist sich als politisch kluge, zumeist gewaltfreie Antwort auf übergriffige Machthaber, auf rücksichtslose Eroberungen und auf den Kolonialismus. Bereits Alexander dem Großen zeigten die Yogis die kalte Schulter, als er mit seinem Heer den Indus überquerte und den Wunsch äußerte, mit ihnen zu sprechen. Das im 19. Jahrhundert neu erwachte Interesse an Yoga hängt mit dem Aufbegehren gegen den britischen Kolonialismus ebenso zusammen wie mit dem Kampf gegen die Sklaverei in den USA.
Von den vielfältigen Versuchen der kolonisierten Völker, im Westen für sich und ihre Traditionen, Werte und Leistungen zu werben, war Yoga am erfolgreichsten; viel erfolgreicher als zum Beispiel der Islam. So verwestlicht Yoga in mancher Hinsicht ist, es bleibt damit ein Sinnbild für die Attraktivität alternativer, nichtwestlicher Lebens- und Denkweisen. Und sollte es stimmen, dass die Welt in eine bedrohliche Sackgasse geraten ist, darf man in Yoga mit seiner Betonung immaterieller Werte und geistiger Disziplin den vernünftigen Versuch sehen, einen Ausweg aus dieser Sackgasse zu finden.
Schließlich verbinden sich mit Yoga die unglaublichsten Geschichten. Sie reichen von der Antike über die muslimische Herrschaft in Indien bis zum Ende der Kolonialzeit. Von dort führen sie mitten in unsere Gegenwart, ja in die Zukunft. Kaum jemand weiß davon, und niemand hat sie je zusammenhängend erzählt.
Versuchen wir es!
Erster Teil
Yoga und die Philosophie
Erstes Kapitel
Ekstatische Konfessionen
Aus Amerika kommend, besuchte Vivekananda zwischen zwei Aufenthalten in London, wo er eine vielbeachtete Rede über Maya und die Freiheit hielt, 1896 auch Deutschland. Dort verbrachte er einige Zeit mit Paul Deussen, Indologe und seinerzeit ein berühmter Philosoph in Kiel. Er hatte die altindischen Lehrgespräche der Upanischaden aus dem Sanskrit ins Deutsche übersetzt und sich unter dem Einfluss Nietzsches, seines Freundes aus Schulzeiten, der Philosophie Schopenhauers verschrieben.
Deussen begleitete den indischen Gast zurück nach London. Sein Bericht über Vivekananda ist wenig schmeichelhaft, ja rassistisch. Man habe den Mönch, schrieb der deutsche Professor in seinen Lebenserinnerungen, »als Probe eines indischen Heiligen zur Ausstellung nach Chicago kommen lassen. […] Wohl oder übel musste ich mit dem braunen Bruder aus dem Osten dasselbe Zimmer teilen, nicht ohne Bedenken, da mir von meiner indischen Reise her die Lebensgewohnheiten der Inder noch wohl bekannt waren.«1 Besonders stieß Deussen auf, dass Vivekananda rauchte, was nicht zu seinen Vorstellungen von einem indischen Mönch zu passen schien:
Als ich mit dem heiligen Mann mein Zimmer bezogen hatte, um schlafen zu gehen, war sein Erstes, dass er seine kurze englische Stummelpfeife ansteckte, und es blieb mir nichts übrig, als Tür und Fenster aufzureißen und ihm eine kleine Vorlesung zu halten über die Schädlichkeit, in einem raucherfüllten Zimmer zu schlafen. Er sprach sehr gut Sanskrit und ebenso gut Englisch, war von lebhaftem, gewandtem, etwas stürmischem Wesen, ein junger Mann, strotzend von Gesundheit, mit vollen rosigen Wangen, sehr verschieden von dem, wie wir uns einen Heiligen vorstellen.2
In England traf Vivekananda Max Müller, den in Oxford lehrenden Großmeister der Indologie des 19. Jahrhunderts. »Einen Heiligen« nannte der Inder den Deutschen.3 Sie verstanden sich bestens und hatten schon seit einiger Zeit Briefe gewechselt. Vivekananda war der Gewährsmann für Max Müllers Buch über seinen Guru Ramakrishna.4 Es machte die beiden in den gelehrten Kreisen Europas erstmals bekannt. Ramakrishna, der 1886 in Kalkutta gestorben war, und sein Schüler Vivekananda wurden so auf dem alten Kontinent zum Inbegriff der Hindu-Renaissance, ja der Vorstellung vom ununterbrochenen Fortleben der alten indischen Weisheit. Erste Bücher von Vivekananda erschienen bereits 1901 auf Deutsch.5 In Gestalt von Ramakrishna, schrieb Martin Buber wenige Jahre später, habe »sich das ganze Indertum in unseren Tagen noch einmal offenbart«.6
Martin Buber, der führende deutsch-jüdische Intellektuelle seiner Zeit, übersetzte die von Vivekananda überlieferten und von Max Müller ins Englische übertragenen Sprüche Ramakrishnas erstmalig ins Deutsche. Sie fanden Eingang in die von ihm 1909 publizierten Ekstatischen Konfessionen, eine Sammlung von Zeugnissen religiöser Mystiker und Ekstatiker. Eine ganze Generation deutschsprachiger Schriftsteller und Intellektueller wurde durch dieses Buch an die Mystik herangeführt, nicht zuletzt die außereuropäische.
Friedrich Nietzsche hatte die bürgerliche Kultur seiner Zeit, den blinden Fortschrittsglauben und die mangelnde Intensität des modernen Lebens aufgespießt. Karl Marx hatte die Industrialisierung als Entfremdung gedeutet, und der Soziologe Max Weber sprach wenig später von der Entzauberung der Welt. Martin Buber, aber auch seine jüdischen Freunde, Schüler und Konkurrenten wie Walter Benjamin, Gustav Landauer, Theodor Lessing, Gerhard Scholem, Franz Rosenzweig waren von diesen Diagnosen ebenso geprägt wie ihre nichtjüdischen Zeitgenossen.
Als Minderheit fühlten sich die Juden selbst oft entfremdet und heimatlos. Viele von ihnen zählten zur kulturellen und intellektuellen Avantgarde, häufig ohne dass ihr Judentum dabei eine nennenswerte Rolle spielte. Ihr Anliegen war größer, richtete sich auf die Gesellschaft insgesamt. Sie verleugneten ihre jüdische Herkunft nicht, sie wollten sie jedoch überschreiten, ihre spezifischen Erfahrungen in den größeren gesellschaftlichen Zusammenhang einbringen. Das geschah in der Hoffnung, die ethnische und religiöse Verengung, die der Nationalstaat mit sich gebracht hatte, zu überwinden und das Gemeinwesen inklusiver zu denken. Nämlich so, dass darin auch für Juden und andere Platz war.
Bubers Anthologie ist ein gutes Beispiel für diese Tendenz. Sie versammelt indische, muslimische, antike und christliche Mystik, aber keine jüdischen Beiträge, von zwei unscheinbaren Seiten im Anhang abgesehen. Das ist umso auffälliger, als Buber sich um die Vermittlung ostjüdischer Lebensweisheit und Religiosität besonders verdient gemacht hatte. 1872 in Wien geboren und im galizischen, heute ukrainischen Lemberg (Lviv) bei seinem Großvater aufgewachsen, einem der angesehensten jüdischen Religionsgelehrten seiner Zeit, war er für die Rolle des Vermittlers zwischen jüdischen und deutschen Lebenswelten prädestiniert.
Aber darum ging es ihm nicht. Er wollte Größeres, wie im indischen Kontext auch Vivekananda. Wie dieser begeisterte sich Buber für das existenzielle, alle Menschen und Kulturen betreffende Potenzial religiöser Ekstase. Gemäß der damaligen Vorstellung wies sie zu allen Zeiten und in allen Regionen, Kulturen und Sprachen beträchtliche Ähnlichkeiten auf. Sie war der gemeinsame spirituelle Nenner der Menschheit, unabhängig von religiösen Unterschieden im Detail. Beispielhaft dafür ist der folgende Ausspruch von Ramakrishna, überliefert von Vivekananda, aufgezeichnet von Max Müller, übersetzt von Martin Buber:
Ein Sannyâsin (Asket) konnte Râmakrishnas Liebe zu seiner Mutter (der Göttin [Kali]) nicht verstehen. Er redete davon als von bloßem Aberglauben und spottete darüber. Da gab ihm Râmakrishna zu verstehen, dass es in dem Absoluten kein Du, kein Ich, keinen Gott gebe, dass es über allem Sprechen und Denken sei. […] und dieses allwissende, allgemeine Bewusstsein sei für ihn seine Mutter und Gott …7
Vivekananda ist der einzige Zeitgenosse, den Buber in seinem Buch zitiert.8 Die Ekstatischen Konfessionen beginnen sogar in Indien — mit dem Gespräch zwischen einem muslimisch Fürsten und einem Yogi, Baba Lal. Der Name des Fürsten aus der Dynastie der Mogulen ist Dara Shikoh. Er lebte im 17. Jahrhundert in Delhi, und wir werden von ihm noch hören. Kam Buber auf Indien, weil es gerade Mode war? Oder gab es tiefere Zusammenhänge?
Seine spätere Frau, Paula Winkler (1877—1958), redete ihren Verlobten in ihrer Korrespondenz regelmäßig mit dem Spitznamen »Mougli« an9 — nach dem Protagonisten des Dschungelbuchs von Rudyard Kipling, Mogli (englisch Mowgli). Offenbar hatten die beiden zusammen die deutsche Übersetzung gelesen. Buber als Mogli, ein Menschenkind unter wilden Tieren? Dazu gäbe es viel zu sagen. Doch bleiben wir bei Paula. Sie sei »unheimlich gescheit und herrischen Willens«, schrieb der Philosoph und Publizist Theodor Lessing über sie.10 Er kannte sie früher als Buber.
Paula Winkler wurde unter dem Pseudonym Georg Munk eine anerkannte Schriftstellerin. Sie hat an vielen Büchern ihres Mannes mitgeschrieben, zum Beispiel an den Legenden des Rabbi Nachman und anderen seiner chassidischen Erzählungen. Und ohne sie wäre Buber nicht auf die Idee gekommen, die Ekstatischen Konfessionen ausgerechnet mit zwei Texten aus Indien zu beginnen. Aus dem Briefwechsel lässt sich schließen, dass es Paula Winkler war, die Martin Buber mit indischen Themen bekannt machte.
Als sich die beiden 1899 an der Universität Zürich kennenlernten, hatte die 22-Jährige bereits eine bewegte Vergangenheit. Die Mutter war früh gestorben, mit ihrem Vater lag sie im Streit, und sie arbeitete in München als Sekretärin für die berühmte Schriftstellerin Helene Böhlau und ihren geheimnisvollen Mann. Fast eine Generation älter als Paula, dürfte sich Böhlau in der jungen Frau wiedererkannt haben, denn beide hatten eine ähnliche Geschichte. Helene, Tochter einer berühmten Weimarer Verlegerfamilie, hatte sich ebenfalls mit ihrer Familie überworfen und war geflohen — nach Istanbul!
Helene hatte in Weimar den aus dem russischen Reich zugezogenen, staatenlosen Friedrich Arnd (1839—1911) und dessen Familie kennengelernt. Er kam ebenfalls aus der Verlagsbranche, aber eigentlich verstand er sich als Schriftsteller und Philosoph — ein Autor ohne Werk, sieht man von einem in Weimar kurzzeitig erfolgreichen Theaterstück ab. Arnds Wirkung lag in seiner persönlichen Ausstrahlung, seiner unkonventionellen, unverstellten Art. Er hatte das Zeug zum Guru. Wollte man wissen, was er lehrte, musste man sich ihm anvertrauen. Helene Böhlau wurde seine Schülerin. Er förderte ihre schriftstellerische Neigung, und sie wurde seine Geliebte — ein Skandal im beschaulichen Weimar der späten 1870er-Jahre.
Arnds Frau weigerte sich, in eine Scheidung einzuwilligen, die Situation schien ausweglos. Aber nur fast. Denn Friedrich verfällt auf die wahnwitzige Idee, nach Istanbul zu reisen, dort zum Islam überzutreten und Helene zu heiraten. Im Islam ist, glaubt man zu wissen, die Vielehe erlaubt. Tatsächlich fährt er nach Istanbul, Helene reist ihm nach, sie heiraten und bleiben zunächst am Bosporus. Der konvertierte Arnd nennt sich fortan Omar al Raschid Bey — Omar in Anlehnung an den persischen Dichter und Forscher Omar Chayyam, der seinerzeit auch in Europa sehr populär war.
Es gibt ein Buch von ihm unter seinem neuen Namen mit dem Titel Das Hohe Ziel der Erkenntnis. Die schmale, hermetische Schrift wurde erst nach seinem Tod 1911 von Helene publiziert. Es ist eines der eigenartigsten Bücher der deutschen Literatur — und neben Hermann HessesSiddharta sicher das indischste. Yogis wie Ramakrishna hätten ihren Standpunkt nicht besser ausdrücken können als Omar al Raschid Bey:
Wer sein Heil im ›Ich‹ sucht, dem ist Selbstsucht Gebot, dem ist Selbstsucht Gottheit. Wer sein Heil in dieser Welt sucht, der bleibt dieser Welt verfallen; dem ist kein Entrinnen aus ungestilltem Verlangen; dem ist kein Entrinnen aus nichtigem Spiel; dem ist kein Entrinnen aus den engen Fesseln des ›Ich‹. Wer sich aus dieser Welt nicht erhebt, der lebt und vergeht mit seiner Welt.11
Das Zeug zum Guru hatte Friedrich alias Omar zwar schon vor seiner Zeit in Istanbul; aber bis dahin keine eigene Botschaft, keine Mission. Die fand er am Bosporus. Das ungewöhnliche Paar wohnte im Viertel Aksaray, das noch heute von Moscheen, Medressen und Klöstern aus osmanischer Zeit geprägt ist. In Aksaray lag auch das sogenannte »Kloster der Inder« (Hindiler Tekkesi).
Omar al Raschid Bey, um 1895
Anders als man vermuten würde, hatte das Kloster der Inder nichts mit dem Hinduismus zu tun. Es war ein muslimisches Kloster, eine Tekke, also ein Versammlungsort und eine Schlafgelegenheit für Sufis, Wanderderwische und andere religiös motivierte Reisende. »Kloster der Inder« hieß es, weil es Mekkapilgern aus Indien als Durchgangsstation diente. Britisch-Indien war damals das Land mit den meisten Muslimen auf der Welt. Wer den Landweg nahm, reiste nicht selten über Istanbul. So sah man nicht nur Mekka, sondern auch andere altehrwürdige Orte wie die Stadt am Bosporus, wo der osmanische Sultan als Kalif und Beherrscher der Gläubigen residierte.
Gleich vielen anderen Moscheen und religiösen Bauwerken wurde auch das »Kloster der Inder« von einer sufischen Bruderschaft, einem Derwischorden geleitet. Wie der indische Islam insgesamt waren diese Orden stark von der Theosophie des mittelalterlichen arabischen Mystikers Ibn Arabi geprägt. Sie beeinflusste in Istanbul nun auch Omar al Raschid Bey und verschmolz mit seinem Interesse für die Upanischaden und andere hinduistische Glaubenssysteme, die in jener Zeit bekannt wurden.
»Haben Sie die blinden Bettler an den Moscheen gesehen, haben Sie sie singen hören?«, lässt Böhlau in ihrem noch heute lesenswerten Roman unter anderm über die Zeit in Istanbul, Isebies (1911), einen ihrer türkischen Freunde fragen. Dann berichtet er, was diese vor sich hinmurmeln: »Gläubige, ich tat die Augen zu, um die Welt nicht zu sehen. Schließt eure Augen! Hört mich, Gläubige! Besser, du verlierst das Augenlicht, als du siehst die Verlockung der Welt und liebst sie. […] Gläubige, gebt dem Blinden eine Gabe.«12 Der Freund ergänzt und erläutert seine Übersetzung mit folgenden Worten:
Was meinen Sie, — unter diesen Bettlern sind manche einst Reiche und Mächtige. Ja, wir verstehen es, die Bürde dieser Erde von uns zu werfen, wir wissen, was Freiheit ist. — Buddha, der Königssohn, den kennen Sie doch; — und so dich dein Auge ärgert, reiße es aus und wirf es von dir, — das predigt Ihr!13 Wir aber tun es, — wir auch sprachen es aus! Wir sind die Augenausreißer, — wir sind die Trunkenen ohne Wein, — wir sind die Seher ohne Blick, wir sind die Seligen ohne Seligkeiten, die Gottsucher — und die Weltflieher.14
Schopenhauer, die Yogis und die Sufis hätten an dieser Weisheit ihre Freude gehabt! In der altindischen Bhagavad-Gita wird der Rückzug der Sinne aus der Außenwelt mit einer Schildkröte verglichen, die ihre Glieder einzieht.15 Und in einer kanonischen Schrift über Hatha-Yoga aus dem indischen Mittelalter heißt es über die dort beschriebenen Übungen, dass sie den Yogi »instand [setzen], die sichtbare Welt zu vernichten«.16
Omar al Raschid Bey fand in Istanbul zu seiner aus vielen Quellen gespeisten, spirituellen Philosophie und vermittelte sie in die blühende Münchener Bohème jener Zeit. Nach ihrer Rückkehr Anfang der 1890er-Jahre ließen sich Helene und Omar im Münchener Stadtteil Schwabing nieder, in unmittelbarer Nachbarschaft von Stefan George, den Brüdern Heinrich und Thomas Mann, Max Scheler, Franziska von Reventlow und vieler anderer Größen jener Zeit. Helene war inzwischen eine erfolgreiche Schriftstellerin geworden und konnte die Familie mit ihrer Arbeit ernähren.
In diesen Kreisen bewegte sich nun auch die junge Paula Winkler, die spätere Frau Buber, alias Georg Munk, denn sie arbeitete ja für die Familie Böhlau-al Raschid. 1898 verbrachten die Literaten mit Freunden einige Monate in Klausen in Südtirol, um zu schreiben, zu wandern, nachzudenken, zu diskutieren, sich zu lieben und zu streiten. Paula, allein mit dem herrischen Vater in München zurückgeblieben, fiel die Decke auf den Kopf, als ihre bewunderten, unkonventionellen Arbeitgeber die Stadt verlassen hatten. Sie sagte ihrem Vater Lebewohl und stieß zur Gruppe in Südtirol.17
Dort entwickelte sich zwischen Paula und Omar ein ähnliches Verhältnis wie zuvor in Weimar zwischen ihm, damals noch Friedrich Arnd genannt, und Helene. Helene, alternativen Lebensentwürfen und weiblicher Selbstbestimmung gegenüber aufgeschlossen, schien die Liaison zu dulden. Doch dann flohen Omar und Paula gemeinsam nach Zürich, so wie Helene mit Friedrich Arnd, alias Omar, einige Jahre zuvor nach Istanbul geflohen war.
Zürich wählten sie, weil die dortige Universtität eine der wenigen war, wo Frauen studieren durften. Auf Omars Anregung hin sollte sich Paula für indische Philosophie und asiatische Sprachen einschreiben. Da trat Omars bester Freund, der Schriftsteller Theodor Lessing, auf den Plan. Er reiste dem Verführer nach, redete ihm ins Gewissen und überzeugte ihn, zu Helene zurückzukehren.
Damit Paula, die den Kontakt mit dem Vater abgebrochen hatte, ihr Studium finanzieren konnte, legten die Schwabinger Freunde Geld zusammen. Omar kehrte mit Theodor zu seiner Frau nach München zurück, und Paula, die nun ihre eigenen schriftstellerischen Pläne entwickelte, schrieb sich in Zürich für Germanistik ein. Dort lernte sie den ein Jahr jüngeren Martin Buber kennen, ihren späteren Mann.
Eine wilde Zeit, eine wilde Geschichte.
Im Kreis der Münchener Künstler, der Paula Buber prägte, interessierten sich vor allem Omar al Raschid und Theodor Lessing für außereuropäische Philosophie. Der 33 Jahre ältere Omar hatte sich dank seines Aufenthalts in Istanbul intensiver damit auseinandergesetzt als Lessing.
Aber Lessing erwies sich als der produktivere der beiden, mit sprudelnder Beredsamkeit gesegnet. Wie ein Schwamm verstand er es, alles, was ihm begegnete, aufzusaugen, es sich anzuverwandeln und in Form von provokanten, witzigen, tiefsinnigen, tragischen, sarkastischen Schriften wieder abzugeben. Omar hinterließ außer dem Kriemhild-Trauerspiel nur ein einziges, dürres, rätselhaftes Buch, Das hohe Ziel der Erkenntnis. Lessing publizierte so viel, dass heute kaum jemand mehr sein Werk überblickt.
Martin Buber wiederum ging mit dem außereuropäischen Einfluss, den Omar in den Münchener Freundeskreis getragen hatte, am kreativsten um. Er integrierte die alten orientalisch-indischen Lehren als kritisch reflektierte Gegenposition in sein eigenes Gedankengebäude, vor allem in sein poetisch-philosophisches Hauptwerk Ich und Du. Bei Lessing hingegen artikulierte sich Omars Einfluss am lautesten, politischsten, radikalsten. Er zählte zur seltenen Spezies freier, unbestechlicher Geister, nahm auf niemanden Rücksicht, schrieb, wie ihm das Maul gewachsen war.
Wie Buber jüdischer Herkunft, stellte er sich gegen seine Zeit und, wie könnte es anders sein, gegen das wilhelminische Deutschland; seit 1914 zunehmend verzweifelt. Lessing protestierte als einer von wenigen deutschen Autoren schon lautstark gegen den Krieg, als Buber und andere darin noch eine Chance für die Integration der Juden und weitere positive Effekte sahen. Lessing hingegen zog aus den Ereignissen Schlüsse, die so radikal sind, dass sie sogar den Postkolonialismus unserer Tage alt aussehen lassen:
Gegenwärtig gibt es für die ganze Erde nur eine einzige, wirkliche Gefahr, das ist die weiße Gefahr. Wer das erkennt, muss fordern: Die Vermehrung der weißen Rasse muss unbedingt eingeschränkt werden. […] Die zweite Forderung ist: rückläufige Kolonisierung, colonisation retroverse. Was heißt das? Es ist notwendig, dass Amerika und Europa endlich missionarisiert werden. Zunächst sollen die farbigen Völker ihre fähigsten jungen Menschen hierher schicken, nicht nur, damit sie lernen, wie man Dampfmaschinen baut, Turbinen anlegt, Radio und Elektrizität ausnutzt — nein, Inder, Chinesen, Perser, afrikanische Völker sollen als Lehrer kommen und den ganzen abscheulichen Hochmut des weißen Kulturkreises brechen. Denn was wissen die Menschen voneinander? Gar nichts!18
Was sich damals, in den Zwanzigerjahren des 20. Jahrhunderts, wild, ja abstrus ausgenommen haben dürfte, ist hundert Jahre später, in unserer Epoche, eingetreten. Lessings Forderung, »dass Amerika und Europa endlich missionarisiert werden«, war aber bereits zu seiner Zeit in die Tat umgesetzt worden, und zwar von Vivekananda, seiner Ramakrishna-Mission und allen späteren Yoga-Lehrerinnen und -Lehrern bis heute. Vivekananda und die Seinen haben den »abscheulichen Hochmut des weißen Kulturkreises«, den Lessing konstatiert, tatsächlich gebrochen. Aber nicht nur Inder leisteten einen Beitrag zu dieser Gegenmissionierung. Auch viele Muslime und Juden — wie Lessing und Buber — haben mit ihrem Werk dazu beigetragen.
Das ist nicht verwunderlich. Denn der »abscheuliche Hochmut« hat nicht nur Rassismus und Kolonialismus hervorgebracht, sondern auch den Antisemitismus. Als überhebliche Haltung zur Welt und zu ›anderen‹ Menschen hängen Kolonialismus, Rassismus und Antisemitismus eng miteinander zusammen. Indem sich die jüdischen Intellektuellen in Deutschland, und zwar konsequenter und intensiver als die nichtjüdischen Deutschen, für außereuropäische Zivilisationen und die darin angelegten kosmopolitischen Haltungen interessierten, trugen sie ihrer eigenen Situation Rechnung. Sie hatten einen Weitblick, der bis heute seinesgleichen sucht.
Vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum Buber seine Sammlung »ekstatischer Konfessionen« mit indischen und muslimischen Texten beginnt, ja sogar mit einem indisch-muslimischen, nämlich dem Gespräch des (muslimischen) Mogul-Fürsten Dara Shikoh mit dem hinduistischen Asketen Baba Lal, eine Frucht der muslimisch-indischen Synthese der Mogulzeit, die Buber ebenso wie viele andere inspirierte.
Auch Buber selbst legt ein ›mystisches‹ oder ›ekstatisches‹ Bekenntnis ab. »Der Ekstatiker«, schreibt Buber am Ende seines Vorworts,
will die Einheit ohne Vielheit zur Einheit aller Vielheit machen. Der Gedanke an den großen Mythos erwacht, der durch die Zeiten der Menschheit geht: von der Einheit, die zur Vielheit wird, weil sie schauen und geschaut werden, erkennen und erkannt werden, lieben und geliebt werden will, und, selber Einheit bleibend, sich als Vielheit umfasst; von dem Ich, das ein Du zeugt; von dem Urselbst, das sich zur Welt, von der Gottheit, die sich zum Gotte wandelt. Ist der Mythos, den Veden und Upanischaden, Midrasch und Kabbala, Platon und Jesus kündeten, nicht das Sinnbild dessen, was der Ekstatiker erlebt?19
Was unter dem »großen Mythos« zu verstehen ist, werden wir sehen. Die Vorstellung davon hatte Buber über seine Frau Paula und deren vormaligen Geliebten und Guru Omar al Raschid Bey vermittelt bekommen.
Die sanfte Eroberung, die »Missionarisierung« Amerikas und Europas, wie Theodor Lessing es nannte, war bereits vor dem Ersten Weltkrieg in vollem Gang. Die Schwabinger Intellektuellen, gleich ob Juden, Christen oder Muslime wie der konvertierte Omar, trugen — mal leiser, mal lauter — mit ihrem Werk dazu bei. Ob bewusst oder nicht, reihten sie sich in eine mehr als zweitausendjährige Tradition ein, hatten ihren Anteil am »großen Mythos«.
Um diesem Mythos auf die Spur zu kommen, müssen wir nun ebenfalls nach Istanbul reisen, müssen in zerfallenden arabischen Handschriften blättern, die uns von Indien erzählen, wie es einst war, von Aristoteles, von seinem Schüler Alexander dem Großen und von den Gymnosophen, den »nackten Weisen«. So nannten die alten Griechen — die Yogis!
Zweites Kapitel
Die Entdeckung der Yoga-Sutren in Istanbul
Zwei Jahre vor dem Beginn des Ersten Weltkriegs, als die Philosophie des Yoga schon überall von sich reden machte, stieß der gläubige Katholik und Islamwissenschaftler Louis Massignon (1883—1962) bei Studien in der Köprülü-Bibliothek in Istanbul auf ein verschollenes, seit achthundert Jahren lediglich als Gerücht bekanntes Manuskript.
Es gab an heißen, schwülen Sommertagen am Bosporus keinen besseren, kühleren Arbeitsplatz als das dicke Gemäuer des alten Lesesaals dieser Bibliothek. Sie liegt nur einen Spaziergang vom Stadtteil Aksaray entfernt, wo zwei Jahrzehnte vorher Helene Böhlau und Omar al Raschid Bey gewohnt hatten. Die Bibliothek war im 17. Jahrhundert von der Großwesirsdynastie der Köprülüs als erste öffentliche Bücherei im Osmanischen Reich gegründet worden. Heute ist der einstige Lesesaal eine Ruine, an der die Touristen auf dem Weg zur Hagia Sophia achtlos vorübergehen.
Massignon beschäftigte sich an jenem Tag mit einem Codex aus 433 vergilbten, vom Wurmfraß durchlöcherten Seiten. Das Konvolut stammt vom Ende des 8. Jahrhunderts muslimischer, des 14. Jahrhunderts christlicher Zeitrechnung und ist im iranischen Schiras, der Heimatstadt des großen persischen Dichters Hafis, noch zu dessen Lebzeiten geschrieben und zusammengebunden worden. Laut dem Bibliothekskatalog enthält die Sammelhandschrift religiöse Literatur auf Persisch. Massignon studierte sie, weil er sich für die islamische Mystik interessierte, den Sufismus. Er arbeitete an seinem ersten großen Buch, dem »Versuch über die Ursprünge der mystischen Terminologie der Muslime«.1
Louis Massignon
Besonders fesselte ihn die Lebensgeschichte von al-Hussain ibn Mansur al-Halladj, der im 10. Jahrhundert in Bagdad zu Ruhm gelangt war, weil er sich als eine Art neuer Messias stilisierte. Ebenso wortgewandt wie charismatisch, dabei radikal in seinen asketischen Praktiken, hatte er im Lauf der Zeit eine große Gefolgschaft erlangt und sich viele Feinde geschaffen. Seine Anhänger schrieben ihm Wundertaten zu. Die Gebildeten bezweifelten das, und die Strenggläubigen hielten es für Ketzerei: Nicht einmal der Prophet Mohammed hatte Wunder vollbracht!
Außerdem sagte man ihm nach, er habe seine Kunststücke von Ungläubigen gelernt, nämlich in Indien. Seine Anhänger rechtfertigten ihn: Er habe aus Indien lediglich die weiße Magie mitgebracht, und das auch nur, um neue Gläubige für den Islam zu gewinnen. Ein Zauberer sei er nicht. Als »weiße Magie« galten die akrobatisch-asketischen Fähigkeiten, für die die Inder seit der Antike berühmt waren. Dazu zählten die Selbstkasteiungen der Yogis, die tagelang nackt in unerträglichen Posen in der Sonne ausharrten. Schon der griechische Geograf Strabo aus dem 1. Jahrhundert hatte von ihnen berichtet. Die arabischen Reiseschriftsteller späterer Zeit übernahmen diese Geschichten und ergänzten sie um das, was sie mit eigenen Augen sahen.
Nach seiner brutalen Hinrichtung im Jahr 922 wurde al-Halladj zum Helden frommer Legenden. Fast alle Muslime kennen den Ausspruch, den er in mystischer Ekstase getan haben soll: »Ich bin die Wahrheit« (auf Arabisch: ana al-haqq). Das arabische Wort für »Wahrheit« (haqq) gilt den Muslimen als einer der neunundneunzig sogenannten »schönen Namen« Gottes. Folglich hat al-Halladj in seiner Ekstase etwas ganz und gar Ungeheuerliches geäußert: »Ich bin Gott!!«
Damit war sein Schicksal besiegelt. In den zu jener Zeit entbrannten Kämpfen der Bagdader Eliten um die Macht wurde der volksnahe, charismatische Mystiker zum Faustpfand, zur Verhandlungsmasse. Viele Jahre verbrachte er im Kerker. Nach seiner Gefangennahme soll sich Folgendes zugetragen haben, wie in den Legenden berichtet wird:
In der ersten Nacht seiner Inhaftierung kamen die Wärter zu seiner Zelle, konnten ihn aber nicht finden, weder in seiner Zelle noch anderswo. Als sie in der zweiten Nacht erneut nach ihm suchten, fanden sie ihn ebenfalls nicht. Aber nicht nur das. Obwohl sie die ganze Stadt absuchten, fanden sie nicht einmal mehr das Gefängnis. In der dritten Nacht dann fanden sie alles wieder: das Gefängnis und al-Halladj in seiner Zelle. ›Wo warst du in der ersten Nacht? Und wo waren du und das Gefängnis in der zweiten Nacht?‹, fragten sie den Mystiker.
›In der ersten Nacht‹, antwortete er, ›befand ich mich in der Gegenwart Gottes, deshalb war ich nicht hier. In der zweiten Nacht befand sich die Gegenwart Gottes hier bei mir im Gefängnis, sodass wir beide abwesend waren. In der dritten Nacht wurde ich von Gott wieder zurückgeschickt, damit dem Gesetz Genüge getan wird und ihr die Strafe vollziehen könnt. Kommt herein und tut euer Werk!‹2
Im Jahr 309/922 wurde al-Halladj schließlich hingerichtet. Als er zum Schafott geführt wurde, so heißt es, habe ihm die aufgepeitschte Masse zugerufen, er solle die letzte Gelegenheit nutzen, um seinen Spruch »Ich bin die Wahrheit« zurückzunehmen und stattdessen das zu sagen, was sich gehört, nämlich: »ER, Gott, ist die Wahrheit.«
Al-Halladjs Antwort darauf bestand aus einer neuen, diesmal pantheistischen Provokation: »Ja, ER ist alles!« Dann fügte er erläuternd hinzu: »Ihr habt behauptet, dass Gott in meinem Ausspruch ›Ich bin die Wahrheit‹ untergegangen ist. Aber das Gegenteil ist der Fall gewesen: Es war al-Halladj, der dabei in Gott untergegangen ist. Wie könnte das Meer selbst untergehen oder weniger werden?«
Die Zuschauer verstehen den Vergleich nicht und wenden sich an einen Sufi, der unter sie geraten ist: »Diese Worte, die Halladj gesprochen hat, haben eine verborgene Bedeutung. Was sollen wir davon halten?« Aus Angst, seinerseits gelyncht zu werden, verleugnet der Sufi seine wahre Überzeugung und antwortet: »Im Zweifel für die Orthodoxie! Er soll getötet werden; das ist nicht die Zeit für verborgene Bedeutungen.«3
Massignon war von diesen Legenden fasziniert und trug sie akribisch zusammen. Aber er war auch überzeugt: Ekstase und Mystik, verstanden als Ahnung vom Göttlichen, Übernatürlichen, Metaphysischen, sind keine Märchen, sondern lassen sich, eine gewisse Disposition und Disziplin vorausgesetzt, regelrecht erlernen. Was Sufis und Yogis erstrebten, war folglich keine Zauberei, sondern entsprach dem, was Sigmund Freud später das »ozeanische Gefühl« nannte — nicht ohne zu betonen, dass ihm, Freud persönlich, eine solche Verschmelzung mit der ganzen Schöpfung, bei der das Ich untergeht, fremd sei, ja dass er sie für eine Form der Einbildung, wenn nicht für eine psychische Störung halte.4 Die Sufis nannten dieses Erlebnis schlicht Gottesnähe. Ihr Ziel bestand darin, von den individuellen Begierden, von Beschränkungen und Bedingtheiten, von Zeit und Raum erlöst zu werden. Es bestand darin, Herz und Hirn zu reinigen und zu einer höheren, nämlich absoluten Wahrheit zu gelangen und diese direkt am eigenen Leib zu erfahren.
Massignon näherte sich dieser Thematik nicht nur als Wissenschaftler. Er hatte seine eigenen Erfahrungen mit religiöser Ergriffenheit gemacht, und zwar genau dort, wo al-Halladj gewirkt hatte, in Bagdad. Auf dem Rückweg von einer archäologischen Expedition in die irakische Hauptstadt wurde er unter Spionageverdacht festgesetzt. In der Schiffskajüte, wo die osmanischen Behörden ihn gefangen hielten, verdichteten sich seine Erfahrungen: ein Nahtoderlebnis, ein gescheiterter Selbstmordversuch, tiefe Reue und das daraus resultierende Verlangen nach spiritueller Umkehr. Es prägte ihn für den Rest seines Lebens und trieb ihn in die Arme der Religion seiner Kindheit, den Katholizismus, den er wie viele seiner Zeitgenossen unter dem Einfluss Nietzsches aufgegeben hatte. Er beschreibt sein Erlebnis wie folgt:
Kurz nach dem missglückten Selbstmordversuch überkam es mich, folternd, übernatürlich, unaussprechlich. Ein Brennen mitten im Herzen. Ein Auseinanderreißen meiner Vorstellungen auf dem Rad all meiner vergangenen Urteile … eine Form der Verdammung, und zugleich eine Befreiung, weg von den Menschen.5
Der Katholizismus führte bei Massignon nicht zu einer Abkehr vom Islam, sondern zu einem vertieften Interesse an der muslimischen religiösen Empfindsamkeit. Sie fesselte Massignon nicht nur als Wissenschaftler, sondern auch als Mensch. Al-Halladj wird in seinem vierbändigen Hauptwerk Die Passion des al-Halladsch schließlich zu einer Reinkarnation von Jesus.
In seinem Buch über die Terminologie der Mystiker, für das er sich in der Köprülü-Bibliothek über das wurmstichige Manuskript beugte, kam Massignon auch auf indische Askesetechniken zu sprechen. Sie haben in Europa seit jeher für Aufsehen, Staunen und Skepsis gesorgt. Auch der nüchterne, hyperkritische Theodor Lessing war von ihnen fasziniert. In seinem Vortrag über »Asien und Europa« schreibt er wie nebenbei:
Die Geheimwissenschaften (Theurgie, Theosophie, Occultismus) entwickeln manche vitalen Möglichkeiten der Seele, vor denen unsere große [westliche] Gehirnkultur als vor unfassbaren Rätseln steht. Samnyasi, Gosain, Soufi, Mahadma in Indien, sowie die Jünger der Yogaphilosophie, besitzen die Gabe, Herzschlag und Puls, Atem und Eingeweide vollkommen der Willkür menschlichen Willens zu unterstellen.6
Was Lessing wie die meisten anderen Europäer nur bestaunte, untersuchte Massignon als Historiker und Philologe, der sich an überprüfbaren Fakten orientiert. In seitenlanger begrifflicher Kleinarbeit arbeitete er die Ähnlichkeiten zwischen den Ausdrucksweisen von Sufis und Yogis heraus. So heißt es bei ihm:
Das Ziel [der Yogis] ist […] reine, intuitive Vergegenwärtigung, die Wahrheit ohne Inhalt. Das asketische Training lässt die Elemente im Bewusstsein erlöschen, die dem erstrebten Ziel als fremd entgegenstehen. Wer gelernt hat, seinen Atem zu kontrollieren, kann nach Belieben seine Gedanken auf einen Punkt konzentrieren.7
Massignon verstand sich als Wissenschaftler, er war jedoch alles andere als ein Stubenhocker. Er reiste viel, sprach etliche Sprachen, pflegte gute Verbindungen in die Politik sowie zu den Literaten und Intellektuellen seiner Zeit, in Europa ebenso wie im Vorderen Orient.
Als er im Sommer 1912 in der Köprülü-Bibliothek seinen Studien nachging, kündigten sich welthistorische Umwälzungen an. In den osmanischen Balkangebieten hatten Offiziere einige Jahre zuvor eine Revolte angezettelt, um Reformen nach europäischem Vorbild durchzusetzen. Federführend waren die sogenannten »Jungtürken«. Sie hatten ihren Namen von den republikanischen Aktivisten anderer »junger« Bewegungen im 19. Jahrhundert in Europa, wie dem »Jungen Italien«, »Jungen Polen« und »Jungen Deutschland«. Einer dieser Jungtürken war Mustafa Kemal, der spätere Atatürk.
Massignon versuchte, sich bei seinen Studien vom politischen Hintergrundrauschen nicht beirren zu lassen. Es gelang ihm nur halb. So ist in seinem Buch über die Terminologie der Sufis plötzlich von Gandhi die Rede, einem der Führer der indischen Unabhängigkeitsbewegung. Gandhi, schreibt Massignon, predige eine Sozialreform, bei der es nicht um die individuelle Befreiung gehe, sondern um das Heil der Gemeinschaft. Damit überschreite Gandhi das asketische Ideal Indiens und nähere sich dem der muslimischen Tradition an. Sogar von einem »spirituellen heiligen Krieg« könne man in seinem Fall reden!8
Und es lauerten weitere Ablenkungen auf den Gelehrten. Am Rand des Manuskripts, das er studiert, fallen ihm plötzlich andere Schriftzüge auf, »winzig, in einem schwer lesbaren Duktus«.9 Es handelt sich um einen Text in arabischer Sprache. Im Katalog der Bibliothek wird an dieser Stelle gar kein weiteres Schriftstück erwähnt.10
Er liest die ersten Zeilen und traut seinen Augen nicht:
DAS BUCH DES INDERS PATAÑJALIÜBER DIE BEFREIUNG VON DEN BESCHWERNISSEN
Massignon ist auf die verschollene arabische Übersetzung der Yoga-Sutren gestoßen, des Gründungsdokuments der Yogaphilosophie. Vivekananda hatte die Yoga-Sutren in seinen Vorträgen bekannt gemacht, sie übersetzt und kommentiert. Hundert Jahre zuvor hatte ein englischer Forscher in Indien, Henry Thomas Colebrooke, erstmals zusammenfassend darüber berichtet. In Indien selbst waren die Yoga-Sutren nahezu vergessen gewesen, und mangels Übersetzungen (die erste erschien in verschwindend kleiner Auflage 1883 in Kalkutta) waren sie auch im Westen nur ein Gerücht geblieben — bis zu den Auftritten Vivekanandas. Die später viele Dutzend Male übersetzte und kommentierte Abhandlung wurde vermutlich vor rund zweitausend Jahren von einem indischen Gelehrten namens Patañjali verfasst. Alles Weitere ist Gegenstand von Spekulation.11
Einige Jahre zuvor hatte Massignon in Paris die umfangreiche Beschreibung Indiens des arabischen Universalgelehrten al-Biruni gelesen. Darin erwähnt al-Biruni, dass er Patañjalis Yoga-Sutren ins Arabische übersetzt habe. Aber diese Übersetzung hatte nie jemand zu Gesicht bekommen. Sie war verschollen. Abgesehen von al-Birunis eigenen Angaben in seiner Beschreibung Indiens wusste man nichts darüber.
Al-Biruni hatte sein Werk über Indien im 11. Jahrhundert in der einstigen Residenzstadt Ghazni (im heutigen Afghanistan) verfasst. Er berichtet darin über die Sitten, Religionen, Wissenschaften und philosophischen Theorien der Inder und vergleicht sie mit denen anderer Völker, vor allem der Griechen. Und er zitiert aus alten indischen Schriften. Nebenbei erwähnt er, dass er zwei solcher Schriften ins Arabische übersetzt habe. Eine davon, die Yoga-Sutren, hatte Massignon nun gefunden.
Massignon wurde von al-Biruni, al-Halladj und den anderen muslimischen Denkern, die er studierte, zu weitreichenden Überlegungen angeregt. Er kam dabei zu einer Erkenntnis, der wir bereits in der Blütezeit der muslimischen Philosophie im 5./11. Jahrhundert begegnen, wie sie von al-Biruni und seinen Zeitgenossen exemplarisch verkörpert wird. Es handelt sich um das für manche Gläubige verstörende, für andere hingegen beglückende Phänomen, dass vordergründig unterschiedliche religiöse und philosophische Traditionen ähnliche Muster erkennen lassen, dass sie ähnliche Rituale, Ausdrucksweisen, Gottesvorstellungen und Welthaltungen hervorbringen.
Das galt nicht nur, wie es offensichtlich war, für die drei großen monotheistischen Religionen Judentum, Christentum und Islam, sondern auch für ganz andere wie den Hinduismus und den Buddhismus, ja womöglich sogar für Weisheitslehren und Weltanschauungen der vorchristlichen Antike. Ihre Praktiken und Andachtsformen, ihre Begriffe und Konzepte ähneln sich, haben sich wechselseitig beeinflusst und dabei verwandte, ineinander übersetzbare Vorstellungen hervorgebracht. So erklärt sich, wie die kryptischen, auf uralte Lehren zurückgehenden Yoga-Sutren verständlich in ein klassisches Arabisch übersetzt werden konnten — und warum sich strenggläubige Muslime im Mittelalter dafür genauso interessierten, wie es konfessionslose, westlich geprägte Menschen unserer Tage tun.
»Mit anderen Worten«, schreibt Massignon, »die Wissenschaft, die wahre experimentelle Wissenschaft, ist ein kollektives, ständig wachsendes Gebilde, an dem wir von Anbeginn der Zeit alle gemeinsam teilhaben. Wir verarbeiteten unsere individuellen Erfahrungen auf ähnliche Weise und wollen sie miteinander in Einklang bringen.«12
Das gelte auch für intime religiöse Erfahrungen wie die mystische, betont Massignon mit Verweis auf den einflussreichen muslimischen Theologen Abu Hamid al-Ghazali (447/1055—505/1111): »Wenn wir mit al-Ghazali Mystik als regelgeleitete Introspektion definieren, als religiöses Experiment, dessen Resultate sich im Gläubigen zeigen, dann können in jedem Umfeld, in dem es aufrichtige, nachdenkliche Seelen gibt, Fälle von Mystik vorkommen. Es handelt sich um ein menschliches, spirituelles Phänomen, das keine physischen Grenzen kennt.«13
Mit einem Wort: Mystik, die ekstatische Erfahrung des Göttlichen, ist universell. Sie ist kein Eigentum einer bestimmten Religion oder eines bestimmten Volkes, auch nicht das einer bestimmten Epoche. Gott ist überall und immer erfahrbar, auch und sogar — in der Gegenwart!
Zeitgenossen von Massignon wie Vivekananda und Martin Buber hatten ähnliche Gedanken geäußert, aber mit anderem Akzent. Als Philologe und Historiker suchte Massignon nach den Quellen des religionsübergreifenden Denkens. Er folgte dabei seiner persönlichen Erfahrung, der zufolge man Gott nicht nur suchen, sondern regelrecht finden und »schmecken« könne. So hatten es die muslimischen Mystiker ausgedrückt: »Und was für ein Unterschied, ob man die Definition der Trunkenheit kennt, oder ob man selbst betrunken ist«14, schreibt al-Ghazali in seiner berühmten Autobiografie Der Erretter aus dem Irrtum und fährt fort: »Das Schmecken aber ist wie Schauen und in die Hand Nehmen. Es findet sich nirgendwo anders als auf dem Wege der Mystik.«15
Die Ähnlichkeit kultischer und religiöser Traditionen, ja ihre Übersetzbarkeit ineinander war für die Sufis eine Grundgegebenheit. Sie wurde im Lauf der Aufklärung auch im christlichen Europa wiederentdeckt. Die unmittelbare Erfahrbarkeit Gottes, auf die es al-Ghazali und Massignon ankam, wird dabei gleichsam universalisiert, wenn nicht demokratisiert. Das heißt zum einen, dass sie aus der Starre spezifischer religiöser Dogmen und ausgetrampelter Heilswege (etwa bestimmten Pilgerritualen) befreit wurde; und zum anderen, dass man kein Religionsgelehrter sein musste, um Gott zu erfahren und zu begreifen, das heißt »zu schmecken«. Auch einfache Menschen konnten von Gott ergriffen werden.
Die Menschen haben die in diesem Religionsverständnis angelegten Möglichkeiten für Gutes genutzt wie Gandhi und für Schlechtes missbraucht wie Sektenführer, Terroristen, Ideologen. Sie haben sie übernommen, aber auch verworfen; begrüßt, aber auch verdammt. Sie haben tiefgreifende, ja teils explosive Schlüsse daraus gezogen: philosophische und praktische ebenso wie politische und kulturelle. Manche davon haben noch im 20. und 21. Jahrhundert weitreichende Folgen gezeitigt. Die globale Verbreitung von Yoga war eine davon.
Dieser revolutionäre spirituelle Kosmopolitismus hatte seinen Ursprung, im damaligen Europa unbemerkt, vor ziemlich genau eintausend Jahren, weit jenseits des Westens, im tiefsten Asien, in Afghanistan; dort, wo heute die Taliban herrschen, die mit ihrer Ideologie an dieser Geschichte zugleich teilhaben und sie pervertieren. Vor tausend Jahren, zu Beginn des 11. Jahrhunderts christlicher, des 4. Jahrhunderts muslimischer Zeitrechnung, lebten die bedeutendsten Dichter, Denker und Gelehrten des Erdballs in einem Raum zwischen den heutigen Staaten Iran, Afghanistan, Usbekistan, Turkmenistan und Tadschikistan. Sein klangvoller Name ist heute in Vergessenheit geraten: Er lautet Chorasan, auszusprechen mit einem stimmlosen »ch« wie in »Krach«. Erst der afghanische Ableger der Terrororganisation »Islamischer Staat« hat diese Region wieder in Erinnerung gerufen — und sie sogleich in Verruf gebracht. »IS-K« nennt sich dieser Ableger. K steht für die englische Schreibweise »Khorasan«.
Nirgendwo sonst, außer vielleicht in Cordoba, Bagdad und Byzanz, wusste man im 10. und 11. Jahrhundert so viel über die alten Griechen wie in Chorasan, nirgendwo waren Aristoteles, Sokrates, Galen, der große griechische Arzt, geläufigere Namen, nirgendwo sonst wurden sie häufiger zitiert als in diesem intellektuellen Milieu. Dort befanden sich die besten Bibliotheken der Welt; nur in Cordoba, im arabischen Andalusien, sollen sie ähnlich gut gewesen sein. Und nirgendwo anders als in Andalusien und Chorasan wusste man das antike Wissen besser zu nutzen, zu erweitern, zu aktualisieren. Erkenntnisse, die in jener Zeit dort gewonnen wurden, sollten für die Kultur und das Denken der Muslime ebenso wie der Christen, Juden und schließlich auch Hindus in den nächsten fünfhundert, wenn nicht tausend Jahren wegweisend sein.
Zu den unumstrittenen Helden dieses intellektuellen Aufbruchs zählte Abu Rayhan al-Biruni, der Übersetzer der Yoga-Sutren.
Drittes Kapitel
Die Araber schließen Indien auf
Al-Biruni, »einer der größten Wissenschaftler aller Zeiten«1, wurde 362/973 nahe der (heute usbekischen) Stadt Chiwa geboren.2 Provinzfürsten förderten den hochbegabten Jungen, und bereits als junger Mann war er für seine astronomischen und astrologischen Kenntnisse berühmt. Astrologie und Astronomie gehörten damals zusammen. Reisende und Seefahrer nutzten sie seit jeher, aber man benötigte sie auch für die korrekte Berechnung der islamischen Feiertage, also des Kalenders, und für die Vorhersage der Zukunft.
Al-Biruni auf einer afghanischen Briefmarke zu seinem 1000. Geburtstag, 1973
Al-Birunis Karriere als Historiker steht damit in Zusammenhang. Er verfasste ein Buch mit dem Titel Bleibende Spuren vergangener Generationen, eine »Welt- und Religionsgeschichte aus dem besonderen Blickwinkel des Astronomen«.3 Beginnend bei Adam und Eva, berichtet er darin über die unterschiedlichen Zeitrechnungen der Völker; erzählt wie nebenbei aber auch ihre Geschichte, berichtet von ihren Königen und Propheten. Die alten Zeitsysteme richteten sich üblicherweise nach Machthabern, Dynastien oder Religionsgründern aus. Neben der christlichen und islamischen, die im christlichen Jahr 622 beginnt, erläutert al-Biruni auch Zeitrechnungen, die auf weltliche Herrscher zurückgehen, etwa den römischen Kaiser Augustus.
Von al-Biruni erfahren wir, warum die Muslime das Jahr der »Hidschra« (arabisch für »Auswanderung«), als der Prophet Mohammed vor der Verfolgung aus Mekka nach Medina floh, als Beginn der Zeitrechnung wählten. Die Auswanderung des Propheten war nämlich das Ereignis, das sich am genausten datieren ließ: »Der Grund, warum der [zweite Kalif] Umar [gest. 23/644] dieses Ereignis als Beginn der Zeitrechnung wählte und nicht die Geburt des Propheten oder den Zeitpunkt, als er mit seiner Mission betraut wurde, liegt darin, dass hinsichtlich dieser beiden Daten eine große Meinungsverschiedenheit herrschte, was es nicht erlaubte, sie zur Grundlage einer Sache zu machen [d.h. der Zeitrechnung], auf die sich alle einigen können mussten.«4 Um die westliche Zeitrechnungshegemonie, die zwangsläufig einen Verlust an kultureller Vielfalt und geschichtlichen Perspektiven darstellt (und außerdem euro- und christozentrisch ist), zu relativieren, steht, wenn von der muslimischen Welt die Rede ist, bei Jahreszahlen in diesem Buch fortan zuerst die muslimische Zeitangabe.5
Im Zusammenhang mit den Religionsstiftern, die eigene Epochen begründeten, kommt al-Biruni auch auf falsche Propheten zu sprechen. Zu ihnen rechnet er al-Halladj, den Bagdader Mystiker aus dem 3./10. Jahrhundert, dem Massignon sein Lebenswerk widmete. Al-Biruni, nüchterner Rationalist, der er ist, heißt die Verurteilung von al-Halladj gut und bezeichnet ihn als Gaukler und Trickbetrüger6 — ein Vorwurf, der später häufig auch gegen indische Fakire und Yogis erhoben wurde, besonders vonseiten der Europäer.
Um das Jahr 407/1017 gelangte al-Biruni als Kriegsgefangener — Gelehrte und gute Handwerker galten als wertvolle Beute — an den Hof Mahmuds von Ghazni, einem der mächtigsten Herrscher jener Zeit. Heute ist Ghazni eine unbedeutende afghanische Provinzstadt von rund 200.000 Einwohnern. Auf 2000 Metern Höhe gelegen, besteht sie aus einer von Bergen umgebenen Oase. Breite, alte Straßen verbinden sie mit Iran und Indien, mit Kandahar und Kabul. Alexander der Große ist mit seinem Tross auf dem Rückweg von Indien dort entlanggezogen. Später war für einige Jahrhunderte Griechisch die Verkehrssprache in Afghanistan, und Nachkommen der Statthalter Alexanders herrschten über griechisch-buddhistische Königreiche. Von den damals geprägten Münzen mit griechischer Schrift existieren heute noch so viele, dass man sie für wenig Geld erwerben und sammeln kann.7
Im Zentrum von Ghazni erhebt sich ein Hügel, der seit vorgeschichtlicher Zeit besiedelt ist. Dort sind die Reste der Zitadelle zu besichtigen, in der al-Biruni, seine Sekretäre, Schreiber, Pandit und Gehilfen arbeiteten. An diesem Ort berechnete al-Biruni den Erdumfang mit einer Genauigkeit, die nur ein Prozent vom heute errechneten Wert abweicht.8 Ein halbes Jahrtausend bevor erstmals in Europa ein Globus konstruiert wurde, hatte al-Biruni bereits einen großformatigen Halbglobus gebaut, der die ganze damals bekannte Hälfte der Erde abbildete. Er hatte einen Durchmesser von fünf Metern und zeigte Längen- und Breitengrade an.9 Die ihm vorliegenden geografischen Informationen, schreibt al-Biruni, habe er auf diese Weise in einem Modell zusammenführen wollen, um »damit das Zerstreute zu vereinigen, das Verschlossene zugänglich und diesen Wissenszweig vollkommen zu machen«, also eine getreue Abbildung der bekannten Teile der Erde zu erstellen.10
Die kulturelle Blütezeit in Chorasan um die Jahrtausendwende erschöpfte sich nicht in Wissenschaft und Philosophie. Bei seiner Arbeit für Mahmud von Ghazni wird al-Biruni auch mit Firdausi in Kontakt gekommen sein, dem persischen Nationaldichter, der das am häufigsten nach- und weitergedichtete Epos der Welt verfasst hat, das sechzigtausend Doppelverse zählende Buch der Könige (Shahname). Teile davon sind Mahmud von Ghazni gewidmet. Das Buch der Könige hat die Vorstellungswelt, die Legenden und Mythen des islamischen Raums, besonders seines persisch- und türkischsprachigen Zweigs, für alle Zeit geprägt. Bis heute sind die Literaturen des Orients davon beeinflusst, berufen sich darauf, schreiben die Geschichten des Shahname fort.
Als alter Mann lernte al-Biruni auch einen der zukünftigen großen politischen Denker des Islams kennen, Nizam ul-Mulk (408/1018—484/1092). Man hat ihn einen »islamischen Machiavelli« genannt.11 Mit dieser Bezeichnung werden die tatsächlichen historischen Gegebenheiten allerdings in ihr Gegenteil verkehrt, so wohlwollend das Urteil gemeint ist. Schon aus chronologischen Gründen müssten wir vielmehr Machiavelli einen »christlichen Nizam ul-Mulk« nennen.
Nizam ul-Mulk gelangte bereits als junger Mann an den Hof der Ghaznaviden (der von Mahmud in Ghazni begründeten Dynastie), für die sein Vater als Finanzbeamter arbeitete. Mit dem Vermögen, das Nizam ul-Mulk im Laufe seiner Karriere als Großwesir und zeitweise De-facto-Herrscher anhäufte, gründete er 457/1065 in Bagdad eine berühmte Hochschule, die »Nizamiyya«, wie sie nach ihm genannt wurde. Wenige Jahre später lehrte hier, von Nizam ul-Mulk selbst beauftragt, der Theologe und Philosoph al-Ghazali, der uns im letzten Kapitel begegnete. Er war es, der die mystische Erfahrung als »Schmecken« bezeichnete und es von der abstrakt rationalen Erkenntnisweise unterschied.
Ein Jahr vor seinem Tod — er wurde von den berüchtigten »Assassinen«, den mit Haschisch gedopten Attentätern, ermordet — erhielt Nizam ul-Mulk den Auftrag, eine Schrift über gute Regierungsführung zu verfassen. Das Ergebnis ist das auf Persisch niedergeschriebene Buch der Staatskunst (Siyasatnama), die Quintessenz seiner politischen Erfahrungen aus dreißig Jahren Kanzlerschaft im Seldschukenreich, den Nachfolgern der Ghaznaviden. Gemäß Nizam ul-Mulk, dem bedeutendsten politischen Denker des islamischen Hochmittelalters, soll Politik für die Menschen gemacht werden, nicht wie bei Machiavelli für den Herrscher. »Die Herrscher müssen die Zufriedenheit des Erhabenen im Auge behalten. Die Zufriedenheit des ›Wahren‹ [das heißt Gottes] liegt darin, dass man den Menschen wohltut. Hierzu genügt schon die Ausbreitung der Gerechtigkeit unter ihnen. […] Denn es heißt: Das Reich dauert schließlich noch mit Unglauben, aber nicht mit Ungerechtigkeit.«12
Doch zurück zu al-Biruni und seinem Buch über Indien! Nach Indien war al-Biruni als Chronist und Astrologe während der Feldzüge Mahmuds von Ghazni und seiner Söhne gelangt. Sie plünderten das reiche Fünfstromland, den Punjab (englisch auszusprechen, also Pandjab, von persisch »Pandj Ab«, das heißt »fünf Wasser«), zwischen den heutigen Staaten Pakistan und Indien gelegen. Aus einem dieser Raubzüge, die al-Biruni mitmachte, erwuchs die Beschreibung Indiens. Fünfhundert Seiten umfasst die englische Übersetzung.
Al-Biruni arbeitete dabei mit gelehrten Hindus zusammen, den sogenannten Pandit. Vermutlich handelte es sich um Verschleppte oder Kriegsgefangene, die ihm als Auskunftsgeber zu dienen hatten. Der Stolz und die Überheblichkeit, die die Inder ihm gegenüber an den Tag legten, lösten bei ihm Kopfschütteln aus:
Der Wahnsinn ist eine Krankheit, für die kein Heilmittel zu finden ist. Die Inder glauben, dass es kein anderes Land gibt als das ihre, keine Nation wie ihre, keine Könige wie ihre, keine Religion wie ihre, keine Wissenschaft wie ihre. Sie sind hochnäsig, übertrieben eitel, eingebildet und stur. Sie sind kleinlich, wenn es darum geht, mitzuteilen, was sie wissen, und achten sehr darauf, es anderen Menschen vorzuenthalten, auch solchen aus einer anderen Kaste ihres eigenen Volkes, und noch mehr natürlich gegenüber Fremden.13
Die Kritik, die al-Biruni gegen die Beschränktheit und den Chauvinismus der Inder vorbringt, kann allerdings auch gegen andere Völker gerichtet werden, wie ihm klar ist: »Übrigens müssen wir, um gerecht zu sein, zugeben, dass eine ähnliche Abwertung von Ausländern nicht nur bei uns und den Hindus vorherrscht, sondern bei allen Völkern gegeneinander üblich ist.«14
Indien war für die Muslime auch vor al-Biruni kein weißer Fleck auf der Karte. Allerdings dienten die Berichte über das Land in der Regel eher der Unterhaltung und Sensationslust als der sachlichen Information. Sie waren voller Wundergeschichten, exotischer Details oder legendärer Storys. Anders das Indien-Buch von al-Biruni. Seine wissenschaftliche, um Objektivität bemühte Grundhaltung drückt sich bereits im umständlichen Untertitel aus: »Überprüfung dessen, was in rational akzeptabler oder nicht akzeptabler Weise über Indien gesagt worden ist«.15
Diese Haltung gegenüber Indien trug ihm den Ehrentitel des »ersten Ethnologen« ein.16 Al-Biruni