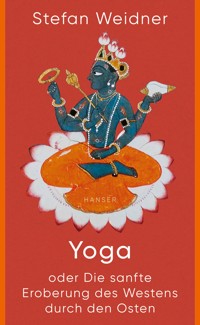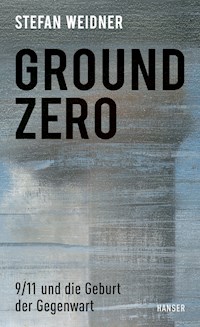
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Terrorismus, Bürgerkriege und Migration: 9/11 bestimmt noch immer unsere Gegenwart. Ein Plädoyer dafür, die Welt neu zu denken. Die Gegenwart beginnt am 11. September 2001: das Ende der USA als alleinige Weltmacht, Guantanamo und die Konfrontation zwischen dem Westen und der islamischen Welt, die Flucht vor den Kriegen im Nahen Osten, der Aufstieg von Populismus und Nationalismus. Hat Bin Laden also tatsächlich gewonnen und die Selbstgewissheiten des Westens entzaubert? Für Stefan Weidner, Experte für den arabischen Raum und kenntnisreicher Beobachter der Weltpolitik, ist die Geschichte von 9/11 erst zu Ende, wenn wir uns von den Feindbildern der vergangenen 20 Jahre verabschieden. Dann könnten die existenziellen Probleme der Menschheit – etwa der Klimawandel – an die Spitze der weltpolitischen Agenda rücken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Über das Buch
Die Gegenwart beginnt am 11. September 2001: das Ende der USA als alleinige Weltmacht, Guantanamo und die Konfrontation zwischen dem Westen und der islamischen Welt, die Flucht vor den Kriegen im Nahen Osten, der Aufstieg von Populismus und Nationalismus. Hat Bin Laden also tatsächlich gewonnen und die Selbstgewissheiten des Westens entzaubert? Für Stefan Weidner, Experte für den arabischen Raum und kenntnisreicher Beobachter der Weltpolitik, ist die Geschichte von 9/11 erst zu Ende, wenn wir uns von den Feindbildern der vergangenen 20 Jahre verabschieden. Dann könnten die existenziellen Probleme der Menschheit — etwa der Klimawandel — an die Spitze der weltpolitischen Agenda rücken.
Stefan Weidner
Ground Zero
9/11 und Die Geburt der Gegenwart
Carl Hanser Verlag
Inhalt
Einleitung
Die Aufgabe
Das Programm
Erster Teil: 9/11 und die Vorgeschichte
Feindbild USA
Der Kalte Krieg im Globalen Süden
Die Islamische Revolution im Iran
Die Ermordung Sadats in Ägypten
Die Besetzung der Kaaba in Mekka
Wahhabismus und Salafismus
Der sowjetische Krieg in Afghanistan, der Zusammenbruch des Ostblocks und die Anfänge von Bin Laden
Bin Laden und der Kampf um die Moderne
Bin Ladens erste Angriffe gegen die USA
Die Weltsicht in den USA der neunziger Jahre
Die Weichenstellung im Jahr 2000
Der Angriff
Sicherheitslücken, Verschwörungstheorien und die mediale Revolution
Die Stunde der Neokonservativen und das Problem der Heimatfront
Kritik an den USA und die Einschränkung der Meinungsvielfalt
Die Jagd beginnt; Guantanamo
Zweiter Teil: Von der Vertreibung der Taliban zum Ende der Ära 9/11
Friedhof der Imperien, zum Ersten: Afghanistan
Friedhof der Imperien, zum Zweiten: Irak
Testlauf in Teheran
Die Logik von Freund und Feind
Ziellose Geschichte, erfolglose Proteste
Der Winter vor dem Frühling
Arabische Revolutionen
»Im Westen nichts …« — als Zaudern!
Von Libyen nach Syrien
Der Preis fürs Zusehen: die neue Migration
Rassismus und »weißer« Terror
»Islamischer Staat« und neuer Schrecken
Simulation von Normalität
Epilog: Von 9/11 zum kosmopolitischen Reset
Ground-Zero-Ereignisse
Die verpasste Pandemie
Ein Korsett namens Freiheit
Die Sisyphusarbeit an Veränderung und Demokratie
Ein kosmopolitisches Gedankenexperiment
Anhang
Anmerkungen
Danksagung
Literaturverzeichnis
Einleitung
Die Aufgabe
Am Anfang der Erzählungen von »Tausendundeine Nacht« (in der achten) steht die berühmte Geschichte vom Fischer und dem Geist aus der Flasche: Ein armer Fischer wirft sein Netz aus, aber jedes Mal, wenn er glaubt, etwas gefangen zu haben, entpuppt sich der Fang als Abfall. Beim letzten, verzweifelten Versuch zieht er eine versiegelte Messingflasche aus dem Meer. Er hofft, sie zu einem guten Preis verkaufen zu können. Doch vorher möchte er wissen, was sich darin befindet, und öffnet sie: »Eine Weile verging. Dann stieg plötzlich eine gewaltige Rauchsäule aus der Flasche. Sie hob sich in die Höhe und bewegte sich über die Erde. Dabei wuchs sie riesenhaft, bis sie das Meer bedeckte, das Tageslicht verdunkelte und sich zu den Wolken des Himmels erhob. Schließlich hatte sich der Rauch vollständig aus der Flasche gelöst. Er sammelte sich, zog sich zusammen, schüttelte sich und wurde zu einem bösen Geist, dessen Füße im Staub der Erde standen, während der Kopf in die Wolken ragte.«1
Die plötzliche Erscheinung des Geistes gleicht einem Vulkanausbruch. Oder der Aschewolke, die sich nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 aus den Trümmern des World Trade Center erhob und durch die Straßen Manhattans wälzte. Die Parallelen zwischen dem Geist aus der Flasche und dem Geist aus der Asche geben zu denken. Der Geist lädt den verdutzten Fischer ein, sich etwas zu wünschen:
»›Was darf ich mir denn wünschen?‹, erkundigte sich erfreut der Fischer.
›Du darfst dir wünschen‹, sagte der Geist, ›wie du sterben möchtest und auf welche Art und Weise ich dich töte.‹«
9/11, wie die Attacke am 11.9.2001 kurz genannt wird2, ist das Geburtstrauma des 21. Jahrhunderts; bis heute prägt es die Politik und unsere Wahrnehmung der Welt. Der Geist, der aus der Asche von 9/11 aufgestiegen ist, stellt uns vor eine ähnliche Wahl wie der Geist aus der Flasche. Wer ihm auf den Leim geht, sein Spiel mitspielt oder sich von ihm in Versuchung führen lässt, ist verloren. In »Tausendundeine Nacht« besinnt sich der Fischer eines Besseren und erinnert sich daran, dass der Geist nur ein Dämon ist, er selbst aber ein vernünftiges Wesen: »Gott hat mir Verstand gegeben und mich so über den Geist gestellt. Ha! Ich werde ihn mit meinem Verstand überlisten.«
Tatsächlich gelingt ihm, was die Welt im Umgang mit 9/11 bis heute nicht geschafft hat: den Geist wieder in die Flasche zurückzulocken. Zwar sind wir unendlich viel reicher als der arme Fischer aus dem Märchen. Aber wir sind uns unseres Verstandes nicht mehr sicher. Oder so traumatisiert und manipuliert, dass wir gar nicht auf die Idee kommen, den Geist in die Flasche zurückzulocken. Genau das müssen wir aber versuchen.
Gelingt es uns nicht, hätte Osama Bin Laden, der 2011 getötete Drahtzieher der Anschläge, die meisten seiner Ziele erreicht. Dann hätte seine radikale, aggressive und kompromisslose Weltsicht gleich einem Virus, gegen das es kein Mittel gibt, auch den »Westen« angesteckt und ihn damit gespalten. Dann bekämen alle recht, die den Schock und das Trauma von 9/11 für ihre Zwecke ausgenutzt haben und dabei unzähligen Menschen keine andere Wahl ließen als die Art ihres Todes: den Tod in Afghanistan oder im Irak, sei es als Aufständische gegen die Amerikaner, sei es als ihre Verbündete; den Tod durch zahlreiche Terroranschläge in Europa, durchgeführt von al-Qaida, vom sogenannten »Islamischen Staat« oder von radikalisierten Einzeltätern; den Tod durch Ertrinken auf der Flucht über das Meer oder in einem Bürgerkrieg aufseiten der Regimes oder der Aufständischen, sei es in Syrien, Libyen und Ägypten, sei es im Jemen oder Iran; den Tod als Kollateralschaden, weil man zur falschen Zeit am falschen Ort war. Kaum etwas davon war unvermeidlich. Aber alles hängt mehr oder weniger mit 9/11 zusammen.
Als indirekte Folge von 9/11 sind inzwischen weitere »Todesarten« im übertragenen Sinn (sprich: Katastrophen) hinzugekommen: die immer weiter auseinanderklaffende wirtschaftliche Ungleichheit, eine Kultur der Intoleranz und des Hasses gegen Menschen, die anders denken, anders aussehen, anders leben; schließlich die Zerstörung von Umwelt und Klima und, dadurch begünstigt, ein neues, unberechenbares Virus, das sich rasend schnell über den Planeten verbreitet hat und in seiner Allgegenwärtigkeit und zerstörerischen Kraft dem Virus des Terrors gleicht. Der vierte Weltkrieg, der manchen Beobachtern zufolge am 11. September 2001 begonnen hat (als dritter galt demgemäß der Kalte Krieg3), verläuft in Zeitlupe, so langsam, dass viele Menschen ihn noch gar nicht richtig wahrgenommen haben. Aber er hält seit zwanzig Jahren an, und es wird höchste Zeit, ihn zu beenden.
Der »Krieg gegen den Terror«, seine Folgen und Rückkopplungen haben andere wichtige Themen allzu lange von der Tagesordnung verdrängt. Erst die Generation derjenigen, die 9/11 nicht bewusst erlebt haben, wie etwa meine Ende der neunziger Jahre geborenen Kinder, haben mit der Fridays-for-Future-Bewegung ein dringlicheres Thema groß gemacht: den Umwelt- und Klimaschutz. Damit knüpfen sie an die Umweltkonferenz in Rio von 1992 an, als alle diese Probleme schon einmal diskutiert wurden. Nur dass sie damals wesentlich leichter beherrschbar gewesen wären.
Ähnliches gilt für die Proteste 1999 in Seattle gegen die Konferenz der Welthandelsorganisation WTO und die entfesselte Globalisierung, deren Problematik den meisten Menschen inzwischen bewusst ist. Sie hat zur rasanten Ausbreitung der Corona-Pandemie entscheidend beigetragen und ist für die Lockdown-Maßnahmen 2020/21 und die schwerste weltweite Wirtschaftskrise seit Langem mitverantwortlich.
Bereits 9/11 war ein Warnschuss gewesen, dass die wirtschaftliche und politische Globalisierung auch andere, bis dahin eher regionale Probleme wie zum Beispiel den muslimischen Terrorismus globalisiert. Kaum jemand wollte diesen Warnschuss ernst nehmen: Unter dem Deckmantel des Kriegs gegen den Terror wurde die Globalisierung hemmungslos weiter vorangetrieben. Aber weil China neuerdings ähnlich rücksichtslos seine Interessen vertritt und zur nächsten Großmacht aufsteigt und weil mittlerweile sogar die reichen Gesellschaften unter den negativen Folgen der Globalisierung zu leiden haben, macht sich sogar bei denen ein Umdenken bemerkbar, die lange davon profitierten: Europa, den USA, Japan und einigen anderen Staaten, die zusammen eine Art »globalen Westen« bilden.
Nun lässt sich die Geschichte nicht zurückdrehen. Aber ihrem zukünftigen Verlauf sind wir nicht willenlos ausgeliefert. Auch 9/11 und die Folgen waren keine Naturkatastrophe, sondern von Menschen gemacht. Das heißt: Wenn wir erkennen, wie wir in die gegenwärtige Lage geraten sind und dass sie keineswegs unausweichlich ist, haben wir die nötigen Mittel an der Hand, um einzugreifen und den Lauf der Dinge anders zu gestalten. Dieses Buch will das Bewusstsein dafür schärfen, dass wir die Wahl haben. Und dass wir die Verantwortung für die Gestaltung der Zukunft übernehmen müssen.
Die Ereignisse von 9/11 haben den demokratischen Staaten eine Aufgabe, eine Mission vorgegaukelt: den »Krieg gegen den Terror«, die Beseitigung von Schurkenstaaten, die Demokratisierung der Welt, die »Integration« der Muslime. Vieles davon ist gescheitert, teils grausam. Während ich diese Zeilen schreibe, stellt sich die Frage, ob die Corona-Krise uns hilft, das Trauma von 9/11 loszulassen, oder ob der »Krieg gegen den Terror« nur von einem ebenso verheerenden »Krieg gegen das Virus« abgelöst wird.4 Der Fischer in »Tausendundeine Nacht« wusste: Gott hat den Menschen Verstand gegeben. Wissen wir es auch?
Die gegenwärtigen gesellschaftlichen und politischen Tendenzen verleiten dazu, weitermachen zu wollen wie bisher, nur bitte ohne Virus, ohne Terror und vielleicht mit ein bisschen mehr Umwelt- und Klimaschutz. Das klingt wie nach einer Reise zurück in die neunziger Jahre, als die Welt scheinbar noch in Ordnung war. Es läuft aber auf die Weigerung hinaus, sich den gegenwärtigen Realitäten und Herausforderungen wirklich zu stellen. Dazu brauchen wir neue, positive Vorstellungen von der Zukunft. Wenn unsere politischen Ziele sich auf Kriege gegen geisterhafte Gegner wie Viren oder Terroristen beschränken, bleiben wir für immer im Morast von 9/11 gefangen.
Das Programm
Die drei Teile dieses Buchs sind eng aufeinander bezogen. Das erste Kapitel erzählt die Vorgeschichte und die unmittelbaren Nachwirkungen von 9/11. Es erklärt, wie in der islamischen Welt im Lauf des Kalten Krieges die explosive Mixtur zustande gekommen ist, die sich in den kaltblütigen Angriffen auf das World Trade Center und das Pentagon entladen hat.
Der zweite Teil ist der Nachgeschichte des 11. September 2001 gewidmet, vom Beginn des Afghanistankrieges bis zum Friedensprozess mit den Taliban 2020. Ich rekapituliere die Schlüsselmomente dieser Epoche und zeige, wie stark die politischen Entwicklungen, die uns bis heute in Atem halten, mit 9/11 zusammenhängen. Dabei geht es nicht bloß um eine Nacherzählung der Geschichte, sondern auch darum, sich kritisch mit den dahinterstehenden Denkmustern auseinanderzusetzen und die richtigen Lehren aus den Ereignissen zu ziehen.
Im letzten Kapitel kontrastiere ich schließlich die Mentalität der Zeit nach 9/11 mit den Herausforderungen, die sich seit der Corona-Krise stellen. Wir stehen vor der Wahl, ob wir die 9/11-Politik weiter betreiben, so wie es die globale Wirtschaftsordnung und ein autoritärer Neoliberalismus im populistischen Schafspelz vorgeben; oder ob wir die Probleme erkennen, die von dieser Politik und Wirtschaftsweise verursacht werden. Tun wir das, lässt sich die Krise als Chance für eine andere, fairere und lebensfreundlichere Politik begreifen.
Das Buch versteht sich als Einladung zum Durchdenken, Mitdenken, Nachdenken. Es ist ein politischer Essay, der Versuch, neue Denkhorizonte zu erschließen, die geistige Situation der Zeit zu ermitteln und die Prüfungen, die sie bereithält, gut zu bestehen, das heißt, geistige, moralische und seelische Widerstandskraft gegen ihre Zumutungen zu entwickeln. Gewiss, die Welt wird auch nach der Lektüre keine andere sein. Aber wie in einem Kipp- oder Umkehrbild, das plötzlich etwas Ungesehenes zeigt, könnte sie sich danach als eine Welt zu erkennen geben, die offener ist für neue Möglichkeiten, kreative Lösungen, für alternative Zugänge und Umgangsweisen.
Bei allen meinen Überlegungen lasse ich mich von folgenden drei Ausgangsthesen und Grundannahmen leiten:
1. 9/11 ist der Urknall unserer Welt. Die Voraussetzung dafür war, wie ich im ersten Teil erkläre, die explosive Mixtur, die sich in den Jahrzehnten zuvor entwickelt hatte. Ohne das richtige Verständnis dieser Zeit sind die meisten gegenwärtigen Konflikte nicht zu erklären, nicht zu verstehen, nicht zu lösen.
2. Die weit überwiegende Zahl der Menschen überall auf der Welt lehnt den Terror ab. Aus diesem Konsens über alle Kulturen hinweg lässt sich argumentatives Kapital schlagen, lassen sich Erkenntnisse und Handlungsanweisungen für den zukünftigen Umgang miteinander ableiten. Auch in diesem Sinn markiert 9/11 einen Nullpunkt, eine gemeinsame Grundlage, von der aus wir unsere Überlegungen starten können: Ground Zero als Chance und Gelegenheit für einen Neuanfang, für einen Reset.
3. Von heute aus gesehen hat der arabische Terroristenführer Bin Laden fast alle seine Ziele erreicht. Diese Erkenntnis tut weh, aber wir müssen uns ihr stellen. Zwar ist er 2011 getötet worden, aber den von ihm angezettelten Krieg gegen »den Westen« hat er gewonnen. Dieser »Westen« ist nicht wiederzuerkennen. Er taugt in seinem gegenwärtigen Zustand nicht mehr als glaubwürdiges globales Orientierungsmodell, als das er sich vor 9/11 aus nachvollziehbaren Gründen verstanden hat. Diese Feststellung spiegelt keineswegs nur meine persönliche Sichtweise wider, sondern entspricht dem, was auch konservative, liberale und herkömmlicherweise prowestliche Kräfte mittlerweile eingestehen. Das Motto der Münchener Sicherheitskonferenz von 2020 lautete bezeichnenderweise »Westlessness« — »Entwestlichung« oder vielleicht treffender noch »Entzauberung des Westens«.5
Die Einsicht, dass der von Bin Laden angezettelte globale Bürgerkrieg bislang in weiten Teilen nach seinen Wünschen verlaufen sein dürfte, ist niederschmetternd, und es wundert nicht, dass bisher niemand gewagt hat, das auszusprechen. Aber wer seine Niederlage nicht eingesteht, kann nichts aus ihr lernen und sie nicht überwinden. Unsere Weigerung, dieser Realität in die Augen zu schauen, macht die Niederlage komplett. Zählen nicht Realitätssinn, Selbsterkenntnis und Selbstkritik zu jenen Eigenschaften, die moderne, aufgeklärte Gesellschaften in ganz besonderem Maß aufweisen sollten?
Mit der Niederlage (ob eingestanden oder nicht) und Abdankung des »Westens« fällt ein wesentliches Element der bisherigen Orientierung in der Welt fort, nämlich die Idee, dass sich die Geschichte in eine Richtung entwickelt, die der »Westen« vorgibt. Dieser Wegfall einer Zukunftsperspektive ist beunruhigend, wie ich gern zugebe. Andererseits entsteht dadurch jedoch eine neue Freiheit. Die »westliche« Perspektive war ziemlich einseitig, worauf uns auf kriegerische Weise der Terrorismus, auf zivilere Weise die antirassistischen »Black Lives Matter«-Proteste und die globale Umweltbewegung gestoßen haben. Freilich ist die Rede vom »Westen« immer schon problematisch gewesen, weswegen ich sie hier nach Möglichkeit meide oder den Begriff in Anführungszeichen setze. Die Gründe für die Problematik des Begriffs sind vielfältig.6 Auf zwei möchte ich ausdrücklich hinweisen:
Wie der britische Kulturgeograph Alastair Bonnett feststellt, ist der Begriff des »Westens« historisch und praktisch zutiefst mit der Vorstellung der Überlegenheit von weißen, aus Europa stammenden Menschen verknüpft. Benutzen wir ihn, so setzen wir diese Vorstellung einer weißen und europäischen Überlegenheit fort, ob wir wollen oder nicht. Bonnett schreibt: »Der Begriff ›westlich‹ hatte und hat eine rassistische Kodierung und geht mit der Erwartung einher, dass die Welt nie wirklich ›frei‹, ›offen‹ und ›demokratisch‹ sein wird, solange sie nicht europäisiert ist.«7
Der zweite Einwand betrifft die Perspektive, die wir jedes Mal unbewusst voraussetzen, wenn wir vom »Westen« reden. Nur wenn man in Europa auf die Weltkarte schaut, ist »der Westen« wirklich westlich, das heißt links auf der Karte, dort, wo man (West-)Europa und Amerika sieht. Die Mitte, der Fluchtpunkt, liegt ziemlich genau dort, wo im Kalten Krieg der Eiserne Vorhang verlief, und bis heute tun sich viele im »Westen« schwer damit, Osteuropa dazuzuzählen, insbesondere das orthodox geprägte Osteuropa, selbst wenn große Teile davon inzwischen Mitglied der EU sind.8
Schaut man hingegen außerhalb von Europa auf die Weltkarte, liegt der politische »Westen« nicht mehr im Westen, das heißt nicht mehr links auf der Karte. Redet man dort, sei es in den USA oder in Japan und China, dennoch vom »Westen«, übernimmt man, ohne dass man es merkt, die eurozentrische, zentraleuropäische Perspektive. Man verortet im Rahmen einer imaginären Landkarte Europa in der Mitte und macht es somit zum Zentrum der Welt.
So schmeichelhaft das für Europäer ist, es nährt ihren Dünkel, und es entspricht nicht den Tatsachen: Europa ist diese Mitte schon lange nicht mehr. Auch den USA, der einstigen europäischen Kolonie, tut es nicht gut, sich als »Westen« zu begreifen, dessen Zentrum und Perspektive damit unweigerlich europäisch eingefärbt ist: Denn das führt dazu, diejenigen Bürger, die nicht aus Europa stammen und die sich der eurozentrischen Perspektive verweigern, als nicht eigentlich amerikanisch abzuwerten: asiatische, muslimische, indigene, schwarze Amerikaner zum Beispiel. Auch aus Sicht der USA, gleichsam dem »Westen des Westens«, ist also eine Form von Rassismus und von Abwertung nichtwestlicher Perspektiven wirksam, sobald sich das Land als »westlich« betrachtet.
Abschließend ein Wort zu mir. Als Islam- und Literaturwissenschaftler habe ich ursprünglich meine Berufung darin gesehen, arabische Gedichte zu übersetzen. Später habe ich viele Jahre journalistisch gearbeitet. Was die Zukunft der islamischen Welt betraf, hielten sich in den neunziger Jahren Hoffnung und Skepsis die Waage. Ich glaubte damals, mit meinem Wissen und meiner Stimme zu einer positiven Entwicklung beitragen zu können. Aber seit 9/11 war ich vor allem mit Feuerlöschen beschäftigt. 2011 flackerte mit den arabischen Revolutionen kurzzeitig Hoffnung auf. Danach wurde die Situation von Jahr zu Jahr schlimmer. Wo ich früher relativ problemlos arbeiten, reisen und leben konnte, herrschte nun Bürgerkrieg, Terror, Gewalt oder maßlose Frustration. All das hatte es in dieser Region zwar seit jeher gegeben und war der Grund gewesen, weswegen ich mich schon als Schüler für sie interessierte. Aber mit 9/11 hatten die negativen Entwicklungen die Oberhand bekommen.
Heute trauen sich viele Freunde von mir nicht einmal mehr in die Türkei, aus Angst, dort festgenommen zu werden, weil sie die Politik von Erdoğan kritisiert oder oppositionelle Künstler und Journalisten unterstützt haben. Viele andere wiederum sind aus den Krisenregionen geflohen oder spielen mit dem Gedanken an Auswanderung. Auf der anderen Seite fühlen sich viele Freundinnen und Freunde von mir, deren Familien lange vor 9/11 aus der islamischen Welt nach Deutschland und Europa eingewandert sind, in ihrer neuen Heimat nicht mehr sicher und klagen über Vorurteile, Rassismus, Benachteiligungen und Pöbeleien.
Mit einem Wort: Mediales Feuerlöschen, Beschwichtigungen und wohlmeinende Erklärungen reichen nicht mehr. Vielmehr wächst der Verdacht, dass die ganze Perspektive, der denkerische Rahmen (oder frame, wie es in der Kommunikationswissenschaft heißt9) nicht mehr stimmt. Ich habe daher begonnen, über die vordergründigen Fragen, die den Islam betreffen, hinauszuschauen und das eigene »westliche« Selbstverständnis zu hinterfragen und nach Alternativen zu suchen, wie es seit weit über hundert Jahren viele andere ebenfalls getan haben. Das vorliegende Buch ist das Ergebnis dieser Hinterfragung, Analyse und Suche. Es ist der Versuch, Zeitgeschichte zu schreiben, ohne ihr zu erliegen und in ihr aufzugehen, sondern einen Standpunkt zu finden, der darüber hinausweist.
Da ich keine gekünstelte Sprache verwenden möchte, habe ich in der Regel darauf verzichtet, Namen oder Begriffe, die ideologisch aufgeladen sind oder klischeehaft verwendet werden, in Anführungszeichen zu setzen —mit Ausnahme der problematischen Rede vom »Westen«. An keinem Punkt möchte ich eine essentialistische oder identitäre Auffassung von bestimmten Kulturen, Religionen, Traditionen oder Menschen vertreten. Wenn von »wir« oder »uns« die Rede ist, sind damit alle potentiellen Leserinnen und Leser des Buchs gemeint: die mögliche Gemeinschaft derjenigen, die bereit sind, meiner Darstellung zu folgen, auch wenn die Zusammenhänge zuweilen komplex sind und sich anders zeigen als üblich.
Erster Teil
9/11 und die Vorgeschichte
Feindbild USA
Muss man etwas über den Islam wissen, um 9/11 zu verstehen? Erklärt der Koran den Terrorismus, wie viele damals glaubten? Die Anschläge von New York und Washington haben eine Vorgeschichte, die wenig mit den Lehren des Propheten Mohammed aus dem 7. Jahrhundert in Mekka und Medina, viel dagegen mit der globalen Entwicklung der letzten ein bis zwei Jahrhunderte zu tun hat. So kommt es, dass man in der modernen arabischen Dichtung mehr über die Gründe für die Anschläge erfährt als aus dem 1400 Jahre alten Koran.
Zum Beispiel bei dem 1930 geborenen Syrer Adonis, dessen Gedichte ich übersetzt habe. Der Name ist ein Pseudonym. Es steht programmatisch für die Bemühungen der arabischen Intellektuellen der Nachkriegszeit, zeitgemäße Gründungsmythen für die zwischen den Weltkriegen entstandenen nahöstlichen Staaten zu finden. In diesem Fall war es die phönizische, später von den Griechen aufgegriffene Adonis-Sage, ein Wiederauferstehungsmythos. 1971 publizierte der berühmte Dichter einen langen Text, eine Mischung aus politischem Essay und poetischer Collage, mit dem rätselhaften Titel »Ein Grab für New York«.
Mitten im Vietnamkrieg geschrieben, ist das Gedicht eine Abrechnung mit dem Imperialismus der USA in Südostasien, in Südamerika und in der islamischen Welt. Der kubanisch-chilenische Revolutionär Che Guevara wird ebenso angerufen wie Hồ Chí Minh, der Führer der vietnamesischen Kommunisten, und der amerikanische Dichter Walt Whitman aus dem 19. Jahrhundert, dessen progressive, menschenfreundliche Ideale, so Adonis, vom Amerika der Gegenwart verraten werden. Das New York der Wall Street, der Wolkenkratzer und der technisierten Kommunikation ist für den Dichter das Symbol für Dekadenz, Machtgier und koloniale Unterdrückung. Der Untergang der Stadt ist vorgezeichnet und wird, so Adonis, aus dem Osten kommen:
Weil der Islam überhaupt nicht darin vorkommt, zeigt uns das Gedicht, dass die Wut auf die USA früher da war als die Terroranschläge vom 11. September 2001 und dass sie weltliche und geopolitische Ursachen hat, keine religiösen. Bereits der säkulare, antikoloniale Widerstand hatte sich New York und seine Wolkenkratzer als Symbol der USA und der westlichen Moderne insgesamt zum Gegner auserkoren.
Bin Laden und der radikale Islam haben ihren Feind, »den Westen«, von ihren ideologischen Widersachern geerbt, nämlich von den linken und antikolonialen politischen Aktivisten unter den Arabern, wie etwa Adonis. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts prägten diese Denker, Dichter, Politiker und Freiheitskämpfer das intellektuelle und politische Leben in der islamischen Welt. Der Islam spielte für die meisten von ihnen kaum eine Rolle. Bis heute ist Adonis für seine entschieden islamkritische Haltung bekannt.2
Im Lauf der sechziger Jahre, kurz bevor Adonis sein Gedicht über New York schrieb, erfuhr die ein halbes Jahrhundert zuvor in bestimmten kleinbürgerlichen und konservativen Milieus aufgekommene Politisierung des Islams eine Renaissance. Bis dahin waren die Islamisten, wie die Befürworter einer größeren politischen Rolle für den Islam auch genannt werden, anders als die linksorientierten und marxistischen Widerstandsorganisationen (wie etwa die Palästinensische Befreiungsorganisation »PLO«), mit jenen Kräften in der arabischen Welt im Bunde, die dem kapitalistischen Westen nahestanden. Aus diesem Grund förderte Israel damals sogar die Hamas-Bewegung, den palästinensischen Ableger der ägyptischen Muslimbruderschaft. Der Israel-Experte Joseph Croitoru schreibt: »Die israelische Militärbesatzung [in Gaza] ließ Jassin [den Anführer der Hamas] damals gewähren, weil sie über jeden palästinensischen Jugendlichen froh war, der, anstatt sich den säkularen palästinensischen Kampforganisationen anzuschließen, bei den Muslimbrüdern Koranstunden nahm und in deren Jugendgruppen Sport trieb.«3
Die Religion zu fördern galt damals auch in Europa und den USA als probates Mittel im Kampf gegen den Kommunismus. Damit wurde der Islam in den Kalten Krieg hineingezogen. Dass er eine Kraft des Widerstandes gegen die USA und die von ihnen unterstützten arabischen Regierungen werden könnte, galt als unwahrscheinlich. Offenbar hatten die Politiker in den USA und Europa im Geschichtsunterricht nicht gut aufgepasst, oder das Kolonialzeitalter stand, wie so oft, nicht auf dem Lehrplan. Denn es waren vor allem islamische Gruppierungen gewesen, die im 19. Jahrhundert den Widerstand gegen den europäischen Kolonialismus organisiert hatten.
Das gilt zum Beispiel für Algerien, wo der Emir und Sufi-Scheich (ein muslimischer Mystiker) Abdelkader (1808—1883) gegen die Franzosen kämpfte, und für den Sudan, wo Ende des 19. Jahrhunderts der junge Churchill an der Niederschlagung einer islamisch inspirierten antikolonialen Revolte teilnahm, dem sogenannten Mahdi-Aufstand (er hat darüber ein Buch geschrieben4). Das gilt schließlich auch für die britischen Kriege in Afghanistan und Indien, das erst nach der gescheiterten Meuterei indisch-muslimischer Truppen, dem sogenannten Sepoy-Aufstand von 1857, ein offizieller Teil des britischen Kolonialreiches wurde. Karl Marx begriff bereits damals, dass der einheimische Widerstand gegen die Kolonialmächte, so hässliche Züge er annehmen mochte, eine nachvollziehbare Reaktion darstellt: »Wie schändlich das Vorgehen der Sepoys auch immer sein mag [ihnen wurden u.a. Vergewaltigungen vorgeworfen], es ist nur in konzentrierter Form der Reflex von Englands eigenem Vorgehen in Indien.«5
Warum ausgerechnet die Muslime aus kolonialer Perspektive am meisten Probleme bereitet haben, ist leicht erklärt: Sie hatten eine klare Identität, ein großes, in ihrer Geschichte begründetes Selbstwertgefühl, eine klar definierte Weltanschauung mit eigenem universalistischem Anspruch, sie verfügten über einen starken Glauben, und sie waren erfahren in der Begegnung, aber auch Konfrontation und militärischen Auseinandersetzung mit anderen. Das konnten so nur wenige kolonisierte Völker oder Religionsgemeinschaften von sich behaupten.
Unmittelbar nach 9/11 wollten viele nicht wahrhaben, dass der muslimische Terrorismus in einer Tradition des antikolonialen und vor allem deswegen »antiwestlichen« Kampfes steht. Obwohl sich die meisten Beobachter in Europa und den USA gegen diese selbstkritische Einsicht wehrten, ist auffällig, dass die Aufarbeitung des Kolonialismus erst seit 9/11 vollumfänglich begonnen hat und inzwischen, gleichsam »dank 9/11«, in der Breite der Gesellschaft angekommen ist.
Wir sehen dies im Streit um den Rassismus ebenso wie in den Debatten um den Umgang mit kolonialer Raubkunst und bei der Frage, wie mit der Migration aus dem Globalen Süden umzugehen ist. 9/11 hat diese Diskussionen angestoßen wie ein erster Dominostein, der fällt und alle anderen mit sich reißt. Das anzuerkennen ist keine Rechtfertigung für Bin Ladens Mordtaten. Es nicht sehen zu wollen deutet jedoch darauf hin, dass die kolonialen Zusammenhänge, die für 9/11 mitverantwortlich gewesen sind, nach wie vor nicht nur bestehen, sondern auch fortgesetzt werden — schwerlich eine gute, zukunftsweisende Politik!
Als die Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg ihr Bündnis mit dem konservativen Islam eingingen, dürften sie im guten Glauben gewesen sein, sie seien klüger und verantwortungsvoller als die europäischen Kolonialmächte und »man könne darauf vertrauen, dass sie von ihrer Macht in einer gerechten und vernünftigen Art und Weise Gebrauch machten, wie es anderen großen Staaten nicht möglich sei«6, wie der Politikwissenschaftler Francis Fukuyama den amerikanischen »Exzeptionalismus« erklärt. Eine solche Ausnahmestellung beanspruchen die Amerikaner bereits seit dem ersten Präsidenten, George Washington (reg. 1789—1797), der in seiner Abschiedsrede an die Nation versicherte, »die amerikanische Republik sei in der Tugend geboren und werde ihre Unschuld nur dann verlieren, wenn sie eine Machtpolitik von der Art der Europäer betreiben würde«.7
Dass sich die USA, einst selbst eine britische Kolonie, überhaupt in der islamischen Welt einmischten, hängt mit dem Zerfall des Osmanischen Reiches und der neuen Weltmachtrolle der USA nach dem Ersten Weltkrieg zusammen. Vormals hatten die Osmanen weite Teile Nordafrikas und des Nahen Ostens beherrscht. 1918 schrumpfte ihr Reich auf das Gebiet zusammen, das wir seither »Türkei« nennen. Alle übrigen Gebiete mussten neu geordnet werden. Der amerikanische Präsident Woodrow Wilson hatte sich nach dem Ersten Weltkrieg für die Unabhängigkeit dieser neuen arabischen Länder eingesetzt. Aber die Grenzen hatten England und Frankreich gezogen (Vertrag von Sèvres, 1920). So entstanden der Libanon, Syrien, der Irak, Palästina und (Trans-)Jordanien. Auf dem Gebiet Palästinas, das von den Briten verwaltet wurde, gründete sich 1948 ein weiterer Staat: Israel.
Bis 1989 hatten die Islamisten mit dem repressiven Staatssozialismus in der arabischen Welt ein deutlich größeres Problem als mit den USA. Zum ideologischen Kernbestand des Sozialismus zählen bekanntlich die Religionskritik und der Bruch mit vielen gesellschaftlichen Traditionen und Konventionen, die Gläubigen wichtig sind. Zu den sozialistisch geprägten, mit der Sowjetunion verbündeten arabischen Staaten zählten Algerien (seit der Unabhängigkeit 1962), Libyen (seit dem Putsch von Gaddafi 1969); Ägypten (seit dem Putsch der Freien Offiziere 1952), Syrien (seit dem Putsch der Baath-Partei 1963), der Irak (seit dem Staatsstreich gegen König Faisal II. 1958). Damit waren die größten und bevölkerungsreichsten Länder der arabischen Welt Teil des sozialistischen Blocks. Auch Arafats PLO gehörte ins sozialistische Lager, ferner der Süden des geteilten Jemen und das vom alten antikolonialen Freiheitskämpfer Habib Bourguiba (1903—2000) geführte Tunesien.
Politische Unterstützung von staatlicher Seite bekamen die Islamisten hingegen nur von den korrupten arabischen Monarchien, vor allem am Persischen Golf, wo in Saudi-Arabien und den ölreichen Emiraten eine besonders intolerante und puritanische Spielart des Islams zur Staatsreligion geworden war, der Wahhabismus (s.u. S. 46). Die Monarchien wollten sich durch die Förderung der Islamisten vor dem Sozialismus schützen. Aus demselben Grund waren sie mit dem Westen verbündet.
Der Kalte Krieg im Globalen Süden
Fast alle Länder der Welt wurden in den Kampf der beiden konkurrierenden politischen Systeme und der sie repräsentierenden Großmächte USA und Sowjetunion hineingezogen. Einige wurden zum Schauplatz blutiger Stellvertreterkriege, allen voran Vietnam und Afghanistan. Dem Nahen und Mittleren Osten, der arabischen und islamischen Welt, kam dabei eine Schlüsselrolle zu. Die Staaten, um die es ging, waren, wie erwähnt, erst mit dem Zerfall des Osmanischen Reiches nach dem Ersten Weltkrieg entstanden. Und erst nach dem Zweiten wurden sie wirklich unabhängig.
Wie es kaum anders sein konnte, waren diese Staaten militärisch schwach, politisch instabil, leicht von außen zu beeinflussen und auf Verbündete angewiesen. Überdies lagen sie in einer geostrategisch überaus wichtigen Region im Südosten Europas, und sie verfügten über die Rohstoffe, die für die Wirtschaft und das Militär der Industrienationen lebenswichtig waren, vor allem über Erdöl. Der Versuch der Großmächte, auf diese Region Einfluss zu nehmen, dort Verbündete zu finden und sie zu kontrollieren, konnte nicht ausbleiben.
Die UdSSR (Union der sozialistischen Sowjet-[d.h. Räte-]Republiken), die 1917 nach der russischen Revolution entstanden war, wollte mit der bisherigen imperialistischen Politik der europäischen Großmächte brechen. Die Anlehnung an die Sowjetunion, die mit dem Sieg über Hitlerdeutschland zur Weltmacht aufstieg, bedeutete daher für die neu gegründeten nahöstlichen Staaten die Emanzipation von den ehemaligen Kolonialmächten. Freilich begaben sie sich dadurch zugleich in eine neue, oft nicht weniger problematische Abhängigkeit. Aus weltanschaulicher Perspektive war der Sozialismus jedenfalls die Wahl der Stunde.
Hingegen löste der damalige »Westen« mit der Idee des Liberalismus und des freien Marktes in den Ländern, die zuvor vom selben »Westen« in kolonialer Unfreiheit gehalten worden waren, wenig Begeisterung aus. Das kapitalistische Wohlstandsversprechen zog nicht: Nur wenige Eliten schienen davon zu profitieren. Und materiellen Wohlstand, allerdings für alle, verhieß auch der Kommunismus, der in den fünfziger und sechziger Jahren in wirtschaftlicher Hinsicht noch nicht so offensichtlich vom Westen abgehängt worden war wie später.
Kommunismus und Sozialismus versprachen aber noch etwas anderes, das der »Westen« des Kalten Krieges nicht bieten konnte und nicht bieten wollte: eine rundum erneuerte Gesellschaft, eine utopische Vision. Besonders attraktiv war diese Vision für die Intellektuellen, die naturgemäß zuerst damit in Berührung kamen. Aus ihnen rekrutierten sich diejenigen, welche die neuen Staaten tragen und leiten sollten: Beamte, Lehrerinnen, Journalisten, vor allem aber die Offiziere, was aufgrund der sowjetischen Militärhilfe für viele arabische Staaten nicht verwundert. Auch viele Frauen ließen sich vom Sozialismus begeistern, der ihnen nicht zuletzt größere persönliche Freiheiten versprach. Einige von ihnen erlangten weltweite Berühmtheit, wie etwa die kämpferische feministische Autorin Nawal El Saadawi (geb. 1931) in Ägypten.8
Der Sozialismus war unter den aus Europa importierten modernen Weltanschauungen in der arabisch-islamischen Welt freilich nicht konkurrenzlos: Ebenfalls sehr populär war der Nationalismus, zuweilen in eigentümlichen Mischformen aus Nationalismus, Sozialismus und Anknüpfungen an vorislamische Zeit. Von dieser Art war die Ideologie der Baath-Partei im Irak und in Syrien (»ba’ath« bedeutet »Auferstehung«), aber auch der phönizische Nationalismus der »Syrischen Sozialen Nationalistischen Partei«, deren Anhänger der Dichter Adonis in seiner Jugend war und der er seinen Namen verdankt. Ferner gab es Ansätze zu einer ideologisch-politischen Deutung des Islams, die zuweilen ebenfalls sozialistische und nationalistische Gedanken übernehmen konnte, wie etwa in Libyen mit Gaddafis kuriosem »Grünen Buch« oder 1979 mit der Islamischen Revolution im Iran.
Der kapitalistische Block, der »Westen« des Kalten Krieges, konnte hingegen unter den Meinungsführern und Intellektuellen des Globalen Südens, der damals so genannten Dritten Welt, nur wenige Anhänger gewinnen, trotz beträchtlicher Anstrengungen sogar der CIA, die Intellektuellen für Individualismus und Liberalismus zu begeistern. Auch Adonis, der Dichter, zählte zu einer Gruppe von libanesisch-syrischen Intellektuellen, die in den fünfziger und sechziger Jahren von amerikanischer Förderung profitierten9 — umso bemerkenswerter seine dezidiert antiamerikanische Haltung in seinem großen Gedicht »Ein Grab für New York«.
Da es dem Westen, anders als der Sowjetunion, nicht gelang, die »Herzen« der Menschen in der islamischen Welt zu gewinnen, verbündete er sich mit jenen Regimen in der Region, von denen keine Verstaatlichungen zu fürchten waren, die keine revolutionäre Stimmung verbreiteten und die mit den ehemaligen Kolonialmächten im Einvernehmen lebten. Wie erwähnt, handelte es sich dabei in der Regel um Monarchien, welche die traditionellen gesellschaftlichen Strukturen vertraten, äußerst repressiv waren (was die sozialistisch geprägten Militärregimes allerdings auch bald wurden) und sich, wenn überhaupt etwas, den Kampf gegen Fortschritt, Emanzipation und gesellschaftliche Gleichheit auf die Fahnen geschrieben hatten. Beispielhaft dafür sind die (informellen) Bündnisse mit der marokkanischen Monarchie unter Hassan II. sowie mit Saudi-Arabien und mit dem iranischen Schah bis 1979.
Die Menschen, die in der islamischen Hemisphäre zwischen den fünfziger und den achtziger Jahren Werte und Normen vertraten, die heute unter dem Label des »Westens« verkauft werden (Freiheit, Gleichheit, Demokratie, Emanzipation und dergleichen), mussten sich unweigerlich gegen den »Westen« jener Zeit wenden. Das ist ein deutlicher Unterschied zum Image dieses »Westens« im kommunistischen Osteuropa.
Diese beiden entgegengesetzten Wahrnehmungen des »Westens« sind leicht erklärt. In Osteuropa trat der »Westen« (zumindest vor 1989) nicht als koloniale, imperiale Macht auf. Er hatte dort schlicht nichts zu sagen. Sein Ruf war daher ungetrübt von der tatsächlichen westlichen Politik in anderen Weltteilen. Maßstab war allein der demokratische und freie »Westen« im Westen selbst, während die Sowjetunion wie eine Kolonialmacht oder Besatzungsmacht wahrgenommen wurde. Was sie ja auch war.
Beispiele für die problematische westliche Politik jener Zeit sind leicht zur Hand. 1953 kam es zu einem von der CIA und dem britischen Geheimdienst in die Wege geleiteten Putsch (der »Operation Ajax«) gegen den gewählten iranischen Ministerpräsidenten Mohammad Mossadegh, der die Verstaatlichung der iranischen Ölindustrie, die zu einem großen Teil im Besitz britischer und amerikanischer Firmen war, managen und aushandeln musste. Als es zu keiner Einigung kam, verhängten die Engländer einen Boykott gegen den Handel mit iranischem Öl (nicht unähnlich der Situation nach der Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran durch Donald Trump), dann leiteten sie zusammen mit den USA die Absetzung Mossadeghs in die Wege. Aus der konstitutionellen Monarchie, die pro forma bewahrt wurde, war gleichsam über Nacht die Diktatur eines Monarchen geworden, Schah Reza Pahlavi, dem Sohn des ersten Pahlavi Schahs. Dieser hatte das Land zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg regiert und eine brutale Modernisierungswelle nach dem Vorbild von Atatürk in der Türkei in die Wege geleitet. Auch sein Sohn verfolgte seit dem Putsch eine entschieden prowestliche, im eigenen Land jedoch repressive und autoritäre Politik, bis er 1979 von Khomeini gestürzt wurde.
Der aus dem Ausland gesteuerte Putsch gegen Mossadegh ist aus guten Gründen vielen Iranern bis heute in Erinnerung. Mossadegh war kein Kommunist, und die Verstaatlichung der Ölindustrie erschien aus iranischer Sicht überaus sinnvoll.10 Das Eingreifen der Amerikaner und Briten (wohlgemerkt damals erneut unter Churchill, dessen koloniale Haltung weithin bekannt war) geschah auch nicht aus Angst, der Iran würde ein Teil der sowjetischen Einflusszone werden, sondern aus finanziellen Interessen der westlichen Erdölkonzerne; die Kopplung staatlicher und wirtschaftlicher Interessen aber war seit jeher ein Markenzeichen des Kolonialismus. Der Putsch gegen Mossadegh erstickte die Entwicklung der parlamentarischen Demokratie im Iran und die nationale Selbstbestimmung der Iraner. Damit wurde der Weg für die Islamische Revolution und das Aufkommen eines entschieden antiwestlichen, politischen Islams geebnet.
Nur wenige Jahre später, 1956, kam es zur Suezkrise. In ihr waren dieselben (nach)kolonialen Muster wirksam wie beim Putsch gegen Mossadegh drei Jahre zuvor. Der ägyptische Präsident Gamal Abdel Nasser, anders als Mossadegh tatsächlich dem sozialistischen Lager zuneigend, wollte den Suezkanal verstaatlichen, der in den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts mithilfe europäischer Kredite gebaut worden war. Der Kanal diente mehr den Interessen der kolonialen europäischen Seefahrt als den Ägyptern und trug wesentlich dazu bei, dass Ägypten ein Spielball der europäischen Interessen wurde, in Schuldabhängigkeit geriet und schließlich zwischen 1882 und 1924 von Großbritannien besetzt wurde.
Mithilfe von Großbritannien und Frankreich griffen die israelischen Truppen nun im Oktober 1956 Ägypten an und eroberten den Sinai, mussten sich aber auf Druck der Sowjetunion und der USA (die einen Konflikt mit der Sowjetunion fürchteten) zurückziehen. Die Suezkrise endete daher mit einem moralischen und diplomatischen Sieg Nassers und begünstigte dessen Aufstieg zum führenden Politiker in der arabischen Welt, zumal Nasser Charisma hatte, gut reden und die Massen begeistern konnte. Der glückliche Ausgang der Suezkrise schuf aber einen gefährlichen Mythos: dass die Araber, angeführt von Nasser und Ägypten, die koloniale Aggression erfolgreich bekämpfen könnten — und als europäische Siedlungskolonie wurde auch der Staat Israel aufgefasst.