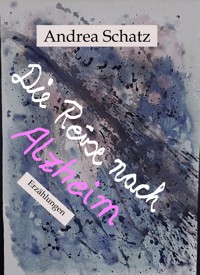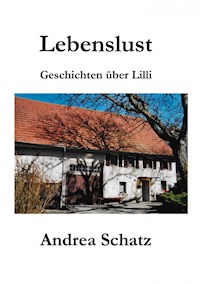Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Es ist wohl das Beste, der Reihe nach zu erzählen … sei es als reine Meditationsübung, als bereinigender Rückblick oder – ein schöner Gedanke – als Ermutigung für Menschen, denen Ähnliches widerfahren ist, denn im Februar 2015 bekam ich die Diagnose "Brustkrebs" vor den Latz geknallt. Und ich hatte wider Erwarten eine gute Zeit damit. Mein Anliegen: zu zeigen, dass die alltäglichen, scheinbar unwichtigen Dinge es wert sind, erzählt zu werden, so wie sie es wert sind, erlebt zu werden, denn ich war während meiner Therapie so sehr mit ihnen beschäftigt, sie machten mich so glücklich, dass ich "das große Thema" teilweise komplett vergaß, ohne je die Realität zu verdrängen. Das war der beste Teil meiner "systemischen Therapie". Meine Erkrankung war und ist Teil meines Lebens, aber nicht mein komplettes Leben. Egal was kommt – das Bisherige war gut.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 159
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
YOHO
oder
Das Geheimnis des Unsichtbaren
Andrea Schatz
Impressum
YOHO oder das Geheimnis des Unsichtbaren
Andrea Schatz Gottlob-Hauser-Str. 11 72348 [email protected]
Copyright © 2016 Andrea Schatz
1. Auflage 2016
Verlag: epubli www.epubli.de
Konvertierung: Andrea Fritz www.ebooktreibhaus.de
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de
Juli 2016
Morgen Abend gehe ich mit meiner Freundin essen. Gestern und heute habe ich mir frische Salatzutaten klein geschnippelt und das Ganze jeweils mit getoastetem Kräuterbutterbrot verdrückt, einmal in der Variante „mit geräuchertem Fisch“ und einmal „mit Oliven mediterran“. Davor habe ich mit meiner Mutter Kaffee getrunken. Davor habe ich meinen Rucksack und ein paar Wanderutensilien für die Wochenendtour nach Österreich zusammengesucht. Davor habe ich Bewerbungen geschrieben. Ach ja, gestern habe ich Sport getrieben und werde das morgen auch tun, bevor ich eventuell weitere Bewerbungen schreibe, Wäsche zusammenlege, einkaufen gehe und – nein, kochen brauche ich dann ja nichts. Wie schön.
Langweilige Abfolge? Genau! Ich schreibe Bewerbungen, treibe Sport, lese, koche, trage Wäsche hin und her, gehe einkaufen, kümmere mich um viele kleine Dinge. Ebenfalls habe ich regelmäßige Verabredungen, die natürlich nicht langweilig sind, und ebenso häufige Arzttermine, die aber bald weniger werden. Ab und zu mache ich eine kurze Reise. Ich lese, ich schreibe. Für all diese Dinge habe ich genügend Zeit. Die zahlreichen Auswahlmöglichkeiten, meinen Tag zu gestalten, ohne dabei Arbeitszeitenregelungen oder Feierabendtermine berücksichtigen zu müssen, sind Zeichen eines Zustands, nach dem ich mich lange gesehnt habe und um den ich sicherlich auch beneidet werde: Freiheit! Und nun behaupte ich: langweilig! Nicht dass mir wirklich langweilig wäre, ich bin gut beschäftigt und gehe meist gutgelaunt durch den Tag. Aber irgendwie stehe ich außerhalb des Geschehens und suche nach Inhalt. Klar, ich könnte ein Buch schreiben, meine Jobsuche intensivieren, ein Studium beginnen und nebenher jobben, eine super Hausfrau werden, mich selbständig machen, ein Biogemüsebeet anbauen, mich stärker als bisher in einer NGO engagieren, etwas Kreatives lernen. Aber das alles ist es nicht, oder es ist zu viel, oder, oder, oder. Mir fehlt eine Aufgabe, bei der mein Tun Bestätigung findet.
So sieht also mein Seelenzustand nach eineinhalb Jahren Arbeitspause aus. Ich war fast ein Workaholic und war anschließend total überrascht, wie schnell ich Abstand zu meinem Berufsleben fand. Jetzt arbeite ich daran, wieder zu jener Welt zu gehören. Das hätte ich so nicht erwartet, oder wenigstens nicht so schnell.
Manchmal kommen auch zu viele Termine zusammen, und ich fühle mich nicht gerade gestresst, bin aber froh, dass ich mich danach wieder ausruhen kann. Immerhin spüre ich noch die Nachwehen einer anstrengenden Therapie in Form von Vergesslichkeit und dem Gefühl, dass manche Dinge anstrengender sind als zuvor. Am Alter allein kann das nicht liegen … Doch ich bleibe dabei: Die Fülle der Möglichkeiten wirkt erschlagend, ich spüre keine grundsätzliche Motivation für die Dinge; ich tue sie einfach, lasse mich treiben, um mangels einer wirklichen Aufgabe irgendwie beschäftigt zu sein, und für teure Selbstverwirklichungstrips wie ausgedehnte Reisen oder Mega-Events in den Bereichen Kunst, Kultur und Bildung reicht es finanziell sowieso nicht. Ich lebe in einer Art Korsett, habe gleichzeitig zu wenig und zu viel Spielraum. Was also tun?
Meine Ra(s)tlosigkeit lässt mich mit Aufräumarbeiten am Computer beginnen, und hier stoße ich auf meine Aufzeichnungen aus dem Jahr 2015. Die tagebuchartigen Einträge beginnen mit der vielversprechenden Aussage Die Fülle der alltäglichen Erlebnisse macht aus unserem Leben ein einziges großes Abenteuer. Es lebe die Schöpfung. – Stop, woher habe ich denn das? Ich kann kaum glauben, dass ich mir vor nicht allzu langer Zeit solch einen beglückenden Satz einfallen ließ, während ich momentan vor Unentschlossenheit fast vergehe und mich auf nichts wirklich konzentriere.
Es ist wohl das Beste, der Reihe nach zu erzählen … sei es als reine Meditationsübung, als bereinigender Rückblick oder – ein schöner Gedanke – als Ermutigung für Menschen, denen Ähnliches widerfahren ist, denn im Februar 2015 bekam ich die Diagnose „Brustkrebs“ vor den Latz geknallt. Und ich hatte wider Erwarten eine gute Zeit damit.
Als alles begann (02-03/2015)
Nach reiflicher Überlegung hatte ich mich dazu entschlossen, meinen Job aufzugeben. Die Entscheidung fiel mir nicht leicht, doch mein alter Vorsatz, mich zu verändern, wenn ich „einmal auf die 50 zugehe“, koinzidierte mit einem bereits einige Zeit andauernden Zustand der Überarbeitung. Gespräche waren geführt, Möglichkeiten ausgelotet, im Privatleben diskutiert worden. Ich würde mir eine Teilzeitbeschäftigung suchen und mich parallel über die Möglichkeiten zur Finanzierung eines alten Traums informieren, der Aufnahme eines Romanistikstudiums an der Universität. Dazu hatte ich ein halbes Jahr Zeit, so lange lief mein Arbeitsvertrag. Ich würde meine Aufgaben ordentlich übergeben, wollte einen „guten Abgang machen“ und vereinbarte parallel dazu, wie in jedem Frühjahr, Termine für einige Vorsorgeuntersuchungen. Vorsorge beim Zahnarzt – ok. Vorsorge bei der Frauenärztin – ok. Check-up beim Hausarzt – ok. Danach Zeit für die beiden gebuchten Kurse bei der Volkshochschule, Antike Kulturen und Grundlagen der Philosophie von Descartes. So dachte ich mir das.
Von der gynäkologischen Praxis wurde ich zwecks Abklärung einer Auffälligkeit in der rechten Brust zur Mammographie geschickt. Meiner Ansicht nach handelte es sich wie bereits öfter um eine harmlose Zyste, die mit Flüssigkeit gefüllt war und erfahrungsgemäß mit der Zeit wieder verschwinden würde. Die Mammographie ergab einen „unauffälligen mammographischen Befund bei dichtem Drüsengewebe“ mit der Bezeichnung BI-RADS 0. Das heißt Breast Imaging Reporting and Data System mit einer Codierung von 1 bis 5, wobei 1 unauffällig und 2 gutartig war. 0 war also gar nichts. Um auf Nummer sicher zu gehen, bekam ich einen Termin zur Stanzbiopsie, um das Gewebe untersuchen zu lassen. Mir sollte es recht sein, ich nahm meine Vorsorgetermine schließlich ernst. Über die entnommenen „Würmchen“, bezeichnet als sechs grau-gelbe Stanzzylinder, musste ich schmunzeln.
Zwei Wochen nach meiner Kündigung erhielt ich einen Anruf aus der Frauenarztpraxis. Die entnommene Gewebeprobe war bösartig. Ich stand mit dem Mobiltelefon am Ohr regungslos im Besprechungszimmer und spürte förmlich, wie das unheimliche Wort in mich einsickerte wie schwere Tinte in Löschpapier. Die Nachricht war weder schlimm noch schockierend, sie war surreal, betraf nicht mich, sondern die neben mir, mein anderes Ich. Ich hatte die Gewebeprobe nicht ernst genommen – die ganze Zeit war ich mir sicher gewesen, dass die bei der Vorsorge nicht als flüssigkeitsgefüllte Zyste, sondern als zackiges Etwas definierte Stelle sich als harmlos erweisen würde. Mit keinem Gedanken hatte ich die Möglichkeit einer schlechten Nachricht in Erwägung gezogen, die mich von meinen Zukunftsplänen abhalten könnte.
Während sich eine meiner jungen Kolleginnen einen Spaß erlaubte und mich mit einem „Ätsch, beim privaten Handygebrauch ertappt!“ foppte, versuchte ich tapfer zu lächeln, mich zu beherrschen und gleichzeitig mein Bedauern darüber, die Volkshochschulkurse sicherlich wieder stornieren zu müssen, zu überspielen. Mechanisch machte ich mich auf den Weg ins Büro, um erst einmal weiterzuarbeiten, um später zu überlegen, machte aber nach drei Schritten kehrt, ging zurück ins Besprechungszimmer, schloss die Tür und versuchte meinen Lebensgefährten anzurufen. Der war leider nicht erreichbar, ich schrieb eine kurze SMS, klopfte bei meinem Chef und faselte etwas von früher gehen und Arzttermin, er nickte und schon klingelte mein Mobiltelefon, keine fünf Minuten später stand das Auto meines Lebensgefährten vor dem Eingang und wir fuhren – nicht nach Hause, aber an den Fluss, der viele Geheimnisse kennt: an die Balinger Eyach.
Tagebucheintrag: Wer zieht hier die Fäden?
Mein Mikrokosmos ist unzweifelbar biologisch erklärbar histologisch überschaubar ursächlich unklar.
Unser Makrokosmos ist anzweifelbar philosophisch diskutierbar wissenschaftlich nicht beweisbar im Großen und Ganzen ungreifbar.
Im Rückblick finde ich es erstaunlich, wie ruhig ich geblieben bin. Mit 48 Jahren spürte ich zum ersten Mal etwas von der Tragweite der Endlichkeit des Daseins, doch gleichzeitig hatte ich den Eindruck, es handle sich um kurzfristige Terminänderungen und nicht um eine potentiell lebensbedrohliche Diagnose namens Brustkrebs. Ein Riesenkompliment an meine Gynäkologin, meinen Lebensgefährten und meinen Hausarzt, die allesamt Bodenhaftung bewahrten, nicht um den heißen Brei herumredeten und dennoch die unfrohe Botschaft mitfühlend mit mir trugen und mir Vertrauen in die bevorstehende Therapie mit auf den Weg gaben.
Nach dem ausführlichen Gespräch mit meiner Ärztin war ich sofort einige Tage krank geschrieben, um meine Gedanken sortieren zu können. Ich schnappte mir das Fax mit dem pathologisch-anatomischen Gutachten und setzte mich ans Internet, um die mir nicht bekannten medizinischen Begriffe zu deuten. Nur gut, dass ich beruflich bereits mit der medizinischen Terminologie in Berührung gekommen war; doch der Bericht war gespickt mit irreführenden Begriffen. Es war etwas gruselig, sich durch so viele Definitionen zu klicken, in denen überall Schlagwörter wie Überlebensrate, Rezidiv, tödlicher Verlauf, Sterblichkeit, Heilungschancen laut Statistik usw. enthalten waren. Sobald ich die wichtigsten Begriffe gefunden hatte, fuhr ich den Computer aus der abergläubischen Sorge, beim Weiterlesen dem sicheren Tode geweiht zu sein, herunter. Ich hatte jetzt ein unscharfes Bild von einem invasiv-duktalen Karzinom NST (no special type), das mäßig differenziert war (G2), dass der Tumor noch recht klein war (< 2 cm), bei Draufsicht auf 9 Uhr stand und damit gut operabel sein sollte, die Proliferationsrate mit 10 % nicht zu beängstigend war, dass der positive Hormonrezeptorstatus für eine Therapie vorteilhaft war und dagegen der HER-2/Neu-Rezeptor (ein Protein) mit starker Ausprägung Score 3+ weniger vorteilhaft war.
Das K-Wort wirkte nun weniger bedrohlich, ich konnte es aussprechen und denken, auch wenn ich es anderen gegenüber eher vermied (ersetzt durch den Begriff „Tumor“). Ein Krebs war an und für sich ja etwas Schönes, ich hatte im Urlaub schon kleine Krebse fotografiert, die sich zwischen Felsritzen versteckten und doch neugierig daraus hervor lugten. Außerdem war mein Lebensgefährte im Sternzeichen Krebs geboren, das konnte also nur Gutes bedeuten. Man legt sich die Dinge eben so lange zurecht, bis sie passen. Dass ich buchstäblich Glück im Unglück hatte, wurde mir erst später in der Klinik, als ich Menschen mit viel schwerwiegenderen Diagnosen oder weit fortgeschrittenen Krankheitsstadien traf, richtig bewusst.
Es folgten angenehme Tage. Ich erinnere mich an mildes Frühlingswetter, an die Stunden, die ich im gemütlichen Sessel unseres Wintergartens verbrachte, wo sich die vielen neuen Informationen und wirren Gedanken setzen konnten: Ich war dankbar für eine recht gute Prognose (Brustkrebs ist heilbar), genoss die wärmenden Sonnenstrahlen, hatte keinen Zusammenbruch meines Weltbildes erlitten, endlich Zeit zu lesen, hatte auf weitere Deutungsversuche von Histologie / Pathologie im Internet verzichtet (dort ist nichts so sicher wie der Tod). Ein gewisses Freiheitsgefühl ersetzte das surreale Schweben, ich bereute meinen beruflichen Schritt nicht im geringsten und verspürte eine ruhige Zuversicht, dass alles gut gehen würde, und da war auch ein ruhiges, natürliches, tiefes Grundvertrauen mir selbst gegenüber. Es war einfach da, und dafür war ich ebenso dankbar wie ich froh war, dass der Tumor durch meinen Gang zur Vorsorge überhaupt entdeckt werden konnte. Dass alles gut werden würde, wusste ich von meiner sechsundachtzigjährigen Mutter, die in ihrem Leben viele schwere Wege gehen musste und vor vielen Jahren die damals noch zu härteren Bedingungen als heute durchgeführte Therapie eines Schilddrüsenkarzinoms überstanden hatte. Warum sollte ich es nicht auch schaffen? Zu dem Zeitpunkt hoffte ich, die bereits in Aussicht gestellte Chemotherapie nach der OP nicht antreten zu müssen – was ungefähr so naiv war wie mein Versuch, meiner Ärztin bei der Vorsorgeuntersuchung die entartete Zelle als harmlose Zyste zu verkaufen.
Blieb der Umgang mit der Familie und der „Öffentlichkeit“. Welches war der schwierigere Part? Die Familie, würde ich sagen. Wegen der Emotionen. Und enge Freunde. Auf das Verhalten der vielen anderen hatte ich eh keinen Einfluss. Ich ging Schritt für Schritt vor, suchte mir einen Freitagnachmittag als unspektakulären letzten Arbeitstag aus und verabschiedete mich im engeren Kollegenkreis mit kleineren Abschiedskärtchen und Gags.
Tagebucheintrag:
Lieber Chef und liebe Hühner. Schwerfallendes Bekenntnis bei der lieben Freundin, die mich als einzige ganz genau versteht. Weitere mir wichtige Personen informiert, die es von mir direkt erfahren sollen. Familie noch offen – wie sage ich es der Mutter?
Ich versuchte es, sie ging mir zweimal durch die Lappen, und es war klar, dass ich sie gerne entwischen ließ. Der dritte Anlauf gelang. Ich sprach sehr behutsam, was gar nicht einfach war, weil sie schlecht hört und ich die klinischen Begriffe in möglichst einfacher Übersetzung darbieten musste. Ich hörte mich selber von Premiere und Abenteuer faseln (ich war bis dato noch nie Patientin in einem Krankenhaus gewesen), von guten Aussichten, von ihr als meinem großen Vorbild, von Organisatorischem, vom Genießen des tollen Frühlingswetters. Große Erleichterung, sie blieb cool. Eine Woche später würde sie mich vorsichtig fragen, ob es denn bösartig sei. Ich bejahte und dankte der Gnade des fortgeschrittenen Alters.
Nachdem der wichtigste Personenkreis Bescheid wusste (auch hier betonte ich die gute Therapiemöglichkeit im Sinne von „Glück gehabt“ und „Alles halb so wild“), war es mir sehr wichtig, das Steuer der Informationen in meiner Hand zu halten. Direkt und offen, wenn auch verständnisvoll, teilte ich meinem Umfeld mit, dass ich gegen betontes Mitleid oder gar Gejammer immun sei und dass die nächsten Monate zwar ein wichtiger Teil meines Lebens seien, dieses aber nicht durchgängig bestimmen würden. Ich bin ein Mensch, der viel mit sich selbst ausmacht, und das wollte ich beibehalten. Der Gedanke an den Empfang von Anstandsbesuchen während der Chemotherapie oder stundenlange Telefonate über das eine große Thema war mir zuwider, einen ganz kleinen Kreis hielt ich danach immer auf dem laufenden und das war völlig ausreichend. Denn ich wollte ja auch meine anderen Pläne voranbringen bzw. umsetzen, auch falls manches nur langsam oder eingeschränkt machbar sein sollte. Das Positive an einer solchen Situation – dem Umgang mit Informationen über die Krankheit, Selbstläufern und Gerüchten, Tratsch und Klatsch – ist, dass man die Menschen noch besser kennenlernt. Es ergibt sich Nähe, wo man es nicht unbedingt erwartet hätte, und man lernt, sich von Personen und Situationen, die einem nicht unbedingt gut tun, zu distanzieren. Wichtig war es jedoch auch, den Menschen gegenüber nachsichtig zu sein – ich hätte nie gedacht, dass mir das gelingen würde, denn es war auch etwas anstrengend, wenn sich Blicke auf der Straße und das Verhalten mancher Menschen änderten. Und doch schaffte ich es, die nötige emotionale Distanz zu wahren, die ich ganz unbescheiden meiner philosophischen Ader und meinem Bauchgefühl zuschreibe – plötzlich war ich diejenige, die der Unsicherheit anderer mit Empathie begegnete. Die Macht der Verletzlichkeit hatte mich nicht besiegt; ich konnte meine körperliche Verletzlichkeit als vorübergehendes Schicksal akzeptieren, während meine seelische Verletzlichkeit mich gar nicht erst herausforderte. Ich war wirklich authentisch und freute mich über dementsprechendes bestätigendes Feedback. Oft lächelte ich in mich hinein und sagte mir „Nun bist du also berühmt geworden“, wenn auch nur in einem 600-Seelen-Dorf und einigen kleineren Kreisen außerhalb. Interessant war die unterschiedliche Wirkung meiner Situation auf jüngere Frauen, die eher auf Körperbild und Beziehung fixiert waren, auf Gleichaltrige, die häufig pragmatisch reagierten, und auf viele ältere Frauen, die mit einer gewissen Hilflosigkeit auf meine Berichte reagierten. Das K-Wort fanden die meisten sehr abschreckend, weshalb ich es meist vermied.
Tagebucheintrag: Bandbreite
Anteilnahme in Worte fassen: traurig, betroffen oder gelassen alle sind sie gleich gewichtig jeder Mensch dazu berechtigt jedʼ Gefühl soll gleich viel gelten und doch: dazwischen liegen Welten.
Bis zur geplanten Operation war noch etwas Zeit. Es folgten Voruntersuchungen, eine unauffällige Magnetresonanztherapie, zwei Beratungsgespräche im Brustzentrum, Ultraschall von Bauch und Leber (bei letzterer wusste ich schon von meinem Hausarzt-Check-up, dass sie unauffällig war), Röntgen der Lunge und so fort. Mein Vertrauen in die Behandlung in der Universitäts-Frauenklinik und dem angeschlossenen Klinikverbund in Tübingen bestätigte sich von Anfang an. Ebenso bestätigte sich mit jedem Schritt die bisherige Histologie: Der Tumor war kleiner als die richtungsweisenden 2 cm (14 bis 18 mm), die Lymphknoten waren nicht befallen, es gab keine Anzeichen für eine Metastasierung, die brusterhaltende OP war sehr wahrscheinlich. Wegen des Kürzels G2 in Verbindung mit meinem jugendlichen Alter (!) wurde eine sogenannte adjuvante systemische Therapie eindringlich empfohlen (beginnend mit Chemotherapie, gefolgt von Strahlentherapie, sowie wegen des nachteiligen HER-2/Neu-Scores eine bereits mit der Chemotherapie beginnende Antikörpertherapie), wiederum gefolgt von einer abschließenden Antihormontherapie in Tablettenform über fünf Jahre. Super Kombi. Dies bedeutete in Summe circa eineinhalb Lebensjahre Therapie und Kosten von über Hunderttausend Euro, die in Aussicht gestellte Anschlussheilbehandlung nicht mit einberechnet. Was sollte ich davon halten? – Ich freute mich über wiederholte Komplimente zu meinen „jungen Jahren“, bei einer auf die Fünfzig Zugehenden nicht gerade alltäglich, auch wenn man mir damit nur die Therapie schmackhaft machen wollte.
In den Brustsprechstunden erfuhr ich außerdem, dass die Ärzte darüber diskutiert hatten, ob die Operation vor Therapie erfolgen sollte oder umgekehrt. Da ich selber die Operation als ersten Schritt bevorzugte, war ich froh zu hören, dass die Ärzte zu demselben Schluss gekommen waren. Eine neoadjuvante Behandlung (Chemotherapie vor OP) war aufgrund der Prognose nicht erforderlich, die Vorarbeiten dazu wären zeitlich ineffizienter gewesen als anders herum und ich war heilfroh, das Unwort mit C vorerst aus meinen Gedanken verdrängen zu können. Alle beruhigten sie mich: eine Chemotherapie sei heute viel besser verträglich als früher, es gebe Medikamente gegen die Nebenwirkungen, sie sei eine Rosskur, aber machbar, sie sei bei Frauen im prämenopausalen Zustand (vor den Wechseljahren) sehr wichtig und zudem, wenn der HER-2/Neu mit 3+ recht ungünstig war. Da für die Rosskur ein guter Zahnstatus erforderlich war (mein geistiges Auge gaukelte mir die Kontrolle eines Pferdegebisses auf dem Rossmarkt vor), sollte ich meinen Zahnarzt bei meinem Vorsorgetermin vorsichtshalber auf eventuelle Bisphosphonate hinweisen, um die Gefahr einer Kiefernekrose (Absterben von Kiefernknochen) zu vermeiden. Bisphosphonate kamen nur im Fall von Knochenmetastasen zum Einsatz. Alles klar? Okay, ich wollte nichts mehr darüber hören und fragte nach den angenehmeren Dingen des Lebens. Und siehe da, mein Wohlbefinden vorausgesetzt, durfte ich alles tun: reisen, arbeiten (wenn ich wollte), Sport treiben, essen was und soviel ich wollte, und auf meine Nachfrage auch mal ein Glas Rotwein genießen. Das war doch was.
In jedem Gespräch und bei jeder Aushändigung eines entsprechenden Formulars war ich dankbar, dass mir die medizinische Terminologie einigermaßen vertraut war. Wie verwirrend musste sie für viele Menschen sein, die schwer krank durch diesen klinischen Riesenapparat geschleust und aufgeklärt werden mussten, Menschen, deren Lebensumstände vielleicht nicht so komfortabel waren wie die meinen.
Ich verspürte immer noch keine Angst vor dem Eingriff, aber eine zunehmende Ungeduld und beteiligte mich an einem Schreibwettbewerb zum Thema Feldforschung. Mein Text wurde später zwar abgelehnt, aber für mich war er die ideale Therapie vor der Therapie, weshalb ich ihn hier gerne wiedergebe:
Märztage
Prolog
Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle: Mein Name ist Cellula und ich gehöre zu den berühmten Mehrzellern, die sich im Laufe der Evolutionsgeschichte durch unermüdliche Zellteilung die lebendige Welt erobert haben. Es heißt, dass es einer meiner direkten Ur-Ur-Ur-Ur-etc.-Großväter gewesen sei, der den genialen Einfall hatte, aus dem trägen Einzeldasein als kleinste lebende Einheit eine schlagkräftige Truppe zu bilden: das Gewebe. Die Entwicklung der erstaunlich lebendigen Vielfalt, die wir heute bereits als Evolutionsgeschichte bezeichnen, war also zumindest teilweise dem ehrgeizigen Plan meines cleveren Vorfahren zu verdanken.