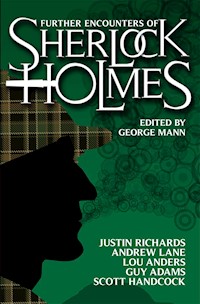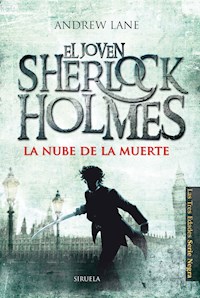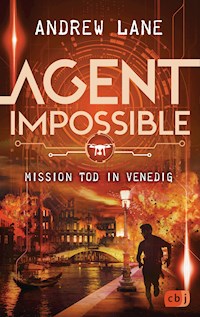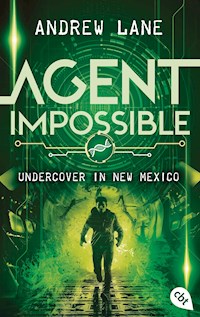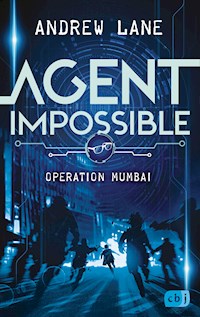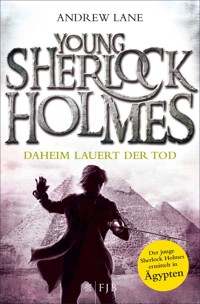
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Krimi
- Serie: Young Sherlock Holmes
- Sprache: Deutsch
Das Serienfinale der überaus erfolgreichen Reihe über den jungen Sherlock Holmes! Sherlock Holmes' Mutter ist gestorben, sein Vater ist in Indien verschwunden und seine Schwester benimmt sich merkwürdig. Die Holmes-Familie scheint zu zerbrechen, und nicht einmal Mycroft kann das ändern. Als plötzlich ein Nachbar in seinem eigenen Haus verschwindet, steht der junge Sherlock vor einem neuen Rätsel. Wo ist er hin? Gibt es einen Zusammenhang zum Bau des Suezkanals in Ägypten? Und wem kann Sherlock wirklich trauen? Ein neuer Fall, der alles bisher Bekannte auf den Kopf stellen wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 371
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Andrew Lane
Young Sherlock Holmes 8
Daheim lauert der Tod
Biografie
Andrew Lane ist der Autor von mehr als zwanzig Büchern, unter anderem Romanen zu bekannten TV-Serien wie ›Doctor Who‹ und ›Torchwood‹. Einige davon hat er unter Pseudonym veröffentlicht. Andrew Lane lebt mit seiner Frau, seinem Sohn und einer riesigen Sammlung von Sherlock-Holmes-Büchern in Dorset.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Book
Die englische Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel ›Night Break – Young Sherlocl Holmes 8‹
bei Macmillan Children’s Books, London, England
© Andrew Lane 2015
Für die deutschsprachige Ausgabe
© 2017 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: bürosüd°, München
Lektorat: Lana Schmitz
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490159-6
ISBN 978-3-10-490159-6
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Motto
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
Richard Boardman, Marshall Lewy, Matthew Faulk, Mark Skeet, Simon Winstone und Georgina Gordon-Smith gewidmet, die meiner Karriere auf das nächste Level geholfen haben.
Meinen tiefen Dank an Kevin Reilly für seinen exzellenten und unschätzbaren Rat, was den zeitgenössischen Fechtkampf anbelangt. Was sein Angebot für einen persönlichen Fechtunterricht betrifft, so bin ich noch nicht darauf zurückgekommen, habe es aber fest vor.
Will man einen einstigen Bekannten ausfindig
machen, der durch die Weltgeschichte reist,
so gibt es zwei Orte auf dem Globus,
an denen man nichts anderes zu tun braucht,
als dazusitzen und abzuwarten:
die Docks von London und Port Said.
Früher oder später wird der Gesuchte
dorthin kommen.
Rudyard Kipling
Prolog
Sherlock Holmes wischte sich mit dem Hemdärmel über die Stirn und musterte gleich darauf den Stoff, als er den Arm wieder sinken ließ. Er war dunkel und feucht vor Schweiß.
Das grelle Licht der hoch am Himmel stehenden Sonne blendete ihn dermaßen, dass von der Umgebung fast nichts zu erkennen war; und die Hitze hämmerte wie ein schweres Gewicht auf seinen Schädel ein. Binnen Sekunden war seine Stirn von Schweiß getränkt, der ihm in warmen Rinnsalen die Wangen und den Nacken hinab in den klitschnassen Kragen lief.
Links und rechts erstreckte sich von Horizont zu Horizont der Suezkanal – eine tiefe Rinne im Sand, eine von Menschen geschaffene Wasserstraße, so gigantisch, als stammte sie von einem Schwertstreich der Götter. Blaues Wasser funkelte zwischen den beiden Ufern. Grüne Büsche und Schilfdickicht säumten die Ränder. Der Kanal war so breit, dass Sherlock das gegenüberliegende Ufer per Steinwurf nicht erreicht hätte – und so tief, dass man ganze Schiffe darin hätte versenken können und die nachfolgenden Wasserfahrzeuge immer noch imstande gewesen wären, über die versunkenen Wracks hinwegzugleiten.
Natürlich nur, wenn er den Anschlag nicht verhinderte, der unmittelbar bevorstand: Dann würde es so viele Schiffswracks geben, dass sie sich bis über die Wasseroberfläche türmen und den Kanal auf Jahre unpassierbar machen würden. Das Problem war bloß, dass er keine Ahnung hatte, wie er das anstellen sollte.
»Sherlock«, hörte er plötzlich eine Stimme. »Es tut mir leid, dass es so enden muss.«
Er drehte sich um. Nur wenige Meter vor ihm stand Rufus Stone. Die Brise wehte ihm das schwarze Haar aus dem Gesicht. Sein einzelner Goldzahn blitzte in der Sonne. Aus seinem Blick sprach … Bedauern, ja sogar Traurigkeit.
Er hielt ein Entermesser in der Hand.
Sherlock spürte, wie seine Kraft und sein Selbstvertrauen schwanden. Wie hatte es nur so weit kommen können?, fragte er sich. Wie war er in die lähmende Hitze eines fernen Landes verschlagen worden – kurz davor, gegen einen seiner besten Freunde auf Leben und Tod zu kämpfen?
Er hob seinen Säbel und wappnete sich für den bevorstehenden Kampf …
1
Die frühe Nachmittagssonne schien durch das Fenster in Charles Dodgsons Zimmer herein. Staubpartikel schwebten im Sonnenlicht und umtanzten einander, angetrieben von den feinen Luftströmungen, die im Raum zirkulierten. Draußen gingen Studenten auf dem Innenhof des Oxforder Christ Church College umher, an dem Dodgson unterrichtete. Zusammen mit dem Sonnenlicht und ebenso gedämpft wie dieses drangen ihre Stimmen durch das Fenster.
»Also«, sagte Dodgson von seinem Sessel aus, der so gedreht stand, dass Sherlock ihn im Profil sehen konnte. Zurückgelehnt saß sein Lehrer da und starrte an die Decke. »Hast du ü… ü… über diese Zahlenfolge nachgedacht, die ich dir vor einer Weile aufgegeben habe? Wie ich mich erinnere, handelte es sich um 1, 5, 12, 22, 35, 51 und 70. Kannst du mir s… s… sagen, welche Logik die Zahlen miteinander verbindet und hinter der Sequenz steckt?«
»Ja«, erwiderte Sherlock. »Ich habe herausgefunden, um welche Zahlenfolge es sich handelt. Endlich.«
»Bitte … dann klär mich auf.«
»Es ist schwer zu beschreiben, aber das Ganze hat mit Pentagrammen, also Fünfecken, zu tun.«
»V… v… vielleicht könntest du die Lösung für mich aufzeichnen.« Dodgson wies auf eine Schreibtafel, die auf einer Staffelei neben dem Kamin stand.
Sherlock stand auf, ging zur Tafel und griff nach einem Stück Kreide, während er sich im Kopf das Diagramm vorzustellen versuchte, auf das er erst nach monatelangem Grübeln gekommen war. Rasch und akkurat zeichnete er mehrere Punkte auf die Tafel und verband sie mit Linien.
»Der erste Punkt oben an der Spitze stellt natürlich die ›1‹ in unserer Zahlenfolge dar«, erklärte er. »Das kleinste Pentagramm hat dann fünf Punkte, womit wir die nächste Zahl ›5‹ haben. Das nächstgrößere Pentagramm besteht aus zehn Punkten, von denen es sich drei Punkte mit dem kleinsten Pentagramm teilt. Aber wenn Sie die beiden Punkte aus dem ersten Pentagramm hinzufügen, die sie sich nicht teilen, ergibt sich die ›12‹. Das dritte Pentagramm hat fünfzehn Punkte, von denen es sich fünf mit dem ersten und zweiten Pentagramm teilt. Wenn Sie jedoch die sieben Punkte von den ersten beiden Pentagrammen hinzunehmen, die nicht miteinander geteilt werden, erhalten Sie die ›22‹. Und so weiter und so weiter.«
»Ausgezeichnet«, sagte Dodgson und klatschte seine mageren Hände gegeneinander. »Und w… w… was sagt dir das?«
»Dass ich eine verflixt lange Zeit gebraucht habe, um das herauszubekommen.«
»Ja, aber wozu sind diese Pentagonalzahlen gut? Was verraten sie uns über die Welt? Was für eine Bedeutung haben sie?«
»Ich habe keine Ahnung«, gestand Sherlock aufrichtig.
»Womit du ganz richtigliegst. Pentagonalzahlen haben keine Bedeutung, die mir bekannt wäre – im Gegensatz zur Fibonacci-Folge, die in allen möglichen Zusammenhängen aufzutauchen scheint. Vielleicht finden wir eines Tages noch eine Anwendung für sie oder eine Bedeutung, vielleicht aber auch nicht. Das wird uns nur die Zeit verraten. Der große Mathematiker Leonhard Euler allerdings hat ihnen einige sehr i… i… interessante theoretische Arbeiten gewidmet und seine Ergebnisse 1783 in einer A… A… Abhandlung veröffentlicht. Er zeigte, dass man das Produkt aus (1-x) (1-x2) (1-x3) … in einer unendlichen R… R… Reihe weiterführen kann, bei deren Exponenten es sich um die Pentagonalzahlen handelt. Was hältst du davon?«
»Nicht zu fassen«, erwiderte Sherlock ruhig und gelassen.
Dodgson bemerkte seinen Sarkasmus nicht oder entschied sich dafür, ihn zu ignorieren, falls er es doch tat.
So ging der Unterricht noch eine Stunde weiter, während Dodgson viele Gebiete der Mathematik durchstreifte, und als Sherlock schließlich ging, schwirrte ihm der Kopf. Es bedurfte eines langen Spaziergangs in der kalten, aber sonnigen Nachmittagsluft, bis sein Geist wieder zur Ruhe gekommen war.
Als er zu Mrs McCrerys Pension gelangte, in der er während seines Aufenthaltes in Oxford wohnte, traf er Matty dort an, der draußen auf der Grundstücksmauer saß. Eine schwarze Droschke hatte am Straßenrand haltgemacht. Ihr Fahrer saß, eine Zeitung lesend, oben auf dem Kutschbock, während das Pferd mit geschlossenen Augen seelenruhig dastand und ganz offensichtlich die Pause genoss.
»Du hast Besuch«, begrüßte Matty ihn und wies mit einer kurzen Bewegung seines Daumens auf das Gefährt.
»Das sehe ich«, sagte Sherlock. Er näherte sich der Droschke, stellte sich neben das Rad, das sich dem Bordstein am nächsten befand, und starrte durch das Fenster nach drinnen. Die Kabine war leer, aber die Polsterung war noch vom Gewicht des Fahrgastes eingedrückt – und so wie es aussah, musste es sich um ein ganz beträchtliches Gewicht gehandelt haben.
»Mein Bruder«, stellte er erstaunt fest. »Mycroft ist hier.«
»Das war clever. Hat er etwa ’n spezielles Rasierwasser, das er immer benutzt?«
»Nicht direkt.« Sherlock beschloss, Matty nicht zu verraten, dass er seinen Bruder anhand der Größe und Form seines Hinterns erkannt hatte. »Und wo steckt er jetzt?«
»Drinnen und trinkt eine Tasse Tee mit der alten Lady.«
»Aber Mycroft hasst es zu reisen.«
»Russland«, entgegnete Matty knapp und streckte den Daumen in die Höhe, gleich gefolgt von seinem Zeigefinger: »Irland.«
»Schon kapiert«, sagte Sherlock. »Aber was ich meinte, war, dass er nur auf Reisen geht, wenn es einen außergewöhnlichen Grund dafür gibt. Mycroft macht keine gesellschaftlichen Privatbesuche.«
»Macht er schon, wenn es um dich geht. Er nimmt einiges in Kauf, um sicherzugehen, dass du okay bist.« Matty schniefte und wischte sich mit dem Ärmel über die Nase. »Ich wünschte, ich hätt’ so ’nen Bruder.«
»Du hast mich«, bemerkte Sherlock. Er starrte zur Pension. »Ich weiß, ich sollte reingehen und rausfinden, was Mycroft hier macht. Aber erfahrungsgemäß taucht er immer nur dann auf, wenn es Schwierigkeiten gibt oder mein Leben kurz davor steht, sich zu ändern. Und in beiden Fällen wird’s meist übel.«
»Miese Neuigkeiten kannste dir nicht vom Leib halten, indem du dir die Finger in die Ohren steckst und tust, als ob du nix hörst«, sagte Matty und sprang von der Mauer herab. »Wenn das Leben mir eins beigebracht hat, dann das. Am besten, du bringst das Ganze schnell hinter dich. Als wenn man ’n Pflaster von der Wunde reißt.«
Sherlock nickte langsam. »Guter Rat.«
»Hey, wozu hat man sonst ’n Bruder?« Matty boxte ihm gegen den Arm. »Erzähl mir dann, wie’s ausgegangen ist.«
Sherlock packte ihn am Ärmel. »Wieso denkst du eigentlich, dass du um die Sache herumkommst? Wenn es schlechte Neuigkeiten gibt, möchte ich, dass du bei mir bist.«
»Warum?«, fragte Matty.
»Weil auch das zu dem gehört, was Brüder tun.«
Gemeinsam stiegen sie die Stufen zu Mrs McCrerys Haus empor und traten durch die Tür.
Augenblicklich hörte Sherlock die Stimme seines Bruders aus dem Wohnzimmer dringen. Er stellte sich mit Matty in den offenen Eingang und gab ein Husten von sich.
Mycrofts Stimme brach mitten im Satz ab, und Mrs McCrery erschien vor ihnen in der Türöffnung. »Ah, der junge Master Holmes. Dein Bruder Mycroft ist hier. Wir haben uns gerade in Erinnerungen an seine Zeit in Oxford ergangen.«
»Die Geschichten habe ich schon gehört«, antwortete Sherlock.
»Ich werde uns noch eine Kanne Tee machen. Ich hätte dir ja Kuchen angeboten, aber der Appetit deines Bruders ist so gut wie eh und je, und es ist nichts mehr da. Ich werde sehen, ob ich noch ein paar Kekse für dich und den jungen Matthew hier auftreiben kann … wie ich weiß, hat der junge Schlingel ja immer so einen Appetit, dass er glatt ein Pferd verputzen könnte!«
»Sagen Sie das ja nicht, wenn Harold in der Nähe ist«, murmelte Matty. »So was nimmt er persönlich.«
»Danke«, sagte Sherlock nur und betrat den Raum, während Mrs McCrery davonwuselte.
Mycroft hatte sich in einen bequemen Sessel nahe dem Fenster gequetscht, und Sherlock hegte den Verdacht, dass womöglich ein Seil und die Dienste eines Pferdes erforderlich sein würden, um ihn wieder herauszuhieven.
»Ah, Sherlock«, begrüßte Mycroft ihn. »Es erfreut mein Herz, dich wiederzusehen. Und an deiner Seite natürlich der junge Master Arnatt, wie ein stets präsenter Schatten.«
»Hallo, Mister Holmes«, sagte Matty fröhlich.
Mycroft bewegte seinen riesigen Kopf, so dass er wieder Sherlock fixierte. »Sherlock, ich muss dir etwas mitteilen, und es handelt sich nicht um die Art von Dingen, über die man in Anwesenheit eines vergleichsweise Fremden redet.«
»Matty gehört für mich zur Familie«, entgegnete Sherlock. »Ich will, dass er dabei ist.«
»Wie du möchtest. Statt um den heißen Brei herumzureden, werde ich geradewegs zum Punkt kommen. Es tut mir leid, dir mitteilen zu müssen, dass unsere Mutter gestorben ist.«
Die Worte schienen im Raum zu schweben wie das Echo einer fernen Glocke. Sherlock versuchte, tief einzuatmen, aber irgendwie wollte es ihm nicht gelingen, Luft in seine Lungen zu befördern. Sogar das Licht im Zimmer schien sich verändert zu haben. Es war, als hätte eine Wolke sich vor das Antlitz der Sonne geschoben und das Haus in Schatten gehüllt.
»Gestorben?«, wiederholte er. »Mutter ist tot?«
»So ist es. Mir ist klar, dass dies für dich ebenso schockierend sein muss wie für mich, aber …«
»Mutter ist tot?«
Mycroft seufzte. »Ja, Sherlock. Das ist korrekt. Nimm dir, wenn nötig, einen Moment Zeit, um die Nachricht zu verdauen.«
Es war, als würde Sherlock in seinem Kopf ein Album mit Empfindungen durchblättern und nacheinander jede einzelne ausprobieren, um zu sehen, ob sie zur Situation passte. Überraschung? Kummer? Wut? Akzeptanz? Er war sich nicht sicher, wie er sich fühlen sollte. Seine Finger kribbelten merkwürdig, und er hatte den Eindruck, dass er leicht schwankte. Er spürte seine Füße nicht. Er öffnete den Mund, brachte aber kein Wort heraus. Es gab keine Worte mehr: Sein Geist war völlig leer.
»Matthew«, sagte Mycroft mit eindringlicher Stimme. »Hilf Sherlock auf einen Stuhl.«
Er spürte, wie Mattys Hände sich auf seine Schultern legten und ihn irgendwohin zur Seite führten. Augenblicke später wurde ihm bewusst, dass er saß, ohne sich jedoch daran erinnern zu können, wie das eigentlich passiert war.
»Wie?«, fragte er schließlich. »Wann?«
»Was das Wie anbelangt, so weißt du, dass sie bereits einige Zeit lang krank gewesen ist. Tuberkulose heißt ihre Krankheit, in der Bevölkerung im Allgemeinen auch unter dem Namen Schwindsucht bekannt. Das ist eine Krankheit, die die Lungen angreift. Es gibt verschiedene Behandlungsmöglichkeiten, darunter absolute Ruhe und Sanatoriumsaufenthalte an Orten mit kalter reiner Luft wie zum Beispiel in den französischen und Schweizer Alpen. Aber normalerweise zeigen diese Behandlungsmethoden selten positive Ergebnisse. Die Krankheit hat Mutters Körper schließlich so geschwächt, dass sie keine Kraft mehr hatte, weiterzukämpfen. Sie wurde schwächer und schwächer, und am Ende ist sie für immer eingeschlafen.« Seine Stimme war leise, und Sherlock konnte aus ihr all jene Emotionen heraushören, mit denen er selbst auch zu kämpfen hatte. »Und was das Wann anbelangt: Ich erhielt heute Morgen die Benachrichtigung, dass sie in der Nacht gestorben ist. Ich nahm augenblicklich eine Droschke nach Paddington, von dort den nächsten Zug nach Oxford und hier dann wieder eine Droschke. Ich wollte, dass du auf der Stelle davon erfährst.«
»Was geschieht jetzt?«, fragte Sherlock leise. All die verschiedenen Gefühle, die er eben noch empfunden hatte, schienen sich auf einmal verflüchtigt und eine emotionale Landschaft hinterlassen zu haben, die einem Strand glich, von dem sich die Tide zurückgezogen hatte: nackt, trostlos und voller alter Erinnerungen, die den Sand wie Treibholz und von der See geschliffene Kiesel übersäten.
»Wir müssen nach Hause.« Mycroft stockte einen Moment, bevor er weitersprach. »Es wird eine Beerdigung geben, und dann gibt es da noch einige medizinische Behandlungskosten, um die sich gekümmert werden muss.«
Sherlock nickte. »Ich verstehe. Wann fahren wir?«
»Auf der Stelle.« Mycroft legte die Hände auf die Sessellehnen und wollte sich in die Höhe stemmen. Doch nichts geschah, sah man einmal von dem Knarzen ab, das das Holz des Sessels von sich gab. »Ich schlage vor«, fuhr er fort und hielt kurz inne, bevor er es noch einmal versuchte, »… dass du für die Reise packst. Geh davon aus, dass du etwa eine Woche fort sein wirst.« Er stemmte sich erneut mit den Händen von den Lehnen ab, doch noch immer rührte sich sein Körper nicht von der Stelle. »Und während du damit beschäftigt bist«, sagte er und vertraute dem Sessel wieder sein volles Gewicht an, »würde ich es zu schätzen wissen, wenn du, Master Arnatt, nach draußen gehen und den Kutscher hereinholen könntest. Womöglich werde ich seine Hilfe brauchen.«
Immer noch wie betäubt, begab sich Sherlock über die Treppenstiegen in sein Zimmer hinauf und warf rasch einige Kleidungsstücke in einen Koffer, ohne sich richtig zu vergewissern, welche genau es waren oder ob sie zum Anlass passten. Matty stieß nach ein paar Minuten zu ihm und sah schweigend zu. Bevor Sherlock das Zimmer verließ, schnappte er sich noch seinen Violinenkasten. Zusammen begaben sie sich nach unten, wobei Sherlock sich unversehens bei der Frage ertappte, ob er Mrs McCrerys Pension oder irgendeinen der dort logierenden Studenten, mit denen er sich angefreundet hatte, jemals wiedersehen würde. Vielleicht war dieser Ort genauso wie die Deepdene-Schule und Onkel Sherringfords Haus dazu bestimmt, lediglich eine weitere Zwischenstation auf seinem Lebensweg zu sein.
Mycroft stand im Wohnzimmer und strich die Frontpartie seines Jacketts glatt. Der Sessel sah aus, als wäre er in einen Kampf verwickelt gewesen, der für das Möbelstück nicht allzu gut ausgegangen war. Mycroft nickte, als er Sherlocks Koffer sah. »Schön. Dann sind wir also zum Aufbruch bereit.«
Sherlock drehte sich um und streckte Matty die Hand entgegen. »Wir werden uns wiedersehen«, sagte er und spürte einen Kloß in seinem Hals. »Ich weiß noch nicht, wo und wann, aber wir werden uns wiedersehen.«
Matty starrte auf seine Hand, als wüsste er nicht, was er damit anstellen sollte, aber es war schließlich Mycroft, der die unangenehme Stille brach. »Eigentlich«, brachte er vorsichtig hervor, »hatte ich mich gefragt, ob sich der junge Master Arnatt womöglich in der Lage sieht, uns zu begleiten. Ich denke, dass du einen Freund brauchen wirst, Sherlock, und meine Zeit wird durch die Beerdigungsvorkehrungen und diverse Familienangelegenheiten in Anspruch genommen werden. Außerdem bin ich nicht im Bilde, in welchem Zustand sich die Familienfinanzen befinden, und ich muss mich vergewissern, dass wir nicht bereits mittellos sind. Es wäre gut für dich, jemanden zu haben, mit dem du reden kannst.«
Sherlock warf einen Blick auf Matty, der ziemlich überrascht aussah. »Ich? Mitkommen? Zu euch?«
»Wenn du Zeit hast.«
»Ich hab’ immer Zeit«, erwiderte Matty. »Jep, klar komm ich mit … das heißt, wenn du das auch willst.« Er starrte Sherlock bittend an.
»Tue ich«, sagte Sherlock und wandte sich an seinen Bruder. »Danke.«
»Freunde sind wichtig«, sagte Mycroft mit leiser Stimme. »Das ist mir aus der schlichten Tatsache heraus klargeworden, selbst keine zu haben. Musst du noch Vorkehrungen treffen, was die Betreuung deines Pferdes anbelangt, Master Arnatt?«
»Nee, es gibt da so ’n paar Leute am Kanal, die sich Harold immer ausborgen, wenn ich ihn nicht brauche. Die füttern ihn, passen auf ihn auf und sorgen dafür, dass er glücklich und zufrieden ist. Wahrscheinlich werden die nicht mal merken, dass ich weg bin.« Sein Gesicht verfinsterte sich. »Genauso wenig wie Harold, ’ne Schande eigentlich.«
»Was ist mit Kleidung?«
Matty starrte Mycroft stirnrunzelnd an.
»Kleidung, zum Wechseln«, half Mycroft ihm auf die Sprünge.
Matty starrte ihn nur weiter an.
»Vergiss es«, seufzte Mycroft. »Wir können dir etwas zum Anziehen besorgen, wenn wir nach Hause kommen. Zumindest haben wir so weniger Koffer zu schleppen.« Er wandte sich an Sherlock. »Und was deine Studien hier in Oxford anbelangt, habe ich mir die Freiheit erlaubt, Charles Dodgson, versehen mit meinen besten Grüßen, eine Nachricht zu schicken, in der ich die Situation erklärt habe. Ich bin sicher, dass er sich sehr verständnisvoll zeigen wird.«
Die drei begaben sich zur wartenden Droschke hinaus, wo der Fahrer Sherlocks Koffer zu dem anderen hochwarf, der sich bereits auf dem Dach befand.
»Du hast gepackt!«, stellte Sherlock vorwurfsvoll fest. »Du hast gesagt, du hättest in dem Moment eine Droschke nach Paddington genommen, als du von der Sache erfahren hast. Aber in Wahrheit hast du erst bei dir zu Hause haltgemacht, um zu packen!«
»Dein sonst so scharfer Verstand lässt dich im Stich«, antwortete Mycroft. »Ich schreibe das mal den Nachwirkungen des Schocks zu. Ich habe dich nicht belogen … Ich habe stets einige gepackte Koffer mit frischer Kleidung und Toilettenartikeln in meinem Büro parat für den Fall, dass ich mich eilig auf Reisen begeben muss.«
»Aber Sie reisen doch gar nicht gern«, warf Matty ein.
»Das ist irrelevant. Für gewöhnlich erwarten Firmen auch nicht, dass ihre Geschäftsräume abbrennen, aber trotzdem schließen sie eine Feuerversicherung ab. Ich reise in der Tat nicht gerne, manchmal jedoch bin ich durch die Umstände dazu gezwungen, in aller Eile irgendwohin aufzubrechen – so wie jetzt.«
Als sich die Droschke vom Bordstein entfernte, blickte Sherlock aus dem Fenster zurück. Mrs McCrery stand in der Haustür. Wie es schien, winkte sie, aber ebenso plötzlich wie unerwartet füllten sich seine Augen mit Tränen, so dass er es nicht genau sagen konnte.
Die Fahrt zum Oxforder Bahnhof war kurz, allerdings mussten sie noch eine Stunde auf den Zug warten, und so besorgte Mycroft für sie Tee und Kuchen in einer Teestube. Die Kellnerin brauchte ein paar Minuten, bis sie ihnen die Sachen brachte, aber als es so weit war, langte Matty begeistert zu. Sherlock hingegen musste feststellen, dass er keinen Appetit hatte. Wortlos schob er seinen Kuchen zu seinem Freund hinüber, als der mit seiner Portion fertig war.
»Was ist mit unserer Schwester?«, fragte er plötzlich. »Wie hat sie die Nachricht aufgenommen?«
»Ihre mentale Verfassung ist fragil«, knurrte Mycroft, der selbst zwei Kuchen verputzt hatte. »Manchmal ist sie sich dessen bewusst, was um sie herum geschieht; und dann wieder scheint sie völlig in ihrer eigenen Welt zu leben; und wie immer diese auch aussehen mag, so scheint sie meinem Gefühl nach sehr viel angenehmer zu sein als die, in der wir anderen zu Hause sind.« Er stockte kurz. »Wie ich gehört habe, hat sie einen Verehrer … einen Mann, dessen Bekanntschaft sie gemacht hat und der irgendwie romantische Gefühle für sie zu hegen scheint. Ich beabsichtige, mich vor unserer Rückkehr mit diesem Mann zu treffen, um herauszufinden, was für ein Mensch er ist.«
»Emma … und ein Mann?« Sherlock dachte unwillkürlich an das blasse Mädchen zurück, an das er sich erinnerte. Sie schien stets wie ein Geist durch das Haus geschwebt zu sein, ohne mit jemandem ein Wort zu wechseln, und tief in Gedanken versunken. Jünger als Mycroft, älter jedoch als Sherlock, hatte sie die physische Zerbrechlichkeit ihrer Mutter geerbt und offensichtlich auch die geistige Labilität ihres Vaters.
»Du denkst an Vaters Probleme«, bemerkte Mycroft. »Und dass unsere Schwester sie offensichtlich geerbt haben muss.«
Sherlock war verblüfft. Was er eigentlich nicht hätte sein sollen, hatte sein Bruder seine erstaunlichen kombinatorischen Fähigkeiten doch schon häufig genug demonstriert. Nur dass dieses Mal er zu deren Gegenstand geworden war. »Woher weißt du das?«, fragte er.
»Hast du wirklich daran gedacht?«, fragte Matty fasziniert.
»Habe ich.«
Matty warf einen finsteren Blick auf Mycroft. »Dann hat er deine Gedanken gelesen. Hab immer den Verdacht gehabt, dass er so was kann. Dunkle Künste … so nennt man das.«
»Mit Gedankenlesen hatte das nichts zu tun«, sagte Mycroft und schüttelte seinen riesigen Kopf. »Vielmehr mit reiner Beobachtung. Siehst du die Kellnerin dort drüben am Tresen? Sie ist etwa im gleichen Alter wie unsere Schwester. Als Sherlock Emmas Namen erwähnte, glitt sein Blick in Richtung des Serviermädchens. Offensichtlich dachte er an Emma, und das Mädchen stellte lediglich einen mentalen Platzhalter dar, wenn du so willst. Dann sah er auf die Teller und Tassen auf dem Tisch und stellte dabei zweifellos die Beobachtung an, dass das Serviermädchen unsere Bestellung perfekt ausgeführt hat, wohingegen Emma die Bestellung entweder vergessen, die falschen Kuchen serviert oder den Tee verschüttet hätte. Sherlocks Blick glitt danach zu mir und anschließend zu seinem eigenen Spiegelbild im Fenster der Teestube. Ich schloss daraus, dass sich seine Gedanken den Unterschieden zwischen Emma und uns beiden zugewandt hatten. Insbesondere nahm ich wahr, dass er unbewusst meine Hand mit seiner verglich … wir beide haben vergleichsweise lange Finger, eine Eigenschaft, die wir mit unserer Mutter teilen. Nebenbei bemerkt, war sie eine exzellente Klavierspielerin und hervorragend in Handarbeiten. Am Ende wanderte Sherlocks Blick nach draußen zum Bahnhofsaufseher, dessen Uniform ihn zwangsläufig an die Armeeuniform unseres Vaters erinnern musste, und schließlich weiter gen Himmel, wo sich, wie die christliche Kirche uns lehrt, das Paradies befindet. Es bedurfte nichts weiter als einer simplen Gedankenfolge, um herzuleiten, dass er nunmehr an unsere Eltern dachte und daran, dass wir alle unterschiedliche Eigenschaften von ihnen geerbt haben.«
»Wahnsinn«, hauchte Matty.
»Eine ganz normale Sache«, erwiderte Mycroft wegwerfend. »Elementar einfach sogar.«
»Wir haben nie wirklich über Vaters Probleme geredet«, sagte Sherlock und blickte seinen Bruder an. »Du weißt, dass Onkel Sherrinford und Tante Anna mir davon erzählt haben?«
»Onkel Sherrinford hat mir geschrieben und berichtet, dass eine entsprechende Konversation stattgefunden hat. Ich kam zu dem Schluss, dass du bei Bedarf schon darüber reden würdest und für mich keine Veranlassung dazu bestand, das Thema grundlos anzuschneiden.« Er warf einen Blick auf Matty. »Und ebenso weiß ich, dass Master Arnatt während der Unterhaltung anwesend war, und ich vertraue ihm so weit, dass er jedwede daraus gewonnene Information für sich behält.«
Matty nickte ernst.
»Vater ist ein komplizierter Mann«, fuhr Mycroft fort. »Dich hat man vielleicht vor seinen Stimmungsschwankungen abgeschirmt, ich jedoch habe sie aus erster Hand miterlebt. Es gab Zeiten, da blieb er tagelang in seinem Arbeitszimmer und starrte einfach nur in die Luft, und andere, in denen er plötzlich um drei Uhr morgens beschloss, sämtliche Gemälde im Haus umzuhängen. Seine Zeit in der …« Er zögerte kurz. »… im Sanatorium ließ ihn zur Ruhe kommen, aber er wird immer exzentrisch bleiben. Zum Glück hat er einen von vier Karrierewegen eingeschlagen, in denen Exzentrik toleriert und belohnt wird, wenn sie mit Kompetenz einhergeht: und zwar in der britischen Armee. Bei den anderen handelt es sich natürlich um die Kirche, das Theater und die akademische Welt.«
»Interessant, dass Onkel Sherrinford beschloss, Predigten für Vikare im ganzen Land zu verfassen«, merkte Sherlock an. »Er hat sich nicht direkt der Kirche angeschlossen, aber tat das, was dem am nächsten kam. Ich denke, sein Geist ähnelte Vaters mehr, als er es selbst jemals zugegeben hätte.«
»Und wie interessant, dass du Violine spielst und ein starkes Interesse am Theaterleben an den Tag legst«, sagte Mycroft, ohne zu zögern. »Ich bin da selbstverständlich die Ausnahme … weder bin ich Professor noch Dozent.«
»Aber Charles Dodgson erzählte mir, dass du seiner Meinung nach das Zeug zu einem ausgezeichneten Wissenschaftler hättest, und er war sowohl überrascht als auch traurig, dass du in den Staatsdienst eingetreten bist«, erwiderte Sherlock.
»Mir fällt grade ein«, meldete sich Matty plötzlich zu Wort, »dass ich nicht mal weiß, wo eure Familie lebt.«
»Sussex«, sagte Mycroft. »In der Nähe einer kleinen Stadt namens Arundel. Unsere Familie besitzt dort ein großes Haus, ein paar Meilen außerhalb des Ortes.« Er blickte auf seine Uhr. »Die Reise wird etwa drei Stunden dauern, und wir werden einige Male umsteigen müssen. Oh, was mich an etwas erinnert …« Er klopfte auf seine Tasche, ließ dann die Hand hineingleiten und zog einen Briefumschlag hervor. »Der ist vor ein paar Tagen eingetroffen. Er ist von Vater, aus Indien. Ich dachte, du möchtest ihn vielleicht lesen.«
Mycroft legte den Brief zwischen ihnen auf den Tisch. Sherlock starrte auf den Umschlag – starrte auf die vertraute Handschrift, die seltsamen indischen Briefmarken, die ihn zierten, und auf die diversen Knicke und Flecken, die er sich während seiner Reise zugezogen hatte. Da kam ihm ein schrecklicher Gedanke.
»Vater weiß nichts davon«, flüsterte er.
»Ich habe ihm auf den Brief geantwortet«, erwiderte Mycroft ebenso leise, »und ihm die tragische Nachricht überbracht.« Er hielt inne. »Darüber hinaus habe ich in einem gesonderten, privaten Schreiben seinen kommandierenden Offizier über den Trauerfall in unserer Familie informiert und ihn gebeten, ein Auge auf Vater zu haben, um sicherzugehen, dass … dass er mit der Nachricht fertig wird. In Anbetracht dessen, dass er sich so fern von zu Hause aufhält, und der Entbehrungen, denen die britische Armee in Indien ausgesetzt ist, habe ich kein großes Vertrauen, was die Stabilität seiner geistigen Verfassung anbelangt.«
Meine lieben Söhne,
zu den Verantwortungen eines Vaters gehört es, seinen Nachkommen die Weisheit weiterzugeben, die er sich während seiner Zeit auf Erden erworben hat. In Anbetracht der Tatsache, dass ich im Moment viele tausend Meilen von Euch entfernt bin und mich höchstwahrscheinlich noch einige Zeit in dieser geographischen Lage befinden werde, bin ich außerstande, dies zu tun. Ich habe hier einen Großteil meiner freien Zeit damit zugebracht, mir das Hirn zu zermartern auf der Suche nach kleinen philosophischen Edelsteinen, die Euch von Nutzen sein könnten. Aber mir ist nichts eingefallen, was Ihr nicht ohnehin bei Platon, Sokrates und auf den Seiten des Punch-Magazine finden könntet (und es vermutlich auch schon getan habt). Alles, was mir somit zu tun bleibt, ist, Euch ein paar Eindrücke von der Umgebung, den Menschen und den Ereignissen hier in Indien zu vermitteln – das so völlig anders ist als unser schönes England, das Land, das wir alle so lieben und von dem ich jede Nacht träume.
Ich erinnere mich, in früheren Briefen etwas über die Landschaft dieses merkwürdigen Landes geschrieben zu haben – über die flachen Ebenen, die Berge, die Flüsse und Städte. Ich erinnere mich ebenfalls, mich über das Wetter ausgelassen zu haben, das entweder viel zu heiß oder viel zu heiß und viel zu feucht zugleich ist. Ich glaube, Euch ebenfalls einen Eindruck von den unterschiedlichen Menschen vermittelt zu haben, die diese Gegend hier als Heimat bezeichnen. Was ich vielleicht nicht getan haben mag, ist, den Versuch zu unternehmen, Euch einmal darzulegen, wie mein Alltagsleben hier aussieht. Ihr mögt vielleicht den Eindruck haben, dass ich als Angehöriger der britischen Armee zwangsläufig die ganze Zeit über in Kämpfe verwickelt bin. Ihr mögt Euch gar Sorgen um mich machen. Ich kann Euch jedoch versichern, dass ich beträchtlich mehr Zeit mit dem Polieren meiner Uniformknöpfe, meines Gürtels und meiner Stiefel verbringe als im Kampf und dass ich mehr von Krankheiten und Schlangenbissen bedroht bin als von feindlichen Kugeln oder Messern.
Ich denke, ich sollte ein paar Worte über die strenge Gesellschaftshierarchie verlieren, womit ich jene der hier lebenden Engländer meine, nicht die der Inder selbst (auch wenn wir, wie es scheint, einige ihrer Vorstellungen übernommen haben). Die hiesige Crème de la Crème bezeichnet man als Brahmanen – ein Wort, das übrigens von den Indern stammt, die seit Jahrtausenden ein sehr starres Kastenwesen besitzen. Ebenso wie in den indischen Kasten üblich, halten sich die Angehörigen unserer verschiedenen Gesellschaftsschichten an ihresgleichen – niemand verkehrt jemals in Kreisen außerhalb seinesgleichen. Wenn man es dennoch versucht, wird man gemeldet und disziplinarischen Maßnahmen unterzogen, und beharrt man trotzdem darauf, kann es gut und gern geschehen, dass man in Ungnade nach Hause geschickt wird. Zu den Brahmanen zählen die Mitglieder des Indian Civil Service – also diejenigen, die dieses Land tatsächlich regieren und lenken. Unter ihnen stehen die Semibrahmanen, die Angehörigen der diversen anderen Regierungsabteilungen, wie zum Beispiel die Forstverwaltung und die Polizei. Darunter folgen die Streitkräfte, und das ist auch die Position, an der ich meinen Platz habe. Wiederum darunter sind die Geschäftsleute angesiedelt – also jene, die im Handel und der Wirtschaft tätig sind –, gefolgt von Kaufmännern, Ladenangestellten und dergleichen. Am oberen Boden der Gesellschaftsordnung sind die Dienstboten angesiedelt und am untersten all jene englischstämmigen Leute, deren Familien aus welchen Gründen auch immer beschlossen haben, sich hier in Indien niederzulassen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen.
Das unterschied sich, dachte Sherlock, nicht allzu sehr von den diversen Schichten der britischen Gesellschaft. Selbst an seiner alten Schule hatte es einen sehr deutlichen Unterschied zwischen jenen Schülern gegeben, die der Aristokratie entstammten, und jenen, deren Väter in der Armee dienten, aus der Wirtschaft kamen oder nur ein Gewerbe betrieben.
In Anbetracht dessen, dass jede Schicht der englischen Gesellschaft hier in Indien ausnahmslos nur mit ihresgleichen verkehrt, komme ich weder mit den Brahmanen noch mit den Semibrahmanen und Geschäftsleuten ins Gespräch, es sei denn aus geschäftlichen Gründen. Ich verbringe viel Zeit im Quartier, wie wir den Militärstützpunkt nennen, in dem mein Regiment stationiert ist. Das Leben hier wird von diversen Truppenparaden bestimmt und gestaltet sich nicht nur als äußerst vorhersehbar, sondern auch als ebenso langweilig. Vor etwa einem Monat zum Beispiel trug einer der Soldaten gerade einen Teller mit Essen von der Messe in seine Unterkunft, als plötzlich ein Adler vom Himmel herabstieß, sich das Fleisch vom Teller schnappte und damit davonflog. Wir reden immer noch darüber, selbst jetzt. So sehr langweilen wir uns.
Den Höhepunkt unseres Lebens hier im Quartier stellen die formellen Dinner dar. Das Essen ist es gewiss kaum wert, darüber zu berichten, weswegen ich es bisher auch nicht getan habe. Wegen der extremen Hitze und der schnellen Verbreitung von Krankheiten muss jedes geschlachtete Tier auf der Stelle verzehrt werden, andernfalls würde das Fleisch verderben. Was Letzteres anbelangt, so ist es stets zäh … zähes Hühnchen, zäher Hammel und zuweilen zähes Rind (auch wenn Letzteres die Einheimischen verärgert). Die Einheimischen, die dem Hinduismus angehören, verehren Kühe und fühlen sich sehr gekränkt, wenn wir sie essen. Das Fleisch ist gewöhnlich mit starken Gewürzen zubereitet, was hilft, es bekömmlicher zu machen.
Die formellen Militärdinners bestehen aus sieben bis acht Gängen, und wir werfen uns zu diesem Anlass natürlich in Schale: sprich Rockschöße, gebügelte Hemden mit steifen Kragen und Ärmelaufschlägen samt weißen Westen. Diese Konventionen werden sogar draußen auf Wachpatrouille in der Umgebung des Quartiers eingehalten, und ich habe Leute gesehen, die für das Dinner aus der Wildnis auf dem Kamel angeritten kamen und dennoch ihre formelle Kleidung trugen. Im Quartier lautet die strikte Regel, dass niemand den Tisch verlassen darf, solange der kommandierende Regiment-Colonel sich nicht zurückgezogen hat. Was in der Praxis bedeutet, dass, falls im Vorfeld in der Bar bereits einige Flaschen Wein geleert wurden, eine Menge zunehmend unangenehmer werdender Männer mit am Tisch sitzen, während das Dinner seinen Lauf nimmt!
Während ich diesen Brief schreibe, ist hier schon Sonntag, auch wenn die Sonne, die just in diesem Moment so heiß auf uns herabbrennt, erst noch zu Euch kommen muss; und wenn sie dann auf Euch scheint, wird es hier bereits dunkel sein. Ich habe heute Morgen den Gottesdienst besucht, wie wir alle es jeden Sonntag tun. Die Kirche ist genauso wie daheim in England, und manchmal, wenn wir dort alle versammelt sind und unsere Choräle singen und beten, könnte man sich vorstellen, dass wir überhaupt nicht in Indien sind, sondern wieder daheim, in Aldershot zum Beispiel. Zumindest könnte man das, wären da nicht die Hitze, die von den Steinen abgegeben wird, die Insekten, die uns um die Köpfe schwirren, und die Tatsache, dass in das Holz der Kirchenbänke Aussparungen geschnitzt sind, in denen wir unsere Waffen lassen können. Ja, wir nehmen unsere Waffen mit in die Kirche. Ich frage mich, was Jesus angesichts seiner Aversionen gegen die Geldwechsler im Tempel davon wohl gehalten hätte.
Ich erwähnte bereits das Wetter, das entweder viel zu heiß oder viel zu heiß und viel zu feucht ist. Wir träumen von der Kälte und vom Schnee. Die exzessive Hitze hier führt zu vielen Problemen, und zwei von ihnen sind Krankheiten und Insekten. Was die Krankheiten anbelangt, könnte ich mittlerweile ein ganzes Buch darüber schreiben. Als Beispiel mag es jedoch genügen anzuführen, dass es hier etwas gibt, das als Miliaria bezeichnet wird – was zwar sehr zivilisiert klingt, in Wirklichkeit aber bedeutet, dass deine Haut so dicht von juckenden Pickeln bedeckt ist, dass man nicht einmal eine Nadel zwischen sie stecken könnte. Ich habe gesehen, wie sich ein Mann, der sich zu Beginn eines Dinners leicht kratzte, am Ende mit den Fingernägeln so heftig über Kinn und Hals fuhr, dass er blutete. Was die Insekten anbelangt, so treten sie in Zyklen auf. In der einen Woche sind überall Stinkwanzen – sei es nun in deinem Bettzeug, deiner Suppe oder im Tintenfass. Sie sind eigentlich harmlos. Es sei denn, man zerquetscht sie, in welchem Fall sie einen zutiefst entsetzlichen Gestank absondern. In der anderen Woche sind die Stinkwanzen dann auf einmal fort, jedoch nur, um von einer bestimmten Mottenart abgelöst zu werden, die, wenn man sie geistesabwesend von der Hand streift, auf der sie sich niedergelassen haben, eine brennende chemische Substanz darauf hinterlassen.
Man bezeichnet den Ort hier auch als »Land des plötzlichen Todes«. Aber es gibt Zeiten, in denen ich mich frage, ob der Tod nicht einem Leben in permanentem Unbehagen, ständigem Schmerz, dauernder Langeweile und Qual vorzuziehen wäre.
Ich sollte jetzt aufhören zu schreiben, sonst sage ich noch Dinge, die ich besser für mich behalten sollte. Bitte schreibt mir – es sind Eure Briefe, neben denen von Eurer Mutter und Eurer Schwester, die mich bei gesundem Verstand halten.
Mit freundlichen Grüßen
Euer Euch liebender Vater
Siger Holmes
Sherlock las den Brief zu Ende und faltete ihn äußerst sorgsam wieder zusammen. Schweigend gab er ihn Mycroft zurück. Es war nicht nötig, etwas zu sagen. Aus den Worten ihres Vaters ging eindeutig hervor, dass sich sein Geisteszustand dort im fernen Indien verschlechterte. So schmerzvoll es bereits für Sherlock gewesen war – was mochte die Nachricht, dass seine Ehefrau, ihre Mutter, während seiner Abwesenheit gestorben war, erst bei seinem Vater bewirken?
2
Die Fahrt zum Familiensitz, der seit Generationen im Besitz der Holmes war, dauerte einige Stunden. Das lag nicht so sehr an der Entfernung, denn Arundel, wo Sherlock geboren und aufgewachsen war, befand sich in Luftlinie nicht allzu weit von Oxford entfernt. Vielmehr war die Reise mit mehrmaligem Umsteigen und ausgiebigem Herumgesitze in kleinen Teestuben verbunden, während sie auf die Ankunft des nächsten Zuges warteten. Matty war munter wie immer und brachte es fertig, in jeder Teestube ein Stück Kuchen zu verputzen, wohingegen Mycroft nicht nach Reden zumute zu sein schien und Sherlock genauso empfand. Das war nicht die Art von Familienwiedersehen, die er sich erträumt hatte.
Das Wetter war schön, und als sie wieder in einem Zug saßen, starrte Sherlock durch das Fenster auf die vorbeiziehende Landschaft hinaus. Die schiere Anzahl und die Verschiedenartigkeit der Menschen und Orte, die es in England gab, faszinierten ihn. Wohin sein Blick auch glitt, überall waren Leute zu sehen, die auf den Feldern Getreide schnitten und bündelten, Äpfel oder Birnen in Obstgärten ernteten oder Karren lenkten, die turmhoch mit Heu beladen waren. In jedem Bahnhof, den sie erreichten – sei es, dass sie dort Station machten oder lediglich durchfuhren –, schien es nur so vor Reisenden und Leuten zu wimmeln, die irgendjemanden abholen wollten. Da gab es Geschäftsleute in Anzügen, Arbeiter in grober Kleidung, alte Damen mit Körben oder junge Damen mit ausladenden Röcken und winzigen Jäckchen, und überall waren Hunde zu sehen, große und kleine, die umherliefen und einander jagten. Die ganze Bandbreite des menschlichen Lebens war dort vor ihnen ausgebreitet, und Sherlock ertappte sich unversehens bei dem Versuch, anhand von kaum sichtbaren Spuren auf Händen oder Kleidung die Geschichten der verschiedenen Reisenden zu enträtseln. Bei einem Mann, mit dem sie sich einige Zeit lang das Abteil teilten, handelte es sich um einen ehemaligen Soldaten, dem Glanz seiner Schuhe sowie der Kürze seines Haars und der Art nach zu schließen, wie er steif und aufrecht dasaß. Eine Lady, die sich einige Minuten bei ihnen niederließ, machte sich hektisch am Fenster zu schaffen, bevor sie schließlich mit hörbar verärgertem Schnauben in ein anderes Abteil davonzog. Doch sie war nicht so gut situiert, wie ihre Kleidung zunächst vermuten ließ, berücksichtigte man die Tatsache, dass ihr Schuhwerk mehrere Male neu besohlt und ihre Jacke von einem einigermaßen kompetenten Kurzwarenhändler geflickt worden war. Ein Pfarrer verwickelte sie eine Weile lang in ein Gespräch. Doch Sherlock war sich ziemlich sicher, dass er überhaupt kein Pfarrer war. Seine Bibelkenntnis erwies sich auf Sherlocks Befragung hin definitiv als lückenhaft, und dauernd versuchte er, das Gespräch auf ein allgemeineres Thema zu lenken. Sherlock fing Mycrofts Blick auf und stellte amüsiert fest, dass sein Bruder ein Lächeln unterdrückte. Als der Pfarrer schließlich ihren Waggon verließ, brachen die beiden unversehens in Gelächter aus, sehr zu Mattys Überraschung.
»Sollen wir die Polizei rufen?«, brachte Sherlock immer noch lachend hervor.
»Sich als Pfarrer auszugeben ist keine Straftat, soweit es mir bewusst ist«, erwiderte Mycroft, dessen schwerer Körper vor unterdrückter Heiterkeit bebte.
»Aber es könnte sich um einen verkleideten Sträfling auf der Flucht handeln oder um einen Trickbetrüger, der eine Kirchengemeinde um ihre Kollekte bringen will.«
»Oder er könnte einfach nur ein trauriges Individuum sein, das irgendein merkwürdiges Vergnügen daraus zieht, sich als Geistlicher zu verkleiden. Das können wir nicht wissen, und es gibt keinen Grund, seinen Schwindel zu durchkreuzen, sieht man einmal von unserer Neugierde ab. Lass gut sein, Sherlock.«
Als sie sich ihrem Reiseziel näherten, erkannte Sherlock nach und nach einige Landschaftsmerkmale wieder. Der Anblick ließ nostalgische Gefühle in ihm erwachen. Er hatte gute Erinnerungen an Arundel – sowohl was die Stadt anbelangte als auch die große Kathedrale. Arundel lag unweit der Stadt Chichester, und folglich waren die Häuser von beachtlicher Größe und die dort lebenden Familien wohlhabend. Die Holmes-Familie entstammte einer Linie lokaler Gutsherren; und auch wenn sie über wenig oder gar keine wirkliche Macht oder Einfluss in der Gegend verfügten, so waren sie doch gut angesehen und wurden zu allen Ereignissen, Feiern und Dinnerveranstaltungen eingeladen. Sherlocks Kindheit war ausgefüllt gewesen von langen Wanderungen in der Natur und vielen in der Familienbibliothek verbrachten Stunden. Zusammen mit seinem Bruder hatte er sich dort gierig durch die Klassiker gelesen, während sie für Stunden jeweils in ihrem Sessel saßen, ohne ein Wort miteinander zu wechseln und die Stille genießend. Und dann waren da noch Dinge wie Frösche und Raupen gewesen, die er immer im Gepäck seines Bruders versteckt hatte, wenn Mycroft zu Semesterbeginn wieder zur Universität aufbrach. Die Erinnerungen an seine Mutter und seinen Vater waren weniger klar … sie waren fürsorglich und liebevoll gewesen – wenn auch aus einer ziemlichen Distanz, hatten sie die beiden Brüder doch weitgehend sich selbst überlassen. Sherlock hatte seinen Vater hauptsächlich als Mann mit riesigem Schnurrbart und dröhnendem Lachen in Erinnerung. Aber er erinnerte sich auch daran, dass es da noch eine andere Seite an seinem Vater gegeben hatte – einem Mann, der sich hin und wieder mit einer Flasche Brandy in seiner Bibliothek einschloss, um erst wieder herauszukommen, wenn diese leer war, oder der tagelang mit niemandem im Haus auch nur ein einziges Wort wechselte. Wie Kinder es eben taten, hatte Sherlock die Tatsache einfach akzeptiert, dass sein Vater Stimmungsschwankungen unterlag. Aber erst zu einem späteren Zeitpunkt, nachdem er mit seiner Tante und Onkel Sherrinford gesprochen hatte, war ihm bewusst geworden, dass die Probleme seines Vaters tiefer reichten als das. Im Gegensatz zu seinem Vater, dessen Stimmungsschwankungen abrupter und drastischer Natur waren, hatte sich seine Mutter eine Weile lang durch eine distanzierte Anwesenheit ausgezeichnet. Dann hatte sich ihre Verfassung langsam und allmählich verschlechtert, bis sie kaum mehr als ein Geist gewesen war, der sich durch das Haus bewegte. Darüber hinaus hatte sie gehustet, mit der Zeit mehr und mehr, und dann war da noch der gelegentliche Anblick von Blut in einem Taschentuch. Irgendwie hatten sich diese Dinge in Sherlocks Erinnerung eingefügt, ohne dass er sie hinterfragte. Aber so rückbetrachtet, war es nun ganz offensichtlich für ihn, dass seine Eltern über lange Zeit krank gewesen waren, wenn auch auf sehr unterschiedliche Weisen.
Schließlich begann der Zug seine Fahrt zu verlangsamen, als sie sich Arundel näherten. Sherlock merkte, wie sein Herz schneller schlug. Es war eine ganze Weile her, dass er daheim gewesen war, und er fragte sich, wer sich mehr verändert hatte – er oder sein altes Zuhause.
Als sie die Bahnstation verließen – bei der es sich um kaum mehr als zwei Bahnsteige und eine kleine Schalterhalle am Ende eines schmalen Feldweges handelte –, sah Sherlock, dass bereits ein geschlossener Einspänner auf sie wartete. Einen Moment lang erwartete er, einen der Familienbediensteten an den Zügeln zu sehen, und versuchte verzweifelt, sich die Namen derjenigen ins Gedächtnis zu rufen, an die er sich noch erinnerte. Doch verblüfft stellte er gleich darauf fest, dass niemand anderes als Rufus Stone auf dem Kutschbock saß.
»Mr Holmes«, sagte er, sich an den Hut tippend, förmlich zu Mycroft, dann noch einmal »Mr Holmes« zu Sherlock und schließlich »Master Arnatt« an Mattys Adresse, ohne die geringsten Anstalten zu machen, das Lächeln in seinem Gesicht zu unterdrücken.
Matty nickte nur lächelnd zurück und setzte sich in Bewegung, um sich mit dem Pferd bekannt zu machen, das geduldig auf den Befehl zum Lostrotten wartete.
»Rufus«, rief Sherlock. »Was machst du denn hier?«
![Young Sherlock Holmes. Tödliche Geheimnisse [Band 7] - Andrew Lane - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/c12797d457efeeaddcae14866eb06c53/w200_u90.jpg)
![Young Sherlock Holmes. Der Tod liegt in der Luft [Band 1] - Andrew Lane - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/3ad6f6cc1cab9f4bc553d4249980a81e/w200_u90.jpg)
![Young Sherlock Holmes. Eiskalter Tod [Band 3] - Andrew Lane - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/685199e56b80e22abcd87a127b9ebc02/w200_u90.jpg)
![Young Sherlock Holmes. Das Leben ist tödlich [Band 2] - Andrew Lane - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/93c647bcf27707e758dc615174b1bc64/w200_u90.jpg)
![Young Sherlock Holmes. Daheim lauert der Tod [Band 8] - Andrew Lane - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/8c36381d12f958c576900190c998b87a/w200_u90.jpg)
![Young Sherlock Holmes. Nur der Tod ist umsonst [Band 4] - Andrew Lane - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/26ceba7462166b4ff1e5cc8e78327c66/w200_u90.jpg)
![Young Sherlock Holmes. Der Tod kommt leise [Band 5] - Andrew Lane - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/55c6460c63f812649f84beff8b78f4e2/w200_u90.jpg)
![Young Sherlock Holmes. Der Tod ruft seine Geister [Band 6] - Andrew Lane - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/0bdc6a0ff0ad4f6d9f6e245376d2935f/w200_u90.jpg)