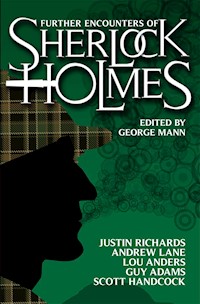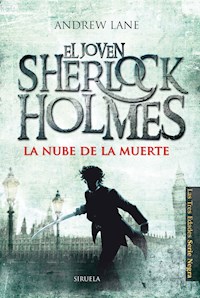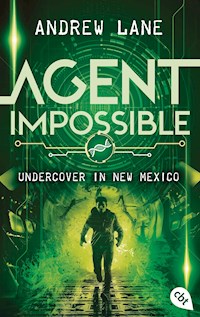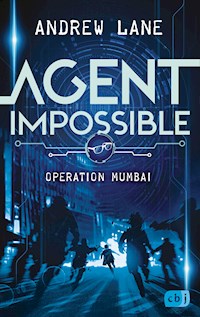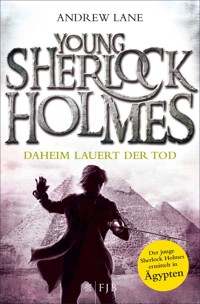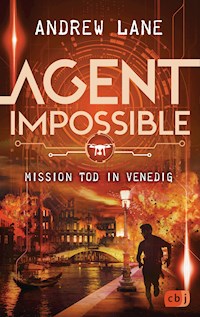
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die AGENT IMPOSSIBLE-Reihe
- Sprache: Deutsch
Agent Without Licence – in tödlicher Gefahr
Special Agent Bex ist auf dem Weg zu Kieron, um ihm zu sagen, dass er nicht mehr als Agent arbeiten kann. Doch Sekunden, nachdem sie aus ihrem Auto gestiegen ist, explodiert es in einem flammenden Inferno. Um Kieron in Sicherheit zu bringen, fährt sie mit ihm zu dem geheimen Apartment, das sie angemietet hat – nur um dort den nächsten Sprengsatz zünden zu sehen. Jemand will ihr Team ausschalten. Aber wer? Der geheimnisvolle Killer scheint nichts von Kieron zu wissen und das ist ihre Chance. Schon steckt Kieron mitten in einer neuen Jagd auf Leben und Tod.
Young Sherlock Holmes-Autor Andrew Lane liefert mit »Agent Impossible« atemlose Spannung und rasante Action.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Andrew Lane
Mission Tod in Venedig
Aus dem Englischen
von Tanja Ohlsen
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »AWOL 3: Last boy standing« bei Piccadilly Press, London, einem Imprint von Bonnier Zaffre Ltd., London, in der Verlagsgruppe Bonnier.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
© 2019 für die deutschsprachige Ausgabe cbj Kinder- und Jugendbuch Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
© Andrew Lane, 2019
Aus dem Englischen von Tanja Ohlsen
Lektorat: Luitgard Distel
Covergestaltung: Guter Punkt GmbH & Co. KG
Covermotiv: iStockphoto (kckate16, OSTILL, faust, Marseas, Yun Heng Lin, Andrew_Mayovskyy, Pixtum, nanmulti)
kk • Herstellung: AJ
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN 978-3-641-22436-3V002
www.cbj-verlag.de
Gewidmet Mike Nicolson, Richard Cooper, Soo Cox, Mark Lawson, Ali Smith, Jerry Foulkes, Anissa Suliman, Mark Brookes, Nigel Douglas, Peter Bradshaw und den anderen vierzig Teenagern, die 1980 den Schreibwettbewerb der Barclay Bank gewannen. Mit ihnen verbrachte ich zwei unglaubliche Wochen in Europa, bis wir schließlich in Venedig landeten. Siebenunddreißig Jahre später schreibe ich darüber, wie es war, als Teenager in der romantischsten Stadt der Welt zu sein. Und Caroline Vass gewidmet, von der ich dachte, sie würde bei dieser Reise dabei sein, die es aber nicht schaffte.
Kapitel 1
»Wie heißt du?«, fragte das rothaarige Mädchen Kieron lächelnd.
»K-Kieron«, stotterte er. »Und du?«
Seufzend tippte sie auf das Namensschild an ihrer Bluse. »Beth. Und ich brauche deinen Namen nur, damit wir dich aufrufen können, wenn dein Kaffee fertig ist.« Demonstrativ schrieb sie Keiron mit einem Eddingauf ein Post-it und klebte es an eine Tasse. »Also, wenn er fertig ist, klar?«
»O ja, klar.« Er fragte sich, ob er anmerken sollte, dass sie seinen Namen falsch geschrieben hatte, hielt aber doch lieber den Mund. Jeder schrieb seinen Namen falsch. Entweder schrieben sie ihn wie das Mädchen oder am Ende mit »a« anstatt »o«. Er hatte sich daran gewöhnt. Einmal hatte er seine Mutter gefragt, warum sie und sein Dad ihm seinen Namen mit der unüblichsten Schreibweise verpasst hatten, die es gab.
»Ach«, hatte sie vage geantwortet, »haben wir? Ich glaube, so hieß einer der Freunde deines Vaters. Der war wohl auch auf unserer Hochzeit.« Stirnrunzelnd hatte sie ergänzt: »Oder war es Keely? Nein, das war ja die, mit der er durchgebrannt ist.« Dann hatte sie sich die Flasche Rosé vom Küchentresen gegriffen.
»Sonst noch etwas?«, fragte die rothaarige Barista fröhlich. »Vielleicht etwas zu essen?«
Kieron sah zu den Kühlregalen zu seiner Rechten. »Äh … Was kannst du denn empfehlen?«
»Der glutenfreie Zitronenkuchen ist sehr gut.«
Was wohl hieß, dass sie nicht genug davon verkauften und gern ein paar Stücke loswerden wollten, dachte er zynisch.
»Danke, nur den Kaffee«, antwortete er.
Er reichte ihr einen Fünf-Pfund-Schein und war etwas erstaunt darüber, wie wenig Rückgeld er bekam. Dann ging er zum Ende des Tresens, wo auf magische Weise sein Kaffee auftauchen würde – mit falsch geschriebenem Namen. Na ja, solange sie ihn richtig aussprachen, war es ihm eigentlich egal.
Er sah sich um. Das Café war neu und lag in einer Nebenstraße in der Nähe des Einkaufszentrums, in das er normalerweise ging. Bex hatte ihn vor ein paar Wochen hierher mitgenommen, als sie aus Amerika zurückgekommen waren. Hier lagen die etwas ungewöhnlicheren Läden – wo schwarze und lila Damenkleidung mit jeder Menge Spitze oder Stickerei verkauft wurde und Männerkleidung, die viel zu eng schien und für die man wohl einen Hipster-Bart tragen musste, bevor man sie auch nur anprobieren durfte. Und außerdem gab es einen Comic- und Spieleladen. Da arbeitete jemand, den er von der Schule kannte. Wenn der Geschäftsführer nicht da war, bekam er manchmal Angestelltenrabatt.
»Kieron?«
»Ja?« Er sah sich um. Es war Beth.
»Dein Kaffee ist fertig.«
»Danke.«
Er hatte seine Sachen auf einen Tisch für zwei gelegt, um ihn zu reservieren. Dort wartete seine Tasche mit dem Laptop und seinen Schulbüchern.
Er starrte auf die Schulbücher und spürte, wie ihn eine Welle der Verzweiflung erfasste. Gleich nach seiner Rückkehr aus Amerika hatte das neue Schuljahr begonnen, aber es war nicht gut gelaufen für ihn. Nach drei Tagen hatten die »Emo!«-, »Greeb!«- und »Loser!«-Rufe angefangen, gefolgt von: »Lass dir mal die Haare schneiden!« Jemand hatte sogar seinen Spind mattschwarz gestrichen, ohne dabei erwischt zu werden. Das hätte ihm ja noch gefallen, wenn die Farbe nicht auf die Schränke darunter und auf den Fußboden getropft wäre und wenn er nicht eine ganze Stunde gebraucht hätte, um den Direktor davon zu überzeugen, dass er das nicht gewesen war.
»Suchen Sie nach jemandem mit schwarzer Farbe auf den Klamotten!«, hatte er protestiert, woraufhin der Direktor nur einen vorwurfsvollen Blick auf Kierons schwarze Hosen, seine schwarze Jacke, schwarzen Schuhe und sein schwarzes T-Shirt geworfen hatte.
Eine Woche lang hatte er es ausgehalten, doch am folgenden Montag war er nicht mehr aus dem Bett gekommen. Er lag einfach da, zu einem Ball zusammengerollt, und versuchte sich dazu zu zwingen, den Rest des Tages zu verschlafen. Seine Mutter hatte ihn so gefunden. Er rechnete es ihr hoch an, dass sie sich den Vormittag freigenommen hatte, um mit ihm zu reden, und dass sie am nächsten Tag mit dem Direktor ausgehandelt hatte, dass er seine Schularbeiten zu Hause machen und per E-Mail schicken konnte. Sam war natürlich wütend gewesen. »Warum können die das nicht auch für mich machen?«
Die offensichtliche Antwort darauf lautete: Wenn die anderen dich beschimpfen, haust du ihnen eine rein, und dann hören sie damit auf. Kieron hatte ihm das gesagt. Sam schien hin- und hergerissen zu sein zwischen: Warum schlägst du nicht auch zu?, und: Wenn ich ihnen eine reinhaue, fliege ich dann von der Schule? Letztendlich ließ ihn der Versuch, zwei Dinge gleichzeitig zu sagen, nur stammeln.
Zu Hause zu arbeiten, schien die perfekte Lösung zu sein. Doch wenn seine Mutter arbeitete, war es einsam in der Wohnung, und er hatte sich unwohl gefühlt. Erst hatte er versucht, das Gefühl durch laute Screamo-Musik zu vertreiben, bis die Nachbarn an die Wände geklopft hatten. Danach hatte er es sich zur Gewohnheit gemacht, am Vormittag irgendwo einen Kaffee zu trinken. Das kostete ihn ein Vermögen, auch wenn er es schaffte, eine Stunde an einem Latte macchiato herumzunuckeln, wenn er sich anstrengte.
Also, zurück zu dem Versuch, die Ablenkung des Magnetfelds einer Spule in einem Stromkreis zu beweisen. Dazu brauchte man Integrale. Er hasste Integrale.
Als er sich setzte, wanderte sein Blick zu seinem Rucksack. In einem Brillenetui lag die AR-Brille, die er – vor mittlerweile schon einigen Monaten – auf einem Tisch im Restaurantbereich des Einkaufszentrums gefunden hatte. Sie hatte ihm eine Welt voller Abenteuer, Spannung und Gefahren eröffnet. Und sie hatte ihn mit Bex und Bradley zusammengebracht, den beiden MI6-Agenten (na ja, eigentlich selbstständige Agenten, wie Bex immer sagte). Das hatte sein Leben verändert. Sie hatten ihm Selbstvertrauen gegeben. Ihm ihr Leben anvertraut. Und mit dieser Brille konnte er auf jeden Computer der Welt zugreifen – nicht nur die allgemein zugänglichen – wie das Internet –, sondern auch auf gesicherte Datenbanken. Geheime Datenbanken.
Also warum musste er in mühevoller Arbeit mathematische Gleichungen lösen, wenn die Summe allen menschlichen Wissens direkt hier vor ihm in seiner Tasche lag? Warum musste überhaupt jemand irgendetwas lernen, wenn man nur fragen musste und in ein paar Sekunden die Antwort erhalten konnte?
Er seufzte. Eigentlich wusste er es ja – so ungefähr. Weil Intelligenz bedeutete, diese Dinge zu kennen, sie anwenden und weiterentwickeln zu können. Zumindest hätten das seine Lehrer gesagt. Was würde er auf einer einsamen Insel tun oder wenn – Gott bewahre – das Internet wegen eines Zombieangriffs ausfiel? Wäre er dann in der Lage zu überleben?
Doch wenn während eines Zombieangriffs sein Überleben davon abhinge, die Ableitung des Magnetfeldes einer Spule in einem Stromkreis berechnen zu können, hätte er ein ernsthaftes Problem.
Seufzend klappte er seinen Laptop auf, lehnte sich auf dem Stuhl zurück und nippte an seinem Kaffee. Vor ein paar Wochen noch war er mit etwas, was man nur als militärischen Hightech-Raketenrucksack bezeichnen konnte, durch die Luft geflogen und hatte sein Leben riskiert, um zu verhindern, dass ein durchgeknallter Milliardär biologisch entwickelte Viren verkaufte, die bestimmte Menschengruppen aufgrund ihrer DNA angriffen. Und ein paar Wochen davor hatte er Bex geholfen, die Zündung mehrerer Neutronenbomben auf der ganzen Welt zu verhindern. Und jetzt saß er hier in einem Café, das nach verbrannten Kaffeebohnen roch, und versuchte, nicht die hübsche rothaarige Barista anzustarren.
Das Leben war fies. Und mit niemandem außer Sam konnte er darüber reden, warum es fies war. Es lag nicht nur am Mobbing. Es lag nicht daran, dass er sich einsam fühlte, als Außenseiter – darauf war er sogar eigentlich stolz. Nein, es war der gewaltige Unterschied zwischen dem Leben, das er in diesen vergangenen Wochen gelebt hatte, und dem, in das ihn das Leben – er fand kein besseres Wort dafür – zurückdrängen wollte.
Bex und Bradley zu helfen, war kein dauerhafter Zustand, das wusste er. Es war eine vorübergehende Lösung, ein letzter Ausweg, solange Bradley rein physisch nicht in der Lage war, die AR-Brille zu benutzen. Eigentlich sollte Bradley Bex bei ihren Missionen unterstützen, indem er ihr nützliche Informationen verschaffte wie die Grundrisse von Gebäuden oder die Identitäten der Menschen, die sie vor sich hatte. Wenn Bradley sich so weit erholt hatte, dass er wieder arbeiten konnte, und wenn sie herausgefunden hatten, wer in ihrer MI6-Abteilung mit der faschistischen Organisation Blut und Boden zusammenarbeitete, würden sie ihn nicht mehr brauchen. Und das war der eigentliche Grund, warum er nicht mehr in die Schule wollte. Und warum er deprimiert war. Es war, als fahre man im Auto auf der Autobahn und sehe die Ausfahrt, die man nehmen will – die man unbedingt nehmen muss –, an sich vorbeiziehen und wüsste, dass die Straße, auf der man feststeckt, sich immer weiter endlos und monoton hinzieht.
»Kommt ein Pferd in die Bar«, erklang eine Stimme hinter ihm, »fragt der Barkeeper: ›Warum machst du so ein langes Gesicht?‹«
Er erkannte Sams Stimme sofort. Ohne sich umzudrehen, schob er mit dem Fuß den Stuhl ihm gegenüber zurück, damit sich sein Freund setzen konnte.
»Also, warum ziehst du so ein langes Gesicht?«, wiederholte Sam, als er sich setzte. »Das sieht man ja schon von hinten.«
Kieron zuckte mit den Achseln.
»Kommt ein weißes Pferd in die Bar«, fuhr Sam fort. »Sagt der Barkeeper: ›Wir haben hier einen Whisky nach dir benannt.‹ Fragt das Pferd: ›Wie jetzt – Brian?‹«
»Solltest du nicht in der Schule sein?«, erkundigte sich Kieron.
Sam zuckte mit den Achseln. »Weißt du – wahrscheinlich schon.« Er schnüffelte. »Die haben die Kaffeebohnen verbrennen lassen. Das riecht man. Meine Mum weiß alles darüber. Sie hat sich Videos auf YouTube angesehen, wie man den perfekten Kaffee macht, von der Auswahl der richtigen Bohnen aus dem richtigen Land bis zum absolut optimalen Dampfdruck in der Maschine. Sie hat auch so eine schicke Kaffeemaschine. Hat Dad ihr letztes Jahr zu Weihnachten gekauft.« Er nickte zum Tresen. »So eine wie die da. Na ja, ich sage gekauft, aber es kann auch gut sein, dass sie irgendwo von einem Lastwagen gefallen ist. Kann man bei meinem Dad nie sagen.«
»Übrigens«, meinte Kieron, »dieser Witz funktioniert nur bei jemandem, der weiß, dass es einen Whisky namens White Horse gibt.«
»Ich dachte, den kennt jeder.«
»In deiner Welt vielleicht.«
Sam zuckte mit den Achseln. »Mein Onkel Bill trinkt nur den. Zu Weihnachten bekommt er von jedem aus der Familie eine Flasche – und das heißt, von jedem Einzelnen, nicht von allen zusammen eine. Und zum Geburtstag auch. Das reicht ihm gerade so übers Jahr.« Er hielt kurz inne. »Also, kommt ein Pferd in die Bar und sagt: ›Ich hätte gerne ein Bier.‹ Der Barkeeper reibt sich verwundert die Augen und fragt: ›Hast du etwa gerade gesprochen?‹ ›Ja, warum?‹, sagt das Pferd und der Barkeeper: ›Das ist unglaublich! Ich habe noch nie ein sprechendes Pferd gesehen. Du solltest zum Zirkus gehen – die hätten gerne jemanden mit deinen Fähigkeiten!‹ Fragt das Pferd: ›Wieso? Brauchen die einen Klempner?‹«
Dieses Mal kicherte Kieron. »Ja, okay, der war gut. Gefällt mir.«
»Ich denke darüber nach, eine Webseite einzurichten – mit den besten ›Kommt ein Pferd in die Bar‹-Witzen der Welt.«
»Wie viele hast du denn?«
Sam wand sich. »Du hast sie gerade gehört.«
»Nur die drei?«
»Ich könnte die Webseite ja auf andere Tiere ausdehnen. Kommt ein Bär in die Bar …«
»Nicht«, unterbrach ihn Kieron. »Lass es lieber.«
»Nur den einen! Also, kommt ein Bär in die Bar und sagt: ›Ich hätte gerne einen Beerenwein‹, und der Barkeeper fragt: ›Mit Beeren oder mit Bären?‹« Er starrte Kieron an. »Beeren. Wie in: Erdbeeren oder Himbeeren. Und dann Bären wie lebendige Bären.«
»Ja, war lustig, als du ihn erzählt hast, und lustig, als du ihn erklärt hast.« Zum ersten Mal sah Kieron Sam richtig an und setzte sich plötzlich kerzengerade auf. »Was ist passiert?«
»Nichts ist passiert.«
»Doch.«
»Nein, echt nicht. Nichts ist passiert.«
»Ich sehe es dir doch an. Ich kenne dich, und ich kenne deinen Gesichtsausdruck, wenn irgendetwas nicht stimmt. Und genau den hast du jetzt. Du könntest es dir auch gleich auf die Stirn schreiben. Also los – raus mit der Sprache!«
Sam seufzte. »Bestell mir einen Iced Latte und ich erzähle es dir.«
Auf dem Weg zum Tresen zählte Kieron verstohlen das Kleingeld in seiner Tasche und überprüfte die Preise auf der Tafel an der Wand. Das Geld reichte so gerade eben noch.
»Wie ist dein Name?«, fragte die Barista – Beth – ihn fröhlich.
»Immer noch Kieron«, antwortete er, was ihr Lächeln ein wenig ins Wanken brachte.
Nach einer Menge Hantieren mit einem Mixer, Eiswürfeln und einem doppelten Kaffee nahm Kieron das Getränk in Empfang und kehrte zum Tisch zurück.
»Also?«, fragte er, als er es vor seinem Freund abstellte.
»Also …«, seufzte Sam, »du kennst doch meinen Vater, oder?«
»Ja. Du hast ihn Bex einmal als einen ewigen Herumtreiber beschrieben, der keinen Job länger als eine Woche behält. Das waren so ziemlich exakt deine Worte.«
»Ja, klingt ungefähr richtig. Ich habe es mal nachgezählt: Er hatte echt knapp hundert verschiedene Jobs, einige davon gleichzeitig. Der längste, den er gemacht hat, waren drei Monate, der kürzeste drei Tage.« Sam starrte aus der Tür des Cafés auf die helle Straße draußen. »Die Sache ist die, dass er jetzt einen richtigen Job gefunden hat. Einen anständigen Job.«
»Das ist doch gut, oder?«
»Der ist in Southampton. So Zeug in Kreuzfahrtschiffe verladen, bevor sie auslaufen – Lebensmittel und so. Aber das bedeutet wohl wenigstens, dass es an Weihnachten bei uns Hummer und Champagner gibt.«
»Oh.« Kieron runzelte die Stirn und versuchte herauszufinden, worauf das alles hinauslief. »Was sagt deine Mum denn dazu? Ich weiß zwar, dass sie sich oft über ihn aufregt – wenn ich zu dir komme, höre ich ihre Streitereien manchmal schon eure halbe Straße runter –, aber ich glaube kaum, dass sie will, dass er wochenlang weg ist.«
»Will sie auch nicht. Hauptsächlich, weil sie Angst hat, dass er sich dort eine Freundin anlacht und das ganze Geld in den Pub trägt.« Sam zögerte. »Deshalb spricht sie auch davon, dass wir alle zusammen dorthin ziehen. Einen neuen Anfang machen, sagt sie. Wir alle zusammen. Das wird ganz toll. Nur – das wird es nicht.«
»Alle? Einschließlich Courtney?«
Sam schüttelte den Kopf. »Nein, Courtney nicht. Courtney ist raus. Sie hat einen guten Job und eine eigene Wohnung. Und einen Freund, obwohl Mum von Bradley noch gar nichts weiß. Aber Caitlin und Amber wohnen noch zu Hause, also würden sie mit nach Southampton ziehen. Und ich auch.«
Kieron hatte plötzlich das Gefühl, mitten in einem Minenfeld zu stehen. Wohin er auch trat, irgendetwas würde explodieren.
»Und was hältst du davon?«, fragte er vorsichtig.
»Ich halte es für dämlich.« Sam nahm einen Schluck von seinem Eiskaffee. »Ich meine, ja, na gut, es ist eine neue Stadt, und wenn jemand einen Neuanfang brauchen könnte, dann wir, aber …« Er schüttelte den Kopf. »Ich will keinen Neuanfang. Ich liebe Newcastle zwar nicht, aber ich bin daran gewöhnt. Ich kenne mich aus. Und …«
Er brach ab, aber Kieron glaubte zu wissen, was er hatte sagen wollen. Und du bist hier.
Er spürte einen Kloß im Hals und musste schnell blinzeln, um das Kribbeln in den Augen loszuwerden.
Das Gefühl von vorhin, in einem Auto zu sitzen, das in die endlose Langeweile fuhr? Die Landschaft, durch die das Auto fuhr, schien mit einem Mal immer trüber und trüber. Nur dürre Erde und gelegentlich ein Kaktus. Er hatte nur einen wirklichen Freund auf der Welt – Sam. Bex und Bradley waren vielleicht auch Freunde, aber sie waren älter, und er wusste insgeheim, dass die Bekanntschaft mit ihnen nur vorübergehend sein würde. In ein paar Wochen, höchstens Monaten, wären sie fort. Aber Sam … Er war davon ausgegangen, dass er und Sam immer weitermachen würden, bis ans Ende ihrer Schulzeit und darüber hinaus.
»Vielleicht«, begann er vorsichtig, »würde deine Mum dich bei uns wohnen lassen. Ich meine, zu dieser Zeit die Schule zu wechseln, würde sich sicher negativ auf deine Noten auswirken. Bei mir ist Platz und meine Mutter hätte bestimmt nichts dagegen.«
»Glaubst du, das wäre wirklich möglich?«, fragte Sam flehend.
»Ja, klar. Soll ich sie mal fragen?«
»Ja, bitte!«
Kieron bemerkte, dass Sams Kehle zuckte, als müsse er schlucken. Er reichte seinem Freund sein Wasserglas und Sam nahm dankbar einen großen Schluck.
»Aber über eines musst du dir klar sein«, meinte Sam. »Ich gehe nicht in die Schule und lasse dich allein zu Hause lernen.«
»Keine Sorge, da finden wir schon einen Weg.«
»Was willst du eigentlich nach der Schule machen?«, erkundigte sich Sam plötzlich.
»Keine Ahnung. Nur so herumhängen.« Dann verstand Kieron Sams Frage plötzlich. »Oh, du meinst, wenn wir mit der Schule fertig sind?«
»Ja.« Sam zuckte beiläufig mit den Schultern. »Hast du mal darüber nachgedacht, aufs College zu gehen?«
»Schon. Aber es ist schwierig, ein Fach zu finden, das ich wählen könnte. Ich hab schon mal an ein Filmstudium gedacht. Oder vielleicht Psychologie.«
»Psychologie – gute Idee. Versuch mal, unsere düsteren Teenager-Gedanken zu erklären.«
»Warum fragst du?«
»Ich habe darüber nachgedacht …« Sam klang plötzlich ungewohnt zögerlich. »Vielleicht könnten wir zusammen ein Unternehmen gründen. Irgendetwas, was uns richtig Geld einbringt.«
»Als Geheimagenten?« Kieron lachte. »Oder vielleicht als Privatdetektive?«
Sam runzelte die Stirn. »Ich dachte eher an Webseitendesign oder die Reparatur von Computern und Tablets und Handys, aber wenn du nur lachen kannst …«
»Nein.« Kieron zwang sich, ernst zu klingen. »Ehrlich gesagt, das ist keine schlechte Idee. Wir könnten vielleicht einen kleinen Raum in einem Industriegebiet mieten.« Vor seinem inneren Auge begann sich eine Vision aufzubauen, wie das alles aussehen könnte. »Wir müssten fahren lernen, zumindest ein Moped, damit wir die kaputten Sachen abholen und in die Werkstatt bringen können. Nein, streich das … Wir würden auf jeden Fall ein Auto brauchen. Einen kleinen PC kriegen wir vielleicht hinten auf einem Moped unter, aber keines der High-End-Geräte. Wir bräuchten etwas Geld für Ausrüstung und Platinen und Werkzeug und so. Vielleicht können wir einen Kredit aufnehmen. Ich frage meine Mutter mal danach.«
»Ehrlich gesagt, meine Mutter hat schon alle Informationen darüber«, warf Sam ein. »Es gibt so was wie Unternehmerkredite.«
Kieron nickte. »Abgemacht. So einen holen wir uns.«
»Abgemacht«, wiederholte Sam und streckte die Faust aus. Kieron boxte mit seiner dagegen.
Eine Weile unterhielten sie sich über die Dinge, die ihnen in den vergangenen Monaten passiert waren, und wie sich ihr Leben verändert hatte, während das aller anderen offensichtlich gleich geblieben war.
Schließlich war Kierons Latte macchiato genauso kalt wie Sams Eiskaffee, und er konnte beim besten Willen nicht weiter daran nippen, daher gingen sie.
»Willst du mit zu mir kommen?«, fragte Kieron. »Wir könnten uns etwas zu essen machen. Es müsste noch was im Kühlschrank sein.«
»Warum nicht«, erwiderte Sam. »Es besteht ja wohl gerade nicht die dringende Notwendigkeit, die Welt zu retten, soweit ich weiß.«
Kieron boxte ihn kräftig gegen den Arm.
Sie brauchten eine Dreiviertelstunde für den Weg. Es hätte auch schneller gehen können, aber zweimal mussten sie einen Umweg machen, um Gangs von Proll-Teenagern aus dem Weg zu gehen, die vor den Bars herumlungerten. Bittere Erfahrungen hatten sie gelehrt, dass sie, wenn sie ihnen zu nahe kamen, beschimpft, geschubst und bespuckt wurden. Kieron fand, dass die Kids Schilder um den Hals tragen sollten wie im Zoo: Bitte nicht die Prolls provozieren – sie beißen gern ohne Vorwarnung zu.
»Wir sind fast erwachsen«, meinte Sam düster, als sie bei einem dieser Umwege durch eine Seitenstraße kamen. »Wir sollten keine Angst mehr vor ihnen haben müssen.«
»Du setzt dich aufs hohe moralische Ross und ich besuche dich dann im Krankenhaus und bringe dir Weintrauben mit«, erklärte Kieron und sah sich vorsichtig um, ob sie verfolgt wurden.
»Wieso bringen die Leute einem immer Weintrauben, wenn man im Krankenhaus liegt?«, fragte Sam stirnrunzelnd. »Als ich mir den Arm gebrochen hatte, standen so viele Tüten mit Weintrauben neben meinem Bett, dass nichts anderes dort Platz hatte. Ich hätte alles für etwas vom Chinesen gegeben, aber daran hat niemand gedacht. Nur an Weintrauben.«
»Muss wohl etwas mit der EU zu tun haben«, erwiderte Kieron vage. »Da gibt es wohl so ein Gesetz über Krankenhäuser und Obst. Nur Weintrauben sind erlaubt. Und vielleicht noch Mandarinen.«
Als sie sich der Wohnung näherten, bemerkte Kieron das Auto seiner Mutter.
»Das ist seltsam. Sie müsste doch bei der Arbeit sein.« Er sah auf die Uhr. »Eigentlich sollte sie erst in ein paar Stunden kommen.«
Sam trat unruhig von einem Fuß auf den anderen. »Wenn ich lieber gehen soll …«
»Nein, komm mit rein. Wahrscheinlich ist nichts …«
Er steckte den Schlüssel ins Schloss und schob die Tür auf.
»Mum, ich bin zu Hause!«, rief er. »Und ich habe Sam mitgebracht!«
»Ich bin im Wohnzimmer«, rief seine Mutter. Es klang, als sei etwas mit ihrer Stimme nicht in Ordnung. Als ob sie an etwas erstickte.
»Geh schon mal in mein Zimmer«, sagte Kieron zu Sam. »Ich sehe nach ihr.«
»In Ordnung, wenn ich mir was zu trinken aus deinem Mini-Kühlschrank nehmen darf.«
»Klar, solange du noch was für mich übrig lässt.«
Während Sam durch den Flur in Kierons Zimmer ging, starrte Kieron auf die Tür zum Wohnzimmer. Plötzlich war ihm schlecht. Irgendetwas hatte sich verändert, und wie es schien, nicht zum Besseren. Es war, als hätte sein Leben gerade einen Satz gemacht und ihn aus dem Gleichgewicht gebracht, aber er wusste nicht, wie und warum. Wie ein emotionales Erdbeben ohne offensichtlichen Grund.
Er holte tief Luft und betrat das Wohnzimmer.
Seine Mutter saß auf dem Sofa und starrte auf den Fernseher. Nun, eigentlich hing sie mehr, als dass sie saß. Der Fernseher war zwar nicht eingeschaltet, aber sie starrte trotzdem auf den Bildschirm. Auf dem Tisch neben ihr standen zwei Flaschen neben einem halb vollen Glas, aber es war nicht der übliche Prosecco oder Rotwein. Eine war eine Flasche Gin, die andere eine Flasche Tonicwater.
Nun, zumindest trinkt sie den Gin nicht pur, dachte er.
»Hi, Mum.«
»Solltest du nicht zu Hause sein und deine Schularbeiten machen?«, fragte sie und sah ihn stirnrunzelnd an.
»Ich war in der Bibliothek«, sagte er automatisch. Es war zwar eine Lüge, aber wenn er ihr sagte, dass er zum Lernen in ein Café gegangen war, würde sie fragen, warum, und die Erklärung würde viel zu lange dauern. Da vermied er die Wahrheit lieber.
»Die Bibliothek?«, wiederholte sie. »Kannst du deine Informationen nicht im Internet finden?«
Ausgerechnet jetzt muss sie technologisch den Durchblick haben, dachte er.
»Das Internet reicht nur für das oberflächliche Zeug wie Namen, Daten und Gleichungen, aber wenn man tiefer in ein Thema eintauchen will, braucht man Bücher.«
»Oh. Okay. Gut zu wissen, dass Bibliotheken noch zu etwas gut sind.« Sie griff nach ihrem Glas und stellte überrascht fest, dass es leer war.
»Mum, was ist los?«
»Nichts. Nichts ist los.«
Sie drehte sich auf dem Sofa nach der Ginflasche um und goss eine ordentliche Portion in ihr Glas. Dann stellte sie die Flasche weg, hob das Glas und nahm einen tiefen Zug, ohne sich die Mühe zu machen, den Gin mit Tonic zu verdünnen.
»Doch, irgendetwas ist los. Willst du mir nicht sagen, was?«
Sie seufzte. »Na gut, setz dich.«
Er setzte sich in den Sessel ihr gegenüber. Plötzlich wollte er nicht mehr, dass sie etwas sagte. Er wollte gar nicht wissen, was los war. Wenn er es nicht wusste, dann war auch nichts Schlimmes passiert. Das war zwar nicht logisch, aber so fühlte es sich für ihn an. Es zu wissen, würde es real machen.
»Sam ist hier«, sagte er. »Er ist in meinem Zimmer.«
»Sam? Sam Rosenfelt?«
»Ja.«
»Ich habe einen Post von seiner Mutter in den sozialen Medien gesehen. Sie schreibt, dass sie vielleicht nach Southampton ziehen. Stimmt das? Southampton?«
Kieron wand sich und nickte. »Möglicherweise … Ich wollte mit dir darüber reden, aber …« Er holte tief Luft. »Erst musst du mir erzählen, was passiert ist. Es ist etwas Schlimmes, nicht wahr?« Plötzlich kam ihm ein Gedanke, der ihm fast die Luft abschnürte. »Geht es um Dad? Ist er … Ist er tot?«
»Nicht, soweit ich weiß.« Seine Mutter nahm einen weiteren Schluck reinen Gin. »Obwohl ich ihm zutrauen würde zu sterben, ohne uns Bescheid zu sagen.« Sie schüttelte den Kopf. »Tut mir leid, das war unnötig. Nein, soweit ich weiß, geht es ihm gut.« Jetzt schien ihr aufzufallen, dass etwas an ihrem Drink nicht stimmte, und sie griff nach der Tonicflasche. »Es geht um die Arbeit«, erklärte sie und goss so viel Tonic in ihr Glas, dass es fast überfloss.
Das nennt man einen Meniskus, dachte Kieron und beobachtete, wie sich die Gin-Tonic-Mischung an den Rand des Glases klammerte, aber zur Mitte hin leicht anstieg. Das hat etwas mit Oberflächenspannung zu tun. Habe ich letztes Jahr gelernt. In der Schule.
»Mir wurde … betriebsbedingt gekündigt«, erklärte seine Mum, ohne ihn anzusehen. »Ich wurde ausgemustert. Gefeuert. Ich werde offiziell ›nicht mehr benötigt‹.« Ihr Gesicht schien sich mit jedem Satz mehr zu verzerren. »Man hat mich ›wegrationalisiert‹. Entlassen. Rausgeschmissen. Gekündigt.«
Kieron hatte plötzlich das Gefühl, innen völlig hohl zu sein. »Was ist denn passiert?«
»Ich weiß nicht, ob ich dir damals davon erzählt habe, aber vor ein paar Monaten gab es eine Fusion mit einer anderen Firma. Man hat uns x-mal versichert, dass sich nichts ändern würde und dass unsere Jobs sicher wären, aber das war alles nur heiße Luft. Die Personalabteilung der anderen Firma soll sich um alle Personalangelegenheiten kümmern und die ist voll besetzt. Also mussten sie mich ›gehen lassen‹.«
»Bekommst du eine Art Abfindung?«
Sie nickte. »Eine Art – das ist der richtige Ausdruck dafür.«
»Kannst du nicht deine Gewerkschaft darauf ansetzen?« Kieron war nicht ganz klar, wozu es Gewerkschaften gab, aber er erinnerte sich vage daran, dass sie in so einer Situation hilfreich sein konnten.
»Ich bin nie einer beigetreten. Die Firma, bei der ich gearbeitet habe, war ein guter Arbeitsplatz. Die Bosse haben sich um uns gekümmert. Ich wollte Mitglied werden, aber irgendwie kam es mir vor, als wäre ich dann illoyal.«
»Aber du findest doch einen anderen Job, oder?«
»Ich hoffe es. Aber im Moment sieht es auf dem Markt schwierig aus, und es gibt eine Menge jüngerer Personaltypen als mich, die einen Job suchen.« Sie lachte bitter. »So oft musste ich Leute beraten, denen aus irgendeinem Grund gekündigt worden war. Was ich ihnen alles gesagt habe … Das kommt mir jetzt so bedeutungslos vor. Es sind einfach … beruhigende Phrasen. Eine Vorgehensweise, ihnen gerade so weit auf die Beine zu helfen, dass sie aus meinem Büro verschwanden.« Sie nahm einen Schluck aus ihrem übervollen Glas. Ein paar Tropfen der klaren Flüssigkeit spritzten auf ihre Bluse. »Und um die Sache noch schlimmer zu machen, schicken sie mich zu einem Kurs, um mich an die neue Situation ›zu gewöhnen‹, meine Stärken herauszuarbeiten, einen beeindruckenden Lebenslauf aufzusetzen und einen neuen Job zu finden. Das ist, als würde dir jemand den Fernseher klauen und dir eine Broschüre dalassen, in der steht, wo du ein günstiges Angebot für einen neuen bekommst.« Sie seufzte. »Es tut mir leid, aber ich werde ein paar Tage nicht da sein. Es ist ein Seminar irgendwo in den Midlands. Ich werde heute Abend online beim Supermarkt bestellen, damit du genug zu essen hast. Wenn es ein Problem gibt, kannst du mich anrufen, dann komme ich sofort zurück. Es ist ja nicht so, als wollte ich diesen dämlichen Kurs unbedingt machen. Das schaffst du schon, nicht wahr? Ich meine, ich weiß doch, wie ihr Kids heutzutage seid. Du bist doch ganz gern allein, oder?«
Ich sollte helfen, dachte Kieron, und plötzlich wurde ihm kalt. Ich bin der Mann im Haus. Ich habe die Verantwortung.
»Ich suche mir einen Job«, verkündete er. »Vielleicht eine Lehre. Oder ich räume Regale in einem Supermarkt ein.«
Lächelnd lehnte seine Mutter ihren Kopf an die Sofalehne. »Du bist ein guter Sohn, Kieron. Das sage ich dir nicht oft genug. Wir kommen schon klar. Ich habe ein paar Ersparnisse und es gibt auch noch andere Jobs. Es ist nur … ein Schlag für mein Ego, weißt du? Dass man plötzlich nicht mehr erwünscht ist, ist so wie … wie damals, als dein Vater gegangen ist. Man glaubt, man wird geliebt, aber dann muss man feststellen, dass man sich getäuscht hat. Es ist überhaupt nicht so.« Sie schloss die Augen. »Geh ruhig und spiel mit Sam. Ich komme schon klar.«
Kieron beobachtete sie eine Weile, doch sie blieb genau so – die Augen geschlossen und den Kopf zurückgelehnt. Schließlich stand er auf, ging zu ihr und nahm ihr das Glas aus der Hand.
Sie schien es nicht einmal zu bemerken.
Er stellte es auf den Tisch, nahm die Flasche Gin und trug sie in die Küche. Nach kurzem Nachdenken stellte er sie in den Kühlschrank. Da war sie zwar nicht wirklich versteckt, aber wenigstens nicht auf den ersten Blick zu sehen.
Seufzend ging er durch den Flur in sein Zimmer.
Sam spielte an Kierons PC und sah auf, als Kieron eintrat. »Alles in Ordnung?«
»Meine Mum hat ihren Job verloren.«
Sam zuckte mit den Schultern. »Wie ich schon sagte: Mein Dad hat haufenweise Jobs verloren. So viele, dass wir, wenn er kommt und sagt: »Ich habe meinen Job verloren«, antworten: ›Hast du schon hinter dem Kühlschrank nachgesehen?‹ Das ist schon ein Running Gag.« Er hielt inne und sagte dann: »Das wird schon wieder. Mach dir keine Sorgen.«
Kieron schüttelte den Kopf. »Sie hatte diesen Job jahrelang, nicht nur ein paar Tage wie dein Dad. Ich habe sie noch nie so erlebt.«
»Vielleicht sagt ihr das Leben so, dass es Zeit für eine Veränderung ist.«
Kieron hob die Hand. »Vielleicht sage ich dir, dass du lieber die Klappe halten solltest, bevor ich dir eine reinhaue.«
»Auch wieder wahr … Schnapp dir einen Controller und mach hier mit – ich habe den Mehrspielermodus gewählt.«
Kieron zog sich gerade einen Stuhl heran, um mitzuspielen, als sein Smartphone piepte. Er nahm es aus der Tasche und sah auf den Bildschirm.
»Eine Nachricht von Bex«, erklärte er. »Moment noch.«
»Ich habe sie schon eine Weile nicht mehr gesehen. Wie geht es Bradley?«
»Das werde ich gleich herausfinden. Warte kurz.« Er las die Nachricht.
Kieron – können wir uns treffen? Wir müssen uns unterhalten. Heute Nachmittag um 4 in dem Café in der Hooley Street?
Das war das Café, in dem er am Vormittag gewesen war. Komisch, wie sich das Leben manchmal im Kreis drehte.
»Alles in Ordnung?«, erkundigte sich Sam, den Blick immer noch auf den Bildschirm geheftet.
»Weiß ich nicht«, gestand Kieron. »Ich habe das Gefühl, dass ich auch gefeuert werde.«
Kapitel 2
»Okay«, sagte Bex Wilson. »Ich habe es abgeschickt.«
Sie sah aus dem Fenster der Wohnung, die Bradley Marshall und sie vor einem Monat gemietet hatten und die schnell zu ihrem Zuhause und ihrer Basis geworden war. Sie fühlte sich schlecht. Es war richtig gewesen, aber sie wusste, wie es auf Kieron wirken würde. Er würde am Boden zerstört sein und sie wollte ihn nicht verletzen. Allerdings musste sie ihm wehtun, damit er später nicht noch schlimmer verletzt werden würde.
Bradley beobachtete sie vom Sofa aus. »Es musste getan werden«, sagte er sanft. »Wir können nicht zulassen, dass die Jungs weiter ihr Leben riskieren. Es ist Zeit, dass ich dich wieder bei unseren Missionen unterstütze. Es ist Zeit, dass ich die AR-Brille wieder benutze.«
»Bist du sicher, dass du das schaffst?« Bex wandte sich vom Fenster ab und sah ihn an. Sie versuchte an seiner Haltung abzulesen, wie es ihm ging. Es war noch nicht so lange her, dass er während einer Mission hier in Newcastle überfallen, entführt, zusammengeschlagen und gefoltert worden war. Jeden normalen Menschen hätte so etwas traumatisiert, aber sie wusste, wie stark Bradley war. Mit seinem Hipster-Bart und seinem freundlichen Lächeln sah er vielleicht nicht danach aus, aber sie wusste, dass er einen stahlharten Kern hatte.
Er nickte. Er saß aufrechter als noch vor ein paar Tagen und wirkte nicht mehr wie jemand, der ständig bei dem kleinsten Geräusch zusammenzuckt.
»Ja. Die Kopfschmerzen sind jetzt so ziemlich weg und ich habe auch keine Sehstörungen mehr. Ich kann sogar aufstehen und einen längeren Spaziergang machen, ohne zusammenzubrechen. Die Privatärztin, die du mir besorgt hast, hat mir einen einwandfreien Gesundheitszustand bescheinigt. Sie ist ziemlich sicher, dass es eine Gehirnerschütterung war, aber jetzt ist sie abgeklungen.« Er lächelte leicht. »Sie meinte immer wieder, ich solle mich im Krankenhaus untersuchen und ein MRT und eine Röntgenaufnahme machen lassen. Aber ich habe ihr gesagt, ich hätte eine Technikphobie.«
»Und was hat sie daraufhin gesagt?«, wollte Bex wissen.
»Sie hat nur den Monitor und den Blu-Ray-Player gemustert, mit den Schultern gezuckt und weiter meinen Blutdruck und meinen Puls geprüft. Was auch immer du ihr zahlst, hält sie davon ab, zu viele Fragen zu stellen.«
»Was ich ihr zahle, zahle ich ihr vor allem, damit sie keine Fragen stellt«, erwiderte Bex, und als Bradley nickte, fuhr sie fort: »Und jetzt die Eine-Milliarde-Dollar-Frage: Was ist mit der Brille? Kannst du sie voll nutzen, gegebenenfalls sechzehn Stunden am Tag?«
»Ja«, antwortete er entschieden. »Kann ich.«
Bex war nicht ganz überzeugt. Die Brille war ihre Verbindung zu ihm, wenn sie für ihre Auftraggeber beim britischen Geheimdienst, dem MI6, unterwegs waren. Wenn Bex irgendwo auf der Welt undercover im Einsatz war, trug sie eine Brille mit versteckten Kameras, versteckten Lautsprechern und einem verborgenen Mikrofon. Über ein verschlüsseltes Satellitensignal übermittelte sie die Informationen in Echtzeit an Bradley, der selbst an einem hoffentlich sicheren Ort saß – vorzugsweise mit einem Kaffee und einem Stück Kuchen vor sich.
Sein Set zeigte ihm, was Bex gerade sah, und ließ ihn hören, was sie hörte und sagte. Doch das war noch nicht alles, was ihre technischen Zaubergeräte konnten. Bradleys Brille fungierte auch als AR-Brille, mit der er alle möglichen Informationen oder Bilder aus dem Internet, dem Darknet oder geheimen Regierungsdatenbanken abrufen konnte, ohne dass es jemand außer ihm sah. So konnte er Bex blitzschnell Fakten und Ratschläge übermitteln, ohne dass es jemand merkte. Er musste mitbekommen, was um ihn herum vor sich ging, aber auch, was Bex gerade brauchte – denn sie befand sich möglicherweise gerade in Lebensgefahr und war abhängig davon, dass er ihr die richtigen Informationen zukommen ließ. Das Problem war, dass Bradley durch die Brille sowohl die reale Welt als auch Bex’ Welt sah, und zwar gleichzeitig übereinandergelagert. Solange er sie trug, sah er alles doppelt. Langfristig konnte das zu Ablenkungen, Verwirrung und möglicherweise sogar zu Halluzinationen führen, wenn Bradley nicht aufpasste – und das schon, wenn er vollkommen gesund war. Doch jetzt … Sie war sich nicht sicher.
»Hast du es schon ausprobiert?«, wollte sie wissen.
»Du hast mir doch gesagt, ich soll nicht«, wich er geschickt aus, »falls sie einen Rückfall verursachen sollte.«
Sie starrte ihn einen Augenblick lang schweigend an und wiederholte dann: »Hast du sie ausprobiert?«
Er tat sein Möglichstes, um ihrem fragenden Blick mit seinem eigenen unschuldigen zu begegnen, aber sie kannte ihn zu gut, sodass er schließlich einknickte.
»Ja«, sagte er blinzelnd. »Kieron hat sie ein paarmal vorbeigebracht und ich habe sie ausprobiert. Beim ersten Mal waren es nur ein paar Sekunden, dann ein paar Minuten und schließlich ein paar Stunden. Keine Nebenwirkungen – keine Kopfschmerzen, keine Ohnmachtsanfälle. Also, ich bin einsatzbereit. Ehrlich.«
Bex seufzte erleichtert. Es war stressig gewesen, solange Bradley beeinträchtigt gewesen war – mehr als sie sich eingestehen wollte. Und im Hinterkopf hatte immer die Frage geschwebt: Würde er sich überhaupt erholen? Würde er je wieder in der Lage sein zu arbeiten?
»Ist vom MI6 irgendein Auftrag gekommen seit der Goldfinch-Mission in Albuquerque und Tel Aviv?«, fragte Bradley.
»Nein, ich hätte es dir gesagt, wenn es so wäre. Wir haben diesen Job gerade erst beendet – sie lassen uns wohl ein paar Tage Zeit, um uns zu erholen, bevor sie uns woanders hinschicken.«
»Sorry«, seufzte er. »Manchmal mache ich mir Sorgen, dass du vielleicht Sachen von mir ferngehalten hast, solange ich krank war.«
»Das würde ich nie tun. Wir sind schließlich ein Team. Absolute Ehrlichkeit – stimmt’s?«
»Stimmt«, nickte er und fügte nach einer kleinen Pause hinzu: »Wo wir gerade dabei sind … Wir müssen mit dem MI6 sprechen.«
Bex zuckte zusammen. »Du meinst, darüber, dass einer unserer MI6-Bosse ein Verräter ist und für eine rechtsextreme Organisation von Faschisten und Rassisten arbeitet? Meinst du so ein Gespräch?«
»Nein, ich wollte eigentlich nur fragen, wo dieses Jahr die Weihnachtsfeier stattfindet.«
Bex musste lachen, und die Erleichterung darüber, überhaupt lachen zu können, überraschte sie.
»Schön, dich wieder mal lachen zu hören«, stellte Bradley fest. »Aber es stimmt, wir müssen über diese Verräter-Angelegenheit sprechen.«
Bex setzte sich, bevor sie etwas erwiderte. Sie hatte angestrengt über die Situation nachgedacht, war jedoch noch zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis gekommen.
Zum einen wussten sie nicht allzu viel. In den Tagen nach Bradleys Entführung durch die Organisation Blut und Boden, und nachdem Bex Kieron und Sam kennengelernt hatte, hatte sich herauskristallisiert, dass irgendjemand beim MI6 einer neofaschistischen Organisation Informationen weitergab. Auch die Informationen über Bradley, als er nach Newcastle geschickt worden war, um Bex dabei zu helfen, die Organisation aufzuspüren. Es war ein Sympathisant der Gruppe, wenn nicht sogar ein Mitglied. Das Problem war nur, dass sie nicht sehr viel mehr wussten, als dass der Verräter eine Frau war. Sie konnten ihren Verdacht natürlich dem MI6 gegenüber äußern, doch die Hälfte ihrer Bosse in der Abteilung SIS-TERR
![Young Sherlock Holmes. Tödliche Geheimnisse [Band 7] - Andrew Lane - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/c12797d457efeeaddcae14866eb06c53/w200_u90.jpg)
![Young Sherlock Holmes. Der Tod liegt in der Luft [Band 1] - Andrew Lane - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/3ad6f6cc1cab9f4bc553d4249980a81e/w200_u90.jpg)
![Young Sherlock Holmes. Eiskalter Tod [Band 3] - Andrew Lane - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/685199e56b80e22abcd87a127b9ebc02/w200_u90.jpg)
![Young Sherlock Holmes. Das Leben ist tödlich [Band 2] - Andrew Lane - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/93c647bcf27707e758dc615174b1bc64/w200_u90.jpg)
![Young Sherlock Holmes. Daheim lauert der Tod [Band 8] - Andrew Lane - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/8c36381d12f958c576900190c998b87a/w200_u90.jpg)
![Young Sherlock Holmes. Nur der Tod ist umsonst [Band 4] - Andrew Lane - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/26ceba7462166b4ff1e5cc8e78327c66/w200_u90.jpg)
![Young Sherlock Holmes. Der Tod kommt leise [Band 5] - Andrew Lane - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/55c6460c63f812649f84beff8b78f4e2/w200_u90.jpg)
![Young Sherlock Holmes. Der Tod ruft seine Geister [Band 6] - Andrew Lane - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/0bdc6a0ff0ad4f6d9f6e245376d2935f/w200_u90.jpg)